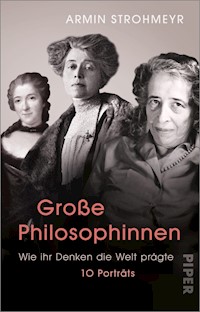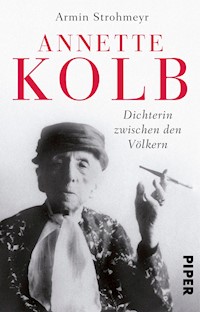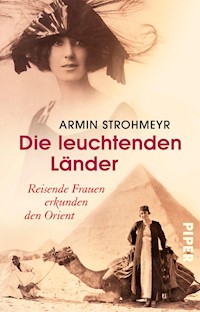14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Neue Perspektiven auf das familiäre Netzwerk der Manns Sie waren Kinder eines Genies: Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael Mann. Lange Zeit standen sie im Schatten ihres berühmten Vaters Thomas Mann. Dieses Buch erzählt die außergewöhnliche Geschichte der hochtalentierten, teils exzentrischen Geschwister, die zeitlebens ein enges Netzwerk bildeten, zusammenhielten, zusammenarbeiteten, aber auch in Konkurrenz zueinander lebten, sich entzweiten. Zugleich gewährt es Einblick in die radikalen Umbrüche des 20. Jahrhunderts, in dem die Mitglieder der Familie Mann zu Repräsentanten sowohl deutscher Kultur als auch eines Mythos avancierten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: akg-images / brandstaetter images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
»Jetzt bin ich endlich frei und darf sprechen«
Prolog: Ein heißer Sommer, ein Suizidversuch und ein Bekenntnis. 1941
»Das Paradies der Unschuld«
Glückliche Kindheit. 1905–1914
»So viel Verderbtheit war eindrucksvoll«
Krieg, Revolution und Revolte. 1914–1922
»Komm doch, es ist so schön und die Wellen sind lebensgefährlich«
Unordnung und frühes Leid. 1922–1927
»Wie wir um die Kurven rasten, hinter denen der Abgrund lag!«
Rallyes auf Leben und Tod. 1927–1933
»Als säßen wir zum Vergnügen in französischen Badeorten«
Einübung ins Exil. 1933–1936
»Ein Gefühl von Sinn, Verstand und 1000 Möglichkeiten«
Abschied von Europa. 1936–1939
»Der Zauberberg, aber ohne die geistigen Ansprüche desselben«
Zuflucht in der Neuen Welt. 1939–1941
»Ein gespenstischeres Abenteuer ist nicht vorstellbar«
Die »amazing family« im Krieg. 1941–1945
»Ruiniert in einem Land, das ich liebe«
Entfremdung und Rückkehr nach Europa. 1946–1952
»Um ein bißchen Gold und Ehr zu ernten«
Karrieren und Absonderungen. 1953–1969
»Der eine Pfeil, den ich durch viele Jahrzehnte im Köcher trug«
Triumphe, Tagebücher, Todesfälle. 1970–1980
»Als dekorierte ich ein untergehendes Schiff«
Die letzten Repräsentanten. 1981–2002
Bildteil
Auswahlbibliografie
Thomas Mann
Heinrich Mann
Erika Mann
Erika und Klaus Mann
Klaus Mann
Golo Mann
Monika Mann
Elisabeth Mann
Michael Mann
Katia Mann
Viktor Mann
Frido Mann
Sonstige Autoren
Sekundärliteratur (Auswahl)
Anmerkungen
Siglen und Abkürzungen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
für Monika
»Jetzt bin ich endlich frei und darf sprechen«
Prolog: Ein heißer Sommer, ein Suizidversuch und ein Bekenntnis. 1941
Manhattan, im August 1941: Ein schlanker, blonder Mann mittleren Alters streunt ziellos durch die Straßen, die – eingezwängt zwischen Hochhäusern – wie Schluchten wirken. Er ist Schriftsteller. In seiner Heimat Deutschland galt er wenige Jahre zuvor noch als einer der bekanntesten Autoren, ein hochtalentierter Romancier und Essayist, der zudem aus einer berühmten Literatenfamilie stammt. Sein Name: Klaus Mann. Doch vor über acht Jahren hat er Deutschland – das Land seiner Ahnen, seiner Kultur, seiner Sprache – verlassen und ist ins Ausland gegangen; nicht freiwillig, sondern weil ihm in seiner Heimat unter der Herrschaft der Nationalsozialisten Verfolgung, Haft und Ermordung drohten. Nach wechselnden Exilstationen in Zürich, Paris, Amsterdam und andernorts lebt Klaus Mann nun in New York. Er logiert im Hotel Bedford, das sich zum Sammelort deutschsprachiger Exilanten entwickelt hat. Literaten, Journalisten, Künstler, Musiker und Diplomaten, Deutsche, Österreicher, Franzosen, Briten und Amerikaner gehören zu seinem Bekanntenkreis. Klaus Mann gilt nicht nur als ein begnadeter Netzwerker, er verfügt auch über die Gabe der Freundschaft, gilt als treu, loyal und von Empathie geleitet. Diese Fähigkeiten – neben seinen literarischen – benötigt er in jenen Monaten sehr wohl, hat er doch vor Kurzem eine Zeitschrift namens Decision gegründet, die ein internationales Podium des freien Wortes sein will.
Die Zeitschrift, deren erste Nummer ein halbes Jahr zuvor erschienen ist, hatte keinen guten Start und ist unsicher finanziert. Das Unternehmen droht bereits kurz nach seiner Gründung zu scheitern. Klaus Mann schreibt Bettelbriefe an seine Eltern im fernen Kalifornien und an andere potenzielle Gönner. Doch wer wirft sein Geld schon gern in ein Fass, das sich von Anbeginn als bodenlos erweist? Die Sterne für Decision und ihren Herausgeber Klaus Mann stehen schlecht.
Klaus Mann hält es nicht in der engen Redaktionsstube und auch nicht in seinem Hotelzimmer, an dessen Tür immer wieder Menschen klopfen – Bekannte und Unbekannte –, die ihn um Rat fragen oder seine Hilfe erbitten. Er flieht hinaus in die Einsamkeit. Denn obwohl die Straßen von Manhattan in Zeiten der Rushhour von Menschen geradezu schwarz sind und ein Strom hupender Autos sich hindurchwälzt, weiß er doch: Nirgends kann man so allein sein wie im Gewühle der Großstadt, nirgends so unbekannt und verlassen. Der Sommer, der in der Stadt am Hudson River erbarmungslos sein kann, trägt ein Übriges zu dieser Stimmung bei. Klaus Mann notiert: »New York glüht. New York schwitzt. New York trieft und dampft, New York stinkt, New York stöhnt, New York geht aus dem Leim – der New Yorker Asphalt ist schon ganz aufgeweicht, eine zähe Masse …«[1] Auch nachts treibt es den Flaneur der Einsamkeit hinaus in den Straßendschungel – und dabei kommt ihm eine Verszeile Gottfried Benns in den Sinn, dessen Gedichte er in tragischer Weise liebt und dessen politische Haltung – die zeitweilige Hinwendung zum Nationalsozialismus – er zutiefst verabscheut und verurteilt: »›Einsamer nie als im August …‹ Ich wandere nachts durch diese heißen, dunklen Straßen, immer in Schweiß gebadet, immer allein. Ich atme diese feuchte, schwere, mit Sinnlichkeit geladene Treibhaus- und Dampfbadluft. Ich bin immer hier. Seit der Auflösung unseres [elterlichen] Princeton-Hauses – das dürfte im April gewesen sein – habe ich die Stadt nicht einen Tag verlassen, nicht eine Stunde war ich auf dem Land. Die Stadt gefällt mir. […] Ich habe keine Sehnsucht nach den Bergen oder nach dem Meer. Auch nach Menschen habe ich kein Bedürfnis.«[2] Die einzige positive, herzerwärmende Unterbrechung in diesem Einerlei einsamer Tage und Nächte sind die Anrufe von Klaus Manns Geliebtem Thomas Quinn Curtiss, der zu jener Zeit eine militärische Grundausbildung in einem Lager im Bundesstaat Georgia absolviert. Curtiss fragt nach Klaus Manns Arbeit, weiß er doch, wie lebenswichtig dem Freund die literarische Tätigkeit ist, wie produktiv er zeitlebens war, wie leicht ihm die Ideen aus dem Kopf, die Worte aus der Feder flossen. Doch nun scheint alles anders: Klaus Mann, der einst ein Liebling der Götter schien, steckt in der bislang tiefsten Krise seines Lebens. Die Worte lösen sich ihm im Munde auf, die Sehnsüchte, Wünsche und Begierden fallen von ihm ab wie dürres Herbstlaub von den Bäumen. Und dennoch beneidet Curtiss den Geliebten um dessen »Freiheit« eines zivilen Menschen, eines »unabhängigen« Literaten. Klaus Mann leidet unter der äußeren Ferne zu Curtiss und unter der wachsenden inneren Entfremdung zwischen ihnen. Er leidet unter seiner Schaffenskrise, unter dem Gefühl, der andere tue in der Vorbereitung auf den Kriegseinsatz gegen Hitler-Deutschland etwas Sinnvolles, während er, der Literat, dessen beste Zeit der Vergangenheit anzugehören scheint, sich nur mit dem Wort gegen den Nationalsozialismus stellen kann, mit einer Stimme, die immer weniger gehört wird, in einem fremden Land mit fremder Sprache. Doch aus diesem verstörenden Gefühl der Unzulänglichkeit erwächst in jenen glühend heißen Wochen ein Plan, zunächst vage, dann immer fester umrissen: »Ich schäme mich vor ihm. Ich möchte etwas tun, etwas leisten, wovon ich ihm am Telephon erzählen könnte. ›Decision‹ genügt mir nicht mehr. […] Ich will etwas Größeres schreiben, etwas Großes: ein Buch! Ein Buch in englischer Sprache … damit ich dem Tomski [Curtiss] etwas zu berichten habe, wenn das Ferngespräch, der ›person-to-person call‹, aus Savannah kommt. ›Imagine! The first chapter is practically finished …‹ Ein Buch …«[3]
Klaus Mann will das Buch in englischer Sprache verfassen. Er weiß, dass dies eine Herausforderung darstellt. Er, der vierzehn Jahre zuvor auf seiner ersten Reise durch die Vereinigten Staaten das Englische lediglich radebrechte, vermag sich im fremden Idiom inzwischen wendig und geschickt auszudrücken. Doch genügt das, um den Geist des zu Sagenden einzufangen, das, was hinter den Worten mitschwingt, das, was die dichterische Suggestion ausmacht? Noch anderthalb Jahre zuvor klagte Klaus Mann in seinem Tagebuch: »Soll ich das Einzige verlieren, was ich je besessen habe –: meine Sprache?«[4] Dennoch macht er sich in jenen heißen Augustwochen des Jahres 1941 an die Arbeit, zwingt sich an den kleinen Schreibtisch in seinem Zimmer, diesem »dumpfen Käfig«,[5] im Hotel Bedford. Doch was für ein Buch soll es werden? Klaus Mann wagt die Konfrontation mit sich selbst, ein schonungsloses Bekenntnis: »Die Stunde ist ernst. Ich weiß um den Ernst der Stunde. Mir ist ernst zumute. Ich will ein ernstes Buch schreiben, ein aufrichtiges Buch. […] ich bin müde aller literarischen Clichés und Tricks. Ich bin müde aller Masken, aller Verstellungskünste. Ist es die Kunst selbst, deren ich müde bin? Ich will nicht mehr lügen. Ich will nicht mehr spielen. Ich will bekennen.«[6]
Ein Bekenntnisbuch also, eine Autobiografie. Es soll das zweite Memoirenwerk im Leben des erst vierunddreißigjährigen Autors werden – nach Kind dieser Zeit aus dem Jahre 1932. Doch während dieses Buch einer Kindheit und Jugend sich bisweilen allzu schnurrenhaft, anekdotenreich und selbstverliebt gab, soll The Turning Point (so der Titel des neuen Werks) ohne Flunkereien, Selbstlügen, Tricks und Sensationsheischen auskommen. Der Titel ist ein Verweis auf seine Erkenntnis im Exil, dass sich jeder Mensch an bestimmten Wendepunkten seiner Existenz für oder wider etwas entscheiden muss und er der Verantwortung für die Folgen seines Tuns und Lassens nicht entgeht. Klaus Mann will mit dem Buch, das er als Bekenntnis vor sich und der Welt sieht, ein Statement abgeben, ein Ja zu den Werten der Freiheit und der Demokratie. Er will einen Kampf führen, den Kampf mit der Feder gegen das Böse der nationalsozialistischen Ideologie und für die Werte des Humanismus.
Geduldig, diszipliniert und mit wachsender Begeisterung beginnt Klaus Mann sein gewaltiges und schwieriges Vorhaben. Der Sog der Erinnerung zieht ihn bald hinein, der literarische Geist entfacht ihn. Er beginnt mit der Geschichte seiner Eltern Katia und Thomas Mann und greift noch weiter aus: skizziert die Lebenslinien deren Ahnen, der Lübecker Kaufmannsfamilie Mann, der durch Eisenbahnaktien zu Reichtum gelangten Pringsheims und der durch ihre frühemanzipatorischen Schriften berühmt gewordenen Urgroßmutter Hedwig Dohm (die Klaus Mann noch persönlich kennenlernte). Der Porträtist, der sonst bisweilen etwas leger mit Fakten und Dokumenten umging, ist sich nun, vor dem Hintergrund der selbst gestellten Aufgabe, Chronist vor der Nachwelt zu sein, seiner schwerwiegenden Verantwortung bewusst: »Jedes Menschenleben ist zugleich einzigartig und repräsentativ; in jedem persönlichen Schicksal, jedem individuellen Drama spiegelt und variiert sich das Drama einer Generation, einer Klasse, eines Volkes und einer Zeit.«[7] Die Arbeit an The Turning Point gerät zur genauen Selbsterforschung: »Was für eine Geschichte ist es denn, die ich zu erzählen habe? […] die Geschichte eines Deutschen, der zum Europäer, eines Europäers, der zum Weltbürger werden wollte; die Geschichte eines Individualisten, dem vor der Anarchie fast ebenso sehr graut wie vor der Standardisierung, der ›Gleichschaltung‹, der ›Vermassung‹; die Geschichte eines Schriftstellers, dessen primäre Interessen in der ästhetisch-religiös-erotischen Sphäre liegen, der aber unter dem Druck der Verhältnisse zu einer politisch verantwortungsbewußten, sogar kämpferischen Position gelangt …«[8]
Die Arbeit schreitet zügig voran. Nach der Vorgeschichte um Urgroß- und Großeltern und der Vermählung der eigenen Eltern folgt das Kapitel über die Geburt der sechs Kinder Katia und Thomas Manns – und damit der Beginn der eigenen Lebenserzählung. Bereits am 17. September 1941, fünf Wochen nach den ersten Überlegungen zu seinem Bekenntnisbuch, kann Klaus Mann festhalten: »›The Myths of Childhood‹ (erstes Kapitel des ›Turning Point‹) abgeschlossen. Merkwürdig, diese Beschwörung frühesten Erlebens in fremder Zunge.«[9] Die Geschichte geht dem Autor nah, näher als jede andere, denn sie dauert an, ist nicht abgeschlossen, und keiner weiß, wohin sie führen und welches Ende sie haben wird. Überdies ist diese Geschichte nicht nur die eigene, sondern auch die der Geschwister, deren Wesen unter dem Klappern der Schreibmaschine zu neuem Leben erweckt werden, in Vergangenheit und Gegenwart. Neben der Bindung zu den Eltern ist die zu den Geschwistern die engste und prägendste für die eigene Existenz, für Fühlen und Denken, Charakter und Persönlichkeit. Klaus Mann weiß das, und es fällt ihm in jenen Wochen nicht immer leicht, der eigenen Erinnerung Glauben zu schenken und sein eigenes Sein abzugrenzen gegen die Figuren auf dem Spielfeld des Lebens, die ihn – mal mehr, mal weniger, mal näher, mal ferner – begleiten, ihn ziehen oder schieben, ihm in Liebe und Dank, Eifersucht und Konkurrenz zugetan sind. Immer mehr wird ihm bewusst, wie dicht das Netz gesponnen ist, das ihn mit den Geschwistern verbindet, gewollt oder ungewollt.
An anderer Stelle des Lebensberichts schreibt er lapidar: »Wir sind unser sechs«[10] – bevor er versucht, die individuellen Charaktere der Geschwister vor sich und der Welt herauszuarbeiten, sie abzugrenzen gegeneinander, als eigenständige Individuen zu ihrem Recht kommen zu lassen und ihnen in der Familie eine Position zuzuweisen:
»Die beiden Jüngsten waren inmitten von Aufruhr und Krise geboren: Elisabeth im Frühling 1918; Michael ein Jahr später. Dank der Ankunft des neuen Pärchens avancierten Golo und Monika zum Stande der ›Mittleren‹, während Erika und ich fast zum Erwachsenen-Rang befördert wurden. Angesichts der winzigen Kreaturen kamen wir uns recht würdig und überlegen vor, fast wie Onkel und Tante. […] Elisabeth, genannt Medi, hatte ein süßes Porzellangesichtchen; Michael (Bibi) hingegen wirkte eher sanguinisch. Elisabeth war der erklärte Liebling des Vaters; Mielein [Katia Mann], um das Gleichgewicht herzustellen, verzärtelte ihren Jüngsten. Die beiden Kleinen nahmen in erheblichem Maß die elterliche Zärtlichkeit in Anspruch, woraus sich natürlich für uns ein gewisser Verlust ergab. […] Für Golo und Monika war die Lage besonders heikel; denn da sie sich ja ihrerseits schon in mittleren Jahren befanden, konnten sie mit der erlesenen Niedlichkeit von Medi und Bibi nicht mehr konkurrieren, ohne es aber mit uns, den Großen, an Vitalität und Abenteuerlust aufzunehmen. Monika – zugleich schüchtern und selbstgewiß – schien trotzdem nicht unzufrieden mit ihrem kleinen Dasein; Golo hingegen, ehrgeiziger und komplizierter, mußte mehr Energie und Einbildungskraft aufbringen, um sich einen eigenen Stil und sein eigenes Idiom zu schaffen. Tief verstrickt in die wunderlichen Bilder und Träume seiner unverkennbaren Golo-Sphäre, nahm er gleichzeitig aus respektvoller und eifersüchtiger Entfernung an unseren Spielen und Abenteuern teil.«[11]
Doch weiß der »Bekenner« Klaus Mann tatsächlich immer, wer sich hinter den Erinnerungsfetzen an seine Kindheit und Jugend verbirgt? Ist seine Erinnerung nicht auch persönlich geprägt, egoistisch gefärbt, von Wünschen, Sehnsüchten und Empathie verwischt? Und haben sich seit der Kindheit die Verhaltensmuster und Charakteristiken der Geschwister nicht grundlegend verschoben, unter dem Eindruck des äußeren Lebens und der Prägung der eigenen, individuellen Reifung?
Die Erinnerungsarbeit allein ist kein schützender Mantel gegen die Kälte des Daseins in jenen Sommerwochen in Manhattan. Die Sorgen um die Zeitschrift Decision werden immer belastender: Autoren mahnen beim Herausgeber die versprochenen Honorare an, Vermieter, Drucker, Verteiler und Zwischenhändler rennen dem Redakteur schier die Türe ein. Hinzu treten Gefühle der Unzufriedenheit mit dem eigenen Schicksal, des literarischen Zweifels, der sprachlichen Unbehaustheit, die Angst um ein Scheitern der Beziehung zu Thomas Quinn Curtiss (dem zu imponieren erster Anlass für die Niederschrift des Bekenntnisbuches war), die quälende Frage, ob man statt als Literat mit der Feder nicht besser als Soldat mit der Waffe gegen die Nationalsozialisten in Europa kämpfen sollte. Irgendwann in jenen Wochen (das genaue Datum ist nicht bekannt) unternimmt Klaus Mann in seinem Zimmer im Hotel Bedford einen Selbstmordversuch. Christopher Lazare, ein Freund und Mitarbeiter, findet ihn gerade noch rechtzeitig und kann ihn retten. Die Familie ist konsterniert, die Reaktionen schwanken zwischen Mitleid, Empörung und Vertuschung. Erika, Klaus Manns Lieblingsschwester, ist über den Bruder und dessen Renitenz guten Ratschlägen gegenüber verstimmt. Auch der jüngere Bruder Golo kritisiert die Halsstarrigkeit von Klaus, sein Scheitern in der Frage der Zeitschrift einzugestehen. Dem befreundeten Journalisten Manuel Gasser vertraut er an: »Dieser Mensch [Klaus Mann] hat eigentlich immer über sein Kapital gelebt, was um so dümmer ist, als er genug Kapital, ich meine Talent, hätte, um etwas Rechtes, Würdiges daraus zu machen, wenn er es nur besser rationieren und jede Stufe einzeln nehmen wollte.«[12]
Klaus Mann erholt sich schneller von seinem Selbstmordversuch, als mancher erwartet hat. In jener Zeit verfasst er einen Text mit dem Titel The Last Decision (erst posthum 1985 veröffentlicht), worin er durchaus sarkastisch den Suizid hinterfragt und sich selbst noch einmal zu Pflicht und Widerstand aufruft:
»›Ältester Sohn eines Nobelpreisträgers nimmt sich das Leben aus Enttäuschung über Mißerfolg seiner Literaturzeitschrift …‹ Das ist nichts Besonderes. Taugt nicht als Schlagzeile. Ich will versuchen, es etwas interessanter zu machen. […] Ich will Ihnen verraten, was wirklich vorgegangen ist. Denn jetzt bin ich endlich frei und darf sprechen. Der Sohn des berühmten Romanciers – übrigens selbst ein durchaus begabter Schriftsteller – hatte den Wunsch zu sterben und faßte den Entschluß dazu, allerdings nicht wegen des Scheiterns seiner Zeitschrift. Denn – das muß zuerst gesagt werden – ein Scheitern gab es nicht. Vielmehr gab es etwas, was man einen ›literarischen Erfolg‹ nennt. Aber niemand war bereit, ihm die nötige Unterstützung zu geben. […] Der Versuch, jenes Amerika, welches Walt Whitman verkündete und besang, jenen ›unauflösbaren Kontinent‹, jenes ›göttliche, magnetische Land‹ zur Realität werden zu lassen, ist hoffnungslos gescheitert. […] Was ich sehe, sind Überheblichkeit und Ignoranz, Habgier und Eitelkeit […].«[13]
Und nochmals spannt er alle Lebens- und Arbeitskräfte an, um der Welt zu zeigen, wie viel »Kapital« in ihm steckt: Decision kann er mit viel Mühen und geschicktem Hinhalten der Gläubiger noch bis zur Doppelausgabe Januar/Februar 1942 weiterführen – dann bricht dieses Projekt ohne finanzielles Fundament endgültig zusammen und hinterlässt einen Berg Schulden. Doch in jenen Monaten treibt Klaus Mann seinen Lebensbericht The Turning Point entschieden voran. Ende Mai 1942 setzt er den Schlussstrich unter das gewaltige Skript. Bereits Ende September desselben Jahres erscheint das Buch in englischer Sprache im New Yorker L. B. Fischer Verlag. (Erst posthum wird auch eine noch von Klaus Mann erstellte, überarbeitete und ins Deutsche übertragene Fassung unter dem Titel Der Wendepunkt publiziert werden und zu einem der meistgelesenen Memoirenwerke des 20. Jahrhunderts avancieren.)
Es ist Klaus Manns wohl bedeutendstes Werk (neben seinem großen Exilroman Der Vulkan), seine Lebensbeichte und die Beichte einer Generation, die sich – aufgewachsen in scheinbar sichereren, ökonomisch, soziologisch und kulturell unumstößlichen bürgerlichen Verhältnissen des Deutschen Kaiserreichs – durch Weltkrieg, Revolution, Inflation, Wirtschaftskrise und die Katastrophe des aufstrebenden Nationalsozialismus in den Grundfesten ihrer materiellen und geistigen Existenz erschüttert sah. Es ist die Auseinandersetzung mit den kulturellen Richtungen und Moden seiner Zeit, mit den ideologischen Einflüsterungen von links und rechts, eine Hommage an Freunde und Weggefährten und eine dankbare, wenngleich nicht unkritische Rückerinnerung an Kindheit und Jugend in München, an die Eltern, die Geschwister, an das zauberhafte und feine, gleichwohl nicht so leicht zu zerstörende Gespinst der familiären Beziehungen, Bündnisse und Auseinandersetzungen. In jenen Wochen und Monaten der Niederschrift seiner Autobiografie wird Klaus Mann auch die äußere wie innere Tragweite der geschwisterlichen Allianzen bewusst; Allianzen, die sich als von wechselhafter Konstellation und Dauer darstellen, die von Liebe und Entfremdung, Vertrauen und Enttäuschung, Einvernehmen und Unverständnis gleichermaßen geprägt sind; Allianzen, die man nicht freien Willens wählt, die einem vielmehr »hinzugeboren« werden und die doch von jener seltsamen, unausgesprochenen Hingabe und Treue zeugen, von denen die etwas altertümliche Redewendung »Blut ist dicker als Wasser« weiß. Und dies ist ihre Geschichte, die Geschichte der sechs Geschwister …
»Das Paradies der Unschuld«
Glückliche Kindheit. 1905–1914
Wohl keine andere Familie der deutschen Geistesgeschichte in der Moderne hat durch ihr Leben und ihre Öffentlichkeitswirksamkeit so sehr die Fantasie des Publikums angeregt wie die Manns – auch außerhalb des eigentlichen literarischen Interesses. Und andererseits haben die Manns, die der englische Schriftsteller Harold Nicolson 1939 treffend als »amazing family«[14] apostrophierte, selbst viel und gern zu dieser Stilisierung und Eigenmythologisierung beigetragen – nicht immer ganz ernst, meist mit spöttisch-ironischem Unterton, aber doch stets von der eigenen Bedeutung überzeugt. Auch das »Märchenhafte« gehört zu diesem Image. Und märchenhaft erscheint es auch, wie ein pubertierender Jüngling, Schüler des Realgymnasiums Katharineum in seiner Vaterstadt Lübeck, um das Jahr 1890 herum auf das Bildnis seiner zukünftigen Braut stößt. Die Reproduktion eines Gemäldes aus dem Jahre 1888 des Münchner Malerfürsten Friedrich August Kaulbach zeigt fünf Kinder, Geschwister, die im Fasching als Pierrots verkleidet posieren. Es sind die Sprösslinge – vier Knaben und ein Mädchen – des angesehenen Münchner Universitätsprofessors Alfred Pringsheim und seiner Frau Hedwig, geborene Dohm (Tochter der Berliner Frauenrechtlerin Hedwig Dohm). Das Gemälde der fünf Kinder trifft den Geschmack der Zeit, wirkt auf die Betrachter »allerliebst« und wird daher alsbald in zahlreichen Reproduktionen, als Postkarte und in Zeitschriften, verbreitet. Der Lübecker Jüngling ist besonders von dem etwa fünfjährigen Mädchen am linken Bildrand angetan. Er kennt weder ihren Vornamen noch den der Geschwister, weiß auch nicht, dass der hübsche Knabe direkt daneben ihr Zwillingsbruder ist. Jedenfalls ist der Schüler von der Aura der Darstellung und von der kindlichen Anmut und Koketterie des Mädchens verzaubert. Der Name des Schülers: Thomas Mann. Er selbst erinnert sich viel später: »Jedermann war entzückt, und so war ich, ein Schuljunge damals im alten Lübeck, hoch oben am Baltischen Meer. Ich schnitt das Bild, dessen persönliche Hintergründe mir ebenso unbekannt waren wie der großen Mehrzahl seiner Liebhaber und Bewunderer, aus einem Journal heraus und befestigte es mit Reißnägeln über dem Arbeitstisch meines Schülerzimmers, so gut gefiel es mir. München war fern, und unbekannt die Zukunft. Wenn ich aber aufblickte von meiner Ovid-Präparation […], so hatte ich – meine zukünftige Frau vor Augen.«[15]
Wie auch immer der Pennäler Thomas Mann sich seine Zukunft damals ausmalt: Er sieht sie sicherlich an den Gestaden des »Baltischen Meers«, ist er doch ein Sprössling aus einer alten hanseatischen Kaufmannsfamilie. Doch das Schicksal greift unerwartet und zunächst grausam ein und erweist sich dann doch – zumindest für den jungen Thomas Mann – als Glücksgöttin: Im Mai 1890 kann die Firma Mann noch ihr hundertjähriges Jubiläum begehen, und Vater Thomas Johann Heinrich Mann, der Unternehmenschef, wird in Lübeck und Travemünde von seinen Angestellten und Arbeitern, aber auch von der Bürgerschaft gefeiert. Dem jugendlichen Thomas ist recht bang zumute: »Ich sah den Reigen der Gratulanten, der Deputationen, […] sah den bewunderten, mit furchtsamer Zärtlichkeit geliebten Mann des Tages, meinen Vater, […] und mein Herz war beklommen […]. So wußte ich damals, daß ich nicht der Nachfolger meines Vaters und meiner Väter sein, wenigstens nicht in der Form, wie man es stillschweigend von mir verlangte, und daß ich die alte Firma nicht weiter in die Zukunft führen würde.«[16] Als wäre der Wunsch Vater der Bestimmung, überstürzen sich wenige Monate später die Ereignisse: Am 15. Oktober 1891 stirbt Firmenchef und Senator Thomas Johann Heinrich Mann im Alter von nur einundfünfzig Jahren an einer Blutvergiftung. Keines der fünf Kinder, so des Senators Einsicht zu Lebzeiten, würde willens und fähig sein, die Firma weiterzuführen: Sein ältester Sohn, der zwanzigjährige Heinrich, ist ein angehender Literat, der zweitjüngste, Thomas, versucht sich ebenfalls mit ersten Prosastücken, ist ein rechter Träumer und tut sich in der Schule schwer, der jüngste Sohn, das Nesthäkchen Viktor, kam erst im April 1890 zur Welt, und die beiden Töchter Julia und Carla sind erst im Mädchenalter und scheiden nach damaliger Konvention für die Leitung einer Firma ohnehin aus.
Der Verstorbene hat resignativ, aber letztlich klug vorgesorgt: Testamentarisch verfügt er die Liquidation der traditionsreichen Firma. Witwe Julia verkauft das große Haus in der Beckergrube und bezieht mit ihren Kindern eine kleinere Villa vor den Toren der Altstadt. Sohn Heinrich beginnt eine Buchhändlerlehre (was freilich seine literarischen Ambitionen nur befeuert), die Übrigen (Nachzügler Viktor ausgenommen) besuchen einstweilen weiterhin die Schule. Doch bereits an Ostern 1892 zieht die Witwe mit den drei jüngsten Kindern nach München: Dort hat sie Freunde, zudem ist ihr, die mütterlicherseits brasilianisches Blut in sich trägt, das südlich-barocke Flair der bayerischen Residenzstadt mit ihrem regen kulturellen Leben sympathischer als das norddeutsch-protestantische Ambiente Lübecks. Die beiden ältesten Söhne bleiben in der Stadt an der Trave, Heinrich soll seine Lehre beenden, Thomas die Schule.
Doch bereits im März 1894 bricht der achtzehnjährige Thomas die Schule ab, ohne das Abitur abgelegt zu haben, und zieht zur Mutter nach München. Hier versucht er sich als Volontär einer Feuerversicherungsgesellschaft, belegt als Gasthörer ein paar Vorlesungen an der Technischen Hochschule, will Journalist werden, schreibt erste Prosastücke und Novellen, versucht, an das quirlige literarische Leben der Stadt anzuknüpfen, die einer ganzen Richtung, der »Münchner Moderne«, ihren Namen und ihren Stempel aufgedrückt hat. Das Erbe aus der Liquidation der väterlichen Firma ermöglicht es der gesamten Familie, zwar nicht in Reichtum, wohl aber in bürgerlichem Wohlstand leben zu können, ohne sich um materielle Forderungen des Tages und existenzielle Notwendigkeiten sorgen zu müssen.
Thomas Mann hat recht bald Erfolg: Erste Erzählungen erscheinen in literarischen Zeitschriften, werden von namhaften Kollegen beachtet und finden Anklang beim Publikum. Der eigentliche Durchbruch gelingt ihm mehrere Jahre später. Der Jungautor gönnt sich eine Auszeit von den bürgerlichen Belangen: Im Oktober 1896 reist er über Venedig und Ancona nach Rom und Neapel, ab Dezember lebt er mit seinem Bruder Heinrich in einer gemeinsamen Wohnung beim Pantheon in Rom und im nahen Palestrina. Hier beginnt er mit der Niederschrift seines Romans Buddenbrooks. In dem breit angelegten Zeit- und Sittengemälde erzählt er vom »Verfall einer Familie« – es ist die stark autobiografisch grundierte Geschichte der eigenen Ahnen und des Niedergangs der väterlichen Firma unter den sich ändernden ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Ende April 1898 kehrt Thomas Mann nach München zurück, bezieht eine eigene Wohnung und arbeitet als Redakteur beim Münchner Simplicissimus. Zugleich schreibt er Erzählungen und weiter an der umfänglichen Geschichte der Buddenbrooks. Der Roman erscheint (wie schon zuvor einige seiner kleinen Novellen) 1901 in zwei Bänden im Berliner S. Fischer Verlag und macht den Autor über Nacht zu einem der höchstgehandelten Schriftsteller Deutschlands – zumindest ideell. Denn rein ökonomisch betrachtet läuft der Verkauf der dicken Bände trotz guter Kritiken und begeisterter Lesermeinungen zunächst schleppend an. Erst einige Jahre später wird sich das Buch auf dem Markt als Bestseller durchsetzen.
In jenem Sommer 1901 unterhält Thomas Mann eine enge Freundschaft zu den Brüdern Paul und Carl Ehrenberg: Paul ist Maler, Carl Musiker und Komponist. Die drei musizieren gemeinsam (Thomas Mann spielt die Violine), machen Ausflüge, begeben sich ins Schwabinger Künstler- und Bohemeleben. Besonders mit Paul verbindet Thomas Mann bald eine schwärmerische, homoerotisch gefärbte Beziehung, was sich in Gedichten, Briefen und Widmungen niederschlägt, vor der Um- und Nachwelt freilich verborgen gehalten wird. Es entstehen leidenschaftliche, wenn auch etwas ungelenke Verse, die der Literat seinem Notizbuch anvertraut: »Dies sind die Tage des lebendigen Fühlens!/Du hast mein Leben reich gemacht. Es blüht –/O horch, Musik! – an meinem Ohr/Weht wonnevoll ein Schauer hin vom Klang –/Ich danke dir, mein Heil! Mein Glück! Mein Stern!«[17] Das Paul-Ehrenberg-Erlebnis ist kurz, aber intensiv und hinterlässt in Thomas Manns Tagebuch noch mehr als dreißig Jahre später schmerzlich-melancholische Spuren. Am 6. Mai 1934 gesteht er sich ein: »Nun ja, ich habe gelebt und geliebt, ich habe auf meine Art ›das Menschliche ausgebadet‹. Ich bin […] sogar glücklich gewesen und durfte wirklich in die Arme schließen, was ich ersehnte.«[18]
Doch sowohl Thomas Mann als auch Paul Ehrenberg wollen nicht entgegen dem bürgerlichen Wertekodex leben. Der junge Maler heiratet einige Zeit später seine Künstlerkollegin Lily Teufel. Und Thomas Mann gibt sich nach jenem leidenschaftlichen Sommer mit Paul selbst eine »Verfassung«, nach der zu leben und zu arbeiten er gewillt ist: Es soll ein Dasein in Pflichterfüllung werden, als Bürger, Ehemann und Künstler – darin nicht unähnlich seinen väterlichen Ahnen im kühl-nüchternen Kaufmannsmilieu Lübecks, nur dass auf dem Papier statt der Zahlenreihen von Soll und Haben gedrechselte Sätze und fantastische Geschichten stehen (die sich wiederum in nicht allzu ferner Zukunft ebenfalls in einem komfortablen Kontostand niederschlagen werden).
Irgendwann im Sommer 1903 macht der aufstrebende Literat Thomas Mann die Bekanntschaft der jungen Katia Pringsheim. Sie ist zwanzig Jahre alt und studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität. Bereits seit zwei Jahren besuchte sie als Gasthörerin Vorlesungen in Physik, Kunstgeschichte und Philosophie, nun, seit Herbst 1903, als »reguläre« Studentin Vorlesungen und Übungen in Physik und höherer Mathematik. Katia Pringsheim, geboren 1883, gilt als eine der besten »Partien« Münchens – wenngleich sie selbst und auch ihre Eltern das so nicht sehen. Die Pringsheims sind einige Jahrzehnte zuvor durch Eisenbahnaktien und andere industrielle Unternehmungen in Schlesien immens reich geworden. In gewisser Weise verkörpern sie die Erfolgsmenschen der neuen Gründerzeit, denen die alten Kaufmannsgeschlechter, wie sie in Buddenbrooks dargestellt werden, ökonomisch nichts entgegensetzen können. Nur dass die Pringsheims, anders als die Emporkömmlinge der Hagenströms in Thomas Manns Roman, es zu wirklicher bourgeoiser Größe gebracht haben: nicht nur im Hinblick auf ihren pekuniären Reichtum, sondern auch bezüglich ihrer bildungsbürgerlichen Position. In der Münchner Arcisstraße 12 ließen sie sich ein gewaltiges Palais im Neo-Renaissance-Stil errichten. Doch während andere »Neureiche« ihr Geld großspurig zur Schau stellen und hinter der pompösen Fassade oftmals Kleingeist und Unbildung herrschen, repräsentieren die Pringsheims Geschmack, Belesenheit und den Willen zum Schönen und Wahren. Alfred Pringsheim, angesehener Professor für Mathematik an der LMU, ist im Grunde seines Herzens ein verkannter Musiker, dem die Kunst Richard Wagners über alles geht (die beiden kannten sich gut, und Pringsheim, obgleich Jude, förderte den Komponisten trotz dessen antisemitischer Tendenz). Seine Frau Hedwig ist eine kluge, gebildete, tatkräftig-burschikose, in ihrer Jugend als Schauspielerin erfolgreiche Dame, die wiederum die Tochter der Berliner Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Hedwig Dohm und des Redakteurs des berühmten Satireblatts Kladderadatsch Ernst Dohm ist. Im Palais Pringsheim geben sich gehobenes Bürgertum, universitäre Wissenschaft und arriviertes Künstlertum die Klinke in die Hand, hier finden literarische Begegnungen, vor allem aber musikalische Soireen statt, bei denen der Hausherr oder seine Kinder schon mal selbst am Flügel brillieren.
Die fünf Pringsheim-Kinder gelten allgemein als eine Zierde der damals recht überschaubaren königlichen Residenzstadt München. Wenn man ihnen auf der Straße begegnet, macht man sich gegenseitig auf diese schönen und zu besten Hoffnungen Anlass gebenden jungen Leute aufmerksam. Alle fünf sind außerordentlich hübsch, und nicht nur der Maler Kaulbach fand Gefallen an ihnen. Vor allem die beiden Jüngsten, die Zwillinge Klaus und Katia, erregen Aufmerksamkeit.
Aus den Kindern des Kaulbach-Gruppenporträts werden junge Leute, die ihre eigenen Wege gehen. Die sprichwörtlich gewordene Liberalitas Bavariae unter dem Prinzregenten Luitpold ermöglicht es in jenen Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend auch jungen Frauen (wenngleich nur solchen aus dem bürgerlichen Stand), ihren eigenen Lebensweg zu gehen, zu studieren und einen Beruf zu ergreifen. Die bürgerliche Offenheit des Hauses Pringsheim befördert dies noch.
Welchen Weg die zwanzigjährige Katia Pringsheim nehmen wird, ist damals freilich noch allen unklar, am meisten wohl ihr selbst. Sie ist vielseitig begabt: Wie ihr Vater ist sie sowohl hochmusikalisch als auch eine versierte analytische Mathematikerin, aber sie zeigt auch sportliche Ambitionen, spielt Tennis, geht gerne in den Bayerischen Alpen wandern und fährt hervorragend und bisweilen zu schnell das Veloziped. (Das muss auch der junge Thomas Mann bald am eigenen Leib erfahren, als das scheinbar so zarte Fräulein dem Verehrer einmal schlicht davonradelt.)
Doch wie ist es zu der Bekanntschaft mit Thomas Mann gekommen? Auch darüber gibt es etwas unklare Legenden der Familie. Viel kolportiert wurde eine Erzählung, die Katia Mann selbst im hohen Alter ihrem sie interviewenden jüngsten Sohn Michael auf Band gesprochen hat. Demnach will Thomas Mann seine künftige Braut in einer Münchner Tram beobachtet haben. Katia Mann erinnert sich an ihren burschikosen Auftritt:
»An einer bestimmten Stelle, Ecke Schelling-/Türkenstraße, mußte ich aussteigen und ging dann zu Fuß, mit der Mappe unterm Arm. Als ich aussteigen wollte, kam der Kontrolleur und sagte: Ihr Billet!
Ich sag: Ich steig hier grad aus.
Ihr Billet muß i ham!
Ich sag: Ich sag Ihnen doch, daß ich aussteige. Ich hab’s eben weggeworfen, weil ich hier aussteige.
Ich muß das Billet –. Ihr Billet, hab ich gesagt!
Jetzt lassen Sie mich schon in Ruh! sagte ich und sprang wütend hinunter.
Da rief er mir nach: Mach daß d’ weiterkimmst, du Furie!
Das hat meinen Mann so entzückt, daß er gesagt hat, schon immer wollte ich sie kennenlernen, jetzt muß es sein.«[19]
Wenig später begegnen sich die schlagfertige Schwarzfahrerin und der sie bewundernde Literat wieder. Thomas Mann wird auch in das Palais in der Arcisstraße eingeladen. Dort wird er höflich, auch mit Interesse, aber doch etwas reserviert empfangen. Dass der junge Mann ein ernsthafter Bewerber um die Hand der Tochter sein könnte, wird erst gar nicht erwogen – weder von den Eltern, die den Jungspund zunächst nicht recht ernst nehmen, noch übrigens von Katia Mann selbst. Die nämlich schätzt ihre studentische und großbürgerliche Freiheit und will auf jeden Fall das Studium abschließen und noch ein paar Jahre die Privilegien des reichen Elternhauses genießen.
Ein Briefwechsel (der leider nur in Exzerpten fragmentarisch überliefert ist) entspinnt sich. Thomas Mann bleibt hartnäckig, harrt aus, absolviert weiterhin Besuche in der Arcisstraße, umwirbt die Angebetete mit Komplimenten und Blumen. Seine Worte werden immer ungeduldiger und verlangender: »Katja, liebe, geliebte kleine Katja, nie war ich mehr erfüllt von Ihnen, als in diesen Tagen! Ich glaube, den seltsamen und unbestimmten Klang Ihrer Stimme zu hören, den dunklen Glanz Ihrer Augen, die perlenartige Blässe Ihres süßen, klugen, wechselvollen Gesichtes unter dem schwarzen Haar vor mir zu sehen – und eine brennende Bewunderung ergreift mich, eine Zärtlichkeit schwillt in mir auf, für die es kein Zeichen und Gleichnis giebt! Und Sie? Und Sie?«[20]
Und sie? Katia Pringsheim hält sich bedeckt, reißt sogar aus und fährt nach Bad Kissingen zur Kur, danach in die Schweiz, nur um den liebestollen Freier für ein paar Wochen los zu sein. Thomas Mann, in höchster Verzweiflung, sucht einen Psychologen auf, schildert ihm sein Leid, aber nicht, um sich therapieren zu lassen, sondern um dessen Meinung zu Katia einzuholen. Der diagnostiziert bei der verwöhnten jungen Dame, ohne sie gesprochen zu haben, eine »Entschließungsangst«[21] und rät, der Angebeteten möglichst diplomatisch gegenüberzutreten und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Den ärztlichen Rat und eine Rechnung in der Tasche zieht der Verliebte davon und bemüht sich in den nächsten Monaten um Zurückhaltung – was ihm freilich nicht gelingt. Die Briefe bleiben leidenschaftlich: »Wissen Sie, warum wir so gut zu einander passen? […] weil Sie, auf Ihre Art, etwas Außerordentliches – weil Sie, wie ich das Wort verstehe, eine Prinzessin sind. Und ich, der ich immer – jetzt dürfen Sie lachen, aber Sie müssen mich verstehen! –, der ich immer eine Art Prinz in mir gesehen habe, ich habe, ganz gewiß, in Ihnen meine vorbestimmte Braut und Gefährtin gefunden.«[22]
So viel Heftigkeit löst offensichtlich die »Entschließungsangst« der jungen Frau. Katia zeigt dem Literaten, dessen Novelle Tonio Kröger im Jahr zuvor in Buchform erschienen ist (sie dürfte die Erzählung gekannt haben, sich aber kaum des autobiografisch-homoerotischen Subtextes bewusst gewesen sein), sogar ihre private Bibliothek im Elternhaus (ohne Beisein einer Anstandsdame!), bietet ihm das Du an und wenig später auch ihre Hand. Natürlich muss Thomas Mann ganz offiziell bei den Brauteltern um deren Einverständnis bitten, aber die sind sich inzwischen doch einig geworden (obgleich Alfred Pringsheim von dem jungen Literaten nicht allzu viel hält). Immerhin hat Hedwig Pringsheim sich bei ihrem Buchhändler nach dessen Einschätzung des Autors der Buddenbrooks erkundigt und eine positive Meinung erhalten. Und da es sich im Hause Pringsheim ja »nur« um die Jüngste handelt und die Erwartungshaltung an die Söhne traditionell höher angelegt ist, findet man sich also zu einer Zustimmung bereit. Am 3. Oktober 1904 verloben sich die beiden jungen Leute, und bereits vier Monate später, am 11. Februar 1905, findet die Trauung im Münchner Standesamt am Marienplatz statt. Danach ist das feierliche Festmahl im großen Saal des pringsheimschen Palais, mit den nächsten Anverwandten der Familien Pringsheim und Mann (wobei Heinrich Mann, der in Florenz eine Liebesaffäre unterhält, nicht kommen kann oder will, ebenso die jüngste Schwester Carla, die sich in nicht immer geschmackvollen Rollen als Schauspielerin versucht). Anwesend ist gleichwohl der erst vierzehnjährige Viktor, in einem neuen Anzug wie ein Konfirmand ausstaffiert. Er lässt sich von einem »Diener, vornehmer als ein Herzog«,[23] teuren Champagner einschenken, stürzt diesen wie Limonade hinunter, langt kräftig bei den erlesenen Speisen zu und verdirbt sich mit Hummermayonnaise den Magen, was später am Tag noch üble Folgen zeitigen wird.
Das sind die kleinen Fauxpas dieses Hochzeitstages. Ansonsten geht alles ohne Ärger und Skandal über die Bühne. Auch der Brautvater, der eigentlich von seiner jüngsten und mathematisch und musikalisch so begabten Tochter gar nicht lassen will, hält sich tapfer und verwindet seinen Abschiedsschmerz. Gleich am Abend nämlich sagt das Brautpaar Adieu und begibt sich auf Hochzeitsreise, zunächst nach Augsburg, wo es im noblen Hotel Drei Mohren übernachtet, tags darauf weiter in die Schweiz, nach Zürich: Hier logieren sie im Luxushotel Baur au Lac (das in späteren Jahrzehnten noch einige Male das dann berühmte Paar beherbergen wird).
Zurück aus dem Honeymoon, bezieht das junge Paar eine eigene großzügige, von den Eltern Pringsheim angemietete und vollständig möblierte Wohnung in der Münchner Franz-Joseph-Straße 2. Vorbei sind für Thomas Mann die Zeiten im Künstlerviertel Schwabing, vorbei seine abendlichen Fluchten in die Cafés und Kneipen der Boheme, vorbei auch seine sehnsüchtig-leidenschaftlichen und zugleich leidensvollen Männerfreundschaften – denn nun folgt er seiner selbst auferlegten Verfassung als repräsentierender Erfolgsautor, Ehemann und bald auch als Kindsvater. Denn Katia Mann ist schwanger. Als das Paar in jenem Sommer 1905 nach Berlin reist und auch Katias Großmutter Hedwig Dohm besucht, fragt die kämpferische Aktivistin für die weibliche Gleichberechtigung (sie veröffentlichte 1876 die Kampfschrift Der Frauen Natur und Recht, worin sie unter anderem das Stimmrecht für Frauen forderte) den jungen Ehemann: »Na, Tommy, was wünschst du dir nun, Junge oder Mädchen?«[24] Der Angesprochene antwortet recht naiv und aus dem Bauch heraus: »Natürlich einen Jungen. Ein Mädchen ist doch nichts Ernsthaftes.«[25] Das fordert die alte Dame natürlich zum Widerspruch heraus. Zeitlebens wird sie dem Gatten ihrer Enkelin gegenüber reserviert bleiben.
Am 9. November 1905 bringt Katia Mann ihr erstes Kind zur Welt. Es ist ein Mädchen, das auf die Namen Erika Julia Hedwig getauft wird. Geknickt und offenherzig gesteht Thomas Mann seinem Bruder Heinrich:
»Es ist also ein Mädchen: eine Enttäuschung für mich, wie ich unter uns zugeben will, denn ich hatte mir sehr einen Sohn gewünscht und höre nicht auf, es zu thun. Warum? ist schwer zu sagen. Ich empfinde einen Sohn als poesievoller, mehr als Fortsetzung und Wiederbeginn meinerselbst unter neuen Bedingungen. Oder so. Nun, er braucht ja nicht auszubleiben. Und vielleicht bringt mich die Tochter innerlich in ein näheres Verhältnis zum ›anderen‹ Geschlecht, von dem ich eigentlich, obgleich nun Ehemann, noch immer nichts weiß.
Die Geburt war wider Erwarten ganz schrecklich schwer, und meine arme Katja hat so grausam leiden müssen, daß es ein Gräuel war und kaum auszustehen. […] Ich hatte einen Begriff vom Leben und einen vom Tode, aber was das ist: die Geburt, das wußte ich noch nicht. Nun weiß ich, daß es eine ebenso tiefe Angelegenheit ist wie die beiden anderen. Gleich danach war dann alles Idyll und Frieden […], und das Kind an der Brust der Mutter zu sehen, die selbst noch wie ein holdes Kind wirkte, war ein Anblick, der die Foltergräuel der Geburt (die im Ganzen fast vierzig Stunden gedauert hatte) nachträglich verklärte und heilig sprach. Die Kleine, die auf Wunsch der Mutter Erika heißen soll, verspricht, sehr hübsch zu werden.«[26]
Der erhoffte Prinz kommt bereits gut ein Jahr darauf, am 18. November 1906, zur Welt: Klaus Heinrich Thomas. Hohe Erwartungen sind ihm in die Wiege gelegt, als Sohn, Stammhalter, »Fortsetzung« von Thomas Manns Wünschen und Selbstbildnissen (der zu jener Zeit an einem märchenhaften und zugleich autobiografischen Roman mit dem Titel Königliche Hoheit schreibt, worin vom Werben eines verarmten Prinzen um eine reiche Millionärstochter die Rede ist). Thomas Mann ahnt nicht, wie sehr sein Hoffen auf eine »Fortsetzung meinerselbst« sich erfüllen wird: Klaus (er erhält seinen ersten Vornamen nach Katias homosexuellem Zwillingsbruder, der die Ehe seiner Schwester mit dem Literaten sehr befürwortet hat) wird später als Schriftsteller beruflich in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten, sich immer daran messen lassen – vom Vater, von Kritikern, von Kollegen – und zu einem Gutteil daran auch zerbrechen. Er wird – wie sein Vater – homosexuell sein, aber seine Liebe und Leidenschaft offen und genussvoll ausleben und sie nicht literarisch sublimieren. Er wird zum Konkurrenten des Vaters aufsteigen – als Autor, als Liebender und Liebling von Mutter und ältester Schwester.
Von alledem kann der kleine Klaus Mann natürlich nichts ahnen. Seine eigene Kindheit und die der Schwester Erika beschreibt er in seinem Lebensbericht Der Wendepunkt als durchweg glücklich, ja als eine Zeit im Garten Eden, aus dem er schließlich unter den Zwängen der Zeitläufte, aber auch der eigenen zerrissenen Entwicklung vertrieben werden sollte: »Der Kinderwagen ist das verlorene Paradies. Die einzig absolut glückliche Zeit in unserem Leben ist die, welche wir schlafend verbringen. Es gibt kein Glück, wo Erinnerung ist. Sich der Dinge erinnern bedeutet, sich nach der Vergangenheit sehnen. Unser Heimweh beginnt mit unserem Bewußtsein.«[27] Dies ist aus einem sehr viel späteren Blickwinkel geschrieben, ein halbes Menschenleben mit viel Mühsal, Enttäuschungen und Entgleisungen liegt dazwischen. In Wahrheit gibt es kaum Anlass, die Kindheit der Mann-Sprösslinge – zumindest bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs – nicht als glücklich und in Sicherheit gewiegt zu benennen.
Erika und Klaus Mann werden von Kindesbeinen an wie Zwillinge behandelt und betrachtet – das Zwillingsmotiv von Katia und ihrem Bruder Klaus scheint sich in der nächsten Generation zu wiederholen. Das bekundet sich äußerlich, aber auch in der psychischen Entwicklung und der emotionalen Nähe. Klaus Mann erinnert sich später an die von der Lebensreformbewegung geprägte Ausstaffierung der vermeintlichen Zwillinge: »Unsere ›künstlerische Aufmachung‹, das sind die Leinenkittel mit den hübschen Stickereien aus den Münchener Werkstätten. Mielein [Katia Mann] hat sie selber ausgesucht, rote Kittel für die Buben, blaue für die Mädchen, wie es sich gehört.«[28]
Das Äußerliche allein freilich kann über die grundsätzlich unterschiedliche charakterliche Disposition der beiden nicht hinwegtäuschen. Fast scheinen die »Geschlechterrollen« (oder das, was man klischeehaft darunter verstehen mag) vertauscht zu sein: Erika ist die Jungenhafte, die klettern, schwimmen, raufen kann, den bayerischen Dialekt spricht, damit in der Münchner Tram ihren derben Schabernack mit Fahrgästen treibt und vor nichts Angst hat. Klaus hingegen ist eher furchtsam, früh zum Außenseiter gestempelt – und: Er bewundert und verehrt seine Schwester. »Erika«, so schreibt er, »war die Rüstigste von uns. Sie konnte wie zwei Buben turnen und raufen und sah aus wie ein magerer, dunkel hübscher Zigeunerjunge, dessen braune Stirn sich manchmal trotzig verfinstert. Als einzige von uns beherrschte sie die bayerische Mundart, die ich niemals erlernt habe.«[29] Erika ihrerseits erlebt die geschwisterliche Symbiose ähnlich. Auch sie erinnert sich schmunzelnd: »Mein Bruder Klaus war ein Jahr jünger als ich, und kaum hatte ich mich an seine Anwesenheit hienieden und unser Zwillingsdasein gewöhnt, als ich auch schon der Überzeugung war, jedes kleine Mädchen brauche einen Klaus, und, wo alles mit rechten Dingen zugehe, habe es ihn auch.«[30]
Klaus ist kein Einzelgänger, aber er schließt sich leichter den Mädchen an: »Ich erlebte die Gemeinschaft, indem ich gegen sie opponierte. Zwar hatte ich schnell Freunde, vor allem unter den Mädchen. Aber ich bildete mit ihnen eine Outsidergruppe.«[31]
Die »Zwillinge« bleiben nicht lange unter sich. Denn schon bald meldet sich familiärer Zuwachs – wieder ein »Pärchen«, und wieder im Abstand von nur einem Jahr: Am 27. März 1909 wird Angelus Gottfried Thomas geboren, den man zeitlebens Golo nennt (und er selbst sich auch, selbst als berühmter Historiker). Um die ungewöhnliche Namensgebung rankt sich ebenfalls eine Anekdote: Erika Mann spielt in Bad Tölz, wo die Familie sich im Jahr zuvor, 1908, inmitten eines großen baumbestandenen Grundstücks ein prächtiges Sommerhaus hat errichten lassen, gerne mit dem dreijährigen Jungen des Postexpeditors. Das Knäblein trägt den katholisch-ländlichen Namen Angelus, und Erika wünscht sich ihrerseits, auch solch einen Angelus zu besitzen (neben ihrem Klaus): »Die guten Eltern! Sie hatten das Herz nicht, mich zu enttäuschen, und, kurz, das Malheur passierte: Angelus Gottfried Thomas – so hieß der Knabe. Er war mein. Ich trug ihn herum. Daß man ihn allgemein ›Gelus‹ rief, war sehr ungebildet, da es den Tatsachen widersprach. Doch selbst, als mein Eigentum zu sprechen anfing, ›Gelus‹ zu schwierig fand und sich Golo (oder, zärtlicher, Gololo) nannte, blieb ich getrost. Der Name stand felsenfest – Gelus hin und Gololo her.«[32]
Auch Klaus ist von dem kleinen Bruder angetan, wenngleich seine Beschreibung des Zuwachses in Kind dieser Zeit weniger schmeichelhaft anmutet: »Wir waren alle vorwiegend nett, dann erst sonderbar. Golo aber repräsentierte unter uns das groteske Element. Von skurriler Ernsthaftigkeit, konnte er sowohl tückisch als unterwürfig sein. Er war diensteifrig und heimlich aggressiv; dabei würdevoll wie ein Gnomenkönig. Ich vertrug mich ausgezeichnet mit ihm, während er sich mit Erika viel zankte. Halb aus dämonischer Servilität und halb, weil ihn Neugierde und Ehrfurcht bannten, ging er stundenlang mit mir im Garten spazieren, wo ich ihm Geschichten erzählte. Ich konnte erfinden wie die listige Dame der Tausendundeinen Nacht, so endlos und so phantastisch.«[33]
Und dann ist da noch Monika, die am 7. Juni 1910 zur Welt kommt (einen Tag nach des Vaters Wiegenfest – worunter sie zeitlebens leiden wird, sieht sie doch dadurch alle familiäre Aufmerksamkeit von ihrem eigenen Geburtstag abgelenkt). Thomas Mann selbst ist, als er von Katia erfährt, dass sie erneut schwanger ist, keineswegs »amused«. In einer Mischung aus Koketterie und Sarkasmus bekennt er im April 1910 in einem Brief an den befreundeten Schriftsteller Walter Opitz: »Reisen kann ich jetzt nicht, da ich über ein Kleines zum vierten Male Vater werden soll. (Wenn ich es zum fünften Male werde, übergieße ich mich mit Petroleum und zünde mich an.)«[34] Als Monika schließlich gesund zur Welt gekommen ist und es auch der Mutter Katia gut geht, ist die Familie bester Laune. Und selbst Großmutter Hedwig Pringsheim gibt ihr wohlwollendes Placet, indem sie nonchalant bemerkt, das Kind sei »7 ½ Pfund schwer und nicht auffallend häßlich«.[35] Selbst die beiden ältesten Geschwister Erika und Klaus sind von den Vorteilen angetan, Kleinere um sich zu haben. Klaus meint spitzbübisch: »Erika und ich übten die grausamste Herrschaft, die Monika sich gefallen ließ, weil sie noch so klein und dumm und niedlich war, Golo hingegen aus zerknirschter Überzeugtheit und masochistischem Hang zur Demütigung.«[36]
Der Zuwachs macht es nötig, dass die Familie im Oktober 1910 in eine größere Wohnung zieht, in die Mauerkircher Straße 13 am Herzogpark. Die Gegend, am nördlichen Rand des vorstädtischen Bezirks Bogenhausen gelegen, ist ehemaliger Wittelsbachischer Jagdgrund, mehr Wald, Wiese und Brache als eigentlicher Park. Hier entsteht in den Jahren vor 1914 ein nobles Viertel, und auch Thomas Mann entschließt sich, in der Poschingerstraße 1 ein Grundstück zu kaufen und sich eine prächtige Villa errichten zu lassen. Das neue Domizil wird Anfang 1914 bezogen. Hier wohnt die Familie, und hier residiert und repräsentiert der inzwischen berühmte Schriftsteller, ein Selfmademan, der es – allerdings mit Anschubhilfe der reichen Schwiegereltern – weitgehend aus eigener Kraft zu Wohlstand und bürgerlichem und literarischem Ansehen gebracht hat.
Die Sommer werden regelmäßig in Bad Tölz verbracht – und nachdem Monika zur Welt gekommen ist, besteht auch kein Hindernis mehr, die schöne Jahreszeit nicht am Fuße der Bayerischen Alpen zu verbringen. Der Garten in Tölz wird – mehr noch als der in der Münchner »Poschi« (so der Familienjargon) – zum ländlichen Paradies stilisiert, und wahrscheinlich haben diese Sommer vor dem Ausbruch des Weltkriegs, in noch weitgehend unbelasteter Natur, in einer unzersiedelten Landschaft mit Blick auf blumenbestandene Wiesen, dunkle Tannenwälder und bis in den Frühsommer hinein schneebedeckte Berggipfel, tatsächlich etwas vom verlorenen Garten Eden. Einige Erzählungen Klaus Manns – so die Kindernovelle – spielen hier. »Das Paradies«, so glorifiziert er es später, »hat den bittersüßen Duft von Tannen, Himbeeren und Kräutern, vermischt mit dem charakteristischen Aroma des Mooses, das von der Sonne durchwärmt ist, der großen, mächtigen Sonne eines Sommertages in Tölz.«[37]
Die Spiele auf dem weitläufigen Anwesen werden naturgemäß von den beiden Ältesten angeführt. Golo und Monika sind die Komparsen, hinzu kommen ein paar Buben und Mädchen aus dem Städtchen. In der Fantasie der Kinder verwandeln sich Haus und Garten in einen Ozeandampfer, sie selbst sind die reichen, auf Weltreise befindlichen Passagiere, auch das Kindermädchen, der Hund Motz und selbst der Vater (dieser aber nur in der bloßen Vorstellung) erhalten Rollen als Matrosen und Kapitän zugesprochen.
Die Spiele erschöpfen sich nicht in Herumtollerei. Vielmehr sind Erika und Klaus (und einige Jahre später auch Golo und Monika) mit einer großen Fantasie begabt, was den Umgang mit Sprache und dem Erfinden von Wortspielen, Codierungen und Geschichten anbelangt: Nahezu alle Mitglieder der Familie Mann erhalten Necknamen. So heißt Katia Mann »Mielein«, Klaus »Eissi«, die Großeltern Pringsheim »Offi und Ofey« oder einfach nur die »Urgreise«. Thomas Mann ist der »Zauberer« oder kurz »Z.«, weil er einmal ein angebliches Gespenst (Klaus nennt es »Me-Me«), einen enthaupteten, blassen Herrn, der im Kinderzimmer sein Unwesen getrieben, mit Erfolg in die Schranken gewiesen hat: »Sagt ihm nur, daß ein Kinderschlafzimmer kein Ort ist, wo anständige Geister sich herumtreiben, und daß er sich schämen sollte. Und wenn das immer noch nicht genügt, so tut ihr gut daran hinzuzufügen, daß euer Vater sehr reizbar ist und häßlichen Spuk in seinem Haus nicht duldet.«[38]
Klaus gefällt sich darin, seinem kleinen Bruder Golo stundenlang selbst erfundene Geschichten vorzutragen, ja, diese aus dem Stegreif zu improvisieren und fortzuspinnen. Ob sich bereits damals sein literarisches Talent zeigt, oder ob dies eine übliche Fähigkeit fantasiebegabter, aufgeweckter Kinder ist, sei dahingestellt. Kaum hat er lesen und schreiben gelernt, beginnt er allerdings auch schon – das »zauberhafte« Weben und Wirken des Vaters in dessen geheimnisvollem Refugium des Arbeitszimmers wird unwillkürlich zum Vorbild –, erste Schreibhefte mit eigenen »literarischen« Versuchen zu füllen. Kopfschüttelnd erinnert er sich: »In schärfstem Tempo entstand jene Fülle von Dramen, Romanen, Skizzen und Balladen, die ich mir fast alle aufgehoben habe und deren Masse mich so erschreckt. Was ich mir nicht alles habe einfallen lassen! Welch absurde Menge von weithergeholten, lächerlichen Stoffen, die mich nichts angingen, und aus denen ich schnell, schnell, schnell eine Tragödie, eine Zauberposse nach der anderen fabrizierte.«[39] Er liefert auch ein Beispiel für solch ein frühes »Werk«, eine Moritat – diesmal gemeinsam mit der Lieblingsschwester Erika ersonnen:
»Meine ersten Gedichte machte ich mit Erika zusammen. Wir schrieben sie säuberlich ab, malten was Fantastisches drum und legten sie unserem armen Vater morgens unter die Serviette. Wenn er sich zum Frühstück niedersetzte, fand er, nahe seinem Eierbecher, Balladen von dieser Art:
›Der böse Mörder Gulehuh,/Der jagte eine bunte Kuh./Die bunte Kuh, die sträubt sich sehr,/Der Gulehuh kriegt das Messer her./Er haut der Kuh das Köpfchen ab,/Der Bauer kommt dabei im Trab./Er hat den Gulehuh eingefangen,/In drei Tagen soll er am Galgen hangen./Da weint der Mörder Gulehuh./Da weint er sehr und schreit huhu –/Ich wills gewiß nicht wieder tun,/Um Gottes will’n, verzeiht mir nun!‹
Und dann sollte einem das Frühstück noch schmecken.«[40]
Auch Erika liegt der spielerische Umgang mit Sprache, sie ist die geborene Mimin und Diseuse, die begnadete Nachahmerin von Sprechweisen, Dialekten, Jargons und Eigenheiten in gesprochener und geschriebener Konversation. Mit den Tölzer Bauernbuben unterhält sie sich im derbsten oberbayerischen Dialekt und wird von ihnen ohne Weiteres als eine der Ihren akzeptiert. Als Onkel Peter Pringsheim einmal zu Besuch ist und bei Tisch Goethes Der neue Amadis vorträgt – immerhin ein Gedicht von dreißig Versen –, brilliert die siebenjährige Erika Stunden später damit, dass sie das Gedicht fast fehlerlos nach einmaligem Hören hersagt. Allerdings wird die Vorstellung für sie zur herben Enttäuschung, glaubt ihr doch keiner der Erwachsenen, Onkel Peter ausgenommen, dass sie unterdessen das Gedicht nicht nachgeschlagen hat.
Später, als Assistentin des Vaters, wird sie sich einen Jux daraus machen, Thomas Manns Diktion, seine hohe, bisweilen etwas gespreizte Literatursprache nachzuahmen. Der Schriftsteller Ludwig Marcuse wird belustigt und fassungslos feststellen: »Sie beherrschte die Thomas-Mann-Sprache fließend, wie nur eine Eingeborene. Der Schöpfer dieses bekannten deutschen Dialekts schrieb ihn nur; die Tochter aber sprach ihn – und trieb so viel Allotria damit, daß er sie gewiß beneidete.«[41]
Wie aber erinnern sich die beiden Jüngeren, Golo und Monika, an jene Jahre vor dem Krieg, an das Kinderparadies der »Poschi« und der Tölzer Sommer, an die gemeinsamen Spiele mit den größeren Geschwistern? Golo Mann leidet lange Jahre unter seiner vermeintlichen »Gnomenhaftigkeit«, die Klaus als »üsis« (im Familienjargon »lieb«, »nett«) empfunden haben mag, ihn, Golo, aber schwer belastete: »Daß ich häßlich sei, wurde mir auch später noch gesagt, so daß diese Vorstellung sich, nicht zu meinem Glück, in mir festsetzte«, bekennt noch der Siebenundsiebzigjährige. »Sehe ich heute [1986] meine Kinderbilder, so kann ich es eigentlich nicht finden; einen wunderlichen Ernst lassen einige von ihnen erscheinen.«[42] An gemeinsame Spiele hat er nur ungefähre Erinnerungen. Das Aufsagen von Gedichten imponiert ihm früh, der mystische Klang gebundener Rede fasziniert ihn instinktiv, eine Liebe zur Dichtung entsteht, die ihn noch als alten Mann, wenn er schlaflos im Bett liegt und sich zum Zeitvertreib Gedichte vorsagt, trägt: »Die Liebe zu den Gedichten ist von Ferne der Musikalität verwandt, ist eine geringere Abart davon. Und wir wissen ja, wie früh das musikalische Talent sich äußert. Den ›beiden Großen‹, Erika und Klaus, wurden Gedichte vorgelesen, vom ›Fräulein‹ oder von Gästen der Eltern […], zuerst Uhland, dann auch Schiller. Uneingeladen hörte auch ich zu, mit Begier offenbar, und schnappte auf und wußte, was ich mir gemerkt hatte, sogar passend und variierend anzuwenden; […] Das erste Gedicht für Erwachsene, das ich auswendig wußte, ehe ich auch nur lesen konnte, war Uhlands Des Dichters Abendgang, keine Ballade, sondern ein höchst lyrischer Gesang, von dessen Sinn ich nicht das Allermindeste verstand.«[43]
An Tölz und die Sommer hingegen sind von Golo Mann nur Assoziationen, fetzenhafte Impressionen überliefert: »So bleibt es das Gedicht, welches die Identität in aller Frühe schon bilden half. Auch mag die Ungeschicklichkeit meiner Hände dazu gehören – nur der Hände? –, die verhutzelten Gänseblümchen inmitten der blühenden Wiese. Dann der Gehorsam gegenüber den großen Geschwistern, die zahme Geduld und Friedensliebe gegenüber der zu mir gehörenden, kleineren Monika, Angst und böses Gewissen nach der Untat des Naschens und Anderes mehr. Dagegen kam mir die drôlerie bald und völlig und für immer abhanden.«[44]
Das komplementäre Wesen in diesem von Pärchen geprägten Kinderreigen ist für ihn Monika. Auch sie hat später Memoiren geschrieben, und auch sie erinnert sich, anders als die Großen, nur ungefähr an jene Jahre vor dem Krieg (ist sie doch auch erst vier, als die alte Welt untergeht). Immerhin, die Nähe zur Mutter wird immer wieder beschworen, auch ganz primär die körperliche Zärtlichkeit: »Sonntag früh empfing die Mama. Nämlich meine Schwester [Erika] und ich durften zu ihr ins Bett hineinschlüpfen. […] Die Mama hatte ein überfußlanges Hemd an, am Hals und an den Handgelenken mit Volants, das, obgleich es aus feinstem Linnen war, an das Hemd der Großmutter in Rotkäppchen erinnerte. […] mit tiefer, rauher, liebkosender Stimme wünschte sie uns guten Morgen. Es war sehr angenehm, erst einmal auf dem dicken Eisbärfell barfuß zu stehen oder zu knien und allmählich unter die kornblumenblaue Daunendecke zu kriechen, um dann den merkwürdig herben und Geborgenheit ausströmenden Duft des mütterlichen Bettes einzuatmen.«[45] An Golo, den Spielgefährten der frühen Jahre, erinnert sich Monika im Zusammenhang mit einer gemeinsam gemachten »Gespenstererfahrung« (und solche »Geister« scheint es ja in der »Poschi«, wenn man den Erinnerungen von Klaus trauen darf, durchaus gegeben zu haben). Einmal schleichen sich Monika und Golo auf den mit Gerümpel vollgestellten Dachboden:
»Der Speicher war selbst bei Tage wenig geheuer, ein Ort ausrangierten Lebens. Zwischen allerlei Vergangenheitsgerümpel mochten Mäuse huschen, Ahnenbilder lächelten mild aus Spinnwebendämmer […]. Es hingen heute nacht dort weiße Laken über Seilen, die im Flackern des Kerzenlichts leise wehten. Es geschah, daß mein Bruder [Golo] hinter einem solchen Laken verschwand, und ich, mich alleine sehend, einen kleinen Schrei von mir gab. Aus Schreck darüber löschte mein Bruder die Kerze aus, und ein so vollendetes Grauen erfüllte mich, gegen das ich mich mit heroischen Kräften zu wappnen hatte. […] ich mag gut und gern von unserer ›Geisterkreation‹ reden, als zwischen den mondbeschienenen Laken erst ein schäumender Pferdekopf sichtbar wurde, ein Stulpenstiefelbein im Bügel, ein wehender weißer Waffenrock und endlich das große milchige Antlitz des Welttyrannen Napoleon unserem gebannten Blick sich darbot. Er hatte den Mantelkragen hochgeschlagen, das Haar klebte ihm in der bleichen Stirn und, die Rechte auf dem Herzen, schaute er mit seinen düstermokanten Augen, über denen eine tiefe Falte eingegraben war, in die Ferne. Mein Bruder stellte ihm stotternd und lispelnd die Frage, bei der er sogar halb französische Brocken einstreute, ob die Zeit bald gekommen sei, da er (mein Bruder) Weltbeherrscher sein würde, worauf der scharf geschwungene Mund des Herrlichen bebte und ein hold schallendes ›oui‹ herunterwarf. Dann löste sich das Bild in nichts auf. In unsere Betten heimgekehrt, dauerte es ziemlich lang, bis unsere Gemüter sich entspannt hatten und der tiefe Kinderschlaf uns wieder aufnahm. Am nächsten Morgen wußten wir nicht, ob wir dies alles träumend oder wachend erlebt hatten, aber die offene Speichertür und ein am Boden liegendes Laken bedeuteten uns, daß Napoleon uns wirklich erschienen war.«[46]
Spiel oder Ernst, Ernst im Spiel oder spielerischer Ernst: Die Welt des Kinderparadieses endet jäh; nicht die Kindheit als solche, aber doch die Illusion von einer reinen, sorgenfreien, märchenhaften glücklichen Kindheit. Kein Gespenst vom Speicher, kein Kindermädchen (mit denen die Kleinen oft genug auf Kriegsfuß stehen), nicht die Strenge des Vaters und nicht einmal die wiederholten Aufenthalte der Mutter in Gebirgssanatorien (man vermutet hinter ihrer Erschöpfung – sie hat in jenen Jahren zudem zwei Fehlgeburten zu verkraften – eine beginnende Tuberkulose, was sich allerdings als Fehldiagnose erweist) können das Kindheitsparadies in der »Poschi« und in Tölz ernsthaft gefährden.
Nein, es sind Pistolenschüsse, die Hunderte von Kilometern entfernt am 28. Juni 1914 das alte Europa erschüttern: Der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau werden in Sarajewo von einem serbischen Attentäter erschossen. Am 28. Juli, nach Ablauf eines Ultimatums, erklärt Österreich-Ungarn dem Königreich Serbien den Krieg. Die komplizierte Pakt- und Beistandsmaschinerie, Jahrzehnte zuvor ersonnen, um ein Gleichgewicht der Kräfte auf dem Kontinent zu garantieren, läuft an: Deutschland steht dem Bündnispartner Österreich bei und erklärt Anfang August Russland und Frankreich den Krieg. Deutsche Truppen marschieren in die neutralen Staaten Belgien und Luxemburg ein, was nun für Großbritannien Anlass ist, Deutschland den Krieg zu erklären. Bereits Mitte August steht der halbe Kontinent unter Waffen, überschreiten Truppen die Grenzen, verwüsten fremde Landstriche, bringen millionenfachen Tod.
Jener letzte Frühsommer vor der Katastrophe wirkt im Nachhinein wie eine unwirkliche Phantasmagorie: hell, scheinbar unbeschwert, bei schönstem Wetter und spielerischer Ausgelassenheit. Doch ein Ereignis wirft auch auf das Kinderparadies von Tölz plötzlich einen Schatten des Todes: Beim Baden im Klammerweiher, einem moorigen Teich, in dem auch die Mann-Kinder gerne planschen, ertrinkt ein junger Bäckergeselle. Er wird, katholischem Brauch gemäß, in der Friedhofskapelle offen aufgebahrt. Die Mann-Kinder spazieren mit ihrem Kindermädchen Affa dorthin und sehen – zum ersten Mal in ihrem Leben – einen Toten. Klaus erinnert sich:
»Warum führte uns die Affa, zufällig – wie sie später behauptete – in jene abgelegene Kapelle, wo der ertrunkene Bäcker unter einem Berg von weißen Blüten zur Schau lag? Erst begriffen wir nicht, daß es ein Toter war, dem wir da gegenüberstanden. Wir hielten ihn für ein Gebild aus Marmor oder Wachs, ein frommes Kunstwerk, bestimmt zum Schmucke eines Grabes oder der Kapelle. Aber die Affa klärte uns eilig auf. Ihre Stimme zischte vor Erregung. Erkannten wir es nicht, das Zischen der argen Schlange, da sie uns flüsternd verriet, was es auf sich hatte mit der Wachsfigur. […] ›Ersoffen ist er, jämmerlich ersoffen!‹ […] Warum war sein Anblick so furchtbar und so schön? Wir standen reglos, versunken in das Bild dieser unbegreiflichen Hoheit […]. Ja, nun hatten wir ihn gesehen, den Toten, feierlich zur Schau gestellt in der Grabkapelle. Wir würden ihn nicht vergessen. Ewig jung, in vornehm bleicher Verklärung, gesellte sich der Bäckergeselle zu den Mythen der Kindheit.«[47]