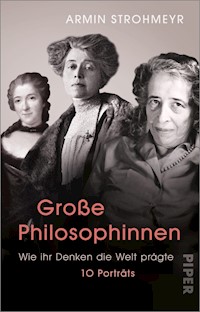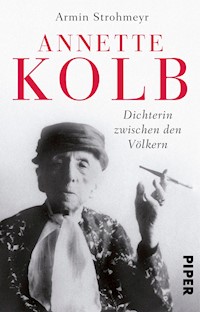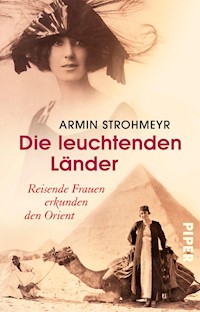11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die dreiundsechzigjährige Amerikanerin Annie Taylor war eine gewitzte Selbstvermarkterin. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhundert ließ sie sich auf die Klatschpresse ein, um ihr waghalsiges Abenteuer zu finanzieren: sich in einem Fass die Niagarafälle hinabzustürzen. Die Schweizerin Ella Maillart heuerte gegen alle bürgerliche Vernunft anno 1924 in Seehundmantel und gelben Golfschuhen als Matrosin an und besegelte in den folgenden Jahren die Welt. Etwas eleganter, aber nicht minder waghalsig war Clärenore Stinnes, deren automobile Weltreise in der Adler-Limousine bis heute Maßstäbe im Motorsport gesetzt hat. Diese und weitere Pionierinnen der Extreme porträtiert Armin Strohmeyr und entführt uns ans Ende der Welt, auf höchste Gipfel, in heißeste Wüsten und kälteste Meere.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Kathrin und Matthias
ISBN 978-3-492-99065-3
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: PVED/Bridgeman Images ; Universal History
Archive/ UIG/Briedgeman Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Annie Taylor (1838–1921)
Lina Bögli (1858–1941)
Maria Leitner (1892–1942)
Odette du Puigaudeau (1894–1991)
Clärenore Stinnes (1901–1990)
Ella Maillart (1903–1997)
Martha Gellhorn (1908–1998)
Dervla Murphy (geb. 1931)
Lynne Cox (geb. 1957)
Auswahlbibliografie
Annie Taylor (1838–1921)
Der Bezwingerin der Niagarafälle
Die Niagarafälle an der Grenze zwischen dem amerikanischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario sind seit Langem ein Besuchermagnet. Mehr als achtzehn Millionen Touristen strömen jährlich in die Region. An drei Stellen, durch Inseln voneinander getrennt, schießen die Wassermassen des Niagara-Flusses, der Verbindung zwischen Eriesee und Ontariosee, tosend in die Tiefe. Der höchste und wasserreichste der drei Katarakte sind die Horseshoe Falls: Hier stürzt der Fluss dreiundfünfzig Meter hufeisenförmig hinab, wodurch ein dichter Nebel aus Gischt über dem »Pond«, dem unten liegenden Becken, wabert, auf dem das Ausflugsschiff »Maid of the Mist« (»Mädchen der Gischt«) seine Runden dreht.
Immer wieder waren und sind die Niagarafälle Schauplatz menschlicher Tragödien: Selbstmörder sprangen hier in die Tiefe; aber auch Menschen, die am Oberlauf verunglückten und ins Wasser stürzten, wurden von der Strömung mitgerissen und in den Katarakten zermalmt. Nur wenige hatten einen gleichermaßen flug- wie schwimmtüchtigen Schutzengel wie der siebenjährige Roger Woodward, der im Juni 1960 aus einem Motorboot in den Fluss fiel und die Fälle hinabstürzte: Bis auf ein paar Schürfwunden und eine leichte Gehirnerschütterung blieb der Junge, der von der »Maid of the Mist« geborgen wurde, unverletzt. Andere »Bezwinger« der Niagarafälle hatten meist weniger Glück: Von dem britischen Barbier Charles Stephens etwa, der sich 1920 in einem Wasserfass zu Tal stürzte, fand man später in den zertrümmerten Dauben nur noch einen Arm. Alles andere hatten die tosenden Wassermassen zerrissen und Richtung Ontariosee gespült.
Von den Verunglückten und Selbstmördern einmal abgesehen, gibt es seit über hundert Jahren die »Zunft« der »Daredevils« (der »wagemutigen Teufel«), die sich freiwillig und mehr todesmutig denn lebensmüde der Hölle der Niagarafälle ausliefern. Einer von ihnen war der genannte britische Barbier, der den Kitzel auf Leben und Tod verspüren wollte. Doch sie alle haben ein Vorbild, eine Art Urmutter des Wagemuts: Annie Taylor. Sie war die Erste, der es gelang, die Horseshoe Falls lebend (und fast unverletzt) zu überwinden – in einem Fass, der »Queen of the Mist«, der »Königin der Gischt«.
Annie Taylor, damals wohnhaft in Bay City am Huronsee, war bereits zweiundsechzig Jahre alt, als ihr der Schlüsselmoment ihres Lebens widerfuhr: Sie las im Juli des Jahres 1901 in der Zeitung New York World einen Artikel über die Pan-Amerika-Ausstellung in Buffalo und die nahe liegenden Niagarafälle, als ein Gedanke sie durchzuckte: »Ich legte die Zeitung weg, saß da und dachte nach, als mich wie ein Blitz der Gedanke anrührte: ›Überwinde die Niagarafälle in einem Fass. Keiner hat je dieses Kunststück vollbracht.‹« Annie Taylor geht mit Kalkül ans Werk: Zuerst muss ein Fass gezimmert werden, das robust genug ist, absolut wasserdicht, innen verstärkt und gepolstert. Sie begibt sich zur »West Bay City Cooperage Company« in der Fremont Street, einem Zulieferer der Brauerei Kolb, und trägt ihr Anliegen vor. Dort hält man die ältere Dame für verrückt, doch Geld stinkt bekanntlich nicht. Also machen sich die erfahrenen Böttcher ans Werk. Annie Taylor will aber nicht einfach nur die Wasserfälle hinabstürzen. Was nützte es ihr, wenn keiner das Spektakel »live« mitverfolgte? Sie beabsichtigt, zugleich die Leiter des Ruhms hinaufzuklettern. Und das geht, damals wie heute, nicht ohne eine befeuerte PR. Sie hat von einem Promoter gehört, einem Agenten, der Menschen und ihre Taten in die Klatschspalten der Zeitungen und Illustrierten bringt: Frank M. Russell, der von seinen Klienten vertraulich »Tussy« genannt wird. Mit ihm schließt Annie Taylor einen Kontrakt und gibt sich zwanzig Jahre jünger aus – denn bereits damals verkauft sich Jugend gut. »Tussy« lanciert in der Presse Artikel über Mrs. Taylors todesmutige Absicht. Nun gibt es kein Zurück mehr: Will Annie Taylor nicht das Gesicht verlieren, so muss sie sich hinunterstürzen. Aber erst soll ein kleines, unschuldiges und wehrloses Wesen einen Probesturz vollführen: Annie Taylors Katze …
Eine junge Witwe
Annie kommt am 24. Oktober 1838 in der kleinen Stadt Auburn im Staat New York zur Welt. Ihre Eltern Merrick Edson und Lucretia Waring-Edson besitzen eine Getreidemühle am Owaco River, die der Familie – neben Annie hat das Ehepaar noch drei Töchter und vier Söhne – gute Einkünfte beschert. Annie ist erst zwölf, als der Vater stirbt. Die Trauer wiegt schwer. Aber anders als in ähnlichen Fällen in jener Zeit vor Einführung einer Sozialrente bedeutet der Tod des Ernährers nicht den Sturz in die Armut: Das angesparte Vermögen und der Verkauf der rentablen Mühle ermöglichen es der Witwe und ihren acht Kindern sogar ein recht komfortables Leben zu führen.
Annie erhält eine gediegene schulische Ausbildung – auch das ist für damalige Verhältnisse alles andere als selbstverständlich. Nach der Volksschule besucht sie das »Conference Seminary and Collegiate Institute« im fünfzig Meilen entfernten Charlottesville. Hier absolviert sie eine Ausbildung zur Lehrerin und legt mit siebzehn Jahren das Examen ab. Zu jener Zeit lernt sie einen jungen Mann kennen, den nur wenig älteren David Taylor. Nach nur kurzer Zeit heiraten die beiden. Bald kommt ein Sohn zur Welt, der jedoch nach wenigen Tagen stirbt. Annie und David bleiben kinderlos.
Annie Taylors Leben erfährt eine grundlegende (und letztlich tragische) Wende, als ihr Mann im Jahre 1864 im Amerikanischen Bürgerkrieg tödlich verwundet wird. Die erst fünfundzwanzigjährige Witwe genießt noch immer das Privileg, auf ein ererbtes Sparguthaben zurückgreifen zu können und nicht in Lohn und Brot stehen zu müssen, aber das macht die Einsamkeit nicht leichter. Sie wird zeitlebens keine dauerhafte Beziehung mehr eingehen und stattdessen ein ruheloses Dasein führen, das sie kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika führt, immer auf der Suche nach beruflicher Bestätigung, persönlicher Erfüllung und dem großen Abenteuer ihres Lebens …
1865, nach dem Ende des Bürgerkriegs, zieht die Witwe in den befriedeten Süden des Landes, nach San Antonio in Texas, das damals noch stark mexikanisch geprägt ist und erst seit 1845 zu den Vereinigten Staaten gehört. Hier lebt eine Schulfreundin Annies, und hier findet die junge Witwe eine Anstellung als Lehrerin. Doch bald schon treibt es sie zurück in ihre neuenglische Heimat, in die Stadt New York. Des Unterrichtens überdrüssig, eröffnet sie in der Großstadt, die sich in jenen Jahrzehnten zur Metropole mausert, eine private Tanzschule. Ob und wo Annie Taylor das Tanzen gelernt hat, bleibt unklar. Vielleicht war sie auch nur eine begnadete Organisatorin.
Doch es hält Annie Taylor nirgends lange. Chattanooga/Tennessee, Birmingham/Alabama, San Francisco/Kalifornien, Washington/D. C., Chicago/Illinois, Indianapolis/Indiana und Syracuse/New York sind Stationen ihres nomadischen Lebens. Ihr ererbtes Vermögen, das bei größerer Umsicht eine Existenz in Unabhängigkeit ermöglicht hätte, schmilzt dahin. Ihr eigener Zuverdienst als Tanzlehrerin reicht nicht aus, zumal sie sich in den Jahren ihrer finanziellen Unabhängigkeit an einen gewissen Luxus gewöhnt hat.
»Daredevils«
Annie Taylors Lebensweg ist ein langsamer, aber stetiger, sich über Jahrzehnte hinziehender sozialer und seelischer Abstieg. Ihr Wille, eine »Heldentat« zu vollbringen, wird weniger von Wagemut denn von bitterer Not genährt. 1890 kommt sie nach Bay City in Michigan. Dass hier ihr Schicksal nochmals eine – wenn auch nur kurze – Wendung nehmen wird, ahnt sie nicht. Bay City liegt am Huronsee, einem der fünf Großen Seen der Vereinigten Staaten. Südöstlich liegt der Eriesee, dem sich flussabwärts wiederum der Ontariosee anschließt. Dazwischen: die Niagarafälle, deren Nimbus allein schon – damals wie heute – bei Millionen Menschen für erhabene Schönheit und gefährliche Wildheit steht und immer wieder auch Waghalsige verleitete, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, im Verlangen, die Fälle zu bezwingen. Was zu jener Zeit für Bergsteiger der markante Gipfel des Matterhorns ist, sind für die »Daredevils« die Niagarafälle.
Der Reiz der Fälle strahlt weit über den amerikanischen Kontinent hinaus: Bereits im Jahre 1859 gelang es dem französischen Artisten Charles Blondin, die Niagarafälle auf einem dreihundertvierzig Meter langen, acht Zentimeter dicken Hochseil zu überqueren. Später wiederholte er sein Kunststück mehrmals, und jedes Mal unter erschwerten Bedingungen: mit verbundenen Augen, in einen Sack eingebunden, eine Schubkarre schiebend, auf Stelzen, seinen Manager auf dem Rücken tragend (der Promoter war von den Künsten seines Klienten wirklich überzeugt!) … Einmal setzte sich Blondin auch auf der Hälfte der Strecke auf dem Seil nieder und buk sich, in schwindelnder Höhe von rund fünfzig Metern über den donnernden Wassermassen, in aller Ruhe in einer mitgebrachten Pfanne auf einem Kocher ein Omelett, das er mit sichtlichem Appetit – Sport macht bekanntlich hungrig – verzehrte. Ein andermal stellte er einen einbeinigen Stuhl auf das Seil und setzte sich hin, um in aller Seelenruh das Spektakel unter sich zu betrachten – während den Zuschauern das Herz in die Hose rutschte.
Blondin ging später nach Irland und England und zeigte dort noch bis ins Alter seine wagemutigen Kunststücke. Er wurde steinreich, heiratete drei Mal, zeugte mehrere Kinder und starb mit beinahe dreiundsiebzig Jahren an den Folgen von Diabetes in seinem Haus »Niagara« in London.
Doch auch andere »Daredevils« forderten die Niagarafälle heraus. Einer von ihnen war der Engländer Matthew Webb, der als Langstreckenschwimmer Erfolge feierte und 1875 als erster Mensch die dreiunddreißig Kilometer breite Meeresenge zwischen Dover und Calais schwimmend in nur knapp zweiundzwanzig Stunden durchquerte. Acht Jahre später wagte sich Webb an die Durchquerung der gefährlichen Stromschnellen unterhalb der Niagarafälle. Er hatte keine Chance: Er wurde von den Strudeln hinabgezogen und ertrank.
Drei Jahre später wagte ein anderer Brite es – englische Verschrobenheit spielte hierbei wohl eine Rolle –, die »Whirlpool Rapids« schwimmend zu durchqueren, diesmal aber mit einem Hilfsmittel, einem Fass: Carlisle Graham gelang das Kunststück mehrmals, zuletzt im Juli 1901, ohne zu Schaden zu kommen. Auf die Idee, sich die Fälle in einem Fass hinabzustürzen, kam er freilich nicht. Das sollte drei Monate später eine Frau versuchen …
Entschluss und Vorbereitungen
Annie Taylor sitzt in jenem Sommer 1901 in Bay City, pleite, vereinsamt, an der Schwelle zum Alter, ohne Perspektive auf einen Ausweg aus ihrer Misere. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liest sie einen Artikel über Carlisle Graham, der am 15. Juli in der New York Times erscheint:
»Carlisle D. Graham hielt heute wieder sein Versprechen und machte eine weitere Fahrt durch die ›Whirlpool Rapids‹. Das ist die fünfte Kerbe in seinem Ruhmesstab, da er bereits fünf Mal dem Wasser getrotzt hat, das durch den engsten Bereich der Niagaraschlucht fließt. Die anderen Male waren 1886, 1887 und 1889. Aber Graham ist seither älter geworden, und heute machte er die Fahrt im Wissen, dass er über ein halbes Jahrhundert gesehen hat und nun beinahe zweihundert Pfund wiegt. Er gab zu, dass seine jetzige Kondition nicht so gut ist, wie sie es war, als er früher die Fahrt machte.
Das Fass, das er benutzte, war dasselbe, das ihm schon 1889 dienlich war. Es ist ungefähr fünf Fuß hoch und in der Mitte breiter als an den Enden. Es wurde so gewichtet, dass es aufrecht treiben würde, aber Grahams Gewicht warf es auf eine Seite, und so ritt es auf den schaumgepeitschten Wassern. Das Fass wurde bei Anbruch des Tages zu Wasser gelassen, ohne dass die Behörden dagegen einschreiten konnten. Er startete seinen Trip von einem alten Kai, mehrere Hundert Fuß stromaufwärts. Nachdem er das Fass um 3.25 Uhr bestiegen hatte, wurde es von einem Boot in den Fluss hinausgeschleppt und dort der Strömung überlassen. Statt gerade zu den Stromschnellen zu treiben, blieb es in einem Strudel hängen und gelangte erst nach fünfundzwanzig Minuten wieder zurück in die Hauptströmung.
Als das Fass die Schnellen passierte, wurde es fürchterlich hin und her geworfen, mehrere Male verschwand es aus dem Blick. Aber nach drei Minuten war das rote Objekt wieder zu sehen, wie es auf dem Whirlpool trieb. Die Strömung trug es sicher hinüber zur kanadischen Seite, ohne dass es im Becken kreiste, und ein paar Männer konnten es fassen und an Land ziehen. Als man Graham herauszog, war er beinahe erstickt. Wahrscheinlich war das seine letzte Fahrt im Fass, aber in ein paar Wochen will er auf andere Weise durch die Stromschnellen hindurch. Viele konnten es kaum glauben, dass er in dem Fass war, so gefährlich erschien ihnen der Trip.«
Annie Taylor muss diesen Artikel gekannt haben. Auch sie gewichtet drei Monate später ihr Fass, damit es aufrecht schwimmt. Und: Sie mag durch die dunkle Andeutung des Berichterstatters, Graham wolle in ein paar Wochen »auf andere Weise durch die Stromschnellen hindurch«, dazu animiert worden sein, dem Briten zuvorzukommen. Und was soll auch mit der »anderen Weise« gemeint sein, die Stromschnellen zu bezwingen? In einem anderen, verbesserten Gefährt? Oder gar: nicht seitlich durch den »Whirlpool« treibend, sondern sich die Horseshoe Falls hinabstürzend? Annie Taylor sah sich angestachelt, den Ruhm, den der Brite wiederholt einheimste, selbst zu ernten und sich weitere Sensationen und Kunststücke nicht von ihm »wegnehmen« zu lassen.
Der wichtigste Impuls für sie ist jedoch ihre finanzielle Misere, wie sie später selbst zugibt: »Für eine Frau [wie mich], die ihr ganzes Leben lang Geld hatte und eine feine Umgebung und den Umgang mit kultivierten Menschen gewohnt war, war es schrecklich, arm zu sein.« Und sie führt aus: »Ich war immer gut gekleidet, ein Mitglied und regelmäßiger Besucher der ›Episcopal Church‹, und mein engster Nachbar hatte nicht die leiseste Ahnung, woher ich mein Geld hatte, wie viel ich hatte, noch, wie ich es ausgab. Meine Verwandten sandten mir jeden Monat eine bestimmte Summe, aber es wurde nur widerwillig gegeben, und so entschloss ich mich, keines mehr anzunehmen.«
Ob es stimmt, dass Annie Taylor freiwillig auf die ihr geleistete monatliche Rente aus dem väterlichen Erbe verzichtete, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass ihr um 1900 das Geld ausgeht und die Verzweiflung in ihr wächst. Der Entschluss, sich die Niagarafälle hinabstürzen zu wollen, ist nicht das Ergebnis nüchternen Abwägens, sondern aus dem Augenblick geboren, es ist die Eingebung einer fixen Idee wider alle Vorsicht und Vernunft.
Annie Taylor macht sich sofort ans Werk: In einer Böttcherei, die auf die Anfertigung von Brauereifässern spezialisiert ist, bestellt sie (wohl auf Pump) ein Fass nach ihren Maßen und Anweisungen: Es ist rund hundertvierzig Zentimeter hoch und damit kleiner als Annie Taylor, die – wie Fotos, die sie neben dem Originalfass zeigen, beweisen – etwa hundertfünfundfünfzig bis hundertsechzig Zentimeter groß gewesen sein muss. In der Mitte misst das bauchige Fass etwa neunzig Zentimeter im Durchmesser. Die Dauben sind mit starken Eisenbändern armiert. Im Innern wird das Fass mit Kissen gepolstert und – das ist wesentlich – mit einem Lederkorsett versehen, um den Körper zu stützen und somit gegen harte Stöße zu schützen. Denn Annie Taylor ahnt, dass bereits der harte Aufprall am unteren Ende des Wasserfalls oder eine Kollision mit einem Felsen ausreichen kann, um einem nicht geschützten Menschen tödliche Verletzungen zuzufügen. Bald ist das Fass fertiggestellt und wird von der Auftraggeberin inspiziert. Unter den Augen der Böttcher steigt die inzwischen etwas füllige ältere Matrone, angetan mit einem schwarzen, bodenlangen Kleid und einem riesigen Damenhut, über eine Leiter in das Behältnis. Man kann sich gut ausmalen, wie die Arbeiter, als die Dame in dem Fass steckt und deren Gesichter nicht sehen können, mit den Augen rollen, anzüglich grinsen und sich dumme Bemerkungen zuflüstern. Bier im Fass, das kennen sie, aber eine ältere Dame? Aber, nun ja, der Kunde ist König …
Unterdessen geht ein weiterer Bericht über Fahrten durch die Stromschnellen durch die Presse. Und diesmal waren es Frauen, die in ein Fass gestiegen sind: Am 6. September 1901 durchquerte Margaret Wagenfuhrer die Stromschnellen, tags darauf Maude Willard. Letztere kam bei dem Unternehmen ums Leben, da ihr Fass fünf Stunden lang in einem Strudel stecken blieb. Als man das Fass schließlich barg, war die Passagierin längst erstickt.
Sicherlich lässt das Annie Taylor aufhorchen. Sie will sich nicht den Titel nehmen lassen, als erster Mensch – und als erste Frau – die Wasserfälle zu bezwingen! Aber sie hat durch Maude Willards tödlichen Unfall vor Augen geführt bekommen, wie gefährlich die Wasserfälle und die Stromschnellen sind, und wie genau alles bedacht und vorbereitet werden muss.
Annie Taylor inspiziert alles kritisch. Sie lässt sich in das Korsett schnallen, lässt den Korkdeckel auf das Fass nageln. Dann rollen die Arbeiter, wie ihnen geheißen, das Fass in der Fabrikhalle herum und lassen es auch gegen eine Wand krachen. Die Passagierin will schließlich wissen, wie gut die Polsterung und das Stützkorsett gegen Stöße schützen. Als die Arbeiter das Fass wieder senkrecht stellen und den Deckel aufhebeln, klettert die ältere Dame unverletzt und tapfer lächelnd heraus. Ein paar kleine Änderungen und Besserungen werden noch angebracht. Zudem wird auf ihren Wunsch hin auf die Außenwand des Fasses in großen Lettern die Aufschrift »Queen of the Mist«, »Königin der Gischt« gepinselt. Dann ist die verrückte Kundin zufrieden und ordnet an, ihr das Fass nach Hause zu liefern. – So könnte es sich in der Böttcherei zugetragen haben.
Eine PR-Kampagne
Natürlich nützte es Annie Taylor wenig, den Niagararitt in ihrem Fass zu wagen, wenn die Öffentlichkeit davon nichts erführe. Sie will ihre Knochen nicht um sportlicher Ambition willen wagen, sondern weil sie sich durch die Publicity eine Sanierung ihrer Finanzen erhofft. Ein PR-Manager muss die Sache professionell vorbereiten und vermarkten, und so schließt sie mit dem damals bekannten Promoter Frank M. Russell einen Kontrakt. Russell hat sich im Bundesstaat Michigan auf Karnevalsveranstaltungen spezialisiert, und wahrscheinlich hegt auch er die Hoffnung, endlich einmal den Events mit verordneter Lustigkeit entkommen zu können und als Agent eine Klasse höher zu spielen.
Russell macht sich sogleich an die Arbeit. Er sendet Pressemitteilungen an diverse Zeitungen, verheimlicht aber zunächst den Namen seiner Klientin – vielleicht, um sie vor unliebsamen Interviewjägern zu schützen, vielleicht auch, um nicht selbsternannte Moralapostel auf den Plan zu rufen, die in so einer Veranstaltung eine Verunglimpfung des weiblichen Rollenverständnisses sehen könnten. Zudem lässt Russell am 8. Oktober 1901 das Fass, die »Queen of the Mist«, im Schaufenster eines Ladens an der Ecke Center Avenue und Saginaw Street in Bay City aufstellen. Zwei Tage später lässt Russell das Fass zu den Niagarafällen transportieren. Wiederum zwei Tage später packt Annie Taylor ihre Siebensachen und begibt sich zum Bahnhofsgebäude der Pere Marquette Railway Company in Bay City. Inzwischen hat Russell das Geheimnis der Identität der Fasspassagierin gelüftet, und Annie Taylor wird von einem Reporter der örtlichen Bay City Times Press bereits erwartet. Auf seine Frage, wie sie zu dem beabsichtigten Wagnis denn stehe, antwortet sie freimütig: »Ich wäre lieber tot, als dass ich in meinen gegenwärtigen Lebensumständen weiter verharrte.« Ob sie denn die Absicht hege, Selbstmord zu begehen? Annie Taylor: »Auf keinen Fall, ich bin zu sehr Episcopanerin, als dass ich so etwas tun würde. Ich glaube an einen Höheren Herrscher, und bin mir dessen gewärtig, was eine Selbsttötung im Jenseits bedeutete. Meine Eltern waren Christen, und ich wurde im christlichen Sinne erzogen und unterrichtet.« Der Journalist scheint indes etwas schwer von Begriff zu sein. Er kann nicht akzeptieren, dass eine Frau sich freiwillig, ohne eingetrübte Sinne, ohne lebensmüde zu sein, die fast sechzig Meter hohen Wasserfälle hinabzustürzen gedenkt. Erneut fragt er sie, was ihr denn diese selbstmörderische Idee in den Kopf gesetzt habe? Annie Taylor antwortet unbeirrt und gelassen:
»Das ist keine selbstmörderische Idee. Ich habe größtes Vertrauen, dass mir der Sturz über die Fälle unbeschadet gelingen wird. Das Fass ist gut und fest, und sein Inneres wird mit Kissen gepolstert, sodass die rollenden Bewegungen mir nicht schaden werden. Übrigens werde ich auch Riemen haben, an denen ich mich festhalten kann. An einem Ende des Fasses wird auch ein Gewicht angebracht, sodass Luft am oberen Ende, wo mein Kopf sein wird, durch ein Ventil einströmen kann.
Natürlich wird es nötig sein, das Fass mehr als eine Meile oberhalb der Fälle zu Wasser zu lassen. Es wird natürlicherweise auf dem Weg flussabwärts beträchtlich rollen […]. Das Ventil wird sich schließen, wenn es über die Kante hinabgeht.
Ich schätze, dass ich, nachdem das Fass luftdicht gemacht worden ist, fast eine Stunde lang darin überleben kann. Und wenn alles funktioniert, wie ich es erwarte, wird das Fass weit vor diesem Zeitpunkt wieder auftauchen. Dann kann ich das Ventil wieder öffnen, um Luft hereinzulassen. An der Außenwand des Fasses werden Riemen befestigt, sodass es den Rettungskräften keine Schwierigkeiten machen wird, das Fass anzuseilen und in Sicherheit zu bringen, wo man mich dann befreien kann.«
Freilich, ganz so überzeugt ist Annie Taylor von ihrem Vorhaben nicht. Doch das darf sie sich niemandem gegenüber anmerken lassen, nicht den Reportern, nicht ihrem Manager, nicht den Helfern. Sie beschließt, in einem Tierversuch die Gefährlichkeit ihres Vorhabens zu sondieren. Der unfreiwillige Passagier: ihre kleine Katze. Am 18. Oktober 1901 bindet Annie Taylor das vor Angst fauchende und strampelnde Tier in das Fass, Helfer schließen den Deckel fachmännisch und lassen das Fass etwas oberhalb der Horseshoe Falls zu Wasser. Rasch wird es von der mächtigen Strömung erfasst und zur Bruchkante getrieben. Unterhalb der Fälle warten Helfer am Ufer. Sie sehen das Fass an der oberen Kante der Wasserfälle für einen Moment, dann kippt es, stürzt hinab und verschwindet in einem Nebel aus Gischt. Minuten vergehen. Die Männer spähen angestrengt nach dem Fass. Ist es untergegangen? Oder gar zerschellt? Da plötzlich taucht das Fass aus dem Wassernebel auf, es schwimmt aufrecht und wird von der nun ruhiger werdenden Strömung zum Rand des Beckens getrieben. Die Männer besteigen rasch einen Kahn und rudern zu dem Fass, holen es mit Haken heran, binden es fest und ziehen es an Land. Unterdessen ist auch Annie Taylor herbeigeeilt. Die Männer öffnen vorsichtig das Fass. Insgeheim befürchten sie, die Katze habe sich bei dem Aufprall das Genick gebrochen. Doch sie lebt! Ein kümmerliches Miauen schallt ihnen entgegen. Annie Taylor langt in das Fass hinein, bindet die Katze los und hebt sie heraus. Das Tier steht unter Schock, ist am Kopf verletzt, aber nicht ernsthaft. Annie Taylor drückt es an sich, streichelt es, redet ihm gut zu, bettet es dann in ein Körbchen. Alle sind froh und erleichtert: Die Katze hat den Sturz ohne größere Schäden überstanden. Die Probe aufs Exempel ist geglückt. Es gilt nun noch, die Polsterung und die Lederhalterungen zu verbessern. Fest steht jedoch: Der Niagarasturz ist möglich!
Alle sind guter Dinge, und der Agent Russell lanciert tags darauf in der Bay City Times Press den folgenden Artikel:
»Mrs. Taylor jagt über die Niagarafälle.
Die Gattin des Managers kommt vom Schauplatz zurück und sagt, die Frau sei dazu bestimmt, morgen über den großen Katarakt zu jagen.
Mrs. F. M. Russell […] kehrte gestern Nachmittag von den Niagarafällen zurück. Sie informierte einen Reporter der Times Press heute Morgen, dass ihr Ehemann, der Manager von Mrs. Anna Edson Taylor, absolutes Vertrauen in seine Fähigkeit hat, die Frau spätestens morgen über den Katarakt zu schicken. Mrs. Russell sagte weiter, dass Mrs. Taylor fest entschlossen ist, den Versuch zu unternehmen, und dass sie sich – sollten die Behörden es probieren, ihre Absichten zu vereiteln – den Protesten zum Trotz ins Wasser werfen würde. Mr. Russell, dem vom Polizeichef von Niagara Falls, New York, amtlich mitgeteilt wurde, er würde verantwortlich sein für den Tod Mrs. Taylors, sollte sie bei dem Abenteuer ums Leben kommen, hat darüber juristischen Rat eingeholt und ist überzeugt, dass er juristisch nicht zu belangen ist. Als Mrs. Russell gestern nach Hause fuhr, hatte ihr Mann noch die Absicht, das leere Fass probeweise hinunterzuschicken: Wenn es nicht zerschellt, so sei man äußerst hoffnungsvoll, dass die Fahrt vergleichsweise sicher durchgeführt werden kann. Es wird geglaubt, dass das Fass nicht mit dem Wasser hinabsinken wird, wenn es über die Kante des Abgrunds fällt, sondern dass es infolge der gewaltigen Kraft hinter sich klar aus dem Wasser herausschießen wird. Das Fass wird auf Höhe der Geißeninsel zu Wasser gelassen werden.«
So weit der Artikel vom 19. Oktober. An dessen Ende bekräftigt die Frau des Agenten nochmals Annie Taylors Willenskraft: »[…] es bestehen kaum Zweifel, dass Mrs. Taylor morgen den Plan ausführen wird. Sie hat, seitdem sie Bay City verlassen hat, nicht eine Minute die Nerven verloren.«
Die Fahrt wird freilich nochmals um vier Tage verschoben. Die Gründe hierfür bleiben unklar. Vielleicht ist Annie Taylor doch etwas beunruhigt darüber, dass die Katze (diesen Tieren sagt man bekanntlich sieben Leben nach) bei dem Aufprall verletzt wurde (was der Presse verschwiegen wird). Also werden noch Verbesserungen an der Innenkonstruktion des Fasses vorgenommen. Ein anderer Grund für die Verzögerung dürfte darin liegen, dass die Abenteurerin am 24. Oktober 1901 ihren dreiundsechzigsten Geburtstag begeht (vor der Öffentlichkeit macht sie sich zwanzig Jahre jünger, und man nimmt es ihr eine Zeit lang sogar ab). Ein Höllensturz über die Niagarafälle am Geburtstag – das zieht als PR-Event besonders!
Der Höllensturz
Der Morgen des 24. Oktober 1901 bricht an. Es ist Annie Taylors 63. Geburtstag. Es wird der wichtigste Tag ihres Lebens werden, ein Tag auf Leben und Tod. Wie sie den Vormittag verbracht hat, wissen wir nicht, vielleicht mit einer kleinen Feier im Beisein von Freunden und ihres Agenten. Wahrscheinlich wird sie sich kaum über die Glückwünsche und Geschenke gefreut haben, denn ihr ganzes Denken und Fühlen ist an jenem Tag vom bevorstehenden Wagnis der Niagarafahrt überschattet. Vielleicht betet sie – nach eigenen Angaben ist sie sehr religiös – und bittet ihren Schöpfer um Beistand und Vergebung ihrer Verfehlungen. Sie ist sicherlich nicht so blauäugig, um das Risiko des Unternehmens nicht recht einzuschätzen. Auch wenn ihre Katze den Sturz überlebt hat, heißt das für sie, Annie Taylor, noch gar nichts. Sie weiß: Ihre Chancen, unbeschadet zu überleben, sind niedriger als das Risiko, schwer verletzt oder gar getötet zu werden. Es ist anzunehmen, dass ihr 63. Geburtstag eher ein Tag der Zweifel und der Todesangst gewesen ist. Ob sie in jener Nacht Schlaf gefunden hat, ist fraglich. Wahrscheinlich ist sie in ihren Nachtmahren von Fässern verfolgt worden, die schäumende, brodelnde Katarakte hinabstürzen und an Felsbrocken zerschellen …
Zäh verrinnen die Minuten und Stunden, und Annie Taylor wird immer unruhiger. Endlich kommt der Nachmittag heran. Annie Taylor und ihr Promoter Russell besteigen einen Wagen und fahren zu einer Uferstelle, etwa eine Meile oberhalb der Niagarafälle. Der Ort selbst wurde geheim gehalten, man will vermeiden, dass die Polizei im letzten Moment auftaucht, das Fass beschlagnahmt, die Niagara-Abenteurerin in Gewahrsam nimmt und damit das ganze Unternehmen durchkreuzt. Die eingeladenen Reporter, darunter von der angesehenen, überregionalen New York Times, warten unterdessen unterhalb der Fälle, am Ufer des »Whirlpool«-Beckens, in der Hoffnung, einen Blick auf das Fass zu erhaschen, wie es über die obere Kante geschossen kommt und in die Tiefe stürzt. Die Reporter sind nicht allein. Russells PR-Arbeit zeigt Wirkung: Tausende Menschen sind herbeigeströmt und tummeln sich an den Ufern des Beckens, um den todesmutigen Sturz mitzuverfolgen …
Die Helfer erwarten Annie Taylor bereits. Russell verabschiedet sich von seiner Klientin, wünscht ihr eine glückliche Fahrt und eilt hinunter zum Becken, um vor Ort zu sein, wenn das Fass aus der Gischt auftaucht und man die Tonne samt »Daredevil«-Abenteurerin aus den Fluten fischt. Unterdessen laufen die Vorbereitungen oberhalb der Horseshoe-Fälle rasch und routiniert ab: In einem Kahn rudern die Helfer samt Annie Taylor und dem Fass zu einer kleinen Insel im Fluss. Hier beschweren sie den Fassboden mit einem Amboss von zweihundert Pfund, damit das Gefährt nach Möglichkeit aufrecht schwimmt und nicht zur Seite rollt. Annie Taylor steigt hinein. Sie hat ihren besten Rock und eine weiße, gestärkte Bluse angezogen, zudem ihre Sonntagsschuhe, denn sie will, sollte sie den Sturz überleben, adrett vor den Pressekameras stehen. Die Helfer zurren die Passagierin der »Queen of the Mist« im Lederkorsett fest, arretieren vor allem Hals und Kopf. Ein letztes »good luck!«, dann pressen die Männer den Korkdeckel auf das Fass, versiegeln es, pumpen noch Luft ins Innere, schließen das Ventil. Vorsichtig zerren sie das Fass ins Boot, rudern ein paar Meter hinaus und lassen die »Queen of the Mist« zu Wasser. Es ist genau 16.05 Uhr. Sofort wird die Tonne von der Strömung erfasst und in die Mitte des Flusses getrieben. Rasch bewegt sich das Fass stromabwärts und entschwindet aus dem Blickfeld der Helfer.
Entlang des Flusses sind Posten aufgestellt, die nach dem Fass Ausschau halten und die Uhrzeit mitprotokollieren. Genau achtzehn Minuten ist die »Queen of the Mist« unterwegs, bis sie auf der kanadischen Seite des Flusses die Sturzkante des »Horseshoe«-Falls erreicht. Was Annie Taylor in diesen achtzehn Minuten gedacht und empfunden hat, wissen wir nicht. Sie hat sich darüber später nicht geäußert, jedenfalls nicht gegenüber der Presse. Vielleicht wollte sie sich nicht äußern, weil es zu intim war, vielleicht konnte sie sich nicht äußern, weil ihr die Worte für die wechselnden Empfindungen zwischen Hoffnung wider alle Vernunft und Todesangst fehlten.
Es ist 16.23 Uhr. Annie Taylor weiß das nicht. Die achtzehn Minuten, seitdem die Tonne zu Wasser gelassen wurde, dürften ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen sein. In ihrem Fass ist es stockfinster. Das mag eine Gnade sein oder ein Fluch, je nach Blickwinkel. Sie hat kein Guckloch, also kann sie nicht sehen, wie weit es noch bis zur Sturzkante ist. Aber sie fühlt in ihrem Fass die schneller werdende Strömung, und – das wohl Fürchterlichste: Sie hört, wie ein infernalisches Tosen lauter und lauter wird. Das Fass schlingert immer mehr, wird einen Moment lang heftig gebeutelt, während draußen ein schreckliches Unwetter zu brüllen scheint. Dann stürzt das Fass in die Tiefe, nein, es wird in einen Höllenschlund gerissen. Annie Taylor spürt noch ein Ziehen im Bauch, einen heftigen Stich im Herzen – dann verliert sie das Bewusstsein –
Nach eigener Aussage erwacht sie aus der Ohnmacht, als das Fass in den Strudeln unterhalb des Wasserfalles heftig umhergebeutelt wird. Sie hat also den eigentlichen Höllensturz nicht bewusst erlebt, vielleicht eine Gnade. Die an den Ufern des »Whirlpool«-Beckens wartende Menge sieht in jener Minute, wie das Fass, die »Queen of the Mist«, kurz an der Sturzkante erscheint, einen Augenblick nur, einen Wimpernschlag. Das Fass ruckelt kurz, als es vom Sog ergriffen wird – dann verschwindet es in den Wassermassen und der Gischt, die jede Sicht auf das, was sich innerhalb dieses Infernos abspielt, nehmen.
Die Sekunden dehnen sich ins Unerträgliche. Wie lange dauert es, bis das Fass unten ankommt? Der Wasserfall ist an jener Stelle dreiundfünfzig Meter tief. Im freien Fall braucht ein Gegenstand dafür knapp 3,3 Sekunden. Beinahe ein Nichts im ruhigen Fluss der Zeit, kaum der Rede wert. Aber in einer Zeit der Erwartung (wie sie die Zuschauer erfasst) oder der Todesangst (wie Annie Taylor sie gehabt hätte, wäre sie nicht rechtzeitig in Ohnmacht gefallen) dehnen sich 3,3 Sekunden schier unerträglich.
Doch das Schlimmste kommt erst noch: Am unteren Ende des Wasserfalls, nach 3,3 Sekunden, prallt das Fass auf die Wasseroberfläche auf, wird von den tobenden Strudeln und den dauernd nachstürzenden Wassermassen hin und her geworfen. Spätere »Daredevils« sind hier bisweilen gescheitert, ihre Fässer wurden zerschmettert, ihre Leiber zermalmt und zerschreddert. Fast eine Minute lang ist von der »Queen of the Mist« nichts zu sehen. Die Zuschauer dieses fürchterlichen Spektakels bangen, insgeheim glaubt mancher schon, dass man von dem Fass allenfalls einzelne Dauben bergen wird, und von Annie Taylor wohl nur ein paar blutige, zerfetzte Glieder.
Doch mit einem Mal geht ein Raunen durch die Menge, kurz darauf ein Hurrageschrei: Die »Queen of the Mist« verlässt schwankend und rollend die tosenden Strudel und die neblige Gischt. Noch ist die Gefahr nicht überstanden: Das Fass gerät in die hier gefährlichen Stromschnellen, aber es ist offensichtlich ganz und unbeschadet und kann als großer Hohlkörper nicht in die Tiefe gezogen werden. Die »Queen of the Mist« hat schließlich auch die Schnellen passiert und treibt nun in ruhigerem Gewässer. Ein paar Männer rudern in einem Kahn in die Strommitte, können das Fass an den außen angebrachten Riemen fassen und ans nahe Ufer schleppen. Es ist exakt 16.40 Uhr. Fünfunddreißig Minuten war Annie Taylor insgesamt unterwegs, der Sturz selbst hat nur gut drei Sekunden gedauert.
Die Spannung ist groß. Ist die Passagierin tot oder lebendig, verletzt oder unversehrt? Aus dem Inneren hört man nichts. Die Helfer sind bald von der herbeiströmenden Menge umringt, Fotografen bringen ihre schweren, unhandlichen Apparate samt Stativen in Stellung. Das Fass liegt nun auf der Seite. Die Männer versuchen den großen Korken zu entstöpseln, aber er sitzt zu fest und zu tief. Also sägen sie ein Stück des oberen Endes weg, brechen dann das Fass mit einem Stemmeisen auf. Sie blicken hinein: Annie Taylor regt sich, sie ist fest in das Lederkorsett geschnallt. Die Männer lösen die Schnallen und Bänder. Sofort kriecht Annie Taylor heraus, richtet sich ohne fremde Hilfe auf, zieht instinktiv den langen Rock zurecht, steht, mühsam lächelnd, aber immerhin lächelnd, vor der nun in Jubel ausbrechenden Menschenmenge. Annie Taylor hat als erster Mensch die Niagarafälle überwunden!
Es existiert eine Fotografie, die die Abenteurerin zeigt, wie sie eben dem Fass entstiegen ist und auf einem Steg vom Kahn an Land geht. Hinter ihr in einiger Entfernung die tosenden Niagarafälle, im Vordergrund, in ihrem Rücken, die stützenden Arme eines Ruderers, ihr entgegen recken sich helfende Hände von Zuschauern, die in Anzug und Krawatte herbeigeströmt sind, um Zeugen des unerhörten Ereignisses zu sein. Annie Taylor ergreift eine der helfenden Hände, doch im Übrigen geht sie aufrecht, schreitet kräftig aus. Die Reporter drängeln sich vor. Erst jetzt bemerkt man, dass die Niagara-Bezwingerin am Hinterkopf blutet. Es ist keine schwere Verletzung. Doch sie steht unter Schock, zu einem ausführlichen Interview fehlt ihr die Kraft. Sie gibt nur die folgende Stellungnahme ab, die sofort von den Journalisten mitstenografiert wird: »Selbst bei meinem letzten Atemzug würde ich jedermann davon abraten, dieses Kunststück zu versuchen. Eher würde ich die Mündung einer Kanone erklimmen, auf die Gefahr hin, in Stücke gerissen zu werden, als nochmals die Fahrt über die Wasserfälle zu tun.« Diese Einsicht gibt sie den Versammelten und der Nachwelt mit – dann wendet sie sich zu der bereitstehenden Kutsche, besteigt sie ohne fremde Hilfe, die Pferde ziehen an, die Kutsche bahnt sich einen Weg durch die Menge.
Annie Taylor wird in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Ihre äußerlichen Verletzungen sind unbedeutend. Der Schock wiegt schwerer, aber nach wenigen Tagen hat sie sich auch davon erholt und kann das Hospital verlassen und nach Bay City in ihre Wohnung zurückkehren. Selbstverständlich ist sie ein Profi, und so hat sie noch vom Krankenbett aus einem Reporter der New York Times ein kurzes Interview gegönnt, das dieser in seinen Bericht, der einen Tag nach dem Niagarasturz erscheint, einflicht. In dem Artikel vom 25. Oktober 1901 heißt es:
»Eine verwitwete Frau, Mrs. Anna Edson Taylor, hat heute Nachmittag in einem Fass die Niagarafälle sicher durchquert. Die Fahrt von einem Ende zum anderen wurde von mehreren Tausend Menschen beobachtet. […] sie ist am Leben, und die Ärzte sagen, sobald sie den Schock überwunden hat, wird sie wieder völlig in Ordnung sein.
Die Jungfernfahrt über den Niagarakatarakt begann in Port Day, beinahe eine Meile vom Rand der Fälle entfernt. Von Port Day wurden Mrs. Taylor und ihr Fass zur Grasinsel gebracht, wo sie in das Fass stieg, und um 15.50 Uhr war sie im Schlepptau eines Kahns, der hinüber in den kanadischen Teil des Stromes fuhr. Um 16.05 Uhr wurde das Fass der Drift überlassen, und Mrs. Taylor wurde dem Wohlwollen der Wasserströmung ausgesetzt, die noch nie einen Menschen, der in ihren Fängen gewesen war, verschont hat. […]
Das Fass stürzte um 16.23 Uhr den Wasserfall hinunter, mit dem Boden voran. In weniger als einer Minute erschien es am Fuße des Wasserfalls und wurde von der Strömung mitgerissen. […] Mrs. Taylor war am Leben und bei Bewusstsein, aber bevor man sie aus dem Fass holen konnte, war es nötig, den oberen Teil des Fasses aufzusägen. Ihr Zustand war für alle überraschend: Sie ging das Ufer entlang zu einem Boot und wurde flussabwärts zur Anlegestelle der ›Maid of the Mist‹ gebracht, wo sie eine Kutsche bestieg und in die Stadt gebracht wurde.
Sie leidet noch recht unter einem Schock. Zudem hat sie einen drei Inch [7,5 cm] langen Schnitt am Schädel, hinter dem rechten Ohr, aber sie weiß nicht, wie oder wann sie sich ihn zugezogen hat. Sie klagt über Schmerzen zwischen den Schultern, aber das ist vermutlich auf den Umstand zurückzuführen, dass ihre Schultern nach hinten geworfen wurden, als das Fass ins Wasser eintauchte, da ihre Arme in Schlingen steckten, was sie zweifellos vor dem Genickbruch bewahrte.
Sie gibt zu, das Bewusstsein verloren zu haben, als sie die Wasserfälle passierte. Sie dankt Gott dafür, ihr Leben verschont zu haben, warnt aber zugleich jedermann davor, diese Fahrt zu unternehmen. Der Schock war so groß, dass sie beim Reden noch stockt, aber es bestehen kaum Zweifel, dass sie innerhalb von ein oder zwei Tagen wieder in guter Verfassung sein wird.
Drei Ärzte wachen diese Nacht an ihrem Bett. Mrs. Taylor ist dreiundvierzig Jahre alt. […] sie hat den amerikanischen Kontinent acht Mal durchquert. Während ihres Aufenthaltes hier hat sie jeden mit ihrer wundervollen Courage beeindruckt. […]«
Annie Taylor hat das Abenteuer ihres Lebens gemeistert, ist der Hölle der Wasserfälle und Stromschnellen glücklich und beinahe unbeschadet entronnen, und mit Recht kann sie sich nun selbst den Titel zulegen, den sie zuvor ihrem Gefährt als Namen verpasst hat: »Queen of the Mist«, »Königin der Gischt«.
Budenattraktion und Hellseherin
Doch so glücklich alles ablief, so unglücklich nimmt ihr Lebensschicksal erneut eine Wende: Der Ruhm, der sie in den Tagen nach dem Erscheinen des Artikels in der New York Times umgibt, verblasst schnell. Zu quirlig ist das amerikanische Leben, zu rasch wechseln in den Blättern die Denkwürdigkeiten, Heldentaten und Sensationen einander ab. Und obwohl Annie Taylor öffentlich vehement davor warnte, es ihr mit der Durchfahrung der Niagarafälle gleichzutun, fand sie doch bald Nachahmer, glückliche und unglückliche, die die Pionierin der »Daredevils« bald in den Schatten stellten.
Bereits am 2. November 1901, nur neun Tage nach ihrer spektakulären Fahrt, tritt Annie Taylor auf der Panamerikanischen Ausstellung in Buffalo auf. Tausende bereiten ihr einen begeisterten Empfang, und sie lässt sich stolz neben ihrem Gefährt, der »Queen of the Mist«, fotografieren. Das Honorar freilich fällt bescheiden aus: gerade einmal zweihundert Dollar. Und während sie in der Provinz in der Nähe der Niagarafälle immerhin eine gewisse Popularität genießt, ist sie in der Metropole New York allenfalls eine kuriose Lachnummer. Versuche, dort in großen Veranstaltungen aufzutreten, scheitern, allenfalls »Huber’s Museum«, ein reißerisches Kuriositätenkabinett, zeigt Interesse an ihr und bietet ihr für einen Auftritt fünfhundert Dollar. Annie Taylor lehnt aus verletztem Stolz ab – obwohl sie die Gage gebrauchen könnte. Es kommt noch schlimmer: Aus Unvernunft weist sie auch das Angebot einer Filmproduktionsfirma zurück, den Sturz nachzustellen. Sie ist sich des Potenzials dieses neuen künstlerischen Mediums nicht bewusst. Da greift ihr Konkurrent Carlisle Graham zu, der ja nur die Stromschnellen unterhalb der Fälle befahren hat: Er mimt den Stunt und stellt Annie Taylors Abenteuer für den Film nach.
Mangelnder Geschäftssinn und Ungeschicktheit lassen Annie Taylor weiterhin scheitern. Als auch noch ihr wahres Alter publik wird, ist sie für die amerikanische Öffentlichkeit uninteressanter denn je. Keineswegs sind damals sportliche, agile Senioren PR-tauglich, sie gelten vielmehr, wenn sie etwas Außergewöhnliches vollführen, als »unwürdig« – man wirft ihnen vor, sie würden sich für ihr Alter und die damit verbundenen Konventionen »unangemessen« verhalten. So gerät eine kleine Tournee durch diverse Städte des amerikanischen Ostens im Winter 1901/1902, die Frank Russell organisiert hat, zum Fiasko. Nicht die Stadthallen sind Annie Taylors Locations, sondern Kaschemmen und Ladenschaufenster, in denen sie wie ein »lebendes Bild« sitzen muss, neben ihr das Fass, auf dem Arm die widerstrebende Katze, die erste Passagierin der »Queen of the Mist«. Ein Foto aus jener Zeit zeigt sie vor einem Ladenlokal, an einem Tisch sitzend, neben ihr das Fass, vor ihr ein handgemaltes Schild mit der Aufschrift »Annie Edson Taylor, Heroine of Horseshoe Falls«, »Heldin der Hufeisen-Fälle«. Auf dem Tisch Fotos und Karten, die zum Verkauf liegen, hinter dem Tisch eine sich sichtlich langweilende »Heldin«, die Ellbogen aufgestützt, auf Kundschaft wartend. Wenig später taucht Frank Russell mit dem Fass unter und beraubt Annie Taylor nicht nur der bisherigen spärlichen Gagen, sondern auch ihres wichtigsten Utensils, des Beweises für ihre Niagarafahrt. Völlig mittellos strandet Annie Taylor in Cleveland/Ohio. Wovon sie in den folgenden Monaten lebt, ist unklar. Immerhin entdeckt sie die »Queen of the Mist« im Sommer 1902 in einem Theater in Chicago, wo es in einem Stück mit dem Titel Over the Falls Verwendung findet. Sie klagt und erhält Recht und ihr Fass wieder.
Nochmals scheint es bergauf zu gehen. Sie engagiert einen anderen Manager, doch auch der betrügt sie und verschwindet wenig später mit dem Original-Fass. Nun lässt Annie Taylor eine Kopie der »Queen of the Mist« anfertigen. Für eine Tournee freilich interessiert sich inzwischen keiner mehr. In dem Ort Niagara Falls, gleich neben den Wasserfällen, posiert Annie Taylor in den folgenden Jahren samt Fass und Katze und bringt sich mühselig mit dem Verkauf von Souvenirs und Autogrammkarten durch. Im Jahre 1906 – sie ist inzwischen achtundsechzig – spielt sie kurzzeitig mit dem Gedanken, die Fahrt zu wiederholen, in der Hoffnung, diesmal mehr Publicity und dadurch mehr Einnahmen zu erhalten, doch gibt sie diese Idee bald wieder auf. Zu krank ist sie inzwischen, zu alt, und die Angst vor einem zweiten Höllensturz ist zu groß.
Sie muss noch erleben, wie ihre Heldentat erfolgreich nachgeahmt wird: Am 25. Juli 1911 wagt der neunundvierzigjährige Engländer Bobby Leach in einem Metallfass die Fahrt die Horseshoe Falls hinab. Ein Reporter der New York Times ist wieder vor Ort und berichtet einen Tag später darüber: »Bobby Leach […] fuhr heute Nachmittag über die Horseshoe Falls und ist noch am Leben. Obwohl er bei dem Sturz von 158 Fuß Tiefe über die Kante des Katarakts böse zugerichtet und zerschrammt wurde, erlitt er nur oberflächliche Verletzungen und ist heute Abend bereits wieder in seinem Haus. Es ist das zweite Mal in der Geschichte des Flusses, dass der Katarakt erfolgreich befahren wurde. Mrs. Anna Edson Taylor hier aus der Stadt [Niagara Falls] unternahm die Fahrt in einem Fass am 24. Oktober 1901 und überlebte.«
Immerhin, die Zeitung kennt zehn Jahre nach Annie Taylors halsbrecherischem Trip noch ihren Namen, und anders als Leach benötigte sie nach der Öffnung des Fasses keine Sauerstoffmaske, wie man sie dem Briten verabreichte (und wie die New York Times zu berichten weiß). Doch all das verhilft ihr nicht mehr zu Ruhm und Geld. Leach ist weit jünger als sie, ein attraktiver Mann, und er versteht es blendend, sich in der Presse und der Öffentlichkeit zu verkaufen.
Annie Taylor bringt die letzte Lebensdekade mühselig zu: Sie verdingt sich als Hellseherin und Salbaderin, liest Niagara-Touristen die Zukunft und behandelt sie mit einer neuartigen Elektroreiztherapie. Zu Beginn des Jahres 1921 – sie ist zweiundachtzig – ist sie so krank, schwach und mittellos, dass sie sich ins Armenhaus von Lockport/New York, fünfunddreißig Kilometer östlich der Niagarafälle, begeben muss. Dort stirbt sie wenig später, am 29. April 1921. Immerhin werden nach ihrem Tod ein paar Lokalreporter nochmals auf die sonderbare Lebensgeschichte der alten Frau aufmerksam. Annie Taylors sterbliche Überreste werden auf dem Friedhof von Niagara Falls bestattet, in dem Teil, der den »Stunts«, den »Daredevils« der Wasserfälle vorbehalten ist.
Viel später, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, wird man auf Annie Taylor wieder aufmerksam: Die amerikanische Schriftstellerin Joan Murray widmete ihr 1999 ihr Erzählgedicht Queen of the Mist, die Autorin Emma Donoghue schrieb über sie eine Short Story, der Komponist Michael John LaChiusa entwickelte ein Musical über Annie Taylor, das 2011 in New York uraufgeführt wurde, und der Autor Chris van Allsburg verfasste über die erste Bezwingerin der Niagarafälle ein Kinderbuch. Heute erst ist Annie Taylor für viele Menschen das, was sie sein wollte: eine wagemutige, furchtlose Heldin.
Lina Bögli (1858–1941)
In zehn Jahren um die Welt
Es ist der Sonntagnachmittag des 2. Juli 1892. Lina Bögli, eine vierunddreißigjährige Schweizer Lehrerin und Erzieherin, die auf dem Landgut Kwiatonowice bei Krakau bei einer adligen polnischen Familie in Diensten steht, hat sich nach dem Mittagessen etwas hingelegt, um von den Anstrengungen der Arbeitswoche auszuruhen. Sie sinniert über die unterschiedlichen gesellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten von Männern und Frauen. Männern steht die Welt offen, im übertragenen wie im wortwörtlichen Sinne. Lina Böglis Leben als Gouvernante ist eng und abgezirkelt, von moralischen Konventionen und finanziellen Engpässen geprägt. Vor Kurzem hat der zweiunddreißigjährige polnische Offizier Juliusz Bijak um ihre Hand angehalten. Doch das strenge Offiziersreglement fordert vor einer Vermählung eine Kaution von 50 000 Kronen, eine Summe, die die beiden Liebenden nicht aufbringen können. So haben sie den schweren Entschluss gefasst, sich zu trennen. Doch das Herz gehorcht nicht der Stimme der Vernunft. Immer wieder begegnen sich die Schweizer Gouvernante und der Offizier. Und immer wieder reißt die kaum vernarbte Wunde auf.
Lina Böglis Gedanken kreisen um die Freiheit: Ein hoher Begriff – und nicht zum ersten Mal geht ihr die fixe Idee durch den Kopf: »Was ich wohl tun würde, wenn ich ein Mann wäre? Gewiß große Reisen machen, um die Welt und die Menschen kennenzulernen.« Da durchfährt es sie wie ein Blitz: Weshalb nicht wie ein Mann eine Weltreise unternehmen? Was hindert sie? Sie hat weder Ehemann noch Kinder, der Vater lebt in der fernen Schweiz, die Mutter ist bereits vor etlichen Jahren gestorben. Ihre Stellung bei der polnischen Adelsfamilie ist, wie die aller Gouvernanten, ohnehin auf nur wenige Jahre beschränkt. Sie ist also frei – frei von Konventionen, von familiären Zwängen, von beruflichen Verpflichtungen. Die Geldfrage freilich meldet sich kurz zu Wort und wird von Lina Bögli recht nonchalant beiseitegeschoben: »Aber was? Mit der Kraft und der Freiheit eines Mannes könnte ich dann die Welt auch ohne Geld bereisen; Tausende von deutschen Wanderburschen haben es getan, und ich habe von Engländern gelesen, die zum Spaß – denn sie waren reich – ohne Geld eine Weltreise unternommen haben, sich auf den Schiffen als Kellner und auf dem Land als Packträger oder so etwas durchzubringen gedachten.« Fieberhaft denkt Lina Bögli nach: Sie hat in all den Jahren rund eintausendvierhundert Schweizer Franken angespart, eine beachtliche Summe. Damit käme sie, wollte sie eine Weltreise unternehmen, per Schiff bis nach Australien – das hat sie einmal im Schaufenster eines Reisebüros gelesen. Und weiter? »[…] auf dem Land könnte ich gewiß überall, wo Menschen wohnen, mein Brot verdienen. Ginge es nicht als Lehrerin, so könnte ich ja Hausdienst verrichten.« Von Unruhe getrieben, springt sie auf. An eine Mittagsruhe ist nicht mehr zu denken. Sie eilt zu ihrem kleinen Schreibsekretär, greift zu Papier und Feder und verfasst einen Brief nach London, an die »Peninsular- und Oriental-Schiffsgesellschaft«, in dem sie genaue Informationen für eine Seereise nach Australien anfordert.
Bereits nach wenigen Tagen erhält Lina Bögli Antwort: Ein Ticket ist für sie in der Triester Niederlassung der Schiffsgesellschaft hinterlegt, ebenso wird ihr ein recht naher Abfahrtstermin vorgeschlagen. Nun ist die Schweizerin doch von der eigenen Courage etwas eingeschüchtert. Sie war auch so voreilig, ein paar Krakauer Freunden von ihren Globetrotterplänen zu erzählen. Die raten der Schweizerin vehement ab: Zu gefährlich sei die Reise, es sei ein Trip ins Ungewisse. Was, wenn sie unterwegs erkrankte? Wenn das Geld ausginge? Wenn sie überfallen oder gar getötet würde? Doch von solchen Unkenrufen lässt sich Lina Bögli nicht beeinflussen. Natürlich wird ihr unterwegs das Geld ausgehen, es wird gerade einmal bis Sydney reichen – aber dessen ist sie sich ja bewusst. Natürlich wird sie irgendwann seekrank werden oder sich eine Tropenmalaise »einfangen« – aber dagegen hat sie in ihrem Gepäck Chinin und andere Arzneien. Und natürlich ist es ein Trip ins Ungewisse – aber gerade deshalb unternimmt sie ja die weite Fahrt! Denn das fade Gesicht der Sicherheit blickt sie in Krakau jeden Tag an. Am 12. Juli, nur zehn Tage nach ihrem jähen Entschluss, schreibt die angehende Globetrotterin aus der Schweiz, die noch nie in ihrem Leben das offene Meer gesehen hat, triumphierend in ihr Tagebuch: »Mein Koffer ist gepackt, und ich selbst bin reisefertig. Heute abend verlasse ich mit dem Wiener Schnellzug das liebe alte Krakau […].« Krakau, die stolze polnische Königsstadt, gehört seit den polnischen Teilungen zur Habsburgermonarchie. Und der Weg in die weite Welt führt nicht über die Städte der Ostsee, sondern über Triest, Österreichs einzigen Überseehafen, durch die Adria und das Mittelmeer und weiter über den Suezkanal in die Gestade Afrikas, Asiens und Australiens. An jenem 12. Juli 1892 legt Lina Bögli ein seltsames Gelübde ab: »Heute nach zehn Jahren werde ich, wenn es menschenmöglich ist, wieder am Krakauer Bahnhof, dem Ausgangspunkt meiner Weltreise, ankommen. Der 12. Juli 1902 wird das Ziel sein, nach dem ich in den nächsten zehn Jahren unaufhörlich streben werde.« Sie wird das sich selbst gegebene Wort halten – auf den Tag genau.
Irrungen und ein Ausweg
Lina Bögli, die spätere selbstbewusste Globetrotterin, wird in eine enge Welt hineingeboren: Sie kommt am 15. April 1858 im schweizerischen Oschwand (Kanton Bern) als jüngstes Kind eines verarmten Kleinbauern und dessen zweiter Ehefrau zur Welt. Linas Mutter stirbt früh, das zwölfjährige Mädchen wird zu einer Familie im Jura geschickt, wo es als Magd und Kindermädchen dienen muss. An einen weiteren Besuch der Schule ist für Lina nicht zu denken. »Ich erhielt mehr Schläge als Unterricht«, gesteht sie später. So bleibt ihr Wunsch, Lehrerin zu werden, ein bittersüßer Traum, selbst die Lektüre von Büchern bleibt ihr aus Zeitmangel verwehrt. Sie wechselt mehrfach die Dienststelle, arbeitet auf einem Bauernhof, findet dann bei einer Schweizer Familie in Neapel Unterkommen. Drei Jahre bleibt sie in dem großbürgerlichen Haushalt, wird gut und anständig behandelt, darf die große Hausbibliothek benutzen. Dann findet sie eine Anstellung als Erzieherin bei der gräflichen Familie Sczaniecki in der Nähe von Krakau, im österreichischen Galizien. Auch hier begegnet man Lina Bögli mit Anstand und Achtung. Der Graf führt ein reges gesellschaftliches und kulturelles Leben, an dem die Schweizerin teilhaben darf. In all jenen Jahren legt Lina Bögli von ihrem bescheidenen Lohn Geld beiseite, mit einem hohen Ziel: Sie will eine weiterführende Schule besuchen. Endlich, im Jahre 1886, sie ist bereits achtundzwanzig Jahre alt, kann sie in die École supérieure in Neuchâtel in der Schweiz eintreten. Die Gebühr für die zweijährige Ausbildung beträgt zwölfhundert Franken (ungefähr so viel, wie sechs Jahre später die Überfahrt nach Australien kosten wird). Lina Bögli ist in dem Institut die mit Abstand älteste Schülerin – aber sie ist, vor dem Hintergrund ihrer nicht immer schönen Lebenserfahrungen, besonders zielstrebig und ehrgeizig. 1888 schließt sie mit dem Diplom ab, das zum Unterrichten an privaten (jedoch nicht staatlichen) Schulen berechtigt. Für ein halbes Jahr geht sie nach England, um am »Ladies College« der Universität Oxford zu unterrichten und ihre eigenen Englischkenntnisse zu perfektionieren.
Dann kehrt Lina Bögli zur Familie Sczaniecki zurück. Sie besitzt nun das Lehrerinnendiplom und beherrscht zwei Fremdsprachen, das Französische und das Englische, nahezu perfekt. Krakau ist ihr eine zweite Heimat geworden. Doch die unglückliche Liebe zu Juliusz Bijak lähmt ihre Lebenskraft. Sie sieht nur noch einen Ausweg: Sie will ausbrechen, noch einmal etwas Neues kennenlernen, ihrem Leben eine entscheidende Wendung geben. An jenem 2. Juli 1892 beschließt sie urplötzlich eine Fahrt nach Australien und weiter um den ganzen Globus. Zehn Jahre soll das Abenteuer währen, keinen Tag länger, aber auch keinen kürzer. Das hat sie sich selbst als Gebot erlassen. Das Heimweh soll bei diesem Unternehmen von vornherein keine reelle Chance haben: Denn Lina Böglis Erspartes reicht gerade einmal für die Überfahrt nach Sydney. Dort heißt es: eine Anstellung finden und sich nach und nach weiter durchschlagen. Geld für ein Rückfahrticket jedenfalls ist keines da, das passt genau ins Kalkül der Schweizerin.
In jenen zehn Reisejahren »rundherum« macht Lina Bögli eifrig Notizen. Später, nach ihrer Rückkehr, bearbeitet sie die Tagebucheinträge und bringt sie als Buch heraus: Forward erscheint 1904 zuerst in englischer Sprache in Großbritannien und den USA, zwei Jahre später in einer von der Autorin übersetzten deutschen Version (Vorwärts) in einem Verlag in der Schweiz. 1907 schließlich folgt eine französische Übersetzung, 1908 eine polnische. Das Buch wird ein Verkaufserfolg. Anders als in ihren auf der Reise gemachten Tagebuchnotizen (sie wurden erst in den 1990er-Jahren in Privatbesitz wiederentdeckt, blieben aber bis heute unveröffentlicht), wendet Lina Bögli im gedruckten Buch einen literarischen Kunstgriff an, der eine emotionale Nähe zur Leserschaft herstellt: Es sind (fiktive) Briefe an eine Freundin – vor allem Leserinnen fühlten sich dadurch von der Autorin direkt angesprochen.
Meeresstille und glückliche Fahrt
Von solch einem großen Erfolg als Reiseautorin kann Lina Bögli an jenem 12. Juli 1892 natürlich nichts ahnen. Sie sitzt auf gepacktem Koffer und steht vor dem großen Unbekannten: Einer Reise um die Welt, fast ohne Geld, ohne Empfehlungen, ohne Begleitschutz, ohne konkrete Reiseroute. An jenem Abend, es ist ein Dienstag, fährt sie mit einer Mietdroschke zum Krakauer Bahnhof und besteigt den Nachtzug, der sie über Prag nach Wien bringt. Dort steigt sie in den Zug nach Triest um. Sie muss sich beeilen, denn bereits am Sonntag, dem 17. Juli, wird der Dampfer »Ballarat«, für den sie ein Schiffsticket erworben hat, in Brindisi in Süditalien ablegen. Eintausend Franken hat sie für die Schiffspassage nach Australien berappen müssen, den Rest von vierhundert Franken gedenkt sie für weitere Fahrkarten (Eisenbahn und die Schiffspassage von Triest nach Brindisi), für Ausrüstung und Essen und Trinken auszugeben. In Australien angekommen, so rechnet sie sich aus, wird sie nur noch wenige Franken haben, um ein paarmal bescheiden übernachten zu können. Dann wird sie darauf angewiesen sein, eine Stelle zu finden – oder in der Gosse landen.
Am 14. Juli ist sie in Triest, tags darauf soll der Dampfer nach Brindisi ablegen. Hilflos streicht Lina Bögli durch die Hafenstadt, die ihr vertraut und fremd zugleich vorkommt: Österreichische Architektur und Kultur vermengen sich mit italienischer Atmosphäre und Lebensart. Noch nie in ihrem Leben war sie ohne Empfehlung oder Buchung in einer fremden Stadt. Ratlos betrachtet sie am Bahnhof die Kofferträger der diversen Hotels, die auf Gäste warten. Schließlich fasst sie sich ein Herz und spricht einen Dienstmann an, auf dessen Schirmmütze die Inschrift »Hotel zum guten Hirten« prangt. Das erscheint ihr vertrauenswürdig, und der Lakai führt sie auch unbeschadet zum nahen Hotel, das sich freilich als rechte Absteige entpuppt. Doch für eine einzige Nacht mag es hinreichen, denkt sich die Schweizerin, wenngleich ihre Courage in den vergangenen zwei Tagen schon gehörig zusammengeschmolzen ist. Vor allem, als sie zum Hafen geht, um nach dem anderntags abgehenden Dampfer zu sehen, wird ihr recht blümerant angesichts des weiten Meers »mit seinem Wald von Masten«. Im Büro der Schiffsgesellschaft Lloyd ist sie sogar kurz davor, das Unternehmen abzubrechen und stattdessen besiegt, aber immerhin heil, in die Schweiz zurückzukehren: »Also zurück zu den stillen, friedlichen Tälern meiner Heimat!« Eben will sie zur Tür hinaus, als sie das Wort »Vorwärts« zu hören glaubt: »Wie ein elektrischer Strom durchrieselte es plötzlich meine Glieder.« Sie blickt auf und sieht den Angestellten des Lloyd, der nach dem anderntags nach Brindisi auslaufenden Dampfer geschaut hat. Ihn hört sie sagen: »Gnädiges Fräulein, der Dampfer, mit dem Sie morgen fahren, heißt ›Vorwärts‹.« Lina Bögli gibt sich einen Ruck: Sie nimmt das als ein gutes Omen und entscheidet sich augenblicklich, doch zu fahren: »Vorwärts soll von nun an mein Losungswort sein!« Und Vorwärts wird zwölf Jahre später auch der Titel ihrer Reiseerinnerungen lauten.
So fasst sie sich also ein Herz und besteigt den Dampfer »Vorwärts«, der am 15. Juli den Hafen von Triest verlässt und durch die Adria südwärts fährt. Lina Bögli hat das Meer nur einmal, auf der kurzen Überfahrt über den Ärmelkanal, gesehen. Doch nie zuvor war ihr die Weite so schön und verheißungsvoll erschienen, zumal die südliche Sonne alles in ihr gleißendes Licht taucht. Kurz vor Brindisi wird sie vom Kapitän darauf aufmerksam gemacht, dass das Schiff den Hafen nicht anläuft, da sie die einzige Passagierin sei, die dort umzusteigen gedenke, und man ihretwegen keine wertvolle Zeit verlieren wolle. »Der ›Vorwärts‹«, so schreibt sie fassungslos, »hielt wirklich ganz draußen auf offener See an.« Anders als der etwas ruppige Kapitän ihr zu vermitteln trachtete, wird sie aber nicht an einem Seil die hohe Schiffswand hinabgelassen, um von einem von der »Ballarat« entsandten Kahn aufgenommen zu werden. Vielmehr legt man eine hohe, wackelige Leiter an, über die sie hinabsteigen muss, und über die man auch ihren Koffer hinunterbugsiert. Glücklich von den Matrosen des Ruderkahns eingeholt, geht es ein Stück weit auf offener See zu der ebenfalls weit draußen ankernden »Ballarat«. Hier wiederholt sich das Spiel zum Ergötzen der Passagiere und zum Entsetzen Lina Böglis: »Dutzende von Fern- und Operngläsern waren auf uns gerichtet, und als es an das Hinaufklettern kam, lehnte alles, was nur einen Platz finden konnte, über die Brüstung hinaus, um das erhabene Schauspiel zu genießen.« Nachdem diese Anfangsschwierigkeiten buchstäblich »überwunden« sind, erweist sich die Fahrt auf dem großen Passagierschiff, das für Überseefahrten konzipiert ist, als erstaunlich angenehm und kurzweilig. Das Publikum freilich könnte nach Lina Böglis Geschmack etwas bunter gemischt sein: »Unsere Gesellschaft besteht meistens aus englischen Offizieren, Ingenieuren, Ärzten und anderen Beamten, die sich auf ihre Posten nach Indien begeben. Wir sind nur wenige Frauen an Bord, einige indische Offiziers- oder Beamtenfrauen und ein halbes Dutzend Bräute, die nach Australien fahren, um ihre dort ansässigen Bräutigame zu heiraten.«
Durch den Suezkanal gelangen sie ins Rote Meer. Die Hitze wird schier unerträglich. Mit Schaudern betrachtet Lina Bögli etliche Männer, die der Glut mit dem Genuss von viel Whiskey entgegenzutreten versuchen. Sie selbst trinkt nur lauwarmes Wasser und »fährt« damit gut, selbst von der Seekrankheit bleibt sie verschont – zunächst jedenfalls. Sie erreichen Aden im Jemen, damals nur eine Ansammlung ärmlicher Hütten, von Sonne und Wind gebleicht, von Wüste umgeben: »Einen traurigeren und unschöneren Ort habe ich nicht nur nie gesehen, sondern ich hätte gar nicht gedacht, daß er irgendwo, außer in Dantes Hölle, existieren könnte.« Sie betritt Dantes Hölle erst gar nicht, belustigt sich aber an den jemenitischen Knaben, die gewandt nach Münzen tauchen, die von den Reisenden zum Spaß ins Hafenbecken geworfen wurden. Erscheinen sie nach einigen Sekunden, das Geldstück zwischen den Zähnen, wieder an der Wasseroberfläche, so werden sie von den Europäern beklatscht und dürfen die Münze als Lohn behalten. »Diese Tauchervorstellungen müssen ganz lukrativ sein«, rechnet die Schweizerin aus, »wenn man bedenkt, wie viele Schiffe da wöchentlich auf ihrem Weg von und nach Australien, Indien, China und Japan vorbeifahren […].«
Die schöne Spazierfahrt auf der »Ballarat« ist vorbei, als das Schiff das sturmgepeitschte Arabische Meer kreuzt, ein »Spielball in den Händen des übelgelaunten Neptun. Das Schiff krachte ständig in allen Fugen, und was mich betrifft, so war ich jeden Augenblick – ich sage nicht in Todesangst, aber – auf den Tod gefaßt.« Sie ankern vor Colombo, der Hauptstadt Ceylons, wie die Insel unter britischer Herrschaft heißt. Lina Bögli macht ein paar Ausflüge an Land, ist aber nicht sonderlich glücklich darüber, wieder festen Boden unter den seekranken Füßen zu haben: »[…] zu viel Hitze, zu viele Schlangen und zu viele Bettler.« Die Schweizerin, bislang in behüteten Verhältnissen lebend, ist angesichts der bitteren Armut entsetzt: »Wir wurden buchstäblich von Bettlern umschwärmt; nicht nur haben sie uns angebettelt, sondern sie haben uns an den Kleidern gefaßt, uns die Broschen und Uhrketten abnehmen wollen. Ja, sogar Steine haben sie nachgeworfen, wenn wir nichts geben wollten oder nichts mehr zu geben hatten.« Geht Lina Bögli auf den Markt, um Obst zu kaufen, so reißt man ihr das Münzgeld buchstäblich aus den Händen. Und auch von den angeblich so schmackhaften Südfrüchten ist sie im Land ihres Anbaus enttäuscht: »Von all den schönen, saftigen Früchten war keine genießbar für meinen uneingeweihten Gaumen außer der Ananas. […] Mögen die Früchte hier auch noch so schön und goldig aussehen, ich würde doch immer einem saftigen europäischen Apfel den Vorzug geben.« Missgelaunt besteigt sie also wieder das Schiff, und endlich geht es weiter, die letzte Etappe auf der weiten Fahrt nach Australien, der britischen Kolonie, die einst als großes Sträflingslager angelegt worden war.
Schöne neue Welt
Ende der Leseprobe