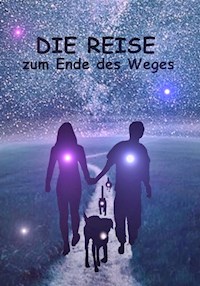
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alles wird gut...Ich sehe meinen Begleiter verzweifelt an und warte darauf, dass er die richtige Entscheidung trifft, während die erste Träne schon wieder in Richtung meiner Augen unterwegs ist. Wir sollen das Land in 32 Stunden durchqueren?..........All die Situationen, mit denen ich täglich konfrontiert werde, machen aus mir einen anderen Menschen, der ich nie sein wollte. Diese Reise bringt mich an meine Grenzen und mir wird immer mehr bewusst, dass es nicht nur materielle Grenzen gibt, die uns limitieren - in einer Welt wie dieser - frei zu reisen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Reise zum Ende des Weges
Unerwünscht im ParadiesSchicksalsfügungenAndere WeltenGrenzenZuhause auf RädernUnter der schwarzen WolkeKampfbereitRettungsversucheZusammenhaltDas Ende des WegesUnerwünscht im Paradies
Nach drei weiteren Stunden Fußweg und Hunderten von verzweifelten Versuchen, die vorbeifahrenden Autos anzuhalten, um mitgenommen zu werden, kommt ein immer langsam werdender Kleinbus endlich vor uns zum Stillstand.
Wir zweifeln kurz, weil wir die Hoffnung schon aufgegeben hatten und kaum glauben können, dass der Wagen wegen uns angehalten haben soll. Yoalli denkt gar nicht weiter nach und läuft schon wie verrückt darauf zu. Gerade eben hatte er doch noch nicht mal die Energie, um im langsamen Schritttempo neben uns herzulaufen.
Die beiden Jugendlichen, die mit zwei Hunden reisen, amüsieren sich, wie so viele andere vor ihnen auch schon, über Yoallis Meistersprung in den Wagen.
Der Mexikaner und die Engländerin nehmen uns bis nach Tonalá mit. Eine Strecke, die im Fahrzeug 20 - 30 Minuten dauert und zu Fuß bei dieser Hitze viel zu lange, um noch weiter darüber nachzudenken.
In Puerto Arista erfuhren wir von einem Fest, das morgen in Tonalá stattfindet und haben daher beschlossen, die nächsten beiden Tage dort zu bleiben. Wir hoffen, dieses Mal mit dem Verkauf unserer Kunsthandwerke wieder mehr Glück zu haben. Dank der letzten Woche, die wir am Strand gearbeitet haben, können wir alle eine Zeit lang ohne zu Hungern auskommen und es wäre daher auch nicht schlimm, wenn wir auf dem Fest nicht viel verkaufen würden.
Wir übernachten mitten am Zocalo unter freiem Himmel, wo auch einige andere Leute mit Rucksäcken und Kisten schlafen, die wohl wie wir, von Weitem gekommen sind, um morgen ihr Glück auf dem Fest zu versuchen. Immer wieder weckt mich der Lärm auf der Straße, während Omar wie immer, tief und fest schläft. Nicht mal, als ein schreiender Betrunkener vorbeigeht und über eine Aluminiumdose stolpert, stört das seinen Schlaf.
Yoalli und ich zucken zusammen, daraufhin bellt er, was alle anderen, bis auf Omar, aufweckt. Ich beruhige den Hund. Der Arme muss bereits völlig verstört sein von den ganzen Erlebnissen der letzten Monate.
Am nächsten Morgen werden bereits die Stände aufgebaut. Wir fragen in der Polizeistation, ob wir unsere Rucksäcke dort lassen können, denn wir wollen aus der Stadt raus und zum Fluss, um uns zu baden. Der Weg von Puerto Arista nach Tonalá war beschwerlich und wir hatten Glück, dass uns das Reisepärchen von gestern, welches Richtung Norden unterwegs ist, doch noch auf halber Strecke aufgesammelt hat.
Wir lernen andere reisende Kunsthandwerker kennen, als wir am späten Nachmittag auf dem Fest unser Tuch am Boden- und die Produkte darauf ausbreiten. Unter ihnen befindet sich David, der jünger ist als ich und mir beibringt, aus einer einfachen Aluminiumdose ein Kunstwerk zu basteln. Er schafft es tatsächlich - nur mit einer kleinen Schere als Hilfsmittel - aus einer Getränkedose in nur fünf Minuten eine wunderschöne Blume zu formen, die er dann für 10 Pesos verkauft.
Kurz vor Mitternacht besucht uns David mit einem selbstgemachten Grashüpfer aus einem Blatt einer Kokospalme geflochten. Ich bestaune das Kunstwerk und kann es noch weniger glauben, als den Trick mit der Aluminiumdose. Mein Herz schlägt höher und ich bitte ihn, mir auch dieses Kunsthandwerk beizubringen, nachdem ich bereits von ihm gelernt habe, wie man eine Sonnenblume und einen Tannenbaum aus einer Aludose herstellt. David meint aber, dass er den Grashüpfer selbst gerade erst von einem Mann aus Honduras, der vor der Kirche sitzen soll, beigebracht bekam.
Ohne zu zögern, folge ich ihm durch die Marktstände hindurch bis zur Kirche. Dort hinten in einer Ecke, im dezenten Licht der Straßenlaternen, sitzt ein Mann mittleren Alters mit einem ganz kleinen Rucksack. Neben ihm liegen einige Palmenblätter und vor ihm stehen fünf
Grashüpfer. Irgendwie sieht er ein bisschen so aus, als hätte er sich schon tagelang nicht mehr gewaschen, aber vielleicht ist es auch einfach nur seine Hautfarbe.
Der dünne Honduraner, der sich mit dem Namen »Mario« vorstellt ist gerührt von meiner Begeisterung und meint, dass er es selbst von einem Reisenden gelernt hat und dass er diesem schon versprechen musste, es nicht jedem beizubringen, sondern nur denjenigen, die so reisen wie wir und sich in harten Zeiten mit dem daraus gewonnenen Kleingeld durchschlagen können.
»Setz dich doch zu uns und nimm dir ein Blatt. Ich bringe es gerade David bei! Da geht es in einem«, schlägt Mario vor. Dankbar und ohne zu zögern setze ich mich neben ihn auf den Boden und nehme, so wie er jetzt, ein längliches Palmenblatt in die Hand.
Alles was ich brauche, um daraus einen Grashüpfer herzustellen, sind eine Schere und einen halben Aluminiumdeckel, der als Messer dient. David hat Mario wohl schon von Omar und mir erzählt, weil ich die Ehre habe, dieses ganz besondere Kunsthandwerk von ihm zu erlernen und dabei auch versprechen muss, es nicht jedem Dahergelaufenen beizubringen, denn wenn es jeder kann, ist es für niemanden mehr etwas Besonderes und verliert so seinen Wert.
Ich bin begeistert und strahle zusammen mit David und Mario bis über beide Ohren. Die beiden sind von Natur aus, eher fröhliche Wesen, die sich bestimmt so wie Omar für alles begeistern können, aber bei mir ist es schon so selten geworden, dass mich noch irgendetwas auf diesem Planeten faszinieren kann, dass diese Grashüpfer wie ein Wunder sind. Diese kleinen, schönen Tierchen bestehen, bis auf die Flügel, nur aus einem einzigen dieser langen Kokospalmenblätter.
Es zu lernen, ist gar nicht so einfach, weil man mit dem Blatt Schlaufen um das eigene Blatt machen muss, ich es immer in die falsche Richtung drehe und es einfach nicht kapiere, als wäre ich total bescheuert. Auch David fällt es nicht leicht, obwohl er schon viel länger übt, als ich.
Mario amüsiert sich prächtig, uns zuzuschauen. Seinen Erzählungen nach, hatte er anfangs genau dasselbe Problem, wie wir gerade.
Erst nach einer weiteren Stunde, als wir es endlich kapieren und immer mehr machen, kommt es uns plötzlich ganz einfach vor.
Damit werden Omar und ich die Menschen auf unseren Reisen begeistern! Sie werden wieder an Wunder glauben, so wie ich, als ich dieses Kunstwerk zum ersten Mal sah.
Wir konnten einiges verkaufen, übernachten noch einmal am Zocalo und verlassen am nächsten Morgen die Stadt. Der Stress ist für Yoalli kaum noch zumutbar. Er leidet unter der Hitze und den langen Wanderungen und verhält sich aggressiv gegenüber anderen Hunden und sogar gegenüber den Leuten.
»Auf dem Weg liegt die Stadt Esquintla. Dort lebt die Mutter eines Freundes von mir. Wir könnten sie fragen, ob sie Yoalli zu sich nimmt«, schlägt Omar vor.
»Ja«, stimme ich schweren Herzens zu. »Es ist das Beste so«. Vielleicht hätten wir ihn schon bei Hugo und seiner Familie in Puerto Barrio lassen sollen. Es war egoistisch von mir, ihm diesen Wunsch nicht zu gewähren, weil ich ihn einfach zu sehr vermisst hätte.
Einige Tage später erreichen wir die Stadt und die Frau stimmt zu, Yoalli zu adoptieren, da sie alleine wohnt und einen Beschützer an ihrer Seite gut gebrauchen könnte, allerdings muss der Hund draußen im Hof bleiben, welcher nur vier Quadratmeter groß ist. Da sie den ganzen Tag arbeitet und erst abends wiederkommt, wäre Yoalli wohl eher ein Gefangener, als ein Familienmitglied und ich bin mir fast sicher, dass sie ihm in keinster Weise Aufmerksamkeit schenkt, wenn sie wieder zuhause ist.
Wir entscheiden am Tag darauf, den Hund nicht hier zu lassen, sondern ihn zurück nach Mexiko-Stadt zu bringen. Unter der schwarzen Wolke - wie Omar die Stadt nennt - muss er zwar auf reine, frische Luft verzichten, kann aber dafür ein ruhiges Leben ohne Stress führen. Dank unserem Aufenthalt in PuertoArista konnten wir mittlerweile genug sparen, um das Busticket für Omar zu bezahlen. Der Hund muss sowieso unten wie ein Gepäcksstück mitfahren.
Ich begleite die beiden zum Bus, dort gibt es aber Probleme, weil wir nur eine Schachtel für Yoalli besorgt haben und er dadurch andere Gepäcksstücke beschädigen könnte, obwohl uns der Ticketverkäufer, der jetzt nicht mehr anwesend ist, versicherte, dass es kein Problem wäre. Omar schafft es glaubwürdig, den Fahrer zu beeindrucken, indem er ihm erzählt, dass der Labrador ein ausgebildeter und trainierter Suchhund ist, der es gewohnt ist, auf Reisen still und ruhig zu verweilen.
Ich glaube, ich habe Omar bestimmt drei Mal gefragt, ob er auch wirklich zu mir zurückkommt. Es passierte einfach schon zu oft, dass ich am Ende doch wieder alleine war.
Am darauffolgenden Tag habe ich keinen Appetit. Omars Bus müsste, nachdem er die Nacht durchgefahren ist, schon in Mexiko-Stadt sein. Mit dem nächsten Nachtbus müsste er dann morgen Mittag wieder hier ankommen. Ich fühle mich nicht mehr wohl und habe das Gefühl, dass wir uns schon zu lange hier bei dieser Frau eingenistet haben.
Aus Langeweile sortiere ich ein paar Sachen aus meinem Rucksack, um das Gewicht zu reduzieren. Möglicherweise sehe ich diese Sachen nie wieder, aber mir vorzustellen, dass ich sie jederzeit wieder abholen kann, macht es leichter, obwohl ich diese Dinge sowieso nicht brauche, um zu überleben. Es sind nur ein paar Kleidungsstücke und Ayoyotes - Fußrasseln, die mir ein Tänzer geschenkt hat und die ich mit dabeihabe, für den Fall, dass wir uns in einen aztekischen Tanz integrieren wollen. Ayoyotes bestehen aus Samen eines Baumes, die wie eine Schale ausgenommen werden und in jede Schale wird eine an einem Faden hängende Glasperle, die bei jeder Bewegung auf die Schale hämmert, eingeknüpft. Omar hat mir bereits beigebracht, wie man diese Dinger herstellt.
Ich brauche ewig, um endlich einzuschlafen. Immer wieder male ich mir aus, was ich machen soll, falls er nicht zurückkommt und ertrage mich selbst kaum, weil ich nicht einfach vertrauen kann. Wir haben zu viel zusammen durchgemacht, um jetzt einfach aufzugeben. Aber ist diese Reise ins Ungewisse, welche auch mit so Leid verbunden ist, wirklich das, was er möchte, oder möchte er einfach nur mit mir zusammen sein, egal wo, wann und in welcher Situation? In guten und in schweren Zeiten. Er hat bestimmt schon Schlimmeres in seinem Leben durchgemacht, als diese Reise...
»Amor! Ich bin schon da!« weckt mich seine flüsternde Stimme, während ich seinen Atem an meinem Ohr spüre. Ich lächle, bevor ich überhaupt begreife, was los ist, als wäre es ganz selbstverständlich neben Omar aufzuwachen.
»Wie geht es Yoalli?«, möchte ich wissen, nachdem ich ihm überglücklich in die Arme falle.
»Dem geht’s gut. Als wir in der ersten Straße waren, die er kannte, ist er sofort schwanzwedelnd und überglücklich vor unser Haus gelaufen. Ich habe meine Familie gebeten, ihn öfters raus zu lassen, so dass er herumstreunen kann. Du weißt ja, dass sich sonst niemand die Zeit nimmt, mit ihm raus zu gehen und dieser Hund ist wie wir, ein Streuner, der das herumstreunen liebt. Es würde mir das Herz brechen, wenn er nur in dem kleinen Hof eingesperrt bleibt und überhaupt nie rauskommt, aber das ist sicher kein Problem, da er sich auf der Straße zu bewegen weiß und jeder Nachbar ihn kennt und liebt.«
»Das ist gut« stöhne ich erleichtert. »Lass uns bitte weiterziehen. Die Señora wartet schon sehnsüchtig darauf.«
Wir kommen der Grenze nach Guatemala immer näher. Da wir noch etwas Zeit haben, bis mein Touristenvisum abläuft und ich das Land verlassen muss, entscheiden wir, einen Abstecher nach Lagos de Colón zu machen.
Carlos hat uns von diesem abgeschiedenen Dorf, das zwischen vielen kleinen Sees gebaut wurde, erzählt. Ihm zufolge, lebt dort ein Freund von ihm, der uns jederzeit auf seinem Grundstück campen lassen würde.
Der Fahrer des Geländewagens, der uns bis dorthin mitnimmt, lässt uns noch vor dem Dorf aussteigen und erklärt, dass wir als Touristen wahrscheinlich bezahlen müssen, um hineinzukommen.
Er zeigt uns einen kurzen Weg durch ein Wäldchen links von der Straße, der uns von hinten in das Dorf hineinführt. Dankbar steigen wir aus und machen uns auf den Weg. Wir durchqueren das kleine Dörfchen bis wir zu einem See kommen, der sich in mehrere kleine Bäche aufteilt. Die Farbe des Wassers ist aufgrund der Steine am Grund türkis-blau. Es ist schon ewig her, dass ich so reines Wasser gesehen habe. Wir wissen nicht, wie wir den Freund von Carlos finden sollen, da wir weder Adresse, noch Namen haben, setzen uns auf eine Holzbank unter einem Dach vor dem See und überlegen, was wir jetzt machen.
»Ihr müsst bezahlen, wenn ihr hier sitzen bleibt«, ruft ein Mann, der plötzlich hinter uns steht. Omar lacht und schüttelt den Kopf, als würde er sagen »Das ist jetzt nicht dein ernst.«
»Wir bleiben aber nicht hier sitzen«, würgt er so freundlich, wie möglich heraus und der lästige Mann verschwindet.
»Die sehen nur die Rucksäcke und denken, wir hätten Kohle«, stellt Omar genervt fest. »Dabei haben wir die Rucksäcke doch, weil wir sonst nichts haben.«
»Es ist wegen mir«, entgegne ich enttäuscht. »Wegen meiner Hautfarbe und den Rucksäcken.«
Auf einer Wiese links von uns beobachten wir einen Mann, der dort irgendetwas arbeitet. Da wir nicht wissen, was wir jetzt tun soll, beschieße ich, einfach ihn zu fragen, ob er jemanden kennt, der öfters von einem Gringo – wie die Mexikaner die US-Amerikaner nennen - namens Carlos besucht wird.
»Ja! Der ist immer bei mir!«, antwortet der Mann freundlich, während ein Strahlen sein ganzes Gesicht erhellt.
Er ist der Freund, von dem Carlos gesprochen hat. Halleluja!
Wir dürfen unser Zelt auf seinem großen, nicht- eingezäunten Grundstück neben dem See aufbauen.
Trini heißt der Mann, der sich so sehr über unseren Besuch freut, dass er uns am Nachmittag sogar ein bisschen herumführt.
Er zeigt uns sein Maisfeld und möchte, dass wir uns jederzeit, wenn wir hungrig sind, bedienen. Trini erzählt, dass es am Ende des Dorfes ein paar Wasserfälle gibt und dass, wenn wir dem Bretterweg, der uns über den im Wasser stehenden Wald führt folgen, wir irgendwann zum unbeaufsichtigten Grenzübergang nach Guatemala kommen würden.
Voller Freude, den Touristenführer spielen zu dürfen, pflückt uns Trini gleich ein paar Maiskolben fürs Abendessen.
»Die können wir dann zusammen grillen!«, freut er sich und fügt noch hinzu: »In drei Tagen findet ein Fest hier im Dorf statt und ihr könntet versuchen, eure Kunsthandwerke zu verkaufen. Jetzt gehe ich noch rüber zu meinem Bruder und wir spielen Marimba, da könnt ihr gerne mitkommen und zuschauen.«
Um nicht unhöflich zu sein und Trini die Freude zu machen, gehen wir mit, bekommen zwei Stühle im Hof und sehen zu, wie die beiden mit zwei weiteren Freunden auf der Marimba spielen. Wir kannten dieses Musikinstrument bis jetzt nicht, weshalb Omar begeistert zuhört und ich mich aus fehlendem Interesse schon wieder langweile. Ich würde viel lieber die Gegend erkunden, auch wenn es bereits dunkel ist. Oder vielleicht gerade deshalb.
Das Dorf ist noch viel schöner, wenn die Sonne untergegangen ist, da sich die wenigen Häuser, die Gräser und alles andere aufgrund der Straßenlaternen in den Gewässern spiegeln.
Trini verhält sich überfreundlich, grinst die ganze Zeit und weiß hoffentlich, dass er von uns nichts bekommt, auch wenn ich Europäerin bin.
»Carlos hat mir einmal in einer sehr schwierigen Notsituation geholfen und mir 8000 Pesos gegeben! Das war so großzügig und eine Tat, die ich nie vergessen werde. Seine Freunde sind auch meine!«, erfahren wir später von ihm.
Omar und ich sind froh über den Empfang, obwohl uns Trinis übergewichtige Frau misstrauisch von der Terrasse aus beobachtet. Für sie hat es wohl noch nicht Wert genug, dass Carlos ihnen so viel Geld gegeben hat und sie will keine Herumstreunenden, die ihr nichts dalassen. Gott sei Dank sind wir weit genug vom Haus entfernt, um ihr grimmiges Gesicht nicht ertragen zu müssen.
Am nächsten Morgen folgen wir einem erdigen Weg neben dem Bach, der immer wieder zu kleinen Seen wird. Dieses Dorf ist unglaublich, aber wenn die Regenzeit kommt und mit ihr die Überschwemmung, möchte ich nicht hier leben.
Wir kommen an einem Wasserfall vorbei, der aus demselben Wasser entsteht, das mitten unter uns, durch einen langen und für eine Person gedachten Weg aus Holzbrettern durch ein überflutetes Wäldchen rinnt.
Ich habe selten etwas so Schönes gesehen. Man muss vorsichtig voranschreiten, denn wenn man abrutscht, würde man einfach ins Wasser fallen und womöglich von der Strömung in Richtung Wasserfall mitgerissen werden. Mein Herz schlägt schneller bei dem Gedanken und in meinem Gesicht bildet sich ein verrücktes Lächeln. Was stimmt mit mir nicht? Warum begeistern mich eigentlich nur die Dinge und Situationen, die lebensgefährlich sein könnten?
Vielleicht, weil mir das Adrenalin mein ganzes Leben lang in meinem langweiligen, öden Land, in dem alles viel zu perfekt schien, immer fehlte. Es gab jemanden, der dieses Gefühl in mir auslösen konnte und es war so schön, dass ich jetzt wahrscheinlich immer danach suche, um es wieder zu fühlen.
Um zu fühlen, dass ich in mir drin noch am Leben bin.
Ein Gefühl, das man schnell vergisst, wenn man in der Routine und im Alltag eines sinnlosen, langweiligen Lebens untergeht, was bei unserer Reise aber eigentlich nie der Fall ist, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, weiterzugehen wäre sinnlos.
Am Ende des Steges gibt es wieder einen ganz normalen erdigen Weg, der hin und wieder leicht mit Wasser überschwemmt ist, weshalb wir ihn nur barfuß überqueren können. Er führt über mehrere Wiesen, über eine Kurve durch den Wald und vom Wald hinaus durch Maisfelder. Ein riesiger, wunderschöner Baum, dessen Äste in alle möglichen Richtungen davonstehen, sieht fast so aus, als würde er mit ausgestreckten Ästen zum Himmel beten. Ein kleiner Trampelpfad führt nun zu einem ganz niedrigen Zaun, der sich rechts über einen kleinen Hügel bis zum Horizont erstreckt und links in die Büsche hineinführt. Es ist nicht sonderlich schwer, einfach darüber zu steigen und weiterzugehen.
»Schau mal«, ruft Omar. »Auf dem kleinen Steinpfosten dort steht Guatemala.«
»Wow, wir sind gerade illegal über die Grenze gewandert!«, lache ich, während Omar auch schon seine Beine ausbreitet und ruft: »Schau, ich befinde mich in zwei Ländern gleichzeitig!«
Nach einigen weiteren Witzen über das illegale Überqueren der Länder, das ganz einfach scheint, spazieren wir in Guatemala auf dem Trampelpfad weiter durch eine Baumallee, da es aber schon bald dunkel wird, kehren wir um, bevor wir das nächste Dorf erreichen. Zwei Frauen, die etwas schleppen, überqueren auch einfach die Grenze neben uns. Für die Leute hier ist das sicher ganz normal. Omar, hilfsbereit wie immer, nimmt einer alten Frau einen schweren Krug ab und hilft ihr mit dem Tragen. Sie ist dankbar, aber trotzdem noch immer sehr langsam. Wir entscheiden, an einem dieser Tage früher aufzustehen, um ihn zu nutzen und das erste Dorf in Guatemala kennenzulernen.
»Ich krieg das nicht hin!« rufe ich meinem Freund, der im Wasser ist und sich selbst gerade Schwimmen beibringen möchte, ungeduldig zu. »Kannst du es bitte machen!«
»Ich kann dir sagen, wie du es machen musst, aber du machst es!«
»Na gut«, gebe ich widerwillig zurück, denn ich habe Hunger und möchte nicht mehr darauf warten, bis er das Feuer macht.
»Du musst erst mal kleine Äste sammeln. Dann grab eine kleine Mulde in der Erde und leg ein paar große Steine rundherum, damit der Wind nicht durchkann.«
Ich soll die Äste nicht einfach übereinander schmeißen, sondern sie strategisch im Viereck auflegen, so dass genügend Luft hineinkommt und die Flamme nicht erstickt. Danach soll ich in paar winzige Stücke Okote genauso dazwischen schieben. Okote brennt garantiert immer, aber es brennt auch schnell ab, also ist es nur zum Anzünden des Feuers gut. Wenn die Flammen dann auf die Äste hinübergreifen, habe ich es geschafft.
Gott sei Dank muss ich nicht auch noch das Feuer selbst erzeugen.
»Jetzt musst du nur noch Äste und Holz nachlegen und fertig!«
»Aber der Rauch nervt. Egal wo ich mich hinsetze, er bläst immer in mein Gesicht«“, huste ich genervt.
»Das kann ich leider auch nicht ändern!«, lacht Omar.
Trini kommt zu uns, als wir gemütlich beim Feuer sitzen und essen.
Er bietet uns zwei Eier von seinen Hühnern an und erzählt, dass hier im Dorf auch eine Frau wohnt, die Deutsch spricht und für die Ausgrabungen bei der Pyramidenanlage zuständig ist. Omar ist sofort begeistert und möchte morgen gleich hinschauen und fragen, ob sie einen Job für uns hat. Ihn begeistert einfach alles, ich wünschte ich wäre auch so. Obwohl sich wahrscheinlich jeder dafür begeistert hätte, bei einer Ausgrabung von Pyramiden dabei sein zu dürfen und uralte, antike Schätze zu finden, aber Ich fühle wie immer gar nichts...
Nachts, als wir im Zelt liegen und mit unseren Köpfen nach draußen in die Sterne sehen, wird mir ein weiters Mal klar, welch unglaubliches Glück wir haben, jetzt hier sein zu dürfen. Dieser Ort ist magisch, nur leider auch nicht das, was wir suchen.
»Hat sich da im Baum gerade was bewegt?«, frage ich erschrocken.
»Ja, die Hühner schlafen dort oben, hast du das noch nicht gesehen?«
»Was? Die Hühner schlafen auf dem Baum? Das glaub ich nicht. Wo ist die Taschenlampe?«
Mit einem einzigen Handgriff hat Omar die Lampe und leuchtet auf den Baum, der jetzt auch noch anfängt, zu gackern. Tatsächlich. Die Hühner sitzen alle auf dem Baum.
»Wie sind die da rauf gekommen?«
»Sie springen, oder fliegen von Ast zu Ast.«
»Um welche Zeit gehen sie denn schlafen? Das darf ich morgen nicht verpassen.«
Am nächsten Tag suchen wir die Archäologin auf. Sie hat leider keinen Job für uns, nimmt uns aber gerne zur Pyramidenanlage mit, wenn wir bei den Ausgrabungen dabei sein wollen. Die Frau spricht nur etwas Deutsch und mit Akzent, aber wir bleiben Gott sei Dank beim Spanisch, so dass wir es alle verstehen. Omar freut sich so sehr auf das Angebot und ihm zuliebe tu ich auch so, als würde ich mich freuen. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass wir etwas gefunden haben, um die Zeit ein bisschen zu vertreiben, obwohl wir auch anfangen sollten, mehr Schmuck für das Fest morgen herzustellen und nach Palmenblättern zu suchen.
Omars Augen glänzen, als gerade ein Stück in der Ausgrabungsstätte gefunden- und mit einem kleinen Pinsel vorsichtig abgekehrt wird. Die Leute arbeiten so vorsichtig und geduldig. Sie müssen zwar mit Meißel die Erde wegschlagen, aber aufpassen, dass sie nichts zerstören, falls in der Erde dann etwas ist.
Auf dem Rückweg suchen und finden wir eine Palme, die noch nicht Mal jemandem gehört und wild neben einem Feldweg wächst. Mit der Schere schneiden wir die dünnen, langen Palmblätter nacheinander ab, sammeln sie zusammen und binden sie mit einem Strick zu einem Bund. Danach setzen wir uns ein paar Stunden in den Schatten, ich zeige meinem Freund, wie man die Grashüpfer herstellt und wir flechten ungefähr 20 vorrätig für morgen.
Am späten Nachmittag fahren wir per Autostopp zurück zur Hauptstraße in das nächste größere Dorf, um dort das Internet zu benutzten und unseren Familien zu schreiben. Sie sollen ja auch wissen, dass wir noch am Leben sind. Beim Zurückgehen begrüßen uns Straßenarbeiter, die gerade dabei sind, den weißen, kaum noch sichtbaren Strich in der Mitte der Straße neu zu malen.
Auf dem Fest abends ist zuerst überhaupt nichts los. Der Mann gegenüber von uns verkauft Pommes und wir freunden uns mit ihm an, um etwas abzukriegen. Zuerst tauscht er eine Portion gegen einen Grashüpfer, spätnachts schenkt er uns eine weitere Portion, einfach so. In einem Zelt nebenan wird Live Musik gespielt und getanzt und erst um 22:00 Uhr, als ich aus Langeweile beginne, neue Grashüpfer zu flechten, obwohl noch genug da sind, werden die Leute darauf aufmerksam und beginnen, sich um uns herum zu versammeln. Jeder will nun einen Grashüpfer und auch Omar muss Draht und Zange liegen lassen und flechten helfen.
Einige Jungs bitten uns, ihnen zu zeigen wie man das macht, doch ich erinnere mich gut an das Versprechen, das ich Mario gegeben habe, als er mir diese Kunst beigebracht hat. Erst, als sich später, als Omar mit anderen Kunden beschäftigt ist, ein Jugendlicher neben mich setz und mich viel zu oft darum bittet, weil er so begeistert ist und ich denke, dass er vielleicht arm ist und es ihm und seiner Familie helfen könnte, stimme ich zu.
Ich schneide mit der Hälfte eines Aluminiumdeckels das Blatt durch, bemerke dass der Junge nur mich anstarrt und weise ihn daraufhin, auf meine Hände zu schauen.
Mist! Jetzt habe ich mich auch noch hineingeschnitten!
Mein Gegenüber sieht mich erschrocken an und fragt dann mit blinzelnden Augen und einem romantischen Lächeln: »Ach Andrea, warum bist du so?«
Ich hätte nur die richtige Person an meiner Seite gebraucht, um mit ihr über diesen Kommentar lauthals loszulachen, doch stattdessen glaube ich, mich verhört zu haben und starre ihn fraglich an. Warum bin ich wie? So, dumm dass ich mich schneide?
Wie konnte ich nur so blöd sein und so einem Trottel das beibringen wollen, dabei war er doch die ganze Zeit nur daran interessiert, mich zu erobern.
Ich kann sein Gesabber nicht mehr ertragen und bitte ihn, abzuzischen. Als Omar und ich nach dem Fest im Zelt liegen, erzähle ich ihm davon und er lacht sich halbtot.
Er wird diesen Spruch jetzt bestimmt öfters nutzen, um mich damit zu ärgern. Obwohl er heute gar nichts verkaufen konnte, haben wir 150 Pesos nur allein durch Grashüpfer verdient. Es ist nicht viel, aber wir fühlen uns reich, denn nach Yoallis Heimreise blieb uns nicht mehr viel Geld übrig. 150 Pesos bedeuten wieder ein paar Tage ohne Hunger, wenn wir sparsam und intelligent essen.
Am nächsten Morgen nutzen wir, um illegal nach Guatemala zu wandern. Als wir auf einer Wegkreuzung stehen und nicht mehr weiterwissen, kommt zufälligerweise ein Mann auf seinem Pferd vorbei und wir fragen ihn nach dem Weg. Da der Cowboy mit Sombrero auch in unsere Richtung wandert, bietet er mir an, mich aufs Pferd zu setzen. Ich bin heute schon wieder barfuß unterwegs und errege damit Mitleid, anstatt Bewusstsein zu verbreiten. Dankend lehne ich ab, denn nicht mal auf einem Pferd zu sitzen, begeistert mich. Im Dorf angekommen, dürfen wir uns in einem kleinen Laden jeder ein Getränk und etwas zum Knabbern aussuchen. Wir probieren die Dinge, die es in Mexiko nicht gibt. Ein Energiegetränk namens »Raptor« schmeckt so lecker, dass wir gleich wissen, was das Erste sein wird, dass wir kaufen, wenn wir uns dann in den nächsten Tagen »legal» in Guatemala aufhalten.
Dankbar verabschieden wir uns von dem großzügigen Cowboy und schlendern noch zum Ende des Dorfes, wo es einen Fluss gibt, in dem wir uns baden. Erst, als wir schon im Wasser sind, bemerken wir, dass es seltsam riecht.
Der Tag war wirklich anstrengend, der Weg weit und die Hitze wie immer kaum erträglich bei Wanderungen dieser Art, trotzdem haben wir diesen gemeinsamen Ausflug sehr genossen.
Wir möchten noch einen weiteren Tag in Lagos de Colón bleiben und die Chance nutzen, um mit Trini nach Comitan zu fahren. Comitan ist eine Stadt, die man von hier aus durchqueren muss, um nach San Christobal de las Casas zu kommen.
Trini fährt die Strecke nämlich mindestens zwei Mal in der Woche mit seinem Wagen, den er als öffentliches Transportmittel nutzt, um Leute aufzusammeln. Obwohl wir ihm vorschlagen, oben auf dem Dach mit dem Gepäck mitzufahren, lässt Trini uns auf die Beifahrersitze. Seine Frau ist verärgert, weil er dadurch das Geld von den zahlenden Passagieren verliert. Jetzt hasst sie uns sicher nur noch mehr, weil wir nicht nur kein Geld einbringen, sondern durch uns jetzt auch noch die Einnahmen verringert werden.
Omar und ich schlendern durch die Stadt, suchen in einem großen Markt nach Okote, probieren ein paar Süßigkeiten, die auf der Straße verkauft werden und fahren zwei Stunden später mit Trini wieder nach Lagos de Colon. Wir quetschen uns so gut es geht auf einen Sitz, so dass neben uns noch jemand hinpasst. Am letzten Abend, als wir beim Feuer sitzen und essen, hören wir Trinis Frau herumschreien.
»Da sind gar keine Eier im Stall! Diese Diebe! Undankbare Schmarotzer!«
Als wir am nächsten Morgen wieder auf der Hauptstraße stehen und Richtung Grenze auf eine Mitfahrgelegenheit warten, fragt Omar doch tatsächlich, ob ich Lust auf ein Ei hätte.
»Was? Hast du doch die Eier gestohlen?«
»Ja zwei, aber erst heute Morgen und als Rache für ihre Anschuldigungen von gestern.
Wenn sie schon so sicher ist, dass wir Diebe sind, dann soll sie es so haben. Sie will doch Recht behalten. Ich habe ihr nur einen Gefallen getan.« Omar reicht mir grinsend das Ei, während er ein Loch in seins sticht und es einfach trinkt.
»Das hast du gut gemacht!«, stolz klopfe ich ihm auf die Schulter, beobachte ihn beim Trinken seines Eies und sage gar nichts mehr dazu. Was soll ich auch noch sagen? Ein Mexikaner, oder ein Omar, der Hunger hat, isst alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Jetzt verstehe ich auch die Hühner.
»Willst du mein Ei auch trinken?«, frage ich.
»Nein, das ist doch für dich! Du musst auch was essen.«
»Ja essen schon. Aber ich möchte jetzt kein Feuer machen und es kochen. Wir sind mitten auf der Straße. Nimm es bitte! Du genießt es sowieso mehr als ich.«
»Bist du dir sicher?«
»Ja, bis es Abend wird und wir kochen, ist es entweder schon schlecht bei der Hitze, oder durch Bewegungen kaputt gegangen.«
Überglücklich nimmt Omar das Ei, trinkt es aus und stopft sich dann auch noch die Schale in den Mund.
Es kracht, wenn er beißt.
Ich starre ihn an und als er es bemerkt, runzelt er die Stirn und fragt mit vollem Mund, so dass ich es kaum verstehe: »Was?«
»Nichts!«, antworte ich und kann ein lautes Lachen nicht vermeiden.
Schicksalsfügungen
In Ciudad Cuauhtemoc, an der Grenze zu Guatemala möchten die Beamten 380 Pesos für meinen Ausreisestempel aus Mexiko.
Ich bin geschockt, verlasse das Gebäude und erzähle es Omar, der draußen mit den Sachen wartet.
»Was? Diese Abzocker. Ich rede mal mit denen!«
»Nein, lass es. Sie haben es mir schon erklärt. So sind halt die Regeln. Das steht sogar auf einem Zettel vor dem Glasfenster. Da können die auch nichts machen.«
»Wie viele Tage bleiben dir noch?«
»Ein Monat, dann läuft mein Visum ab.«
»Dann gehen wir einfach zurück und schauen, was wir noch verkaufen können.«
Wir drehen um und schlendern die ganze Straße, von der wir gekommen sind, wieder zurück. Ich hätte natürlich auf meine Ersparnisse für den Notfall zurückgreifen können, aber das ist nicht der Sinn dieser Reise. Wir glauben noch immer fest daran, dass wir es auch schaffen, wenn wir nichts haben und das alles, was passiert, einen bestimmten Grund hat. Wir möchten vor allem uns selbst beweisen, dass alles möglich ist.
Da wir wieder ewig auf eine Mitfahrgelegenheit warten, schlendern wir bis zu der nächsten Tankstelle, wo ich einen älteren Mann in einem Geländewagen frage, ob wir mitfahren können. So ist es einfacher, als weiterzugehen und den Daumen hochzuhalten, denn wenn man direkt fragt, können die Leute meistens eh nicht mehr nein sagen.
Jetzt stehen wir wieder bei der Kreuzung, wo Omar die Eier getrunken hat. Rechts führt die Straße wieder nach Lagos de Colón und geradeaus weiter nach Comitán, San Christobal de las Casas und Tuxtla de Gutierrez. Als wir ein Stück zu Fuß weitergehen, treffen wir wieder auf die Straßenarbeiter, die uns schon vor einigen Tagen bemerkt haben.
»Hey! Wohin wollt ihr? Habt ihr Hunger?« Der Chef, den man ganz einfach identifiziert, weil die anderen drei Arbeiter noch Jugendliche sind, hört interessiert zu, als wir ihm erzählen, was wir vorhaben. Er bietet uns an, mit ihm heute Abend nach Tuxtla de Gutierrez zu fahren. Eine Bekannte hätte dort eine kleine Hütte, in der ich wohnen könnte, während er Omar zum Arbeiten mitnehmen würde.
Schicksalsfügung... Wir denken nicht lange darüber nach und nehmen das Angebot sofort an. Oblegatorio lädt uns und seine Arbeiter zum Essen ein, danach sollen die Männer es sich hinten im Geländewagen bequem machen und mir wir die Beifahrertür geöffnet. Ich lehne dankend ab, denn ich möchte nicht mit ihm alleine im Auto sitzen, da schon von Anfang an offensichtlich war, dass ich ihm gefalle und er deshalb wahrscheinlich versuchen wird, mit seinen Kotz- Schmeicheleien mein Herz zu gewinnen.
»Nein danke, ich bleibe lieber auch hinten«, mache ich ihm klar und setze mich zu Omar, während Oblegatorio und die anderen Jungs immer noch versuchen, mich zu überreden, vorne im geschlossenen Wagen mitzufahren, weil ich ja die Frau bin. Mir reicht die übertriebene Freundlichkeit, ich sage nichts mehr, bis sich endlich einer der Arbeiter nach vorne setzt.
Nach einer Stunde Fahrt wird es dunkel, der Wind und die Kälte werden immer unerträglicher. Omar, der mich wie ein zitterndes Bündel fest umarmt, bittet mich eine Stunde später, als wir anhalten, mich doch vorne hinzusetzen und ich gebe nach. Die Kälte, die durch den Fahrtwind entsteht, ist unerträglich. Da halte ich eher noch ein paar Eroberungsversuche aus.
Oblegatorio ist überglücklich, stellt viele Fragen zu unserer Reise und meinem Leben. »Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du hierherkamst?«
»Was sollen sie denn gesagt haben?«
»Naja, ich würde meiner Tochter das nicht erlauben, ich hätte zu viel Angst, dass ihr etwas passiert.«
Die gleiche Konversation durfte ich schon mit Emiliano und genug anderen Mexikanern führen.
Ich verstehe noch immer nicht, warum sie nicht verstehen, dass es meine Entscheidung war und dabei die Meinung anderer keine Rolle spielte.
»Meine Eltern sind glücklich, wenn ich glücklich bin. Sie haben auf die Entscheidung zwar überrascht reagiert, aber sich für mich gefreut, weil sie wahrscheinlich bevorzugen, dass es mir gut geht und ich meinem Herzen folge, anstatt mich täglich mit einem traurigen und sorgenvollen Gesicht zu sehen. Außerdem war ich 21, als ich mein Land verlassen habe. Ich musste meine Eltern nicht um Erlaubnis fragen und wäre trotzdem gegangen, auch wenn sie nicht zugestimmt hätten.«
»Nein, also hier hat man Respekt vor seinen Eltern!«, meint Oblegatorio und hat nichts verstanden.
»Das ist ja schön. In meinem Land hat man sogar Respekt vor seinen Kindern. Stell dir vor, sie dürfen sogar ihre eigenen Entscheidungen treffen.« Mit diesem Satz beende ich das Thema. Oblegatorio lächelt gestellt, um sympathisch zu wirken und schon wünschte ich mir wieder, mich für das Ertragen der Kälte in Omars Armen entschieden zu haben und nicht für den Anblick dieses falschen Lächelns, das nur dazu dient, um gut vor mir dazustehen. Kurz darauf erfahre ich von Oblegatorio, dass er drei Töchter hat und eine davon »Amor« heißt.
»Deine Tochter heißt Liebe? Geh, verarsch mich nicht!«
»Ja, sie heißt echt so!«
»Wenn deine Tochter später mal einen Freund hat und alle anderen Männer sie Amor nennen, muss der Junge aber gut aufpassen«, grinse ich und füge hinzu: «Falls sie deine Erlaubnis bekommt, einen Freund zu haben, natürlich.«
Oblegatorio lacht und ich setzte noch einen drauf: »Falls nicht kann sie sich noch immer umorientieren. Die Männer hier kann man eh vergessen.«
Eine Stunde später halten wir bei einem Laden. Es ist bereits Mitternacht. Oblegatorio hat kaum noch etwas gesagt und ich bin fast eingeschlafen. Er kauft Kaffee, Kuchen und Kekse für alle. »Und wie geht’s dir da drin?«, fragt Omar leise, nachdem zwei der Männer wieder im Laden verschwunden sind und die anderen zwei sich intensiv unterhalten.
»Ist es auszuhalten?«
»Ja! Wir hatten anfangs ein paar interessante Gespräche und nachdem ich meine Meinung geäußert habe, war Ruhe.«
Omar verdreht die Augen und schmunzelt. Er kennt mich schon zu gut, um keine weiteren Fragen stellen zu müssen. Wir beide wissen, dass Ehrlichkeit und die eigene Meinung in dieser Welt – wo alle denken, sie müssen sich verstellen- um den anderen zu gefallen, nicht mehr gefragt ist. Doch umso mehr fordert es mich heraus, mir all die falschen Leute, die mich deswegen nicht mögen, vom Hals zu schaffen.
Die Jungs werden zwei Stunden später bei ihren Häusern abgeliefert und wir fahren in einem kleinen Dorf zum Haus von Oblegatorios Mutter, welche einen schönen großen Innenhof und ein schönes Zimmer für uns mit einem sehr weichen Bett hat. Es gibt sogar ein Badezimmer mit richtiger Dusche! Ich fühle mich wie im Himmel. Frisch geduscht und endlich wieder sauber liegen wir Arm im Arm im Bett und danken der Energie für diese Gelegenheit.
»Hey!«, flüstert Omar wenig später, als ich schon fast eingeschlafen bin. »Stört es dich, wenn ich auf dem Boden schlafe? Das Bett ist mir zu weich.«
Nach einem ausgiebigen Frühstück, fahren wir mit Oblegatorio zu der Hütte in Tuxtla. Heute ist Freitag und erst am Montag würde er Omar für eine Woche zum Arbeiten abholen. Wir haben also das Wochenende, um uns einzuleben.
Die Holzhütte befindet in einer kleinen Kolonie namens Teran, die an Tuxtla de Gutierrez grenzt. In dem großen Grundstück, das man durch ein Tor betritt, leben weiter drüben noch zwei andere Familien. Für die einen ist es aber nur ein Ferienhaus und sie sind fast nie hier. Die anderen sind eine Junge Familie mit einem Kind. Wir teilen uns alle einen Brunnen, von dem wir Wasser holen müssen. Bad und WC ist ein kleiner betonierter Raum neben unserer Hütte, in dem nur eine Toilette steht und der Rest des Bodens mit Abfluss dazu dient, um sich zu Waschen. In der unaufgeräumten Hütte gibt es einen Holztisch mit zwei Stühlen, ein verstaubtes, altes Sofa und jede Menge Gerümpel. Wir schlagen aber doch lieber unser Zelt auf, weil zwischen den Holzbrettern an der Wand, Wind und Insekten hereinkommen.
»Morgen bau ich dir einen kleinen Ofen«, entscheidet Omar, »Ich will ja, dass es dir an nichts fehlt, wenn ich nicht da bin.«
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wird ohne dich, aber ich komm schon klar. Ich weiß ja jetzt, wie man Feuer macht und überlebt!«, sage ich stolz.
»Ja, mit dem Feuerzeug...«, lacht mein Freund.
Nach einem ausgiebigen Nachmittagsschläfchen suchen wir am Abend das Zentrum von Teran auf, breiten vor der Kirche unsere Kunsthandwerke aus und versuchen, etwas zu verkaufen.
Ich habe noch ein paar Palmenblätter übrig und flechte daraus Grashüpfer. Omar erklärt den Leuten, was Mario ihm erklärte, nämlich dass der Grashüpfer ein spirituelles Glückssymbol ist und auch »Esperanzita« oder »Hoffnungsträger« bedeutet.
Früher, wenn man einen einzelnen Grashüpfer auf dem Maisfeld gesehen hat, war das ein Zeichen für eine gute Ernte. Da die Leute so (leicht)gläubig sind, haben wir eine halbe Stunde später schon keine Palmenblätter mehr übrig. Ich denke, dass sie denken, dass ihr Leben besser wird, nur weil sie den Grashüpfer in ihr Wohnzimmer stellen, aber wenn sie wirklich daran glauben, könnte es schon genauso passieren. Der Glaube versetzt ja immerhin Berge.
Heute konnten wir endlich den geschnitzten Affen aus einer Kokosschale verkaufen, den Itzel uns in Puerto Arista geschenkt hat, weil sie so glücklich war, mit uns ein bisschen Schmuck herstellen zu dürfen. Itzel hätte bestimmt gewollt, dass wir mit dem Geld Essen für uns kaufen und ihn nicht die ganze Zeit als Erinnerungsstück
mitschleppen.





























