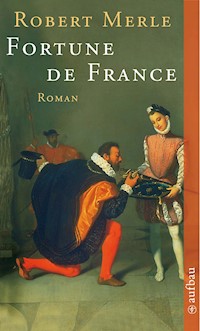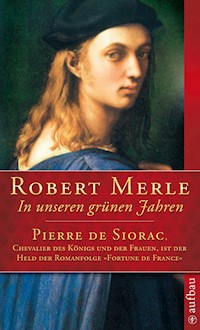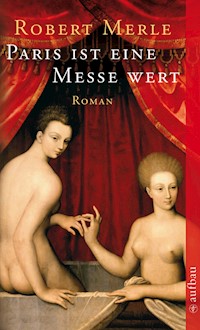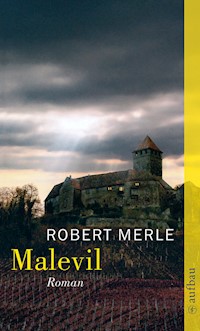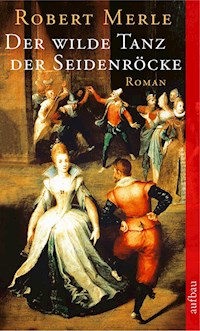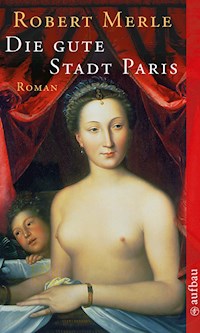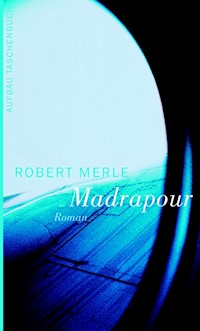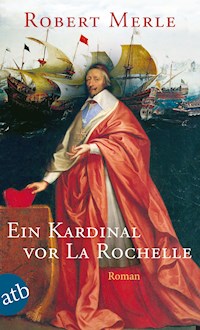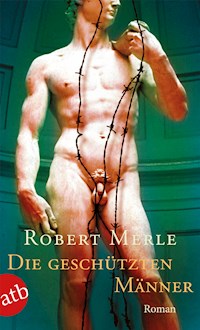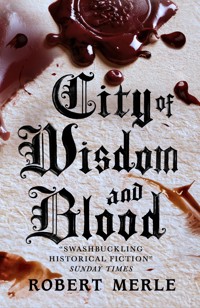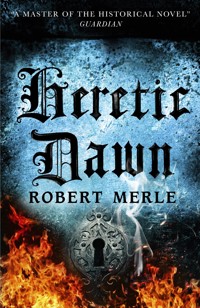9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fortune de France
- Sprache: Deutsch
"Jetzt bin ich König" - sagt der sechzehnjährige Ludwig nach gelungenem Staatsstreich, als der mächtige Günstling seiner Mutter Maria von Medici erschossen auf der Brücke zum Louvre liegt. Mit diesem Theatercoup beginnt der sechste Band der Romanfolge "Fortune de France", in der Robert Merle historisch verläßlich, mit viel Witz und feiner Ironie ein dramatisches französisches Jahrhundert erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Robert Merle
Die Rosen des Lebens
Roman
Aus dem Französischen von Christel Gersch
Aufbau-Verlag
[Menü]
Impressum
Titel der OriginalausgabeLes Roses de la vie
ISBN E-Pub 978-3-8412-0179-9ISBN PDF 978-3-8412-2139-1ISBN Printausgabe 978-3-7466-2298-9
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie deutsche Übersetzung erschien erstmals 2000 bei Aufbau, einer Markeder Aufbau Verlag GmbH & Co. KGLes Roses de la vie © Robert Merle
Die Originalausgabe ist 1995 bei den Éditions de Fallois in Paris erschienen Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Designunter Verwendung des Gemäldes »Bacchanal mit Festival der Venus«Schloß Rosenborg Kopenhagen, © Mauritius Images
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBENTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
[Menü]
|5|ERSTES KAPITEL
Fünf Kugeln feuerten die Verschworenen auf den Schurken Concini ab, als er am 24. April 1617 den Louvre über die ›schlafende Brücke‹ betrat. Die zwei ersten verfehlten ihn, die dritte traf ihn zwischen den Augen, die vierte unterm rechten Auge, die fünfte zerriß ihm die Kehle. So konnte man – leicht übertrieben – sagen, er wurde dreimal getötet, zu Frankreichs Ruhe und Erlösung hätte schon einmal genügt.
»Jetzt bin ich König«, war alles, was Ludwig danach sagte. Zehn Tage später, einen Tag vor Himmelfahrt, am 3. Mai um halb drei Uhr nachmittags ging die schluchzende Maria von Medici nach Schloß Blois in die Verbannung. Mit undurchdringlichem Gesicht sah Ludwig von einem Fenster des Louvre die Karosse seiner lieblosen Mutter davonrollen.
Meine geliebte Patin, die Herzogin von Guise, die mit ihrer Tochter, der Prinzessin Conti, zu den engsten Freundinnen der Ex-Regentin gehört hatte, was in punkto Finanzen für sie ein Glücksfall gewesen war, erholte sich von diesem Schlag nicht so schnell, zumal sie wußte, daß Ludwig kein großer Frauenfreund war, dazu hatte ihn seine Mutter in den sieben unheilvollen Jahren ihrer Herrschaft zu sehr niedergehalten und gedemütigt. Und kein Sturz ist so endgültig wie ein Sturz am Hofe, denn wer von den Höhen der Macht fällt, kann für seine graue Zukunft kaum mehr auf Freunde bauen.
Doch Madame de Guise, die unter der Regentschaft zum großen Zorn meines Vaters, des Chevaliers de La Surie und meiner selbst ziemlich hochnäsig auf meinen armen Königssohn herabgesehen hatte – einfältig hatte sie ihn genannt, »gerade nur imstande, seine Zinnsoldaten zu befehligen« –, entdeckte nun quasi von einem Tag auf den anderen seine Tugenden: Entschlossenheit, Kühnheit, Umsicht und eine wahrhaft königliche Verschwiegenheit. Kurz, sie bewunderte, daß ein Knabe von fünfzehneinhalb Jahren diesen erstaunlichen Staatsstreich ersonnen und bis zum erfolgreichen Abschluß geführt hatte.
|6|Dieses Lob wurde Ludwig an unserem Tische gezollt, denn durch einen Laufburschen, der sich morgens in unserem Haus in der Rue du Champ Fleuri einstellte, hatte sich Madame de Guise ohne Umstände zum Mittagessen angesagt: Sie habe mir, hatte sie ausrichten lassen, höchst wichtige Dinge mitzuteilen.
Daß sie so wichtig seien, bezweifelte ich, obwohl ich meiner Patin alle Sohnesliebe entgegenbrachte, schließlich fließt ihr Bourbonenblut in meinen Adern.1Ich erwähne dies in aller Bescheidenheit, denn ein weiblicher Fehltritt auch seitens einer Prinzessin von Geblüt berechtigt niemanden, sich als wenngleich illegitimen königlichen Abkommen zu betrachten. Was mich im übrigen wenig bekümmerte, ich fühlte mich bis ins Mark als Siorac und war fest entschlossen, mein Fortkommen in der Gesellschaft, wie schon mein Vater, allein nur meinem Dienst für den König zu verdanken.
Vom Mieder bis zum Reifrock, vom Reifrock bis zu ihren Pantöffelchen erstrahlte Madame de Guise in blaßblauem Satin, der ihre himmelblauen Augen in Geltung setzte. Ungeachtet der Perlen an ihrem Gewand wie der blitzenden Diamanten in ihrer Puderfrisur war ich, wenn sie erschien, ganz Aufmerksamkeit nur für ihren bald zärtlichen, bald zornigen Blick, ihr fröhliches, melodisches Lachen, ihren unversieglichen Appetit, ihre sprunghaften Einfälle und Aufregungen, und wie stets bewunderte ich im stillen diese fabelhafte Gesundheit, dank derer sie nicht nur fünf Geburten überlebt hatte, sondern die ihr auch die Gebrechlichkeiten des Alters ersparte und eine prächtige Lebenslust erhielt.
Kaum hatte sie zur Rechten meines Vaters Platz genommen, machte sie sich unverweilt über Wein und Schüsseln her, und erst als sie gesättigt war, sprach sie. Kurioserweise, doch ganz ihrer Art gemäß eröffnete sie die Mitteilung ihrer ›höchst wichtigen Dinge‹ damit, daß sie mich abkanzelte.
»Also, wirklich, mein Herr Patensohn!« begann sie und maß mich mit hochfahrendem Blick, »wer bin ich für Euch? Das fünfte Rad am Wagen, wie? Spielt den Geheimniskrämer! |7|Konspiriert hinter meinem Rücken! Und gegen wen? Gegen die Königin von Frankreich!«
»Um Vergebung, Madame«, sagte mein Vater mit einem halb liebevollen, halb spöttischen Lächeln, »Maria von Medici ist die Königinmutter. Sie ist nicht Königin von Frankreich. Dieser Titel steht allein Anna von Österreich zu.«
»Ist doch egal!«
»Oh, Madame«, fiel ich lebhaft ein, »das ist nicht egal! Es ist ganz und gar nicht egal! Ich habe konspiriert, einverstanden, aber an der Seite meines Königs und gegen die Tyrannei eines schurkischen Abenteurers und einer Mutter, die sich immer noch an den Thron klammerte, obwohl ihr Sohn längst für großjährig erklärt worden war.«
»Na schön, na schön«, sagte Madame de Guise, indem sie ihre molligen Hände hob, »bitte, lassen wir doch diese Spitzfindigkeiten … Geschehen ist geschehen, jetzt haben wir die Suppe auszulöffeln.«
Bei diesen Worten wechselten mein Vater und La Surie einen Blick, denn meine Patin hatte die Angewohnheit, alles, aber auch alles, was ihrer Ansicht widersprach, als Spitzfindigkeiten abzutun.
»Außerdem, wozu sich noch mit der Vergangenheit aufhalten, gibt uns die Gegenwart nicht genug Anlaß zur Sorge?« fuhr Madame de Guise fort, wobei sie vergaß, daß sie selbst ebendies getan hatte. »Im Grunde genommen, Söhnchen, verübele ich Euch die unwürdige Geheimniskrämerei ja nicht so sehr, nur …«
»Nur, Madame«, sagte mein Vater, indem er seine breite Rechte auf die kleine Hand meiner Patin legte – eine Berührung, bei der sie noch nach so vielen Jahren erschauerte und rosig anlief –, »könnt Ihr nicht begreifen, daß es keine Verschwörung ohne Geheimhaltung gibt, nicht wahr? Sogar mir hat Pierre-Emmanuel kein Sterbenswörtchen verraten. Und er hatte recht damit.«
»Aber, Marquis!« versetzte sie aufgebracht, doch ohne ihre Hand unter der seinen wegzuziehen, »läßt es Euch etwa kalt, daß unser Pierre-Emmanuel leicht bis ans Ende seiner Tage in der Bastille hätte schmachten können? Oder, noch schlimmer, auf dem Richtblock enden, unterm Henkersschwert?«
»Madame, wozu ein Was-wäre-wenn beweinen, lacht uns |8|denn nicht die Wirklichkeit?« sagte der Marquis de Siorac. »Ich jedenfalls bin von Herzen froh, daß Pierre-Emmanuel einer von jener Handvoll Männern war, die unter Gefahr für Freiheit und Leben den Plan des Königs ausgeführt haben.«
»Aber das ist es doch gerade!« rief Madame de Guise, »deshalb bin ich ja hier! Ich finde, Pierre-Emmanuel ist viel zu bescheiden und zurückhaltend, während die Meute derer, die mit ihm im Komplott waren, laut und vernehmlich nach Stellen, Ehren, Titeln und Pfründen schreit.«
»Ach, und die bekommen sie?« fragte ich stockend.
»Ja, selbstverständlich!« sagte sie mit einem hochfahrenden Anflug. »Ludwig ist gerecht und vergißt nicht zu belohnen, wer ihm so gut gedient hat!«
Noch zwei Tugenden, die sie ihm plötzlich zuerkennt, dachte ich: Gerechtigkeit und Dankbarkeit. Wie sich die Zeiten ändern!
»Stellt Euch vor«, fuhr sie leidenschaftlich fort, »Vitry ist vom einfachen Gardehauptmann zum Marschall von Frankreich ernannt worden! Statt seiner tritt sein Bruder du Hallier an die Spitze des Garderegiments, und sein Schwager Persan rückt zum Gouverneur der Bastille auf. Und das nur für die Schießerei. Aber Monsieur de Luynes wird Erster Kammerherr, dazu darf er sich ein Herzogtum samt Pairswürde erwarten und obendrein das riesige Vermögen von Concini.«
»Das allerdings sollte man besser dem Schatz der Bastille zurückgeben, denn von daher stammt es«, sagte mein Vater streng.
»Ihr wollt doch nicht etwa Ludwig kritisieren?« sagte Madame de Guise, die mit jeder Minute royalistischer wurde. »Damit aber nicht genug«, fuhr sie fort, »auch die beiden Brüder von Luynes sollen großartig bedacht werden: der eine, heißt es, mit einem Herzogtum, der andere mit einem Marschallsamt.«
»Gott im Himmel!« rief mein Vater aus, »ein Marschallsamt für einen, der noch nie den Degen gezogen hat!«
»Ich stimme Euch bei«, sagte Madame de Guise, »es ist ein bißchen stark. Aber sogar die beiden Bürgerlichen in dem Komplott werden ja hoch ausgezeichnet! Tronçon wird Privatsekretär des Königs, und Déagéant ist zum Finanzverwalter ernannt worden und wird außerdem Mitglied des Kronrats.«
|9|»Das freut mich für ihn«, sagte ich. »Er ist ein Mann von großem Wissen und ungemein scharfsinnig.«
»Es freut Euch für ihn! Also wirklich, Söhnchen«, sagte Madame de Guise mit jähem Zorn, »Ihr glaubt wohl, wenn Ihr Euch wie das bescheidene Veilchen im Blätterkranz versteckt, wird man Euch für Eure Mühen belohnen? Teufel noch eins, Monsieur, tretet hervor! Wartet nicht, daß die Zeit vergeht und man Euch vergißt! Fordert! Fordert endlich! Oder wollt Ihr Euer Leben lang ein kleiner Chevalier bleiben?«
»Was mich betrifft, so bleibe ich ganz gerne Chevalier de La Surie«, sagte La Surie, und dabei funkelte sein braunes Auge, während sein blaues kalt blieb.
»Still, Miroul!« sagte mein Vater sotto voce, aber hinter der Hand verbarg er ein Lächeln.
»Monsieur«, sagte die Herzogin tiefernst zu La Surie, »ich bitte tausendmal um Entschuldigung, wenn ich Euch verletzt habe. Ein Edelmann, gleich welchen Ranges, ist immer ein Edelmann, und Chevalier zu sein ist ganz in der Ordnung. Mein jüngster Sohn war auch Chevalier.«
»Madame«, sagte La Surie, »dieser Vergleich ehrt mich. Und Ihr habt mich so huldreich getröstet, daß ich wünschte, Ihr sähet in mir künftighin Euren sehr ergebenen und sehr untertänigen Diener.«
»Wie reizend er ist, Euer Miroul, Monsieur«, sagte Madame de Guise, an meinen Vater gewandt, und blickte ihn zugleich forschend an, weil sie sich langsam fragte, ob La Surie sie nicht ein wenig hochgenommen habe.
Doch wie dem auch sei, die Lektion saß. Denn sie, die so schwer die Existenz von Menschen wahrzunehmen vermochte, die sie zu weit unter sich erachtete, als daß sie ihre Aufmerksamkeit verdienten, bemühte sich in der Folge, La Surie zu bemerken oder ihn wenigstens mehr zu bemerken als durch ein bloßes Kopfnicken. Was sie mit Humor und nicht ohne Anmut tat. »Und wie«, fragte sie, »ergeht es meinem sehr ergebenen Chevalier?« Und mit einem Lächeln reichte sie ihm die Hand zum Kuß, was sie noch niemals getan hatte. Sie mögen sich vorstellen, wie glücklich La Surie war.
Mich aber drängte sie neuerdings, den Lohn meiner Mühen, wie sie es ausdrückte, einzufordern, und ich versicherte ihr, ihren Rat zu befolgen, ohne daß ich die geringste Absicht hatte, |10|es zu tun. Schließlich war ihr zuzutrauen, daß sie auf eigene Faust einen Schritt in dem Sinne bei Ludwig unternahm, was er seitens einer engen Freundin der Königinmutter schwerlich gut aufnehmen würde.
Nachdem meine liebe Patin gegangen war, faßte mein Vater mich um die Schulter.
»Wollt Ihr es?« fragte er.
»Auf keinen Fall, Herr Vater.«
»Und Ihr tut recht daran. Bestimmt kann man wetten, daß Ludwig Eure Dienste in diesem entscheidenden Moment seiner Herrschaft ebensowenig vergessen wird, wie er die kleine Armbrust je vergaß, die Ihr ihm in Saint-Germain-en-Laye geschenkt habt, als Ihr zehn Jahre alt wart. Ebenso beharrlich wie in seinem Groll ist Ludwig auch in seiner Dankbarkeit.«
***
Aber die Zeit verging, und es sah immer unwahrscheinlicher aus, daß mein Vater seine Wette gewinnen sollte, während ich mich allmählich fragte, ob ich den Rat von Madame de Guise nicht zu Unrecht verschmäht hatte. Nicht daß ich mich über Seine Majestät beklagen konnte. Ich war bedacht worden, aber doch nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht hätte.
Noch am Tage des Staatsstreichs hatte der König jene Staatssekretäre (darunter auch Richelieu), die Concini zu seinen Kreaturen gemacht hatte, verbannt und die greisen Minister seines Vaters zurückgerufen; darauf hatte er mir befohlen, am Kronrat teilzunehmen, jedoch ohne beschließende Stimme, sondern nur als Berater in Angelegenheiten jener fremden Länder, deren Sprache ich kannte.
Dies aber enttäuschte Madame de Guise, als sie es erfuhr, und dann wurde sie zornig. Zumal sie nicht begriff, daß ›ohne beschließende Stimme‹ lediglich ohne Stimmrecht bedeutete.
»Ist das der Aufstieg«, fauchte sie mich an, »den Ihr Euch auf der Adelsleiter erwarten durftet? Heißt das eine Vermehrung Eures Vermögens? Nach wie vor seid Ihr Chevalier und habt keine weiteren Einkünfte als die aus Eurem Amt als Erster Kammerherr! Dreitausendfünfhundert Livres im Jahr! Eine schöne Bescherung! Wer kann denn bei einer so mageren Pension seinen Rang wahren?«
|11|»Aber, Madame, ist es etwa nichts, in meinem Alter dem Kronrat anzugehören?«
»Na, großartig! Ihr nehmt an dem Rat im Stehen teil, und ein kleiner Bürgerlicher wie Déagéant kann sitzen!«
»Um Vergebung, Madame, das kann er nicht. Im Rat sitzen nur Seine Majestät und die vier Staatssekretäre. Alle anderen haben zu stehen wie ich.«
»Aber Déagéant darf reden, und wie ich hörte, tut er es nicht zu knapp, und mit einer Anmaßung! Während Ihr, gelehrt, wie Ihr seid, daneben den Stummen vom Harem spielt.«
»Madame, noch einmal um Vergebung, ich darf reden, sobald Seine Majestät oder Monsieur de Villeroy mich dazu auffordern.«
»Tun sie das denn?«
»Manchmal.«
»Ich bin überwältigt! Also, wenn die paar Wörtchen …«
»Madame, ich habe nicht ›ein paar Wörtchen‹ gesagt, ich habe gesagt ›manchmal‹.«
»Bitte, wenn die paar Wörtchen, zwei-, dreimal im Monat, Euch genug sind, na, bestens, Chevalier, bestens!«
Dieses ›Chevalier‹ statt des gewohnten ›Söhnchen‹ war bei allem der schärfste Pfeil, und nach diesem Pfeil kehrte Madame de Guise mir zornentbrannt den Rücken und eilte mit rauschenden Röcken davon.
Der Staatssekretär für ausländische Angelegenheiten, dem ich von Amts wegen unterstand, war derzeit noch Monsieur de Villeroy. Soweit mein Alter und das seine es erlaubten, hatte ich unter der Regentschaft der Königinmutter seinen Umgang gesucht. Als Sohn eines Vorstehers der Pariser Kaufmannschaft, als gebildeter, strebsamer und scharfsinniger Bürgerlicher, mit Tugenden begabt wie mit Vermögen, als ein Muster jenes Amtsadels, der dem Geburtsadel ein steter Dorn im Auge war, hatte Villeroy vierzig Jahre teilgehabt an der Führung der Staatsgeschäfte. Henri Quatre hatte ihn sogar trotz eines gewissen Mißtrauens, weil Villeroy in seinem ausgesprochenen Katholizismus ein Sympathisant der Spanier war, aber auf Grund seiner großen Erfahrung behalten, auch weil er – außer wenn es sich um Spanien handelte – einen untrüglichen Sinn für die Reichsinteressen hatte.
Als Ludwig ihn erneut berief, war Monsieur de Villeroy |12|dreiundsiebzig Jahre alt, sein Haupt schon weiß, die Wangen hohl, die Nase lang, und ein schütterer Spitzbart zog das gelbe Gesicht in die Länge. Um den mageren Hals trug er eine altmodische Krause, über die unsere Hofgecken sich ausgeschüttet hätten, wäre Monsieur de Villeroy nicht eine so ehrwürdige Erscheinung und von einer Weisheit gewesen, der unsere Herrscher Respekt zollten.
Er schätzte mich, weil ich ihm gerne zuhörte, aber auch, weil ich keine Mühe gescheut hatte, mehrere Sprachen zu erlernen, kurzum, weil ich freudig bestrebt war, mich zu bilden, obwohl ich von Adel war. Und soweit seine Gesundheit es gestattete, hatte Monsieur de Villeroy die Güte, nach den Ratssitzungen oder den Anhörungen der Gesandten noch vertraulich mit mir zu plaudern und mir mit der Vorsicht und Verbindlichkeit des alten Diplomaten den Hintergrund jener Dinge zu enthüllen, von denen bei der Sitzung nur der Vordergrund zur Sprache gekommen war.
Leider ging es ihm nicht mehr allzu gut, und obwohl sein Geist klar blieb, wurde sein Gang von Tag zu Tag unsicherer, seine Gestik fahriger, und er schnaufte stark, die langen Ratssitzungen erschöpften ihn. Und sieben Monate, nachdem er erneut an die Macht gekommen war, ging er den Weg allen Fleisches und folgte den Fürsten, denen er gedient hatte, ins Grab.
In den ausländischen Angelegenheiten wurde er durch Monsieur de Puisieux ersetzt, den Sohn des Kanzlers Brûlart de Sillery. Doch sosehr ich um gute Beziehungen zu den beiden Brûlarts, wie man Vater und Sohn nannte, bemüht war, weil meine Aufgaben bei ihnen dies erforderten, konnte ich nie die geringste Spur von Freundschaft und Achtung für sie empfinden, denn allzubald mußte ich feststellen, daß sie einer wie der andere weit eher ihre eigenen Dinge betrieben als die des Staates.
Noch zu Lebzeiten von Monsieur de Villeroy wohnte ich der Audienz eines Gesandten bei, die einen tiefen Eindruck auf mich machte. Aber vielleicht sollte ich zuerst darstellen, auf welche Weise die Dinge für gewöhnlich abliefen. Wenn einer der ausländischen Gesandten den König zu sprechen wünschte, wandte er sich an Monsieur de Bonneuil, der den König davon unterrichtete, der ihn wiederum an Monsieur de Villeroy verwies, der sich darüber mit Seiner Majestät verständigte. War |13|dann eine Entscheidung gefallen, meldete Monsieur de Bonneuil dem Ersuchenden, daß sein Verlangen entweder genehmigt oder abgelehnt worden sei. Aber der König konnte einen Gesandten auch über den Kanal von Monsieur de Villeroy und Monsieur de Bonneuil einbestellen, wenn er es für notwendig hielt.
Dieser Fall nun ereignete sich in den ersten Junitagen des Jahres 1617, weil Spanien, das sich bereits Mailand einverleibt hatte, Streit mit dem Hause Savoyen anfing, das Frankreich seit langem freundschaftlichst verbunden war und sich ihm zwei Jahre darauf noch enger verband durch die Heirat von Chrétienne, Ludwigs zweiter Schwester, mit dem Herzog von Piemont.
Wenn Ludwig einen Gesandten empfing, bezeigte er ihm die gewissenhafteste Höflichkeit. Er erhob sich, schritt ihm entgegen und grüßte ihn mehrmals, indem er den Hut zog, um dem Land, das jener repräsentierte, Ehre zu erweisen. Und gehörte der Würdenträger einem befreundeten Reich wie etwa Savoyen an und hatte er ihn lange nicht gesehen, dann umarmte er ihn sogar. Und jedesmal wenn der Gesandte ihn im Verlauf des Gesprächs mit »Seine Majestät« anredete und sich dabei verneigte, erwiderte Ludwig die Verneigung unverzüglich. Was ihn nicht hinderte, der Rede seines Gegenübers mit aller Aufmerksamkeit zu folgen. Sein junges Gesicht – meine schöne Leserin möge sich vergegenwärtigen, daß er noch keine sechzehn Jahre alt war –, war dann zugleich von Ernst, Würde und Wohlwollen durchdrungen.
Keinen solchen Empfang erfuhr der Vertreter des besagten Reiches, das bekanntlich einer Monarchie, die unseren Herzen teuer war, immer wieder zu schaden versuchte. Als der Herzog von Monteleone erschien und auf den König zuging, erhob sich Ludwig zur Erwiderung seines Grußes nur halb vom Sitz und lüftete nur halb den Hut. Dann sagte er gleich zur Eröffnung ohne alle Floskeln, Umschweife und Schonung, sollten die Truppen seines liebwerten Vetters das Land Savoyen weiterhin belästigen, werde er zu den Waffen greifen und seinen Freunden Hilfe leisten.
Da stand der Herzog von Monteleone mit langem Gesicht, langen Gliedern, lang in allem, hager und steif. Nur mühsam hatte man diesem Herrn bei seiner Ankunft in Frankreich beibringen |14|können, daß er, auch wenn er als spanischer Grande vor seinem eigenen Herrscher bedeckt bleiben durfte, vor dem König von Frankreich das Haupt zu entblößen hatte. Verblüfft nun über Ludwigs ebenso entschlossene wie knappe Rede, wußte er sie sich nicht anders zu deuten denn als Beweis der Unerfahrenheit, und er dachte, über einen so grünen König leicht die Oberhand zu gewinnen.
»Sire«, sagte er, »dies kommt für mich so unerwartet, daß ich mich enthalten werde, meinem König zu schreiben, der König von Frankreich habe die Absicht, zugunsten Savoyens zu den Waffen zu greifen.«
Ich stand hinter Monsieur de Villeroy, der hinter dem Lehnstuhl Seiner Majestät stand, und konnte deshalb Ludwigs Miene nicht sehen, als er antwortete. Aber am Klang seiner Stimme hörte ich, daß er die Herablassung, die aus den Worten des Gesandten sprach, als verletzend empfand.
»Monsieur«, sagte er kühl, »schreibt nur immer, daß die Kämpfe um des allgemeinen Friedens willen einzustellen sind, oder ich eile Savoyen, das meiner Krone untersteht, zu Hilfe.«
Dieser Erklärung folgte ein Schweigen.
»Wenn Eure Majestät es so wünscht«, sagte der Herzog von Monteleone mit einer Verneigung, doch ohne seine Hoffart aufzugeben, »werde ich schreiben, was sie mir meinem König zu schreiben befiehlt, aber ich bedaure, daß Eurer Majestät zu einem solchen Entschluß geraten wurde.«
Auf diese kaum verhüllte Unverschämtheit hin straffte sich Ludwig und erwiderte, ohne die Stimme zu heben: »Dazu, Monsieur, rät mir einzig meine Pflicht.«
Und mit eisiger Stimme setzte er hinzu: »Ich habe Euch meinen Willen gesagt. Unterrichtet Euren Herrn davon und sucht Monsieur de Villeroy auf, er wird Euch meine übrigen Intentionen mitteilen.«
Dies war das erste und letzte Mal, daß Herr von Monteleone dem König von oben herab zu kommen versuchte. Nicht daß er dumm war, er hielt nur, weil er unter der Regentschaft wenig in Ludwigs Nähe gekommen war, noch an der Version von dem ›höchst kindischen Kinde‹ fest, die seine Mutter in die Welt gesetzt hatte. So kam es, daß die Audienz vom vierundzwanzigsten April 1617 ihn unversehen traf und sprachlos machte. Dennoch, von seiner eigenen Unfehlbarkeit eingenommen wie |15|Diplomaten oft, blieb er überzeugt, daß die Vaterschaft des Staatsstreiches nicht dem König zukam, sondern Monsieur de Luynes und seiner Umgebung. Nun, daß dem nicht so war, kann ich als einer der Verschworenen um Ludwig bezeugen. In unseren geheimen Versammlungen wußte der arme Luynes, ein so reizender Mensch und eine solche Memme, immer nur die Flucht vorzuschlagen. Wäre es nach ihm gegangen, lebte Concini noch und säße die Regentin immer noch auf dem Thron.
Gegen Spanien nun begnügte sich Ludwig nicht mit einer Drohung. Ungesäumt entsandte er Truppen unter dem Befehl von Lesdiguières, der die Spanier zwang, die Belagerung von Verceil aufzugeben. Gewiß hatte der Kronrat mit großer Mehrheit für diese Intervention gestimmt, doch der König hatte sich einen Beschluß zu eigen gemacht, der genau seiner Sicht entsprach, und ihn mit aller Energie durchgeführt. Vom ersten Tag an, als er der Herr war, folgte Ludwig der Maxime, die Mitglieder des Rates nach einer Diskussion abstimmen zu lassen und sich dem Wort der Mehrheit anzuschließen, aber nicht, wenn diese Ansicht seiner inneren Überzeugung widersprach. Dann entschied er aus eigenem Ratschluß, wie es sich in der Jesuitenaffäre zeigen wird.
Die Ratssitzungen fanden im Büchersaal in der zweiten Etage des Louvre statt. Es war ein schöner Raum, ringsum mit verglasten Bücherschränken bestellt, dazwischen hingen Wandteppiche. Ludwig saß, den Hut auf dem Kopf, am oberen Ende des Tisches. Zu seiner Linken und Rechten hatten je zwei der vier ebenfalls bedeckten Staatssekretäre Platz. Die übrigen Teilnehmer, auch Prinzen und Herzöge, standen barhäuptig.
Lakonisch, wie Ludwig es war, verlangte er auch von seinen Ministern Knappheit und Klarheit. Begann einer von ihnen zu reden, drückte er den Hut in die Stirn, kreuzte die Arme und hörte ihm mit undurchdringlichem Gesicht und gesammelter Aufmerksamkeit zu. Er unterbrach nie. Als der Prinz Condé eines Tages einem Staatssekretär mit einer Bemerkung ins Wort fiel, hob Ludwig die Hand und sagte in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Mein Cousin, ich lasse einen jeden zu Wort kommen. Ihr werdet alle Muße haben, Eurerseits zu sprechen.«
Was mich angeht, war ich, wenigstens in der ersten Zeit, |16|immer wieder von dem Kontrast zwischen dem jungen, runden Gesicht meines Königs und den runzligen alten der Minister frappiert. Es waren dies Brûlart de Sillery, der Kanzler und Ratsvorsitzende, Du Vair, der Siegelbewahrer, Jeannin, der Oberintendant der Finanzen, und Villeroy. Alle vier waren sie über Siebzig, und Ludwig konnte sich erinnern, sie manchesmal gesehen zu haben, wenn er als kleiner Junge mucksmäuschenstill zwischen den Beinen seines Vaters einer langen Sitzung des Kronrates beigewohnt hatte.
Seitdem hatte der Schnee des Greisenalters die gelichteten Häupter der Graubärte bedeckt, doch von ihrem Savoir-faire hatten sie nichts eingebüßt. Jede ihrer Runzeln sprach von langjähriger Erfahrung. Sie kannten das Getriebe, die Verfahrensweisen, die Aktengänge, die Präzedenzfälle. Und für Ludwig, der noch so jung war und so begierig, gut zu regieren, hatten diese uralten Säulen, die den Staat seit Jahrzehnten trugen, etwas wunderbar Versicherndes.
Nach dem Tod seines Vaters hatte man ja alles darangesetzt, ihn nicht etwa auf sein königliches Amt vorzubereiten, sondern ihn vielmehr zu seiner Ausübung unfähig zu erhalten. Sein oberflächlicher Unterricht war oft unterbrochen und vorzeitig beendet worden, als er dreizehn Jahre alt war. Seine Ausbildung insgesamt war völlig unzureichend gewesen, viel lateinische Deklinationen, ein bißchen Kartenkunde, wenig Geschichte, keine Fremdsprachen und längst nicht soviel Mathematik, wie er gewollt hätte, denn er fand sie ›sehr nützlich für die Artillerie und für Befestigungen‹. Hinzu kam, daß die Königinmutter ihn zur Teilnahme am Kronrat, gelinde gesagt, nicht eben ermutigte.
Ich will diese Fürstin hier keineswegs schwärzer malen als nötig, ihr starrsinniger Hochmut hatte sie von Dummheit zu Dummheit bis an ein so unglückliches Ende getrieben, daß es schon wieder Mitleid erregt. Aber es stimmt nun einmal und wird allerseits bestätigt, daß die Regentin Macht und Prunk dermaßen liebte, daß sie den Sohn als ihren Rivalen fürchtete, der ihr den Thron entreißen würde, wenn sie ihn nicht nieder, einsam und in engen Schranken hielt. Und das tat sie bar jedes zärtlichen Gefühls, mit einem Dünkel und einer Härte, die bei einer Frau erstaunen, und erst recht bei einer Mutter.
Ludwig war zu scharfsinnig und zu willensstark, als daß dies |17|der Königinmutter ganz gelungen wäre, aber meines Erachtens war es ihr auch nicht ganz mißlungen. Ludwig brauchte noch Jahre, um das demütigende Unterlegenheitsgefühl loszuwerden, das sie ihm eingeflößt hatte.
Das geringe Selbstvertrauen, das Ludwig am Anfang seiner Herrschaft hatte, wurde, meine ich, durch zwei Umstände vermehrt. Nie hatte er sein Stottern ganz überwinden können, und um es zu verbergen, beschied er sich öffentlich darauf, entweder zu schweigen oder mit seinen Worten äußerst sparsam zu sein. Diese Notlösung stellte er gerne als angeborenen Charakterzug dar. Als Kind hatte er seinem Erzieher erklärt: »Ihr wißt doch, Monsieur de Souvré, ich bin kein großer Redner.« Und in den Jahren, die uns hier beschäftigen, sagte er zu dem Nuntius Corsini: »Ich bin kein Wortedrechsler.«
Nun, da er Herr in seinem Reich war, entdeckte er allerdings, daß dieser »Charakterzug« auch Vorteile hatte. Verschwiegenheit und Geheimhaltung fallen leicht, wenn man wenig spricht. Obendrein verlieh ihm diese Selbstbeschränkung etwas Ernstes und Beeindruckendes. Auch gab die Kürze der Rede jedem seiner Worte Gewicht. Trotzdem hatte seine Schweigsamkeit oder Wortkargheit einen großen politischen Nachteil, weil das französische Volk derart vernarrt war in die Sprüche und Witze, die blitzenden Einfälle und die Schlagfertigkeit, mit denen sein Vater geglänzt hatte und denen er großenteils seinen Aufstieg, seine Überzeugungskraft und eine Volkstümlichkeit verdankte, die Ludwig bei all seinen Verdiensten nie erreichte.
Nicht abwegig erscheint es mir auch, daß die klägliche Erfahrung seiner Hochzeitsnacht mit Anna von Österreich, als er vierzehn war, nicht wenig zu seinem Gefühl beisteuerte, den Makel kindlicher Unreife zu tragen, zumal in einem Land, wo Schürzenjägerei mehr gilt als Keuschheit. Zumindest war dies ein sehr belastendes Scheitern, an dem er noch jahrelang zu schleppen hatte, von den Ängsten und Demütigungen der jungen Königin hier ganz schweigen.
Sein Vater, der große Draufgänger, war in allem sein Held, sein Vorbild, sein Idol, nur ausgerechnet nicht in der Galanterie. Da fiel der Apfel weit vom Stamm. Sein Temperament war mit Fleiß gebrochen worden, indem man ihm von klein auf einschärfte, das Fleisch sei der Satan. Pater Cotton nötigte ihn |18|eine volle Stunde zur Beichte und bearbeitete seine Seele, bis darin alle Begierden ausgerottet waren wie Unkraut. Der emsige Jesuitenpater ahnte in seinem Glaubenseifer nicht, daß er mit der Spreu den Weizen verwarf. Gutmütig, aber blind, war er sich nicht bewußt, daß er den König entmannte, während die Mutter den Sohn gleichzeitig in politischer Ohnmacht hielt. Das war kein Komplott. Der gute Pater war selbst am untröstlichsten über das Fiasko dieser Hochzeitsnacht, und er war nicht der letzte, der sein Beichtkind drängte, seiner Zeugungspflicht zu genügen. Aber die Sache schien ziemlich verfahren. Ludwig war keusch wie ein Mönch geworden. Nichts da mit den reizenden Mätressen, dank derer sein Vater einst seine Manneskraft erfrischte. Und, was immer unser netter Hofklatsch auftischen mochte, nichts da auch mit den schönen Knaben Heinrichs III. Gewiß wurde Monsieur de Luynes sehr geliebt, aber nicht auf diese Weise.
Ludwig machte seiner gnädigen kleinen Königin täglich zwei protokollarische Besuche, und oft sah ich ihn bleich und voller Unbehagen, wenn er ihre Gemächer betrat – nicht weil er die arme Anna verabscheute, die so hübsch und so lebhaft war und sich so sehnlich wünschte, wirklich seine Frau zu werden, sondern weil es ihn furchtbar grauste vor ihren gut hundert Hofdamen, die da zuchtlos und schwatzend umherschwirrten, ganz Weib allesamt und, was noch schlimmer war, ganz Spanierinnen, in seinen Augen das schlimmste Laster. So manches Mal dachte ich, wie dagegen sein Vater sich in seinem Element gefühlt hätte in diesem Frauenschwarm, zwischen samtigen Augen, schwingenden Hüften und funkelndem Lächeln. Für meinen armen Ludwig war es eine Folter.
Die große Lust seines Lebens – zugleich Genugtuung und Trost für einen durch Enthaltsamkeit fehlgeleiteten Mannesstolz –, war die Jagd. Verwegen zu Pferde, unermüdlich zu Fuß, auf der Faust oft den Falken, stellte er allem nach, ob Haar-, ob Federwild, nur nicht der schöneren Hälfte der Menschheit. Die Jagd ist etwas Erhabenes für ihn, etwas Heroisches. Vollendetes Können steht obenan. Er ist ein unvergleichlicher Schütze. Mit der Hakenbüchse trifft er einen Adler im Flug. Doch damit nicht genug. Es gilt alles zu wissen über Wild und Waidwerk, alle Jagdverfahren zu kennen sowie alle Regeln, die dabei zu beachten sind. Und dann ist die Beute mit |19|Heldenkraft zu stellen und zu erlegen. Einmal im Gehege Le Pecq, unterhalb des Schlosses Saint-Germain-en-Laye, will er einen Hirsch hetzen. »Sire«, sagen die Jäger, »das wird nichts. Es regnet. Im Regen verlieren die Hunde die Fährte.« Ludwig läßt sich nicht abhalten, und mit seinem Spürhund pirscht er selbst nach dem Tier, er setzt an diese Aufgabe ununterbrochen drei Stunden in Regen und Hagel. Endlich spürt er die Beute auf, jetzt heißt es nur noch dranzubleiben. Er überläßt diese Sorge seinen Jägern, kehrt zurück zum Schloß, geht zur Messe, besucht die Königin, kurz, erfüllt seine üblichen Pflichten. Dann speist er, und frisch gestiefelt eilt er wieder zum Gehege und hetzt den Hirsch, den er am Morgen aufgespürt hat. Fünf Stunden dauert die Hetz, von ein Uhr mittags bis sechs Uhr abends. Es dunkelt, das Tier liegt endlich im Wundbett, verbellt von der Meute, und Ludwig reitet heim zum Schloß. Er wird ausgekleidet, getrocknet, neu eingekleidet. Er besucht die Königin. Im Laufe dieses denkwürdigen Tages hat er ihr zweimal zehn Minuten gewidmet und dem Hirsch acht Stunden.
Weil er ein besessener Jäger war und weil er Rebellen und Verräter exemplarisch bestrafte, wurde behauptet, er habe einen Hang zur Grausamkeit. Weit entfernt, dieses Urteil zu bestätigen, bestreite ich es sogar entschieden. Ich jedenfalls würde sagen, ihm ging nichts über die Gerechtigkeit.
Vielleicht erinnert sich meine schöne Leserin, wie er als Zehnjähriger seiner kleinen Schwester Elisabeth eigenhändig ein Omelette bereitete und dabei zu ihr sagte, daß er von gewissen bösen Zungen Ludwig der Stotterer genannt werde, aber daß er wolle, daß man ihn einmal Ludwig den Gerechten nenne. Es war die Zeit, als er unter den Ungerechtigkeiten seiner Mutter ihm gegenüber desto grausamer litt, weil er nicht offen dagegen protestieren konnte: er wäre ausgepeitscht worden.
So gärte in den ganzen Jahren der Regentschaft in ihm ein unablässiger Groll, der meines Erachtens viel zu seiner Unnachgiebigkeit beitrug und die Strenge seiner Herrschaft erklärt. Ich nenne hier nur ein Beispiel. Ihm unterstand eine Kompanie Schweizer Soldaten in seinem Alter, die er ebenso straff hielt wie sich selbst. Und ich entsinne mich, wie er – es war ein Jahr nach dem Staatsstreich – diese Burschen einmal unangemeldet um sieben Uhr früh in ihrem Quartier aufsuchte |20|und einen noch im Bette fand. Erbost über solche Disziplinlosigkeit, ließ Ludwig ihn auf den Dunghaufen im Hof schaffen und ihm das Gesicht mit Pferdemist einschmieren.
Sicher war das noch wenig in Anbetracht der grausamen Strafen, die unsere Hauptleute über ihre Soldaten verhängten.1Und vielleicht berührte mich diese nur deshalb so stark, weil ich dabei Zeuge war.
In seiner Härte beim Strafen unterschied er sich meines Erachtens am meisten von seinem Vater. Ludwig verzieh nicht gerne und nie zweimal. Doch bedeutete diese Unerbittlichkeit nicht, daß ihm menschliche Gefühle abgingen. Als eine Frau, gegen die er mit einigem Recht einen sehr heftigen Groll hegen konnte – es war die Frau von Concini, Leonora Galigai –, als diese, sage ich, enthauptet und verbrannt wurde2, erschütterte ihn der Bericht von der Hinrichtung dermaßen, daß er nachts nicht schlafen konnte. Ich glaube, ihm wäre es lieber gewesen, man hätte sie zurückgeschickt nach Italien und sich etwas anderes ausgedacht als gerade diesen finsteren Hexenprozeß, um ihr den unermeßlichen Reichtum abzuringen, den sie infolge ihrer Macht über die Regentin hatte zusammenscharren können.
***
Nie werde ich den 13. September 1617 vergessen, ebensowenig wie Monsieur de Luynes, aber bestimmt aus einem ganz anderen Grund.
An dem Tag nämlich heiratete Luynes. Mit seinem Wunsch danach hatte er Ludwig schon eine Weile in den Ohren gelegen, genaugenommen seit den Tagen nach dem Staatsstreich, als Ludwig ihn mit Geschenken und Ehren überhäufte. Als einer der reichsten Grundherren nun und sicher der einflußreichste |21|im Land, wollte er ein Haus gründen, das die große Gunst, in der er stand, überlebte.
Weil Ludwigs Liebe zu ihm grenzenlos schien und der Hofklatsch darüber in die besagte Richtung ging, mag es auch sein, daß Luynes die Lästermäuler ein für allemal stopfen wollte, indem er bewies, daß er jedenfalls nicht unempfindlich war für die Reize des gentil sesso1und auch nicht unfähig, Nachkommen zu zeugen.
Ludwig, der ihm damals nichts abschlagen konnte, wollte ihn zuerst mit seiner illegitimen Halbschwester, Mademoiselle de Vendôme, vermählen. Aber das Fräulein trug die Nase hoch. Sie spreizte sich damit, daß in ihren Adern das Blut von Henri Quatre floß, und obwohl Luynes einer jener schönen Kavaliere war, nach denen die Mädchen sich die Finger ablecken, wollte sie ihn nicht: dieser niedere provenzalische Adel machte ihr übel.
Mehr Erfolg hatte Luynes bei Marie de Rohan-Montbazon, sei es, daß ihr Vater, der Herzog von Montbazon, sie zu dieser Ehe drängte, weil sein Ehrgeiz ihm riet, sich mit dem Favoriten zu verbinden, sei es, daß sie selbst darauf brannte, sich auf eigene Füße zu stellen, weil sie die Männer sehr liebte und schon über ihren künftigen Ehemann hinausblickte.
Ludwig hatte für Zeremonien und Feierlichkeiten nichts übrig, deshalb wurde die Hochzeit in der Turmkapelle abgehalten. Eine große Teilnehmerzahl war durch den beengten Raum ebenso ausgeschlossen wie durch die höchst ungewöhnliche Stunde: fünf Uhr morgens! Nach meiner Kenntnis ist noch nie eine Dame so früh, quasi in der halben Nacht aufgestanden, um ihren Bräutigam zu ehelichen.
Die Trauung wurde vom Erzbischof von Tours vollzogen, einem Fettsack, den man nur mit Mühe zu so unchristlicher Stunde aus den Federn holen konnte und der während der Feier sehr zu kämpfen hatte, um seine Augen offenzuhalten, zweimal verwechselte er sogar die Namen der Brautleute.
Der Herzog von Montbazon hatte nur eine Handvoll Freunde eingeladen, dafür aber waren sämtliche Verschworenen des vierundzwanzigsten April auf königlichen Befehl zugegen, auch Déagéant und Tronçon, die »kleinen Bürgerlichen«, wie |22|Madame de Guise sie nannte. Déagéant glänzte in seiner neuen Rolle als Finanzintendant und Mitglied des Kronrats. Und, wahrhaftig, als mein Blick zufällig den guten Tronçon streifte, dachte ich nicht im Traum daran, daß ich ihm in den folgenden zwei Tagen verzweifelt nachlaufen würde, damit er mir ein Licht aufstecke.
Tronçon besaß nicht die überragenden Fähigkeiten Déagéants, aber seine neue Aufgabe – Ludwig hatte ihn zu seinem Privatsekretär erwählt – behagte ihm sehr, und er erfüllte sie mit einem so majestätischen Gebaren, daß jeder, der es mit ansah, glauben konnte, die Entscheidung stamme von Tronçon selbst: Er hatte den Betreffenden die Gnade oder Ungnade des Königs zu übermitteln.
Mehr als jede Gnade ergötzt die Schadenfreude des Hofes natürlich die Ungnade, die einen hohen Amtsträger Seiner Majestät trifft, und so gewöhnte man es sich bei Hofe an, den Auftritt des königlichen Sekretärs im Hause eines Unglücklichen eine Tronçonnade zu nennen.
Bei Luynes’ Hochzeitsfeier gab es weder Musik noch Gesang, und obwohl Ludwig dem Erzbischof befohlen hatte, seine Predigt abzukürzen, wurde sie länger als gedacht, soviel Mühe hatte der Mann, den Text abzulesen, den ihm sein Großvikar geschrieben hatte. Dennoch ging die Sache ziemlich glatt, um sechs Uhr war alles vorbei. Die prächtig geschmückte Mademoiselle de Montbazon war Madame de Luynes geworden und wurde in Bälde – und meines Erachtens war diese Erhöhung bereits eingeplant – die Frau Herzogin von Luynes.
Die Gesellschaft drängte sich, den Jungvermählten ihre Glückwünsche darzubringen, und ich konnte die Braut in Muße betrachten: Ein hochgewachsenes Mädchen, blühend im Fleische, frisch und mutwillig, und ihr großzügiges Dekolleté, wie ich es von einer Braut in einer Kapelle nicht erwartet hätte, war so schöner Versprechen voll, daß die Heiligen in den Glasfenstern in Versuchung geraten konnten.
Nicht daß sie eine klassische Schönheit war, ihre Nase war ein bißchen zu lang, aber nicht so, daß sie das Gesicht verunzierte. Ich beobachtete, wie herausfordernd sie die Kavaliere um sich anblickte, und trotz dieser Beobachtung, nach der ich hätte auf der Hut sein müssen, war ich, als ich mit meiner Gratulation an der Reihe war, von ihrem strahlenden Lächeln und |23|ihren großen blauen Augen, ihrem Geist und Feuer im Nu bis ins Herz entzückt. Es war eine unwiderstehliche, jähe Regung, weder mein Willen noch mein Verstand hatten daran das geringste Teil. Doch empfand ich am nächsten Tag einige Scham wegen des ungehörigen Aufruhrs, in den dieses Lächeln mich gestürzt hatte, denn wenn auch nur in Gedanken und für einen kurzen Moment hatte es mich untreu gegen meine Pfalzgräfin gemacht.1
Nachdem Ludwig sich von den Neuvermählten verabschiedet hatte, lief er los, ohne zu sagen wohin, und so schnell, daß wir ihm kaum folgen konnten. »Wir«, das waren außer mir der Marschall Vitry, sein Bruder du Hallier, der neugebackene Gardehauptmann, Monsieur de la Curée, Hauptmann der Kavallerie, der königliche Hofmeister Baron von Paluau und der junge Montpouillan, ein Sohn des Herzogs de La Force. Höchst verwundert also sahen wir Ludwig im Geschwindschritt durch Galerien und Treppenhäuser des Louvre eilen, ohne zu wissen, wohin zum Teufel es ihn um halb sieben Uhr früh so heftig trieb, obendrein, wie wir alle, mit nüchternem Magen, weil er beim Lever auch nicht eine Krume zu sich genommen hatte.
Der Wachsoldat war so überrascht, als der König am Schalter erschien, daß er ihn zuerst gar nicht erkannte und womöglich noch festgenommen hätte, wäre hinter ihm nicht Vitrys dicke Rübe aufgetaucht. Flugs beeilte er sich also, die Eintretenden zurückzudrängen und Seiner Majestät Platz zu machen auf dem schmalen Steg, der zur ›schlafenden Brücke‹ führte. Dann öffnete er weit, aber natürlich nicht allein, die Porte de Bourbon, die nur angelehnt war.
Erst draußen begriffen wir, was Ludwig seit Anfang dieses Eilmarsches im Sinn gehabt hatte, nämlich als wir ihn mehrfach ans Tor des Jeu de Paume klopfen sahen, das, wie mein Vater sagte, unter Karl IX. das Fünfjungfernhaus hieß, weil der damalige Besitzer des Ballspielhauses fünf mannbare Töchter hatte. Dieser Name war dem Jeu de Paume noch geblieben, als die Jungfern längst keine Jungfern mehr, sondern Ehefrauen und Mütter und der Hausherr begraben waren.
Vitry verstärkte das königliche Klopfen mit seinen großen Fäusten und machte einen Lärm, bis die Pforte des Jeu de |24|Paume schließlich aufging und ein dürrer, altersgrauer Wächter erschien, der bei Ansicht des Königs fast in Ohnmacht fiel. Die große Halle lag zu dieser morgendlichen Stunde verlassen, und nachdem die Tür hinter uns geschlossen war mit dem Gebot, niemanden hereinzulassen, zeigte es sich, daß keine Schiedsrichter, kein Schreiber, keine Balljungen da waren. Und wir hätten auch keine Bälle und Schläger gefunden, wenn der Haudegen Vitry nicht seine eigene Methode gehabt hätte, einen verschlossenen Schrank zu öffnen.
»Vitry zwingt wieder mal eine Tür«, sagte Ludwig süßsauer in Anspielung darauf, daß Vitry einige Jahre zuvor sich nicht gescheut hatte, ein Gefängnistor zu sprengen, um zwei Soldaten zu befreien, die der Polizeihauptmann in Gewahrsam genommen hatte.
»Alsdann!« sagte Ludwig, den Schläger in der Hand, »wer spielt gegen mich? Ihr, Vitry?«
»Sire«, sagte Vitry, »ich wäre ein jämmerlicher Gegner. Nehmt lieber La Curée. Der ist sehr gut.«
»Ja, gerne, Sire«, sagte La Curée, der aber ganz und gar nicht entzückt schien, sich mit leerem Magen ins Getümmel zu stürzen, denn er war ein großer Schlemmer.
Vielleicht erinnert man sich, wie bei dem ländlichen Festschmaus der ›Freßsäcke vom Hofe‹, denen Ludwig sich damals fröhlich zugesellte, Monsieur de La Curée, eine große Serviette um den Hals, zu Pferde die Schüsseln von der Küche holte und sie auch zu Pferde den ›Freßsäcken‹ überbrachte, nicht ohne davon jeweils eine Portion in sich hineinzustopfen.
Ludwig beauftragte Vitry, Schiedsrichter zu sein, aber weil kein Schreiber da war, übernahm der Marschall auch die Aufgabe, auf einer schwarzen Tafel die Punkte anzuzeichnen, die beide Spieler errangen.
Mich wählte der König zum Netzrichter, doch gab es hier kein Netz, sondern ein zwischen den Spielern gespanntes Seil, das in ganzer Länge mit Fransen behängt war, die bis auf den Boden hinabreichten. Weil aber die Fransen nicht so dicht fielen, daß ein Ball nicht doch einmal hindurchflog, was zu endlosen Streitereien zwischen den Spielern geführt hätte, mußte der Netzrichter entscheiden.
Ludwig bestimmte Paluau und Montpouillan, die Bälle aufzusammeln, die im Fünfjungfernhaus aus Hundehaar mit einem |25|Lederbezug bestehen – aber nicht irgendwelchem Hundehaar und nicht irgendwelchem Leder –, und, nebenbei gesagt, als die besten in Europa gelten, ich bin nämlich sehr stolz auf alles, was es in unserem Reich Gutes gibt. Die beiden Balljungen mußten ebensoviel laufen wie die Spieler, doch ohne jeden Ruhm, es war eine demütige und anstrengende Aufgabe, weniger für Montpouillan, der mit seinen sechzehn Jahren dünn und behende war wie ein Windhund, aber für Paluau, den sein verfrühter Schmerbauch sehr behinderte.
»Meine Herren, wettet Ihr nun?« fragte Ludwig ungeduldig, denn er hatte sein Wams abgelegt und begann zu frösteln.
»Ja, sofort«, sagte der Marschall, und weil er wußte, daß er dem König den besten Gefallen tat, wenn er ihm nicht schmeichelte, setzte er auf La Curée.
Doch genauso geizig wie reich, warf er nur zwei Ecus in den Beutel, der an einem der Netzpfeiler hing. Aber selbst dieser schäbige Einsatz mißhagte ihm, es war für ihn verlorenes Geld, weil der gesamte Wettertrag vom Sieger eingestrichen wurde.
Monsieur du Hallier, sein Bruder, der wie eine bläßliche Zweitausgabe des Älteren wirkte und ihm alles nachmachte, setzte ebenfalls zwei Ecus auf La Curée. Du Hallier hatte auf Vitrys Zeichen hin einen der drei Schüsse abgefeuert, die Concini auf der schlafenden Brücke des Louvre getötet hatten. Aber obwohl alle drei Schüsse tödlich waren, wie sich nachträglich herausstellte, schwoll Du Hallier der Kamm, und er schrie lauthals aus, nur sein Schuß sei der entscheidende gewesen, so daß die beiden anderen Schützen ihn ums Haar zum Duell bestellt hätten, hätte Vitry ihm das große Maul nicht gestopft.
Der Hofmeister, Monsieur de Paluau, hatte wahrscheinlich das gleiche Kalkül angestellt wie Vitry und setzte ebenfalls auf La Curée. Und weil er den Marschall nicht kränken wollte, indem er mehr gab, legte auch er zwei Ecus in den Beutel. Jedenfalls blieb Montpouillan und mir zur gerechten Kostenverteilung nur noch übrig, jeder drei Ecus auf Ludwig zu setzen. Insgesamt betrug der Siegerpreis also zwölf Ecus, ein bißchen wenig für einen Kavalleriehauptmann, erst recht aber für einen König.
»Sire, soll ich losen, wer anfängt?« fragte Vitry und zog auch gleich ein Goldstück aus dem Beutel. »Was sagt Eure Majestät, Kopf oder Zahl?«
|26|»Kopf«, sagte Ludwig mit einem Lächeln, denn er entsann sich gerne, daß es ja sein Kopf war.
Der Ecu überschlug sich in der Luft, fiel mit dem königlichen Porträt nach oben auf den Boden, Seine Majestät packte den Schläger fester, die Partie begann. Vitry hob das Goldstück auf und steckte es wie selbstverständlich in seine Tasche.
»Nehmt!«1rief der König mit geschwungenem Schläger.
»Ich nehme,« rief La Curée auf der anderen Seite des Feldes.
La Curée gewann gegen den König, dann verlor er, gewann wieder, aber auf einmal erlahmte sein Spiel, er brachte nichts Rechtes mehr zustande.
»Ihr laßt nach, La Curée!« rief Ludwig.
»Weil ich Hunger habe, Sire!« versetzte La Curée.
»Wenn ich Euch besiege, soll es nicht am Hunger liegen. Paluau!« rief er, »lauft in die Küche und bestellt ein Frühstück.«
»Hierher, Sire?« fragte Paluau und machte große Augen.
»Hierher!«
»Für Euch, Sire?«
»Für alle!«
Und als Paluau seinen Schmerbauch sachte davonschob, rief Ludwig: »Nun lauft doch, Paluau! Lauft!«
Alles lachte, und sogar Ludwig schmunzelte, er war bester Laune an diesem Morgen, schließlich hatte er seinen Favoriten binnen Monatsfrist mit einer berühmten alten Familie verbunden.
Bis das Frühstück kam, gewann Ludwig noch zwei Spiele nacheinander gegen La Curée, weil der, seit die Rede von Essen war, an nichts anderes mehr dachte. Endlich erschienen zwei kräftige Küchenjungen, die auf einem kleinen Karren zwei große Schüsseln hereinrollten, begleitet von den beiden Ersten Kammerdienern Seiner Majestät, Henri de Berlinghen und Soupite. Der erste trug eine dicke Butterkugel wie eine Monstranz vor sich her, der zweite Brot, um eine ganze Mannschaft sattzumachen.
Den Vater von Soupite kannte ich nicht, dafür aber sehr gut den von Berlinghen, der bei Henri Quatre lange Jahre Erster Kammerdiener gewesen war: ein treuer, ergebener Edelmann, |27|verschwiegen und unbestechlich. Nach seinem frühen Tod konnte der Sohn ihm nicht ohne weiteres im Amte folgen, er war zu jung. In Anhänglichkeit an seinen Vater wollte Ludwig jedoch nur einen Berlinghen in seinem Dienst, und so mußte er sich mit dem Grünschnabel begnügen, der gerade erst dreizehn war. Soupite war nicht viel älter noch besser ausgebildet, kein Wunder also, daß Ludwig oft Ärger mit ihnen hatte, sie wegen ihrer unzähligen Fehler zurechtweisen und bestrafen mußte, aber trotzdem liebte er sie. Und gelegentlich, wenn er seine Majestät vergaß und sich auf sein Alter besann, spielte er mit ihnen.
Die Küchenjungen und Ersten Kammerdiener stellten die Schüsseln auf die Zuschauerbänke, die Tisch und Stühle ersetzten. Alles machte sich über das Fleisch mit Fingern und Zähnen her, weil die Küche Messer und Gabeln vergessen hatte. Am meisten Ehre wurde den Bressehühnchen erwiesen, die zwar am Vortag gebraten, aber am saftigsten waren. Wie ich sah, aß Ludwig gegen seine Gewohnheit wenig, vermutlich dachte er an die unvollendete Partie. Dafür schlang La Curée für drei, immerhin hatte er einen Ruf zu verteidigen.
»Ah, leckeres Keulchen!« sagte er, und der Speichel troff ihm quasi vom Munde, als er sein Lieblingsstück von einem goldenen Hühnchen abriß.
»Pah!« sagte Vitry, »Luynes hat jetzt ein viel leckereres beim Wickel!«
»Vitry!« sagte Ludwig in strengem Ton, aber ohne die Stimme zu heben, »ich will nicht, daß vor mir unzüchtig und unflätig geredet wird.«
Vitry senkte sofort den Kopf, und es war eine Pracht, wie dieser Klotz jungfräulich errötete. So hatte ich ihn schon einmal anlaufen sehen, als er in Ludwigs Kutsche vor Hunger versucht hatte, heimlich ein Biskuit zu verdrücken, und Ludwig bemerkte: »Vitry, wollt Ihr meine Karosse zur Wirtschaft machen?«
Selbstredend war jene wegen Madame de Luynes erteilte königliche Rüge noch vor Mittag am ganzen Hof herum, die einen mokierten sich hinter vorgehaltener Hand über die Prüderie des Königs, die anderen, besonders die Damen, beklagten die Grobheit des Marschalls. Ich gehörte zu letzteren, teils vielleicht, weil Madame de Luynes sich schon in mein Herz gestohlen |28|hatte, teils aber auch, weil Ludwig nach meiner Ansicht recht daran tat, in seiner Gegenwart keine Zoten zu dulden. Einfachheit hieß bei ihm nicht, daß er alles durchgehen ließ. Es war vorgekommen, daß Ludwig, erschöpft und hungrig nach langer Jagd, zu Fuß bei Wind und Regen, ein ländliches Gasthaus betreten und dort Schweizer eines seiner Regimenter vorgefunden hatte. Er setzte sich mit ihnen an denselben Tisch und teilte mit ihnen Roggenbrot, gesalzene Butter und billigen Wein. Aber man gebe sich keiner Täuschung hin: dabei blieb er immer der König.
Was die Ballpartie mit Monsieur de La Curée betrifft, so gewann Ludwig sie, weil sein Gegner nun schwer war von Fleisch und Wein. Und kaum hatte Vitry mit Stentorstimme den Sieg des Königs verkündet, überbrachte ich Seiner Majestät den Beutel mit dem Wettertrag. Wie gesagt, waren es keine zwölf Ecus mehr, sondern elf. Aber entweder hatte der König Vitrys Unverschämtheit nicht bemerkt, oder er wollte den Marschall an einem Morgen nicht ein zweites Mal rüffeln, jedenfalls sagte er nichts. Ganz anders als sein Vater, der auf alle Glücksspiele versessen war und auch schamlos mogelte, hielt Ludwig darauf, Geld und Vergnügen nicht zu vermischen. Wenn aber der Brauch es wie bei diesem Spiel verlangte, respektierte er streng die Regeln, stritt nie um einen Punkt und war ein guter Verlierer.
An diesem, wie gesagt, für Luynes und mich denkwürdigen 13. September sah ich Ludwig noch zweimal: von Mittag bis um halb drei Uhr im Kronrat und am Abend bei Monsieur de Luynes, der um acht Uhr dem König und den Gästen seiner morgendlichen Trauung ein Souper gab. Das ganze Mahl war höchst raffiniert, doch hatte ich kaum darauf acht. Madame de Luynes hatte ein neues Gewand angelegt, das ihrem Hochzeitskleid an Glanz nicht nachstand. Ihr Antlitz war im Kerzenschein noch schöner, süßer und voll eines innigen Zaubers, der mich tief berührte. Abgesehen von zwei, drei Malen schaute ich sie, ganz gegen mein Wünschen, jedoch nicht an. Ich fürchtete, wenn ihre schönen blauen Augen meinen Blick kreuzen würden, verfiele ich noch tiefer in jene Sklaverei, in die ich in der Frühe bereits unverhofft geraten war.
Das Souper endete um elf Uhr, und um die beiden Gatten nicht zu trennen, verbot Ludwig seinem Gastgeber, ihn zu seinen |29|Gemächern zu geleiten, wie es das Protokoll verlangte, Luynes war ja wie ich Erster Kammerherr. Dadurch hatte Ludwig indes keinen Verlust, denn alle, die am Souper teilgenommen hatten, folgten ihm bis an seine Tür, dort jedoch entließ er die ganze Gesellschaft.
Als ich diesen Urlaub auch auf mich bezog und gehen wollte, sagte er: »Bleibt, Sioac.«
So hatte Ludwig mich genannt, als er sechs Jahre alt war und noch kein r sprechen konnte. Und jedesmal, wenn er mir seine Zuneigung bekunden wollte, kam er auf diese kindliche Anrede zurück.
Berlinghen hing mit ausgestreckten Beinen schräg auf einem Stuhl und schlief wie ein Kind. Ludwig gab ihm einen leichten Klaps auf die Wange, um ihn zu wecken. Entschuldigungen stotternd, fuhr das Bürschchen in die Höhe, und wer weiß woher erschien auch Soupite mit strubbeligem Haar und halboffenem Wams. Zu zweit begannen sie Ludwig zu entkleiden, weil sie aber noch halb schliefen, stellten sie sich so ungeschickt an, daß sie nie fertiggeworden wären, hätte der König ihnen nicht geholfen. Dann streifte er eigenhändig sein Nachthemd über, legte sich zu Bett und faltete die Hände zum Gebet.
Mit gesenktem Kopf stand ich abseits und wartete, bis er sich bekreuzigte, dann sagte ich: »Sire, ich wünsche Euch eine gute Nacht.«
Hierauf antwortete Ludwig in dem gleichmütigsten Ton und ohne daß in seinem Gesicht der kleinste Muskel zuckte: »Gute Nacht, Graf von Orbieu.«
Ich traute meinen Ohren nicht.
»Sire!« war alles, was ich hervorbrachte.
»Sucht Tronçon auf«, sagte Ludwig. »Er wird Euch meine weiteren Intentionen mitteilen.«
Und zu guter Letzt reichte er mir die Hand. Ich küßte sie, aber ohne das Knie zu beugen, derart von Sinnen war ich. Es blieb mir nur mehr übrig, rückwärts zur Tür zu gehen, sosehr mir die Beine auch zitterten und obwohl ich kaum mehr wußte, wo oder wer ich war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!