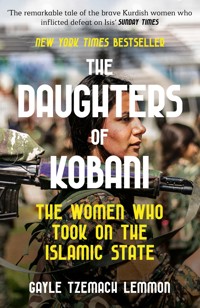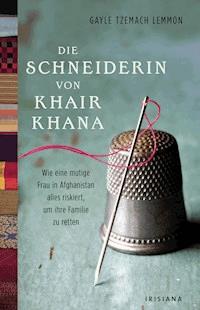
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Irisiana
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Herzerwärmend, inspirierend, wunderschön – der New-York-Times-Bestseller
Als die Taliban Kabul einnehmen, ändert sich das Leben von Kamila Sidiqi über Nacht dramatisch. Da ihr Vater und ein Bruder zur Flucht gezwungen werden, muss Kamila plötzlich das Brot für sich und ihre fünf Geschwister verdienen. Mit Mut und Entschlossenheit gründet sie in dieser gefährlichen Zeit eine Schneiderei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für all die Frauen,deren Geschichte niemalserzählt werden wird
sowie fürRhoda Tzemachund Frances Spielman
Anmerkung der Autorin
Die Geschichten in diesem Buch spiegeln drei Jahre Vor-Ort-Interviews und Recherche in Kabul, London und Washington, D.C. wider. Während dieser Zeit hat sich die Situation in Afghanistan zusehends verschlechtert. Aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Privatsphäre habe ich für dieses Buch die Namen vieler Personen geändert. Zudem habe ich, wenn ich darum gebeten wurde, weniger relevante Details weggelassen, um der Sicherheit dieser Personen willen oder um deren Privatsphäre zu schützen. Ich habe mich sehr darum bemüht, die Zeiten und Daten ihrer Geschichten korrekt wiederzugeben; dennoch könnte es mit der Präzision etwas hapern, weil in den letzten drei Jahrzehnten und seit Beginn dieser Geschichte in Afghanistan so viel geschehen ist.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Das erste Mal landete ich in Afghanistan an einem rauen Wintermorgen im Jahr 2005. Der zweitägige Flug hatte mich von Boston über London zunächst nach Dubai geführt. Meine Augen brannten, mir war schwindelig. Zu nervös zum Schlafen hatte ich die ganze Nacht im Terminal II in Dubai auf den Ariana-Anschlussflug nach Kabul gewartet, der auf 6.30 Uhr angesetzt war. Die afghanische Fluggesellschaft verlangte von ihren Gästen, sich drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden, was die Suche nach einem Hotelzimmer irgendwie überflüssig machte. Die Abflüge vor Morgengrauen auf der großen schwarzen Anzeigetafel lasen sich wie ein Reiseführer zu den exotischsten Krisenherden der Welt: Karatschi, Bagdad, Kandahar, Luanda. Mir wurde plötzlich klar, dass ich die einzige Frau in der Abflughalle war; also wartete ich auf einer Fensterbank in der Ecke des spärlich ausgestatteten Terminal II, lud mein Handy auf und versuchte mich dabei möglichst unsichtbar zu machen. Dennoch spürte ich die irritierten Blicke der Männer, die in ihren lose sitzenden Shalwar Kameez an mir vorübergingen und die gemieteten silbernen Gepäcktrolleys vor sich her schoben, auf denen sich vollgestopfte und mit einer schweren braunen Kordel zusammengebundene Koffer türmten. Vermutlich haben sie sich gefragt, was um alles in der Welt die junge Frau da ganz allein um drei Uhr morgens zu suchen hatte.
Um ganz ehrlich zu sein: Das fragte ich mich auch. Ich schlich zur leeren, aber frisch geputzten Damentoilette, um aus dem grauen Rollkragenpulli, den Kasil-Jeans und den braunen Lederstiefeln zu schlüpfen, die ich in Boston noch gebraucht hatte. Stattdessen streifte ich mir ein Paar übergroße schwarze Hosen, ein schwarzes, langärmeliges T-Shirt, schwarze Aerosoles-Schuhe und schwarze Socken über. Mein einziges Zugeständnis an die Farbe war ein lose sitzender rostbrauner Pulli, den ich in einem New-Age-Laden in Cambridge, Massachusetts, gekauft hatte. Meine Freundin Aliya hatte mir ein schwarzes Kopftuch aus Wolle geliehen, das ich mir nun möglichst salopp um Kopf und Schultern schlingen wollte, so, wie sie es mir gezeigt hatte, als wir auf einer Plüschcouch Tausende von Kilometern – und Welten – entfernt in ihrem Zimmer der Harvard Business School gesessen hatten. Fünfundzwanzig Stunden später stand ich allein in einer sterilen Damentoilette in Dubai und drapierte das Tuch ein Dutzend Mal um, bevor es einigermaßen passabel aussah. Im Spiegel erkannte ich mich kaum wieder. »Ist schon in Ordnung«, sagte ich laut zu meinem besorgt aussehenden Spiegelbild. »Die Reise wird toll werden.« Ich sprach mir weiter Mut zu, drehte mich auf dem Gummi-Keilabsatz meiner Schuhe um und verließ die Toilette.
Acht Stunden später stieg ich die Metalltreppe zur provisorischen Rollbahn des Kabul International Airport hinab. Die Sonne schien hell, und augenblicklich stieg mir der Geruch verkohlter Winterluft – frisch, aber mit Rauch gewürzt – in die Nase. Ich versuchte, Aliyas Wolltuch an Ort und Stelle zu halten, während ich meinen orangefarbenen Rollkoffer hinter mir herzog. Ich musste alle paar Schritte stehen bleiben und den Schleier neu ordnen. Niemand hatte mich darauf vorbereitet, wie schwierig es ist, einen Schleier zu tragen und sich gleichzeitig zu bewegen – und dabei noch schweres Gepäck hinter sich herzuschleppen. Wie gelang es den Frauen um mich herum bloß, dabei so elegant auszusehen? Das wollte ich auch, doch stattdessen wirkte ich lächerlich, ein tollpatschiges fremdes Entlein unter einheimischen Schwänen.
Ich wartete eine Stunde lang in dem Flughafengebäude im Stil der Sechzigerjahre, fasziniert von den Überresten russischer Panzer, die immer noch neben der Startbahn standen, obwohl die Sowjets Afghanistan schon vor Jahrzehnten verlassen haben. Die Passkontrolle verlief problemlos. So weit, so gut, dachte ich. Doch nach dem Zoll strebten alle um mich herum in verschiedene Richtungen davon, da sie im Gegensatz zu mir offensichtlich ein Ziel hatten. Mein Magen krampfte sich vor Angst zusammen, als mir klar wurde, dass ich nicht wusste, was ich tun oder wohin ich gehen sollte. Normalerweise arbeiten Journalisten, die an weit entfernte und gefährliche Orte reisen, mit einem Mittelsmann zusammen, einem Einheimischen, der ihnen Reise, Interviews und Unterkunft organisiert. Meiner, ein junger Mann namens Mohamad, war nirgends in Sicht. Ich suchte in meiner Brieftasche nach seiner Telefonnummer. Ich fühlte mich hilflos und hatte Angst, versuchte aber dennoch, cool und gefasst auszusehen. Wo steckte er denn nur? Hatte er die Amerikanerin, die ehemalige ABC-News-Sendeleiterin, vergessen, der er in einer E-Mail fest versprochen hatte, sie am Flughafen abzuholen?
Schließlich fand ich seine Handynummer auf einem Stück zerknülltem Papier in den Tiefen meines Geldbeutels. Doch anrufen konnte ich ihn immer noch nicht – pflichtschuldigst hatte ich zwar mein britisches Handy aufgeladen, doch die Londoner SIM-Karte funktionierte in Kabul nicht. So viel zum Thema Vorbereitung.
Zehn Minuten vergingen, zwanzig Minuten. Immer noch kein Mohamad. Ich stellte mir vor, wie ich fünf Tage später immer noch am Kabuler Flughafen feststecken würde. Als fröhliche afghanische Familien durch die Glastüren hinausströmten, kam ich mir einsamer vor als letzte Nacht um drei in Dubais Terminal II. Nur die ernsten britischen Soldaten, die draußen die riesigen NATO-Panzer bewachten, trösteten mich etwas. Im schlimmsten Fall konnte ich sie um Hilfe bitten. Nie zuvor hatte ich den Anblick eines Panzers am Flughafen beruhigend gefunden.
Nach einer Weile fiel mein Blick auf einen etwa zwanzigjährigen Mann mit Bart, der an einem kleinen Eckstand in der Nähe der Eingangstür Telefonkarten, Süßigkeiten und Säfte verkaufte. Mit einer Fünf-Dollar-Note und einem breiten Lächeln bewaffnet, fragte ich ihn auf Englisch, ob ich sein Handy benutzen dürfte. Er lächelte ebenfalls und gab es mir.
»Mohamad!« Ich schrie fast, um sicherzustellen, dass er mich auch hörte. »Hallo! Hallo, hier ist Gayle, die amerikanische Journalistin. Ich bin am Flughafen. Wo bist du?«
»Hallo Gayle«, entgegnete er ruhig. »Ich steh auf dem Parkplatz, schon seit zwei Stunden. Näher komme ich nicht heran, wegen der Sicherheitsbestimmungen. Folge einfach der Menge, ich warte auf dich.«
Natürlich – die Sicherheitsbestimmungen! Wie hatte ich die vergessen können?
Ich schob meinen übervollen Kofferkuli einen gefühlten Viertelkilometer weit zu einem Parkplatz, weit entfernt von den NATO-Panzern und den britischen Soldaten. Und da stand, wie versprochen, Mohamad und lächelte herzlich.
»Willkommen in Kabul«, sagte er und nahm mir meinen grünen Eddie-Bauer-Seesack ab, der mit Stirnlampen, langen Unterhosen und Wolldecken vollgestopft war. Die hatte ich speziell für diese Reise gekauft. Ich fragte mich, wie viele naive Fremde Mohamad schon am Flughafen abgeholt hatte. Seit Jahren arbeitet er mit Journalisten zusammen, war selbst einer. Eine Freundin bei CBS News in London hatte darauf bestanden, ihn anzuheuern, da er professionell, erfahren und vertrauenswürdig war – genau das, was ich im Winter 2005 in Kabul brauchen würde. Zu dieser Zeit eskalierten gelegentliche Raketenangriffe und Bombenanschläge gerade zu einem ausgewachsenen Aufstand. Ich war ihr für ihre Beharrlichkeit in diesem Augenblick sehr dankbar.
Auf den Straßen der afghanischen Hauptstadt fand ein einziges, kakophones Hauen und Stechen statt. Amputierte mit Krücken, mit Klebeband reparierte Autos, Esel, mit Brennmaterial beladene Fahrräder, Geländelimousinen der Vereinten Nationen – sie alle kämpften um die Vorfahrt oder den Vortritt, und das ohne Ampeln und mit nur hier und da einen Verkehrspolizisten. Der schmierige Ruß der braunen Kabuler Luft klebte an allem: an der Lunge, an den Pullis, an den Kopftüchern und an den Fenstern. Ein recht giftiges Souvenir jahrzehntelangen Krieges, in dem alles, von den Bäumen bis zum Abwassersystem, zerstört worden war.
Einen solchen urbanen Wilden Westen hatte ich noch nie gesehen. Andere Autos fuhren bis auf fünf Zentimeter an unseren blauen Toyota Corolla heran und schwenkten dann plötzlich wieder auf ihre eigene Spur zurück. Aus den Toyotas, Hondas und Mercedes, die mit uns im Verkehr feststeckten, dröhnte laute afghanische Musik. Die ganze Stadt hallte von den unzähligen schrillen Hupen wider. Weißhaarige alte Männer, die sich Wolldecken lose um die Schultern gelegt hatten, traten einfach auf die Straße und brachten den Verkehr zum Erliegen. Die herannahenden Autos wurden einfach ignoriert. Offensichtlich waren sie wie alle anderen auch an diesen verrückten Wirrwarr gewöhnt, dieses kaum im Zaum gehaltene Chaos namens Kabul.
Ich nicht. Ich war zum ersten Mal hier.
Ich hatte gerade Winterferien während meines MBA-Studiums – Master of Business Administration – an der Harvard Business School. Der Journalismus war immer meine große Liebe gewesen, doch hatte ich ein Jahr zuvor meine Stelle im Politikressort von ABC News aufgegeben, wo ich mich fast mein gesamtes Berufsleben lang mit der Berichterstattung über den Präsidentschaftswahlkampf beschäftigt hatte. Mit dreißig wagte ich den Sprung und beschloss, meiner Leidenschaft für internationale Entwicklung nachzugehen; wenn ich den Absprung jetzt nicht schaffen würde, dann nie. Also verließ ich das warme Nest meiner Washington-D.C.-Welt und sprang ins kalte Wasser der Graduiertenschule. Als Erstes begab ich mich auf die Jagd nach einem Thema voller Storys, über die niemand sonst berichtete. Storys, die die Welt interessierten. Das Thema, das mich anzog, waren Frauen, die in Kriegsgebieten arbeiten: eine besonders unerschrockene und inspirierende Form von Unternehmertum, das in den gefährlichsten Konfliktsituationen der Welt und ihren Nachwehen häufig zu finden ist.
Ich begann meine Recherchen in Ruanda. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was die Frauen dort zum Wiederaufbau ihres Landes beitrugen, indem sie sich und anderen Geschäftsmöglichkeiten schufen. Nach dem Völkermord von 1994 machten Frauen drei Viertel der ruandischen Bevölkerung aus, zehn Jahre später stellten sie immer noch die Mehrheit. Die Beamten, die in der Hauptstadt Kigali angestellt waren – alles Männer –, behaupteten, es gebe keine Story. Den Frauen in Ruanda würden keine kleinen Unternehmen gehören, sie würden ausschließlich im deutlich weniger lukrativen Mikrofinanzsektor arbeiten und Obst und Handarbeiten an kleinen Straßenständen verkaufen. Durch meine Recherche hatte ich herausgefunden, dass das nicht stimmte: Ich hatte Frauen ausfindig gemacht, denen Tankstellen gehörten und die Hotels leiteten. Und die Obstverkäuferinnen, mit denen ich gesprochen hatte, exportierten ihre Avocados und Bananen zweimal wöchentlich nach Europa. Kurz darauf veröffentlichte ich einen Artikel in der Financial Times, in dem ich einige der erfolgreichsten Unternehmer, denen ich begegnet war, vorstellte – darunter eine Frau, die ihre Korbwaren an Macy’s verkaufte, an die berühmte New Yorker Kaufhauskette.
Jetzt, wenige Monate später, war ich in Kabul und wieder für die Financial Times unterwegs, um über ein erstaunliches Phänomen zu berichten: über eine neue Generation afghanischer Geschäftsfrauen, die sich nach der Machtübernahme der Taliban entwickelt hatte. Außerdem sollte ich eine Protagonistin für eine Fallstudie finden, die man im darauffolgenden Jahr an der Harvard Business School in den Lehrplan aufnehmen wollte. Meine ehemaligen Kollegen in der Nachrichtenagentur hatten mir dabei geholfen, mich auf Kabul vorzubereiten, und mir mit ihren Kontakten den Weg geebnet. Doch kaum war ich angekommen, wurde mir auch schon klar, wie wenig ich wirklich über das Land wusste.
Alles, was ich hatte, war der leidenschaftliche Wunsch, einer Story nachzugehen.
Die meisten Storys über Kriege und ihre Folgen konzentrieren sich unweigerlich auf Männer: die Soldaten, die heimkehrenden Veteranen, die Staatsmänner. Ich wollte wissen, was Krieg für diejenigen bedeutete, die man zurückgelassen hatte – die Frauen, die weitermachten, auch wenn ihre Welt zusammenbrach. Der Krieg verändert das Leben der Frauen und zwingt sie meist unerwarteterweise und völlig unvorbereitet in die Rolle des Ernährers. Nun tragen sie die Verantwortung für das Überleben ihrer Familie und zeigen sich meist sehr erfinderisch im Erhalt ihrer Kinder und Gemeinschaften. Doch berichtet wird darüber selten. Wir sind viel mehr daran gewöhnt – und fühlen uns auch wohler damit –, Frauen als Kriegsopfer dargestellt zu sehen, die unser Mitgefühl verdienen – und nicht als unverwüstliche Überlebenskünstlerinnen, denen wir Respekt zollen sollten. Das wollte ich ändern.
Also reiste ich auf der Suche nach einer Story nach Kabul. Die Misere der afghanischen Frauen nach der Vertreibung der Taliban durch amerikanische und afghanische Truppen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatte weltweit das Interesse der Öffentlichkeit geweckt. Ich war gespannt darauf, welche Firmen von Frauen in einem Land gegründet wurden, das ihnen noch vier Jahre zuvor den Zutritt zu Schulen und die Ausübung eines öffentlichen Amtes verwehrt hatte. Aus Boston hatte ich vier einzeilig beschriebene und fein säuberlich zusammengeheftete Seiten mitgebracht, auf denen die Namen und E-Mail-Adressen möglicher Quellen standen. Die Liste war das Ergebnis wochenlanger Gespräche mit Fernseh-und Zeitungsreportern, Harvard-Kontakten und Helfern in der Region.
Ich besprach meine Interviewideen mit Mohamad. Als wir im leeren Speisesaal eines von Journalisten frequentierten Hotels Tee tranken, fragte ich ihn, ob er Frauen kenne, die ein eigenes Unternehmen führten. Er lachte. »Du weißt, dass sich die Männer in Afghanistan nicht in Frauenarbeit einmischen.« Doch nachdem er einen Moment lang über meine Frage nachgedacht hatte, sah er mich an und gab zu, von ein paar Frauen gehört zu haben, die in Kabul ihr eigenes Geschäft aufgezogen hätten. Ich hoffte, das Gerücht stimmte.
In den darauffolgenden Tagen arbeitete ich mich durch meine Liste potenzieller Interviewpartnerinnen, hatte jedoch kein Glück. Viele der Frauen, deren Namen man mir gegeben hatte, leiteten nichtstaatliche Organisationen, sogenannte NGOs (»nongovernmental organizations«), die keine Unternehmen im eigentlichen Sinne waren. Man erzählte mir, dass es 2002, als die internationale Gemeinschaft sich erstmals im großen Stil in Afghanistan engagierte, leichter gewesen war, eine NGO eintragen zu lassen als eine Firma. Die Leistungsanreize hatte man schon früh festgelegt. Es mochte ja sein, dass die amerikanischen Beamten in Washington und Kabul afghanische Geschäftsfrauen förderten, öffentliche Veranstaltungen organisierten und Millionen von Steuergeldern in ihrem Namen ausgaben – doch hier suchte ich verzweifelt nach einer einzigen Unternehmerin mit einem erfolgversprechenden Businessplan. Es musste sie irgendwo da draußen geben; vielleicht hatte ich nur nicht am richtigen Ort gesucht.
Meine Deadline näherte sich unerbittlich, und allmählich befürchtete ich, mit leeren Händen nach Hause zurückkehren und sowohl die Financial Times als auch meinen Professor in Harvard enttäuschen zu müssen. Und da endlich erzählte mir eine Mitarbeiterin der in New York ansässigen gemeinnützigen Organisation Bpeace von Kamila Sidiqi, einer jungen Schneiderin, die sich zum Serial Entrepreneur – zur Serienunternehmerin – gemausert hatte. Sie leitete nicht nur ihre eigene Firma, sondern hatte darüber hinaus ihre ungewöhnliche Karriere zur Zeit der Taliban bereits als Teenager begonnen.
Nun endlich verspürte ich die Aufregung eines Reporters, der eine gute Story wittert; mein Körper schüttete das »Story-Adrenalin« aus, das Journalisten am Leben erhält. Und eine in eine Burka gehüllte Familienernährerin, die vor der Nase der Taliban ein Unternehmen gründete, war ganz bestimmt eine Story. Wie die meisten Ausländer hatte ich mir afghanische Frauen während des Taliban-Regimes als stumme und passive Gefangene vorgestellt, die auf das Ende ihres Hausarrests warten. Ich war begierig darauf, mehr zu erfahren.
Je mehr Informationen ich ausgrub, desto klarer wurde mir, dass Kamila nur eine von vielen jungen Frauen war, die jahrelang während des Taliban-Regimes gearbeitet hatten. Sie hatten Geld verdienen müssen, um ihre Familien ernähren zu können, während Kabuls Wirtschaft infolge des Kriegs und des Missmanagements zusammenbrach. Sie verwandelten kleine Chancen in große und fanden immer wieder Wege, Regeln zu umgehen. Wie alle Frauen überall auf der Welt hatten sie aus Sorge um ihre Familie einen Weg nach vorn angestrebt. Sie lernten, sich im System zu bewegen, ja sogar, darin zu gedeihen.
Manche besetzten Stellen in ausländischen NGOs, meist im Themenbereich Frauengesundheit, denen die Taliban das Fortbestehen gestatteten. Ärzte durften immer noch arbeiten; und damit auch Frauen, die anderen Frauen die Grundregeln der hygienischen und gesundheitlichen Praxis beibrachten. Einige unterrichteten auch in Untergrundschulen und gaben Kurse, in denen Mädchen und Frauen alles von Microsoft Windows und Mathe über Dari bis zur Heiligen Schrift des Islam, dem Koran, erlernen konnten. Die Kurse fanden in ganz Kabul in privaten Wohnungen oder – noch besser – in Frauenkliniken statt, unter den Taliban die einzige sichere Zone. Dennoch mussten die Frauen ständig auf der Hut sein und oft ganz hastig die Unterrichtsmaterialien zusammenpacken, wenn jemand den Gang hinuntergelaufen kam und vor heranrückenden Taliban warnte. Wieder andere, darunter auch Kamila, arbeiteten von zu Hause aus und riskierten viel, um Käufer für ihre Waren zu finden. Ihre Berufe variierten, doch eines hatten all diese Frauen gemeinsam: Ihre Arbeit entschied über Tod oder Überleben der eigenen Familie. Und sie machten alles ganz allein.
Noch nie hatte jemand die Geschichte dieser Heldinnen erzählt. Es gab bewegende Tagebücher, die einen Eindruck von der Verzweiflung der Frauen während des Taliban-Regimes und dessen Brutalität vermittelten, es gab auch Bücher, die vom Neuanfang der Frauen nach der Vertreibung der Taliban erzählten. Doch diese Geschichte war anders: Sie handelte von afghanischen Frauen, die einander unterstützten, als die Welt da draußen sie vergessen hatte. Sie halfen sich und ihren Gemeinden mit Mitteln, die sie allein aus ihrem armen und gebrochenen Land bezogen, und ganz nebenbei erschufen sie sich damit eine neue Zukunft.
Kamila ist eine dieser jungen Frauen, und gemessen an der nachhaltigen Wirkung, die ihre Arbeit auf das moderne Afghanistan hatte, ist sie auch eine der visionärsten. Ihre Geschichte erzählt uns viel über ihr Land, das Land, in das wir auch fast zehn Jahre nach dem Rückzug der Taliban immer noch Truppen schicken. Schon längst patrouillieren auf den Straßen vor Kamilas Haus keine Taliban-Kämpfer mehr. Und ihre Geschichte dient uns als Orientierungshilfe, während wir gespannt auf das Ergebnis der letzten zehn Jahre warten. Wird sich der bescheidene Fortschritt, den das Land gemacht hat, als Möglichkeit zum Neuanfang für die afghanischen Frauen herausstellen oder als Irrweg, der mit dem Verschwinden der Fremden im Nichts endet?
Den Entschluss zu fassen, über Kamila zu schreiben, war einfach – das Schreiben selbst nicht. In den Jahren, in denen ich Kamilas Familie, Freunde und Kollegen interviewte, wurde Sicherheit immer mehr zu einem Fremdwort für mich. Immer häufiger und heftiger wurde die Stadt von Selbstmordattentaten und Raketenangriffen erschüttert. Diese waren am Ende so effektiv und so gut koordiniert, dass die Einwohner von Kabul stundenlang in ihren Häusern und in öffentlichen Gebäuden eingeschlossen waren. Selbst der für gewöhnlich stoische Mohamad zeigte gelegentlich seine Nervosität und brachte mir das schwarze, iranisch anmutende Kopftuch seiner Frau, damit ich »einheimischer« aussähe. Nach jedem Attentat und jedem Angriff rief ich meinen Mann an, um ihm zu sagen, dass alles in Ordnung sei und er dem Google-Alarm, den das Wort »Afghanistan« in einer Meldung auslöste, nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken solle. In der Zwischenzeit wurden die Betonwände in Kabul immer höher und der Stacheldraht darum immer dicker. Ich lernte, wie jeder andere in Kabul, mit schwer bewaffneten Wachen zu leben; jedes Mal, wenn wir ein öffentliches Gebäude betraten, wurden wir vorher sehr gründlich durchsucht. Immer wieder wurden ausländische Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen aus ihren Häusern und Autos von Gangstern und Rebellen entführt; manchmal wegen des Lösegelds, manchmal aus politischen Gründen. Ich verbrachte Stunden mit befreundeten Journalisten, um Gerüchte über Angriffe und mögliche Angriffe auszutauschen; wir schickten uns gegenseitig eine SMS, wenn man offiziellen Angaben zufolge eine bestimmte Gegend an diesem Tag meiden sollte. An einem Nachmittag – ich hatte den ganzen Tag lang anstrengende Interviews geführt – bekam ich einen besorgten Anruf von der US-Botschaft: Ob ich die amerikanische Autorin sei, die man tags zuvor entführt hatte? Ich war es glücklicherweise nicht.
Die sich verschlechternde Situation erschwerte meine Arbeit. Die afghanischen Mädchen, die während des Taliban-Regimes mit Kamila gearbeitet hatten, hatten Bedenken, sich mit mir zu treffen. Sie fürchteten, ihren Familien oder Arbeitgebern könne die Aufmerksamkeit nicht recht sein, die der Besuch einer Ausländerin erregt. Andere weigerten sich von vornherein, da sie befürchteten, von ihren Kollegen belauscht zu werden. »Wissen Sie denn nicht, dass die Taliban wiederkommen?«, flüsterte mir eine junge Frau nervös zu. Sie war zu dieser Zeit für die Vereinten Nationen tätig, hatte mir aber gerade alles über die NGO erzählt, für die sie unter den Taliban gearbeitet hatte. »Die hören alles«, fuhr sie fort. »Wenn mein Mann herausfindet, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, lässt er sich scheiden.«
Wie ich darauf reagieren sollte, wusste ich nicht, tat jedoch alles, um meine Interviewpartner und auch mich selbst zu schützen. Ich kleidete mich noch konservativer als die afghanischen Frauen um mich herum und trug meine eigenen Kopftücher, die ich in einem islamischen Bekleidungsgeschäft im kalifornischen Anaheim gekauft hatte. Außerdem lernte ich Dari, die Amtssprache in Afghanistan. Wenn wir in den Geschäften oder Büros ankamen, in denen die Interviews geführt werden sollten, hielt ich so lange wie möglich den Mund und ließ Mohamad mit den Sicherheitsleuten und den Mitarbeitern am Empfang reden. Je besser ich mich anpasste, desto sicherer wären wir alle.
Einer meiner Arbeitsausflüge traf zufällig mit einem waghalsig am frühen Morgen verübten Attentat auf ein UN-Gästehaus zusammen, bei dem fünf Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet wurden. Danach schreckte ich oft nachts hoch, wenn ich die Nachbarskatze über die Plastikisolierung auf unserem Dach laufen hörte, weil ich sie für einen Einbrecher hielt. Nur halb im Scherz schlug ein Freund mir vor, mir eine Kalaschnikow anzuschaffen, um das Haus gegen potenzielle Angreifer zu verteidigen. Ich stimmte sofort zu, doch waren meine Zimmergenossen angesichts meiner begrenzten Erfahrung mit Handfeuerwaffen etwas besorgt, ob ich dadurch nicht mehr Schaden anrichten als verhindern könnte. Auch Kamila und ihre Schwestern sorgten sich um meine Sicherheit.
»Machst du dir keine Sorgen? Was sagt denn deine Familie dazu?«, wollte Kamilas ältere Schwester Malika wissen. »Hier ist es im Moment sehr gefährlich für Ausländer.«
Ich erinnerte sie daran, dass sie viel Schlimmeres durchgemacht und dennoch nie aufgehört hatten zu arbeiten. Warum sollte ich das also tun? Sie versuchten zu protestieren, wussten aber, dass ich recht hatte: Sie hatten während des Taliban-Regimes trotz der Gefahren durchgehalten; nicht nur, weil sie mussten, sondern auch, weil sie an das, was sie taten, glaubten. Und das tat ich ebenfalls.
Dass ich seinerzeit in Kabul blieb und Jahr für Jahr wieder kam, hatte mir ihren Respekt eingebracht und unsere Freundschaft besiegelt und sehr gefestigt. Je mehr ich über Kamilas Familie erfuhr – von ihrem Engagement für Arbeit und Bildung, ihrem Bestreben, etwas Gutes für ihr Land zu tun –, desto mehr wuchs meine Hochachtung vor ihr. Ich wollte ihrem guten Beispiel unbedingt folgen.
Mit der Zeit wurde Kamilas Familie Teil meiner eigenen. Eine ihrer Schwestern half mir dabei, Dari zu lernen, eine andere zauberte für den vegetarisch essenden Gast aus Amerika köstliche, traditionell afghanische Abendessen aus Reis, Blumenkohl und Kartoffeln. Abends stellten sie zuerst immer sicher, dass mein Auto noch da war, bevor ich mir die Schuhe anziehen und gehen durfte. Nachmittags saßen wir oft zusammen, tranken Tee und naschten toot, getrocknete Beeren aus dem Norden. Wenn wir nicht arbeiteten, tauschten wir Geschichten über Ehemänner und Politik und die »Situation« aus, wie die Lage in Kabul euphemistisch genannt wurde. Wir sangen und tanzten mit Kamilas wunderschönen kleinen Nichten. Und wir sorgten uns umeinander.
In Kabul lernte ich eine Schwesternliebe kennen, der ich nie zuvor begegnet war und die sich durch Empathie, Lachen, Mut, Neugier auf die Welt und vor allem Leidenschaft für die Arbeit auszeichnete. Und das vom allerersten Tag an, als ich Kamila traf: Ich hatte eine junge Frau vor mir, die von ganzem Herzen daran glaubte, durch die Gründung eines eigenen Unternehmens und dadurch, dass sie anderen Frauen das Gleiche beibrachte, ihr Not leidendes Land retten zu können. Und die Journalistin in mir wollte wissen, worauf eine solche Leidenschaft, eine solche Berufung beruht. Was sagt uns Kamilas Geschichte über die Zukunft Afghanistans – und Amerikas Beteiligung daran?
Das ist die Geschichte, die ich erzählen will. Und das sind die Fragen, die ich beantworten will.
Die englische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The Dressmaker of Khair Khana« bei Harper Collins Publishers, 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
Alle Rechte vorbehalten. Vollständige oder auszugsweise Reproduktion, gleich welcher Form (Fotokopie, Mikrofilm, elektronische Datenverarbeitung oder andere Verfahren), Vervielfältigung und Weitergabe von Vervielfältigungen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Copyright © 2011 by Gayle Tzemach Lemmon
Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe Irisiana Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, 81673 München Umschlaggestaltung: Gabrielle Bordwin (Original) und Geviert – Büro für Kommunikationsdesign, München, unter Verwendung eines Motivs von Susan Fox/Arcangel Images (U1) und von Topic Photoagency in /Age Fotostock (Buchrücken)
Ornamente: iStockphotos
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN: 978-3-641-08066-2
817 2635 4453 6271
www.randomhouse.de
Leseprobe