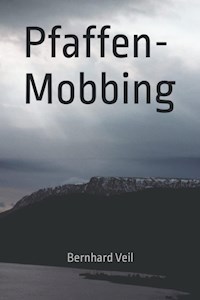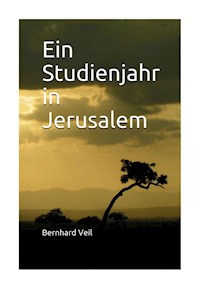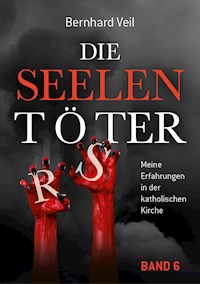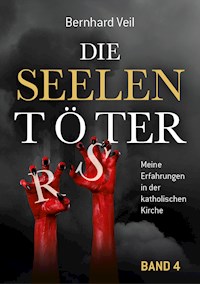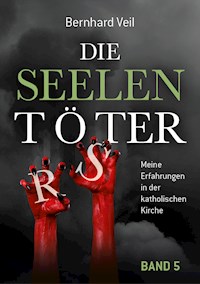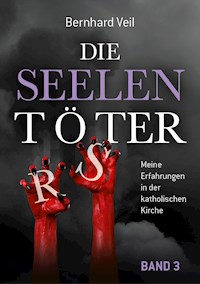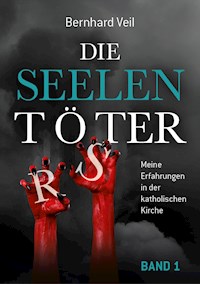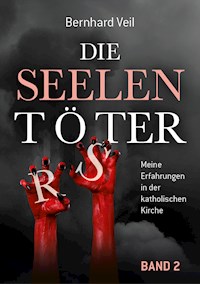
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band der Reihe „Die Seelentöter“ beschreibt der Autor seine Erlebnisse, die er als Mitarbeiter in einer Kirchengemeinde mit über 10000 Katholiken durchstehen muss. Weil er selbst Priester werden möchte, lässt er sich zunächst zum Pastoralreferent ausbilden, um auf diese Weise den Priesterberuf in der realen Seelsorge kennenzulernen. Er hofft, sich somit besser für oder gegen den zölibatären Lebensweg entscheiden zu können. Dabei stellt er fest, dass viele Priester sich keineswegs an das Zölibatsgebot halten, sondern eheähnliche Partnerschaften eingehen oder homosexuelle Beziehungen pflegen, die von ihren Kirchenoberen geduldet werden. Während der arbeitsintensiven und turbulenten Zeit in der Gemeindeseelsorge erinnert er sich zurück an das Collegium Ambrosianum, wo er in penetranter Weise von zwei homophilen Studienkollegen gestalkt wurde. Einer von ihnen studiert nach seinem Abitur ebenfalls Theologie und lässt sich zum Priester weihen. Wie dessen weiterer Lebensweg verläuft, wird in den folgenden Bänden berichtet. Außerdem schildert der Autor in einer Rückblende interessante und amüsante Begebenheiten, die er während seines Auslandsstudiums in Israel erlebt. Damit er Land und Leute besser kennenlernen kann, bringt er bereits im ersten Semester sämtliche Studien- und Seminararbeiten sowie alle obligatorischen Prüfungen hinter sich, die für den Erhalt seines Stipendiums erforderlich sind. Im zweiten Halbjahr geht er auf Entdeckertour durch Israel, durch Jordanien und in den Sinai. Bei seinen gewagten Exkursionen zu den antiken Ausgrabungsstätten erlebt er abenteuerliche Begegnungen mit Beduinen, muss brenzlige Situationen in der Wüste bewältigen und berichtet von launigen und kuriosen Erlebnissen mit der einheimischen Bevölkerung und ihren kulturellen Gepflogenheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Umzug in meine neue Gemeinde
Collegium Ambrosianum
Verhängnisvolle Zeit
Wahrlich ein Desaster
Böse Erinnerungen
Jugendseelsorgertagung und Supervision
Erwachsenenbildung
Allerlei Verpflichtungen
Seelsorgliche und andere Gespräche
Die Forderung des Schuldekans
Studium an der Dormitio-Abtei
Arabischer Service
Weihnachten und Jahreswechsel
Reiseerlebnisse in Israel
Exkursion in den Sinai
Reise nach Jordanien
Abschied von der Dormitio-Abtei
Arbeit ohne Ende
Soll ich den Priesterberuf ergreifen?
Enttäuschungen und Unzufriedenheit
Abschied von Ludwigsburg
Impressum
Bernhard Veil
Die Seelentöter
Meine Erfahrungen in der katholischen Kirche
Band 2
Neubeginn in Ludwigsburg
mit Erinnerungen an das Collegium Ambrosianum und an meine Studienzeit in Jerusalem
ISBN 9789463186995
2019 Bookmundo Osiander
2. Auflage
Alle Rechte liegen beim Autor.
Umschlaggestaltung: Hannes Klein / jkdtp
Vorwort
Unter der Reihe „Die Seelentöter“ berichte ich von meinen Erfahrungen, die ich als Mitarbeiter in der katholischen Kirche erlebt habe. Damit der Focus der beschriebenen Personen nicht nur auf Priester, Pfarrer und sonstige Kleriker gerichtet ist, habe ich auch mehrere Episoden aus meinem Leben und Werdegang hinzugefügt.
Alle Namen der beschriebenen Personen wurden abgeändert, die angeführten Institutionen und Handlungsorte jedoch beibehalten, so dass jeder sich ein Bild darüber machen kann, was sich vor wenigen Jahren an diesen Schauplätzen ereignet hat. Die zitierten Schriftstücke sind im Originaltext wiedergegeben und wurden lediglich mit den Namen, die vom Autor abgeändert wurden, ausgetauscht. Alle angeführten Briefe und schriftlichen Belege sind wortwörtlich zitiert, so dass der Leser erkennen kann, welche Konsequenzen die kirchlichen Entscheidungsträger aus den vorgegebenen Situationen gezogen haben.
Um das Kostenrisiko in Grenzen zu halten, habe ich auf ein Lektorat verzichtet, sollten sich im Text Fehler eingeschlichen haben, dann bitte ich Sie, mir diese Mängel zur Berichtigung mitzuteilen.
E-Mail-Adresse: [email protected]
Umzug in meine neue Gemeinde
Auf meine Bewerbung hin werde ich vom Bischöflichen Ordinariat der Kirchengemeinde „Zur heiligsten Dreieinigkeit“ in Ludwigsburg zugeteilt. Von Böblingen aus fahre ich mehrmals an meinen neuen Arbeitsort und suche mir dort eine Wohnung, was nicht ganz einfach ist. Denn diese schöne Stadt mit ihren etwa 90.000 Einwohnern ist nur etwa 15 km von Stuttgart entfernt und gehört somit zum großen Ballungs- und Industriezentrum von Baden-Württemberg. Auf mein Inserat in der Zeitung sind mehrere Wohnungsangebote eingegangen, von denen ich mir ein sehr zentral gelegenes Apartment mitten in der Stadt, im Marstall-Center, auswähle. Dieses Einkaufszentrum liegt nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt, beherbergt auf zwei Ebenen verschiedene Läden, Gaststätten, Banken und allerlei andere Geschäfte sowie ein Kaufhaus. Darüber erheben sich in vielen Stockwerken moderne, schön geschnittene Wohnungen. Von meinem neuen Apartment in der achten Etage sehe ich direkt hinunter auf den quadratisch angelegten Marktplatz, wo unsere schlichte katholische Kirche der prächtigen evangelischen Stadtkirche gegenübersteht. Auch unser katholisches Gemeindezentrum und das Pfarrhaus, die beide auf der anderen Seite des Schlossgartens liegen, kann ich leicht zu Fuß erreichen, ebenso sämtliche Schulen, in denen ich voraussichtlich unterrichten werde. Der Ausblick über die Stadt ist fantastisch. Jeden Abend werden die Häuser um den Marktplatz und die beiden Kirchen mit ihren barocken Fassaden in goldfarbenes Licht getaucht und erstrahlen romantisch die ganze Nacht hindurch. Es ist ein wunderschöner Anblick.
Alle Veranstaltungen, die dort das Jahr über stattfinden, ob Faschingsumzug, Jahrmärkte, Sommerfeste, politische und sonstige öffentliche Kundgebungen bis hin zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt und Silvesterfeuerwerk, alles kann ich von meinem Balkon aus beobachten. Eine besonders feierliche Stimmung entfaltet sich jeden Samstagabend, wenn die drei Glocken unserer katholischen Dreieinigkeitskirche zur linken und die fünf Glocken der doppeltürmigen evangelischen Stadtkirche auf der rechten Seite gemeinsam in fein aufeinander abgestimmtem Geläute den beginnenden Sonntag verkünden.
Die Miete für meine neue Unterkunft ist zwar nicht gerade billig, doch dafür kann ich per pedes umweltfreundlich alle meine Einsatzorte erreichen und mein Auto zumeist in der Tiefgarage stehen lassen. Wenn ich mit dem Aufzug von meiner Wohnung hinunterfahre, sind es bis zur Kirche am Marktplatz nur fünf Minuten, durch den Ludwigsburger Schlossgarten bis zum Pfarrbüro oder zum Gemeindehaus zehn Minuten und bis zum Schiller-Gymnasium oder zur Elly-Heuss-Knapp-Realschule etwa fünfzehn Minuten. Lediglich zur Filialkirche in Hoheneck oder wenn ich in unserem weitläufigen Gemeindegebiet jemanden besuchen muss, benötige ich mein Fahrzeug. Somit habe ich die Auflage meines Arbeitgebers voll und ganz erfüllt, dass ich als kirchlicher Mitarbeiter meinen Wohnsitz innerhalb des Gemeindegebietes nehmen muss. Für einen Pfarrer oder Vikar ist solch eine „Residenzpflicht“ wesentlich leichter zu erfüllen, da ihnen normalerweise ein Pfarrhaus meist neben der Kirche für einen günstigen Mietpreis zur Verfügung gestellt wird.
Unsere Kirchengemeinde ist mit über 10.000 Katholiken eine der größten Pfarreien in unserer Diözese. In den ersten Wochen ist mein Terminkalender prall gefüllt, viele Sitzungs- und Begrüßungstermine in Schulen, beim Kirchengemeinderat und bei diversen Gruppen und Verbänden, bei den Gruppenleitern der Jugendlichen und in Gremien des Dekanates stehen auf dem Programm, um mir erst einmal einen Überblick zu verschaffen. Nach einigen Wochen der Orientierung setzt sich Pfarrer Fauser mit dem Vikar und mit mir zusammen, um unsere Arbeitsgebiete unter uns neu aufzuteilen.
Bei meiner Vorstellung in den verschiedensten Gruppierungen haben einige bereits ihre Wünsche geäußert und mir mitgeteilt, dass ich doch bitte künftig ihr pastoraler Ansprechpartner sein möge und möglichst regelmäßig bei ihren Zusammenkünften und Veranstaltungen dabei sein solle. Vor allem die Jugendleiter wollen, dass ich für sie zuständig bin, damit eine kontinuierliche Jugendarbeit gewährleistet ist. Denn bisher war immer ein Vikar für sie da, der jedoch nach zwei Jahren die Gemeinde wieder verließ, weil er ja noch in Ausbildung ist und danach in eine andere Ausbildungsstelle wechseln muss.
Pfarrer Fauser, Vikar Achim Stützel und ich treffen uns wöchentlich im Pfarrhaus, um die anstehenden Termine für Gottesdienste, Sitzungen und andere Veranstaltungen in der Gemeinde zu planen und untereinander abzusprechen. Gelegentlich ist ein pensionierter Priester dabei, der im Kloster der Karmelitinnen in unserer Filialgemeinde Hoheneck wohnt. Diese Ordensgemeinschaft unterhält auf ihrem Anwesen ein Waisenhaus und ein Müttergenesungsheim, das von einem schönen Park umgeben ist, in dem auch eine kleine, moderne Kirche steht, wo wir für den Teilort Hoheneck unsere Gottesdienste halten.
Pfarrer Fauser teilt unsere Zuständigkeitsbereiche folgendermaßen unter uns auf: er übernimmt kraft seines Amtes den Vorsitz des Kirchengemeinderates und des Verwaltungsausschusses, der Vikar den Liturgie-Ausschuss, den Ausschuss für Ökumene und die Betreuung der Ministranten, ich übernehme den Ausschuss für Erwachsenenbildung, den Veranstaltungsausschuss und den Jugendausschuss, der für folgende Jugendverbände zuständig ist:
die Katholische junge Gemeinde (KjG), die Katholische studierende Jugend (KSJ), die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) die Jugend der Kolpingfamilie (Kolping-Jugend) und die Deutsche Jungendkraft (DJK- Sportgemeinschaft)Die übrigen Ausschüsse des Kirchengemeinderats, der Ausschuss Mission, Entwicklung und Frieden, der Ausschuss für ausländische Mitbürger und der Ausschuss für Familien und Arbeitswelt werden je nach Bedarf und Anforderung von uns dann abwechselnd mitbetreut. Die Franziskanische Gemeinschaft, die Elisabethen-Gruppe, die Vinzenz-Gemeinschaft, der Katholische Frauenbund, die Schönstatt-Müttergruppe, die Kolpingfamilie und der Seniorenkreis haben ihre eigenen Leitungsstrukturen und fordern uns ebenfalls gelegentlich zu Vorträgen, Diskussionsrunden oder für die Gestaltung ihrer Besinnungstage an.
Die sechs Sonntagsgottesdienste, die in der Dreieinigkeitskirche, in der Schlosskirche und in Hoheneck stattfinden, sind zeitlich so nacheinander festgelegt, dass sie notfalls von zwei Priestern bedient werden können. Den Predigtplan erstellen wir derart, dass jeder von uns reihum die Predigt halten muss. Wenn man die Urlaubszeiten von uns mitberücksichtigt und die vielen kirchlichen Feiertage mit einrechnet, muss dann jeder etwa alle zwei Wochen predigen. Da der Pfarrer selbst nicht so gerne eine Predigt ausarbeitet, weil er für eine gründliche Vorbereitung zu wenig Zeit hat, nimmt er oft Predigtvorlagen aus diversen Predigt-Zeitschriften und liest sie einfach im Gottesdienst vor. Dies merken aber oftmals die gewieften Gottesdienstteilnehmer, weil er ungewohnte Ausdrücke und Fremdwörter während seiner Predigt meist sehr unsicher vorliest und dadurch mit seinen Augen nah am Predigttext hängenbleibt. An den kirchlichen Hochfesten wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten oder an anderen hohen Feiertagen überlässt er deshalb sehr gerne mir die Predigt. Außerdem wird bei diesen Festgottesdiensten jedes Mal von unserem „Chor der Dreieinigkeitskirche“ eine große Orchestermesse aufgeführt, die Pfarrer Fauser zusammen mit dem Vikar zelebriert, wobei ich dann als Prediger ebenfalls mit eingesetzt werde. So ziehen wir drei Seelsorger bei solch einem Festgottesdienst in einer großen liturgischen Prozession vom hinteren Portal durch den Mittelgang in die Kirche ein. Viele Ministranten gehen uns voraus, von denen einer das Vortragekreuz, andere die Kerzenleuchter und zwei von ihnen das Rauchfass und das Weihrauchschiffchen tragen, um unsere Gottesdienste an den Feiertagen besonders feierlich und würdig zu gestalten. Alles in allem ist die Arbeitsaufteilung unter uns Dreien recht gut geglückt, so dass wir ohne größere Reibungsverluste mit den uns zugeordneten Gemeindemitgliedern zusammenarbeiten können.
Allerdings ereignet sich nach meiner zweiten Predigt eine Begebenheit, die Pfarrer Fauser sozusagen in Gewissensnöte bringt. Zwar wird in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart schon seit geraumer Zeit in einigen Gemeinden die sogenannte „Laienpredigt“ praktiziert, die es erlaubt, dass Theologen, die an einer Universität studiert haben, in den sonntäglichen Messfeiern die Predigt halten dürfen. Doch als der Vatikan von dieser neuen Praxis Wind bekommt, erlässt das kirchliche Lehramt eine Instruktion, die es diesen sogenannten „Laien“ untersagt, in den sonntäglichen Messfeiern das Wort Gottes zu verkündigen, da dies in der katholischen Kirche ja nur den geweihten Priestern, also den „Klerikern“ vorbehalten ist. Diese „päpstliche Instruktion“ wird von unbekannten Gemeindemitgliedern nun jeden Sonntag in Plakatgröße ans Hauptportal unserer Dreieinigkeitskirche geheftet und jedes Mal von unserem Mesner wieder abhängt.
Wie wir durch diese Protestaktion erkennen müssen, sind also einige sehr konservative Mitglieder unserer Gemeinde nicht mit dem fortschrittlichen Stil der Glaubensunterweisung in unserer Diözese einverstanden und weisen uns mit dieser Plakataktion darauf hin, dass die vatikanischen Richtlinien doch bitte auch bei uns hier eingehalten werden sollen. Pfarrer Fauser überlegt hin und her, ruft im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg an, um sich abzusichern, und lässt mich dann, wie vom Bischof beschlossen, weiterhin in seinen Sonntagsgottesdiensten predigen. Es dauert jedoch noch einige Wochen, bis die anonym gebliebenen Protestler aufgeben und keine Plakate mehr am Hauptportal der Dreieinigkeitskirche anbringen.
Doch eine weitere Begebenheit ist wohl eher nicht mit diesen protestierenden Gemeindemitgliedern zu vergleichen, sondern mag vor allem eine Form von persönlicher Kontaktaufnahme zu mir gewesen sein, wie es unter altphilologisch gebildeten Gymnasialprofessoren üblich ist. Als ich an einem Sonntag wieder gepredigt hatte, meldet sich zur Mittagszeit ein Mann bei mir am Telefon und fragt, ob ich ihm mal einige Auskünfte zu meiner Predigt geben könnte. Nach einem kurzen Gespräch über Inhalt und Deutung meiner biblischen Sichtweise und Interpretation kommt er auf das Evangelium zu sprechen, über das ich gepredigt hatte, und will von einem ganz bestimmten Textabschnitt wissen, wie dieser Bibeltext denn in der griechischen Urfassung lauten würde. Ihm komme es vor allem darauf an, in welchem Kasus ein bestimmtes darin vorkommendes Substantiv geschrieben sei.
Ich hole meine altgriechische Bibelausgabe aus meinem Bücherschrank, schlage die gewünschte Textstelle auf und lese ihm auf Griechisch den von ihm gewünschten Bibelabschnitt vor. Anschließend bestimme ich den von ihm genannten Kasus, der ausschlaggebend für die Deutung dieser Bibelstelle ist. Äußerst angetan zeigt er sich, als ich den Akkusativ von dem im Altgriechisch vorkommenden Aorist genau unterscheiden kann. Nach diesem einvernehmlichen Gespräch zeigt er sich sehr zufrieden und wünscht mir weiterhin ein gutes Gelingen bei meiner Arbeit in der Gemeinde. Danach bringt er zum Ausdruck, dass wir uns bald ohnehin persönlich kennenlernen werden.
Nach diesem Gespräch bin ich erstaunt, dass sich jemand so genau bis ins letzte Detail für meine Bibelauslegung interessiert und eine derart detaillierte Auskunft von mir wünscht. Er hatte sich zwar am Telefon mit seinem Namen „Bertram“ vorgestellt, doch wer dieser Mann war, wird sich demnächst noch erweisen. Zwei Wochen später nehme ich erstmals an der Sitzung des Veranstaltungsausschusses teil, um das Herbstfest in der Gemeinde zusammen mit einigen Kirchengemeinderäten vorzubereiten. Und tatsächlich, hier lerne ich diesen Mann nun persönlich kennen. Es ist Dr. Bertram, ein pensionierter Altphilologe, der sich als treuer Katholik unserer Gemeinde stark verbunden fühlt und schon seit Jahren sehr aktiv am Gemeindeleben teilnimmt. Früher war auch er lange Zeit ein Mitglied des Kirchengemeinderates und wie ich in unserem Gespräch nun überrascht feststelle, leitet er sogar ein- oder zweimal im Jahr wissenschaftliche Studienreisen nach Griechenland für einen namhaften kirchlichen Reiseveranstalter in Stuttgart.
Da ich in den Sommer- und Herbstferien für dasselbe Reiseunternehmen zwei Studienreisen nach Israel leitete, kommen wir uns schnell näher und er lädt mich daraufhin des öfteren zu sich nachhause ein, wo seine Frau uns immer ein gutes Mittag- oder Abendessen zubereitet. Manchmal sitzen wir danach noch lange bei einem guten Wein zusammen und ich erhalte von ihnen bei dieser Gelegenheit allerlei interessante Informationen über unsere Kirchengemeinde, sowie viele brauchbare Anregungen und Tipps für meine Arbeit. Unter anderem erzählt er auch von seiner Tochter, die als Lehrerin in Giengen an der Brenz unterrichtet. Sie sei ganz begeistert von dem dortigen Pfarrer, der erst vor kurzem die dortige Pfarrei übernommen habe und außerordentlich gut predigen würde. Er habe so richtig neuen Schwung in diese Gemeinde gebracht. Als Dr. Bertram anerkennend den Namen dieses Pfarrers erwähnt, schrillen bei mir alle Alarmglocken. Es ist Pfarrer Eckmann, mein damaliger Rektor im Collegium Ambrosianum, wo ich das Abitur gemacht habe. Nebenbei bemerke ich, dass ich diesen Mann persönlich recht gut kenne, ich als Seminarist jedoch damals leider etwas andere Erfahrungen mit ihm machen musste. Frohgemut und beschwingt gehe ich nach dieser recht angenehmen Einladung nachhause. Doch bald kommen in mir die sehr schmerzlichen Erinnerungen an das Collegium Ambrosianum wieder hoch, die durch die Erwähnung dieses Namens „Eckmann“ ausgelöst wurden. Es waren überaus leidvolle Erfahrungen, die ich in diesem kirchlichen Seminar gemacht habe. Anfangs fühlte ich mich dort zwar sehr wohl, denn es wurde mir die Möglichkeit geboten, nach meinem Beruf als Verwaltungsbeamter das Abitur nachzuholen. Ich wollte ja Theologie studieren und Priester werden. Doch mit derartigen Problemen, die dort auf mich zukamen, hatte ich nicht gerechnet.
Collegium Ambrosianum
Das Collegium Ambrosianum wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Priester Dr. Albert Rüebli in Stuttgart-Bad Cannstatt gegründet, um den großen Priestermangel in der Diözese Rottenburg-Stuttgart abzumildern. Viele Priester wurden noch in den letzten Kriegsjahren eingezogen und kamen von der Front nicht mehr zurück. Außerdem ergoss sich eine Flut von Heimatvertriebenen in die neu entstandene Bundesrepublik Deutschland, die nicht nur in die althergebrachten politischen Gemeindestrukturen integriert, sondern auch von der ortsansässigen Bevölkerung aufgenommen, eingegliedert und in die bestehenden Kirchengemeinden mit ihren damals oft viel zu kleinen Kirchen eingegliedert werden mussten. Durch das große Leid und die Zerstörungen, die der Krieg über das ganze Land gebracht hatte, suchten die Menschen in ihrer Not wieder Hilfe, Zuflucht und Trost in den Gottesdiensten. Die Kirchen waren brechend voll, der Glaube an Gott wurde bei vielen Menschen in der Nachkriegszeit zu einem neu entdeckten Gut. Die große Enttäuschung und Niederlage, die mit dem Untergang des Dritten Reiches einherging, der Verlust von unzählig vielen Menschenleben, aber auch von materiellem Wohlstand musste kompensiert und den Menschen in ihrem persönlichen Leben neue Hoffnung und ein neuer Sinn vermittelt werden. Die Kirche war gefragt, doch es fehlten die Priester. Da kam Dr. Rüebli auf die Idee, brachliegende Ressourcen in der Diözese ausfindig zu machen. Er schaute sich um, wo er geeignete Männer finden könnte, um sie für den Priesterberuf zu gewinnen. Da es früher Gymnasien und weiterführende Schulen nur in den Städten gab und die Landbevölkerung oft nicht die Möglichkeit hatte, ihre Kinder auf höhere Schulen zu schicken, reiste er deshalb von Dorf zu Dorf, predigte in den Kirchen und warb dafür, dass er junge Burschen zum Abitur führen könne, wenn sie bereit wären, sich dafür einige Jahre so richtig ins Zeug zu legen. Allerdings setzte er eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus, damit sie wieder in ihren alten Beruf zurückkehren könnten, falls sie es bei ihm nicht schaffen würden. Da in Baden-Württemberg die Prüfungsaufgaben in den verschiedenen Fächern für das Abitur zentral vom Kultusministerium ausgegeben werden und die Abiturprüfungen in allen Gymnasien des Landes gleichzeitig an den dafür bestimmten Tagen stattfinden, war es für Dr. Rüebli nicht einfach, seine von ihm selbst geschulten Zöglinge auf diese damals sehr schwierigen Abiturprüfungen vorzubereiten. Er hatte zwar die gymnasiale Unterrichtserlaubnis (Staatsexamina) für Latein, Griechisch, Mathematik und Deutsch und konnte somit in diesen Fächern selbst unterrichten, jedoch für Physik, Chemie, Biologie und andere Fächer musste er Lehrer von den umliegenden Gymnasien für seinen Unterricht hinzuziehen. Anfangs wurden die Schüler in sämtlichen Räumen seines Pfarrhauses in Stuttgart-Bad Cannstatt unterrichtet. Alle Räumlichkeiten wurden dafür hergerichtet, angefangen von seinem Wohnzimmer bis zum Kellerraum, wobei ihm seine Schwester den Haushalt führte und bisweilen sogar seine Schüler verköstigte, die in verschiedenen Privatwohnungen untergebracht waren. Als sich nach und nach dieser Schulbetrieb vergrößerte, verlegte er seinen Unterricht in einige Klassenzimmer der benachbarten Schulen. Da seine Schülerzahlen bald weiter anstiegen, baute er schließlich mit Geldern der Diözese das Collegium Ambrosianum, eine Schule mit Internatsgebäude für etwa 120 Seminaristen.
Es wurde in Form eines Hufeisens gleich gegenüber der Bahnstation Stuttgart-Sommerrain erbaut, ein kleiner Haltepunkt für Nahverkehrszüge zwischen Fellbach und Stuttgart-Bad Cannstatt. Somit konnten auch auswärtige Schüler aus dem Großraum Stuttgart leicht per Bahn zu seiner neu errichteten Schule kommen. Dieses Gebäude hatte er selbst entworfen. Man konnte es von der offenen Seite des Hufeisens durch ein großes Tor betreten, gleich an der linken Seite des Eingangs war sein Bungalow angebaut, in dem Dr. Rüebli als Schuldirektor zusammen mit seiner Schwester wohnte. Sie führte ihm nicht nur den Haushalt, sondern war zugleich auch seine Schulsekretärin. Vom Balkon seines Bungalows hatte Dr. Rüebli die beste Übersicht über die Schule und das Seminargebäude. Was für ihn aber besonders wichtig war, er hatte vor allem auch die Kontrolle darüber und konnte genau beobachten, wer durch dieses Tor heraus- und hineinging, vor allem nachts, wenn heimlich noch zu später Stunde einige Studenten versuchten, über dieses verschlossene Eingangstor zu steigen, um zurück ins Seminargebäude zu gelangen. Denn ab acht Uhr abends wurde es vom Hausmeister abgeschlossen und morgens um sechs Uhr wieder geöffnet. Im Collegium Ambrosianum herrschte äußerste Disziplin!
Gleich anschließend an den Bungalow zur Linken erstreckte sich das Schulgebäude mit acht Klassenzimmern, einem Lehrerzimmer und dem Sekretariat. Auf der gegenüberliegenden Seite, also rechts des Eingangstores fügte sich das rechtwinkelige Internatsgebäude an, die einzelnen Gebäudeteile bildeten somit ein quadratisches Bauwerk mit gut überschaubarem Innenhof. In den zahlreichen Einzelzimmern und in einigen Doppelzimmern wohnten rund 120 Seminaristen. In der Ecke zwischen Seminargebäude und Schule waren übereinander vier Wohnungen eingebaut. Ganz oben wohnte Pfarrer Strässle, der als Spiritual für die seelsorgliche Betreuung der Hausbewohner zuständig war, er hielt für uns Gottesdienste und Besinnungstage, erteilte in einem Stuttgarter Gymnasium Religionsunterricht, arbeitete in der Schulbuchkommission mit und gab zusammen mit anderen Lehrern und Professoren verschiedene Religionsbücher heraus. In der Wohnung darunter wohnte der Leiter des Seminars, Rektor Eckmann, ein junger Priester, der für die Organisation und die Verwaltung des Seminarbetriebs zuständig war. Unter ihm wohnten vier Ordensschwestern, die für Haushalt und Küche zuständig waren. In der darunter liegenden Wohnung war schließlich unser Hausmeister mit seiner Familie einquartiert. Unsere „Welt“, in der wir uns in diesen vier Jahren bewegten und uns auf das Abitur vorbereiten mussten, bestand außer der Schule und unseren Zimmern aus unserem Speisesaal, einer Aula, die als Sporthalle genutzt werden konnte, sowie aus unserer Hauskapelle und verschiedenen Aufenthalts- und Versorgungsräumen.
Wollte ein Seminarist abends das Haus verlassen und in Stuttgart eine kulturelle Veranstaltung besuchen, benötigte er von Dr. Rüebli eine Erlaubnis und musste sich im Schulsekretariat bei seiner Schwester eine schriftliche Ausgangsbescheinigung aushändigen lassen. Auf dieser Ausgangsbescheinigung war Ausgangsdatum und Rückkehrzeit vermerkt, die man der Schwester Oberin Anna im Seminar abgeben musste, um einen Hausschlüssel zu bekommen, der auch für das Schloss im großen Eingangstor passte. Auf diese Weise konnte man abends nach acht Uhr wieder ins Seminargebäude hineinkommen. Wer jedoch versuchte, bei Nacht das verschlossene Eingangstor zu übersteigen, weil er zu spät ohne Schlüssel zurückkam, hatte keine Chance, an Dr. Rüebli vorbeizukommen. Jeder Versuch, auch noch so heimlich das Tor zu überwinden, scheiterte. Denn über das metallene Gestänge, mit dem das Tor am Mauerwerk des Bungalows verankert war, wurde jedes Geräusch unmittelbar an die Wand übertragen, hinter der Dr. Rüebli sein Schlafzimmer hatte. Sofort erschien er im Schlafanzug auf seinem Balkon und befahl dem „Spätheimkehrer“, am nächsten Morgen vor Schulbeginn zu ihm ins Rektorat zu kommen, wo er ihm dann den Ausschluss aus Schule und Seminar androhte, falls dies nochmals vorkommen sollte. Dieses strenge Regiment übte er unerbittlich über uns junge Männer aus, die wir doch bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung und meist auch etliche Berufsjahre hinter uns hatten.
Dr. Rüebli verhielt sich bei der Vergabe der Ausgangsbescheinigungen sehr restriktiv. Bevor er sie ausgab, schaute er bei jedem Schüler genau die einzelnen Noten der vergangenen Klassenarbeiten an und wollte außerdem noch wissen, welche Veranstaltung er in Stuttgart besuchen möchte. Erschien ihm der Bildungsgewinn des abendlichen Events zu gering, wurde von ihm das Gesuch kurzerhand abgelehnt und der Studiosus ermahnt, seine Zeit lieber dafür zu verwenden, um Latein, Griechisch oder Mathematik zu pauken und sich zielbewusst auf das Abitur vorzubereiten. Hatte man jedoch alle Voraussetzungen für eine Ausgangsbescheinigung erfüllt, musste der Gang zur Oberin Anna angetreten werden, um von ihr den Schlüssel für die Haustür zu erbitten. Dabei schaute sie ganz genau auf den Zettel, ob Datum und Uhrzeit richtig vermerkt waren, setzte den Kandidaten eine Zeitlang ihren kritisch musternden Blicken aus, um letztendlich in ihr Büro zu gehen und einen Schlüssel zu holen, der dann von ihr mit der Mahnung ausgehändigt wurde, dass man ihn am nächsten Morgen sofort beim Frühstück wieder zurückgeben müsse. Nicht nur wegen ihrer kritischen Blicke, sondern auch wegen ihres schleichenden Ganges wurde Schwester Anna von einigen Seminaristen unter vorgehaltener Hand „Schwester Anakonda“ genannt.
Auf diese Weise leitete Dr. Rüebli das Collegium Ambrosianum nach altbewährtem, diktatorischem Stil und hatte dafür sein gut geschultes Personal. Alle drei Priester, Dr. Rüebli, Rektor Eckmann und Spiritual Strässle hielten abwechselnd für uns in der Hauskapelle die täglichen Gottesdienste, die jedes Mal von einem anderen Seminaristen vorbereitet und gestaltet werden mussten. So spielte sich unser tägliches Leben das ganze Jahr über tagaus, tagein in diesem geschlossenen Karree in eintönigem Lerneifer ab. Morgens und nachmittags im linken Flügel der Unterricht, danach im rechten Flügel konzentriertes Lernen, Studieren und Büffeln auf unseren Zimmern. Unterbrochen wurde diese Paukerei von festgesetzten Essenszeiten. Danach unternahmen wir meist kurze Spaziergänge, bei denen wir uns gegenseitig recht gut kennenlernten, aber auch bisweilen mächtig auf den Geist gehen konnten. Der schulische Druck war ungeheuer. In vier Jahren sich quasi den gesamten Lernstoff eines humanistischen Gymnasiums mit großem Latinum einzuverleiben, geistig aufzunehmen und innerlich zu verarbeiten, war für viele kaum zu leisten. Jedes Jahr am Schuljahresende schafften fünf oder sechs Klassenkameraden nicht die Versetzung in den nächsthöheren Kurs, so dass sie die Klasse nochmals wiederholen mussten. Am Ende eines jeden Schuljahres verließen somit etwa ein Viertel unserer Klassenkameraden unseren Kurs, wobei etwa dieselbe Anzahl von der nächsthöheren Klasse wieder als Sitzenbleiber zu uns stieß. So schafften es von den vierundzwanzig Seminaristen, die mit mir zusammen damals ins Collegium Ambrosianum eingetreten waren, nur sechs Mitschüler das Abitur in diesen vier Jahren, ohne einen Kurs zu wiederholen. Und wer zweimal eine Klasse wiederholte, musste, genau wie es bei den Gymnasien geregelt ist, das Ambrosianum verlassen. Im Grunde genommen war diese Kaderschmiede eine Fehlkonstruktion. Da mehr als dreiviertel der Schüler das Abitur in vier Jahren nicht schaffen, hatte diese hohe Misserfolgsrate für das Selbstwertgefühl der Sitzenbleiber und Schulabbrecher mitunter dramatische Folgen und hinterließ bei ihnen bleibende psychische Schäden. Wir wurden ja wie alle anderen Schüler in Baden-Württemberg mit denselben Abituraufgaben geprüft, die zentral vom Kultusministerium in den Fächern Deutsch, Latein, Griechisch, Mathematik und Physik ausgegeben wurden.
Bald gingen die Schülerzahlen im Collegium Ambrosianum geringfügig zurück, da auch in den ländlichen Gebieten des Landes zunehmend weiterführende Schulen gebaut wurden und somit auch in den Dörfern leichter ein höherer Schulabschluss erreicht werden konnte. Um den Rückgang der Schülerzahlen im Ambrosianum auszugleichen, wurde ein zweiter Ausbildungszug eingeführt, in den nun auch Schüler mit Mittlerer Reife aufgenommen wurden. Aufgrund ihrer etwas höheren Schulbildung wurde für sie die Möglichkeit geschaffen, das Abitur schon nach drei Jahren zu absolvieren.
Der allgemeine Schulstress wäre für mich in dieser Zeit zwar einigermaßen erträglich gewesen, da ich eine durchaus gute Auffassungsgabe hatte und daher in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern nicht viel lernen musste. Was mir aber vor allem zu schaffen machte, waren die zwischenmenschlichen Beziehungen zu meinen Mitschülern, die in meiner Klasse allesamt älter waren als ich. Gleich nach meiner Berufsausbildung, die ich als Verwaltungsbeamter bei der Stadtverwaltung Aalen abgeschlossen hatte, meldete ich mich im Seminar an. Ich war 18 Jahre alt, während meine Klassenkameraden meist schon mehrere Berufsjahre hinter sich hatten. Das Lernen fiel ihnen nach mehreren Jahren im Beruf meist schwer, so dass sie über die Jahre hinweg durch die mangelnden Lernerfolge oft frustriert waren. Ihre dadurch entstandenen und aufgestauten Aggressionen ließen sie, ob unabsichtlich oder gewollt, häufig kurzerhand und ohne lange zu überlegen an mir aus. Denn ich war in ihren Augen ein „junger Pimpf“, der meist gelangweilt in der Klasse saß und nichts als Blödsinn im Kopf hatte.
Hinzu kam, dass aufgrund des fehlenden attraktiven weiblichen Geschlechts in diesem Haus, der homoerotische Aspekt in dieser reinen Männerkultur durchaus ebenfalls eine Rolle spielte. So bekam ich damals insofern Schwierigkeiten, als dass ein älterer Mitschüler aus unserer Klasse sich heimlich mehr an mir interessierte, als ich es akzeptieren konnte. Abends wenn ich mein Zimmer verließ, um in der Hauskapelle Orgel zu spielen oder in einem Leseraum mit ein paar anderen Kameraden noch zusammensaß, musste ich bei meiner Rückkehr überrascht feststellen, dass sich Alex während meiner Abwesenheit in mein Zimmer geschlichen hatte. Er legte sich mit einem Buch auf mein Bett und las bis ich zurückkam. Dann tat er so, als wolle er von mir in Mathe etwas wissen, was ich ihm auch meist kurz erklärte, ihn aber trotzdem darauf hinwies, dass er mit solch einer Frage doch auch durchaus zu einer früheren Tageszeit hätte kommen können. Zum Dank für meine Hilfe wollte er mit mir danach etwas trinken und den anstrengenden Tag gemütlich ausklingen lassen. Um nicht unhöflich zu sein, ging ich kurz auf seinen Wunsch noch ein, doch als ich es dann ablehnte, ihn zu solch später Stunde noch in meinem Zimmer zu dulden, suchte er andere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Mal wollte er, dass ich ihm bei den Hausaufgaben in Physik helfe, dann kam er, um irgend ein Buch von mir auszuleihen, jedenfalls merkte ich, dass er bei all diesen Begegnungen auch die körperliche Nähe zu mir suchte und mich dabei immer wieder „kameradschaftlich“ anfasste. Als ich diese Annäherungsversuche ablehnte, Alex aber nicht damit aufhörte und sich auch nicht zurückweisen ließ, kam es zu einer Rangelei. Obwohl ich ihn ernsthaft aufforderte, mein Zimmer zu verlassen, lächelte er nur, denn er war sehr sportlich und viel stärker als ich. Bald versuchte er, mich immer wieder zu umarmen und aufs Bett zu ziehen. Ich war ihm heillos unterlegen. Alex kam vom Bodensee, war Sporttaucher und bei der DLRG Rettungsschwimmer. Mochte ich mich auch noch so gegen ihn wehren, es half nichts. Unweigerlich landete ich in seinem Schwitzkasten, in dem er mich festhielt, so lange er wollte. Zwar hätte ich, eingeklemmt in seinen kräftigen Armen, laut um Hilfe rufen können, doch ich fürchtete, dass dies im Seminar zu einem Aufsehen erregenden Eklat führen könnte. Die Folgen konnte ich nicht abschätzen. Vermutlich hätte es für Alex den Ausschluss aus der Schule bedeutet und wie meine Schulkameraden auf mich reagiert hätten, war ungewiss. Sicherlich, ich hätte zwar meine Ruhe vor ihm gehabt, doch die einsetzende und unkontrollierbare Gerüchteküche, die in solch einem Seminar wie das Gegackere in einem Hühnerstall in Gang gesetzt würde, ist beileibe nicht zu unterschätzen. Womöglich wäre ich den darauffolgenden Sticheleien und dem ganzen Gerede hilflos ausgeliefert gewesen, wenn wegen mir ein Mitschüler das Haus hätte verlassen müssen. Dies alles war für mich einfach nicht kalkulierbar. Darum entschloss ich mich, mein Zimmer künftig immer abzuschließen, obwohl unter uns Seminaristen ein offenes, nicht abgeschlossenes Zimmer als gegenseitiger Vertrauensbeweis galt, wodurch wir untereinander unser kameradschaftliches Miteinander im Haus demonstrieren wollten.
Doch bald entdeckte Alex eine andere Variante, wie er sich an mich heran machen konnte. Jeden Morgen stand ich um 6.00 Uhr auf, um in der Sporthalle im Untergeschoss ein paar Runden zu laufen und anschließend zu duschen. Nun kam er zur selben Zeit in den Duschraum, wo er sich plötzlich jetzt ebenfalls abbrausen musste. Dabei versuchte er, mich in der Duschkabine zu beobachten, indem er den Vorhang minimal zur Seite rückte. Als ich dies bemerkte und ihm spontan einen kräftigen Schlag ins Gesicht versetzte, packte er mich, drosch wild und wütend auf mich ein, so dass ich voller Schmerzen und aus der Nase blutend in der Duschwanne lag. Von jetzt an war mir aber klar, ohne fremde Hilfe komme ich nicht mehr gegen ihn an.
In den folgenden Wochen konnte ich nur noch mit größter Mühe dem Unterricht in der Schule folgen. Zu sehr hatte mich dieses Erlebnis geschockt. Auch beim Lernen in meinem Zimmer konnte ich mich kaum noch konzentrieren, denn ich befürchtete ständig erneute Annäherungsversuche dieses Mitschülers und wusste nicht, wie ich sie abwehren könnte. Nach einiger Zeit vertraute ich mich Ottmar an, ein Seminarist, der eine Klassenstufe über mir war. Er erschien mir vertrauenswürdig zu sein und ich hoffte, dass er mich verstehen würde. Ich erzählte ihm, in welchem Dilemma ich stecke und nachdem er diese Situation eine Zeit lang beobachtet hatte, gab er mir Ratschläge, wie ich mich verhalten könnte, um Begegnungen mit Alex zu vermeiden. Doch da ich beim Unterricht in der Schule, bei den Mahlzeiten im Speisesaal, in den Gottesdiensten und auf den Gängen ihm ständig begegnete, gestaltete sich dieses Zusammenleben im Seminar für mich immer schwieriger.
Inzwischen hatte das Collegium Ambrosianum einen so großen Zulauf, dass im Seminargebäude nicht mehr alle Schüler untergebracht werden konnten. Rektor Eckmann mietete nun Zimmer in den umliegenden Häusern an, in denen die Seminaristen ebenfalls wohnen konnten. Als einige dieser angemieteten Zimmer frei wurden, kam Ottmar auf die Idee, dass es für mich doch eine Erleichterung wäre, wenn ich aus dem Seminar ganz ausziehen würde, um mich aus meiner schwierigen Situation zu befreien. Auch er trug sich seit längerer Zeit mit diesem Gedanken und wollte sich um ein Zimmer außerhalb des Seminars bemühen. Obwohl ich mich im Ambrosianum durchaus wohlfühlte, leuchtete mir dieser Vorschlag ein, um vor allem von Alex den nötigen Abstand zu bekommen. Denn immer wieder versuchte er, mich irgendwo im Seminargebäude zu erwischen.
Also gingen Ottmar und ich zu Rektor Eckmann und brachten ihm unseren Wunsch vor, dass wir gerne in ein Zimmer außerhalb des Seminars ziehen würden. Er war froh darüber, denn es hatten sich wieder viele jungen Männer für das kommende Schuljahr angemeldet, die er anfangs lieber im Seminargebäude unterbringen wollte, damit sie sich somit besser an die Gepflogenheiten des Hauses und an den gesamten Schulablauf gewöhnen konnten. Er gab uns zwei Zimmer bei einer älteren Witwe, Frau Wenzel, die etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt in ihrem Reihenhaus wohnte. Im Erdgeschoss hatte sie ihr Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer, im ersten Stock war ihr Schlafzimmer, sowie eine Toilette mit Bad und zwei kleine Zimmer, in die wir einziehen durften. Zu den täglichen Mahlzeiten konnten wir weiterhin ins Ambrosianum kommen und im Speisesaal zu den gewohnten Essenszeiten teilnehmen.
Schnell packte ich meine Sachen zusammen und transportierte sie in mein neues Heim. Auch Ottmar zog mit allem, was er in seinem Zimmer hatte um, und wir wunderten uns, was sich doch in so kurzer Zeit bei uns alles angesammelt hatte. Müde von der anstrengenden Arbeit machte ich abends beim Einräumen meiner Bücher, Kleider und den vielen anderen Kleinigkeiten eine kleine Verschnaufpause. Dabei entdeckte ich in einer Tasche noch eine Flasche Holundersaft, den meine Mutter hergestellt und mir mitgegeben hatte. Ich fragte Ottmar, ob er herüber in mein Zimmer kommen möchte, um zusammen etwas zu essen und ein Glas Saft zu trinken. Sofort kam er, wir setzten uns in die beiden Clubsessel und ließen es uns an einem kleinen Tischchen zwischen meinen Kartons und den noch nicht aufgeräumten Gepäckstücken schmecken. Um jedem von uns ein Glas Holundersaft einzuschenken, öffnete ich die Bügelflasche und mit einem lauten Knall spritzte der dunkelrote Saft in geballter Ladung an die Wand bis zur Decke hoch. Fassungslos starrten wir beide auf die blutrot eingefärbte Tapete. Der Saft hatte in der Flasche gegärt und einen starken Druck aufgebaut, ich hatte bereits zwei Tage nichts mehr davon verkostet. Der Anblick der von unten bis oben verspritzten Wand war schrecklich. Und das am ersten Tag!
Verhängnisvolle Zeit
Wo bin ich? Was war geschehen? Ach ja, ich war heute Abend bei Dr. Bertram, er hatte mir von seiner Tochter erzählt, die unseren früheren Rektor Eckmann ja so toll findet. Ich muss wohl eingeschlafen sein und bin aus meinem Alptraum erwacht. Der Name Eckmann hat eine ganze Kaskade von Erinnerungen in mir ausgelöst. Mühsam erhebe ich mich aus meinem Sessel, gehe in meiner Wohnung ans Fenster und schaue hinunter auf den nächtlich beleuchteten Ludwigsburger Marktplatz. Immer ein wunderschöner Ausblick. Wie schön kann diese Welt doch sein, wenn....
Ich halte inne: War da nicht ein blutroter Fleck an der Wand? Misstrauisch schaue ich mich in meiner Wohnung um. Meine innere Beklemmung versuche ich damit zu bekämpfen, indem ich laut vor mir hersage: „Ich bin jetzt in Ludwigsburg und die Zeit im Ambrosianum ist endgültig vorbei.“
Doch immer wieder holt sie mich ein. Zu turbulent waren damals die auf mich einstürzenden Ereignisse. Ich trinke ein Glas Wasser und gehe ins Bett. Bald schlafe ich wieder ein, der gute Wein von Dr. Bertram entfaltet seine Wirkung. Schon tauche ich wieder ein in die unangenehmen Traumbilder. Die Wand, der rote Saft, verspritzt in tausend kleinen Tröpfchen bis zur Decke hoch! Die ganze Tapete in meinem neu bezogenen Zimmer ist ruiniert! Ottmar und ich, wir stehen fassungslos da und wissen nicht, was wir tun sollen.
Die Spritzer entfernen? Aber wie?
Zuerst versuche ich es mit einem Handtuch und lauwarmem Wasser. Oh Gott! Es wird ja noch schlimmer! Die dicken roten Kleckse verschmieren zu einem hässlichen rotbraunen Fleck. Ottmar versucht es mit einem trockenen Tuch. Tatsächlich, er hat wenigstens damit einen kleinen Erfolg, indem die dick aufgetragenen Spritzer etwas dünner werden. Doch auch so kommen wir nicht viel weiter. Die dunkelrote Farbe bedeckt in abertausenden von kleinen Klecksen die Tapete der halben Wand. Was wird wohl unsere Hausfrau dazu sagen? Sollen wir gleich schon jetzt nach unserem Einzug ihr berichten, was passiert ist? Wie wird sie reagieren? Wird sie uns gleich wieder hinauswerfen, so dass wir zurück ins Seminar müssen?
Und eine derartige Tapete aufzutreiben, wäre ein Ding der Unmöglichkeit: grau-weiße kleine Striche in verschiedenen Farbabstufungen auf grau-weißem Untergrund. Wo würden wir denn so ein langweiliges Muster heutzutage noch bekommen? Oder die ganze Wand komplett mit einer anderen, halbwegs passenden Tapete überkleben? Vielleicht das ganze Zimmer neu tapezieren? Ob sie da wohl zustimmen würde?
Um auf andere Gedanke zu kommen, räumen wir unsere Sachen vollends in die Schränke. Auch den neuen Schreibtisch bestücke ich mit allerlei mitgebrachten Utensilien. Gerade will ich meinen Wasserfarben-Kasten in die unterste Schublade legen, da kommt mir der Gedanke....? Ja, man könnte es doch einmal versuchen? Die hässlichen roten Saftspritzer einfach mit Wasserfarben übermalen? Schnell hole ich ein Glas Wasser vom Bad, tauche die Pinsel ein und stelle mit der weißen und schwarzen Wasserfarbe verschiedene Grautöne her. Dann mache ich mich vorsichtig daran, jeden einzelnen roten kleinen Fleck mit dem passenden Grauton zu übermalen. Ich entferne mich, schaue das Ergebnis von weitem an. Es funktioniert! Aber nur, wenn der Saft an der Tapete schon ganz trocken ist. Ansonsten vermischt er sich gleich mit der grauen Farbe und es kommen hässlich blutige Mischtöne heraus. Ich hole Ottmar von seinem Zimmer herüber zur Begutachtung, doch er behauptet:
„So schaffst du das doch nie! Jetzt hast du gerade mal fünf Spritzerchen übertüncht! Für die ganze Wand brauchst du ja mindestens drei Wochen“, gibt er zu bedenken.
„Nein, das geht schneller“, halte ich ihm dagegen, „und wenn du mithilfst, dann sind wir bis morgen früh ganz bestimmt fertig.“
„Trotzdem, lass es, das hat doch keinen Sinn! Du wirst sehen, bei Tageslicht kommen erst recht die unterschiedlichen Farbtönungen heraus. Du kannst nie deine Wasserfarben so genau anrühren und so exakt auftragen, dass man nichts mehr merkt“, wendet Ottmar skeptisch ein.
Doch ich lasse mich nicht von ihm entmutigen. Bald nimmt auch er einen Pinsel zur Hand und fängt damit an, die vielen roten Fleckchen zu übermalen. Die ganze Nacht arbeiten wir unentwegt daran, ohne Pause. Als der Morgen graut, ist mir ganz übel. Der Rücken und sämtliche Glieder tun mir weh, auch Ottmar stöhnt und kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Diese akribische Malweise stundenlang in völlig ungewohnter Haltung, es war eine Tortur. Als wir uns fertig machen, um in die Schule zu gehen, schauen wir unser Werk nochmals an. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, sämtliche Spritzer an der Wand unsichtbar zu machen. Doch wie das alles erst bei helllichtem Tageslicht und bei genauerer Betrachtung aussehen wird? Heute Mittag, wenn wir vom Ambrosianum zurück sind, werden wir es sehen.
In der Schule lasse ich den Unterricht über mich ergehen. Ich bin sterbensmatt. In der langweiligen Griechisch-Stunde nicke ich sogar ein. Auch bei der Klassenarbeit in Mathe kann ich mich kaum konzentrieren. Doch das ist nicht weiter schlimm, es ist ja mein Lieblingsfach. Da ich mich ohnehin nie lange darauf vorbereiten muss, kann es mir zwischendurch auch mal gleichgültig sein, wenn ich mal eine schlechtere Note schreibe als sonst. Als ich nach der Schule wieder zurück ins Reihenhaus von Frau Wenzel gehe, bin ich äußerst gespannt, wie die Wand bei Tageslicht wohl aussehen wird. Schnell gehe ich die Treppe hoch in mein Zimmer und schaue die Wand an. Ich bemerke, dass noch einige kleine Ausbesserungsarbeiten nötig sind, ansonsten sieht es aber recht gut aus. Gleich mache ich mich daran, mit meinen Wasserfarben die noch nicht ganz perfekten Grautöne dieser gestrichelten Tapete in Angriff zu nehmen. Nach einer Weile höre ich, wie Ottmar unten zur Haustür hereinkommt und mit Frau Wenzel ein paar Worte spricht. Sie muss ihn von ihrem Wohnzimmer aus gesehen haben und gibt ihm noch einige Anweisungen für die Benutzung des Teppichbodens in unseren Zimmern. Schnell mache ich mich daran, die auffälligsten Farbunterschiede rasch noch auszugleichen, doch schon höre ich, wie er langsam mit ihr zusammen die Treppe heraufkommt und laut mit ihr redet. Flugs räume ich den Farbkasten, die Pinsel und das Wasserglas beiseite. Es klopft an der Tür. Ich rufe: „Herein!“
Ottmar und Frau Wenzel stehen unter dem Türrahmen, sie schaut neugierig herein und fragt:
„Na? Haben Sie sich schon einigermaßen eingerichtet?“
Wie angewurzelt stehe ich da und hoffe, dass sie sich nicht allzu sehr im Zimmer umschaut und antworte trocken:
„Ja, halbwegs. Aber schlafen konnte ich noch nicht so gut.“
Sie geht ans Bett, drückt leicht von oben auf die Matratze und stellt fest:
„Die ist doch ganz in Ordnung? Als ich so jung war wie Sie, da konnte ich überall schlafen, ganz egal wo. Wenn Sie aber Probleme haben, sagen Sie es mir, ich gebe ihnen dann ein zusätzliches Unterbett.“
„Nein, nein,“ lehne ich dankend ab, „es lag wohl eher an der Klassenarbeit, die wir heute geschrieben haben. Das mulmige Gefühl lässt mich oft in der Nacht zuvor nicht ganz zur Ruhe kommen.“
Ottmar grinst und schaut demonstrativ auf die andere Seite der Wand, um ihren Blick von unserem „unauffälligen Gemälde“ etwas wegzulenken. Als Frau Wenzel bemerkt, dass ich mit hochrotem Kopf wie versteinert dastehe und mir der Puls in den Adern immer schneller schlägt, fragt sie besorgt:
„Sind Sie krank?“
Sie kommt auf mich zu, hält ihre Hand an meine Stirn und stellt fest:
„Sie habe ja Fieber! Am besten gehen Sie gleich ins Bett, ich mache Ihnen einen Kamillentee und bringe ihn gleich herauf!“
Ich bin heilfroh, als sie das Zimmer wieder verlässt und sich nicht allzu neugierig umschaut. Schnell ziehe ich mich aus und lege mich im Schlafanzug ins Bett. Als Frau Wenzel klopft, stehe ich schnell auf und nehme an der Tür dankend von ihr ein Tablett mit Teekanne und Tasse entgegen, um zu verhindern, dass sie nicht nochmals ins Zimmer hereinkommt.
„So ist es richtig! Sie sind wenigstens vernünftig. Wenn man krank ist, muss man sofort ins Bett, dann geht es am schnellsten wieder vorüber“, belehrt sie mich, „und wenn Sie den Tee gleich trinken, können Sie sicherlich auch noch ein bisschen ihren Schlaf nachholen.“
Fix und fertig falle ich ins Bett und schlafe sofort ein.
Es dauert einige Wochen bis ich mich endlich wieder wohlfühle und mit meinen Gedanken beim Lernen nicht mehr ständig abschweife. Der größere Abstand von Schule und Seminar tut mir gut, ich kann mich wieder frei bewegen, ohne dass ich ständig anderen Seminaristen begegne. Vor allem bin ich nicht mehr den lästigen Blicken und den unterschwelligen „Anmachversuchen“ von Alex ausgesetzt. Da Ottmar einen anderen Stundenplan hat, sehe ich ihn meist nur abends. Überwiegend halten wir uns in unseren Zimmern auf, wo jeder in aller Ruhe lernen kann. Wenn wir zwischendurch eine kurze Pause einlegen, tauschen wir einige Erlebnisse von unserem Schulalltag aus, um uns danach wieder bis oft spät in die Nacht hinein auf die bevorstehenden Klausuren vorzubereiten. So entwickelt sich zwischen Ottmar und mir bald ein gutes Miteinander, da wir bei unserem Tagesablauf für gute Abwechslung sorgen. Zwischen den Schulzeiten und unseren Lernphasen in unseren Zimmern legen wir kleine Spaziergänge ein, um anschließend uns wieder mit aufgefrischter Konzentration an unsere kleinen Schreibtische zu setzen und uns hinter unsere Bücher zu verkriechen.
An einem Samstagabend kommt Ottmar auf die Idee, nachdem ein jeder von uns wieder lange in seinem Zimmer gepaukt hatte, den anstrengenden Tag mit einer Flasche Wein gemütlich ausklingen zu lassen. Da er ein sehr geselliger Typ ist und auch sonst bei allerlei Anlässen mit anderen gerne bechert, animiert er mich bei einem unterhaltsamen Gespräch, dem Wein ordentlich zuzusprechen. Doch bald legt er freundschaftlich seinen Arm um meine Schulter und redet, inzwischen deutlich beschwipst, pausenlos auf mich ein. So langsam wird mir die Sache unangenehm und jetzt umso mehr, als er mir nun ein Kompliment nach dem anderen macht. Zunächst denke ich, dass er mittlerweile doch viel zu viel getrunken und eine „gewaltige Zacke in der Krone sitzen“ hat.