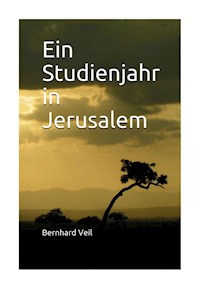4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bernhard Veil
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch „Pfaffen-Mobbing“ ist ein Auszug aus der Buchreihe des Autors „Die Seelentöter“ und beleuchtet ein kirchliches Phänomen, das vielen nicht präsent ist und gern vertuscht wird. Es geht um die Ausgrenzung und die psychische Zerstörung einer Person, die nicht ins gewohnte Raster passt. Schauplatz der Handlung ist die Klinikseelsorge im Klinikum Stuttgart. Hier arbeiten evangelische und katholische Klinikseelsorger/innen zusammen, es sind ausschließlich Pfarrerinnen und Pfarrer, nur einer nicht. Weil er als katholischer Theologe das Zölibatsversprechen nicht ablegen wollte, wählte er den Beruf des Pastoralreferenten. Seine Ausbildung ist gleich wie die eines Pfarrers, nur ohne Priesterweihe. Unterschiedliche Sichtweisen und egozentrisches Verhalten sind die Beweggründe, die Abwertung und Ausgrenzung bewirken. Anfangs noch kaum zu erkennen, schleichen sich zunehmend unschöne „Nettigkeiten“ ein, die mehr oder weniger von allen akzeptiert werden. Mobbing hat viele Ursachen und ist immer wieder anders. Durch die Herabsetzung des Anderen lässt sich das eigene Ego erhöhen. In der Gier nach Bewunderung und Anerkennung muss der Andere schließlich „zerbrechen“. Um den vermeintlichen Konkurrenten auszuschalten, muss man ihn vor anderen herabwürdigen, um dadurch Achtung vor sich selbst zu gewinnen. Es macht sprachlos, wenn man in dieser Geschichte die Dreistigkeit, die Arroganz und die Selbstgerechtigkeit der kirchlichen Amtsträger, ob evangelisch oder katholisch, mitbekommt und wie sie mit ihrem Kollegen verfahren. Mobbende Kollegen, mobbende Vorgesetzte bzw. mobbende Freunde von Vorgesetzten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite nicht vorhandene oder nicht zuständige kirchliche Strukturen, die allzu oft von feigen Personen besetzt sind, die lieber wegschauen als helfen. Und wie absurd! Beide Kirchen bezahlen Betriebsseelsorger, die aber für das Kirchenpersonal nicht zuständig sind! Gut besoldete Kirchenobere sind unfähig oder nicht willens, gegen Mobbing in ihren eigenen Reihen einzuschreiten. Der Gedanke, dass der unmittelbare Vorgesetzte selbst zum Kreis der Mobber gehört, wird von Anfang an unterdrückt. Für den Betroffenen ist es katastrophal, da er es viel zu spät bemerkt, wenn Dekane, Prälaten und sonstige Theologen es zulassen, dass er zum Abschuss freigegeben ist. Alles geschieht „hintenherum“, so dass sich das Opfer nicht wehren kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Pfaffen-
Mobbing
Bernhard Veil
Das Buch ist ein Auszug
aus der Buchreihe
„Die Seelentöter“
Copyright © 2022 Bernhard Veil
1. Auflage
ISBN: 9798361609659
Inhalt
VorwortUnser Seelsorge-Team 9Das Netz zieht sich zusammen 35Rückzug auf meine Arbeit75Es bahnt sich etwas an77Deprimierende Nachrichten116Nervenaufreibende Zerreißprobe153Suche nach juristischem Beistand180Die Schikanen gehen weiter194Abschied für immer212Bitte um Verständnis 228Mein neuer Kollege262Im Bischöflichen Ordinariat293Ausgegrenzt und abgeschoben315Unterschiedliche Behandlung 338Die überaus wichtige Klinikseelsorge 372Die Lage ändert sich 407Priesterliche Teamarbeit 432Die Hetzkampagne geht weiter 466Vorwort
Bei der Einführung der neuen Berufsgruppe der Pastoralreferenten gab es bei vielen Priestern und Gläubigen große Vorbehalte und Bedenken, die teils offen diskutiert, teils hinter vorgehaltener Hand sehr skeptisch beurteilt wurden. Ein Grund dafür liegt im kirchlichen Amtsverständnis der katholischen Kirche, die zwischen Klerikern und Laien unterscheidet. Kleriker ist, wer von einem Bischof geweiht wurde, alle anderen werden als „Laien“ bezeichnet, selbst wenn sie einen höheren Bildungsstand und mehr Ausbildungen vorweisen können als die geweihten Amtsträger. Dieser herabsetzende Begriff „Laie“ wurde von den „geweihten“ Amtsträgern vor allem deshalb eingeführt, um sich selbst von den übrigen Kirchenmitgliedern abzusetzen und deren Inkompetenz und Machtlosigkeit zu benennen.
Dass es mit dem Beruf der Pastoralreferenten nun Theologen im „Laienstand“ gibt, ist für manche Priester und Pfarrer oft schwer zu ertragen, vor allem dann, wenn solche sogenannten „Laientheologen“ bei vielen Kirchenmitgliedern besser ankommen als sie selbst oder gar häufiger um Rat und Beistand gefragt werden als so mancher Kleriker. Dieser Umstand bewirkt bei Klerikern viel Neid und Missgunst, zumal sie es gewohnt waren, selbst im Rampenlicht zu stehen und der Mittelpunk ihrer Kirchengemeinden zu sein.
Um sich Ansehen und Einfluss zu sichern, entsteht oft unterschwellig ein psychodynamischer Prozess, der mit intriganten Vorgehensweisen nicht selten äußerst unfair ausgetragen und mit massiven Mobbing-Attacken solange weitergeführt wird, bis das gestresste Opfer aufgibt oder von seinen Peinigern mit Verleumdungen und üblen Nachreden aus dem Weg geräumt wird.
Da ich als Pastoralreferent in einem ökumenischen Pfarrer-Team arbeitete, wurde ich schnell zum Ziel von Mobbing-Attacken, weil ich einerseits bei den Leuten gut ankam, andererseits von meinen Priester- und Pfarrer-Kollegen/innen als nicht ebenbürtig und gleichwertig akzeptiert wurde. Ständig mussten sie mir und anderen klarmachen, dass sie selbst weitaus wichtiger und mehr sind als ich.
Die Vorgesetzten in den Kirchenleitungen verhielten sich bei diesen Mobbing-Attacken wie bei den zahlreichen Missbrauchsfällen, die in den letzten Jahren weltweit publik wurden. Die Täter (Pfarrer) wurden geschützt, ihr Fehlverhalten geduldet bzw. gedeckt, begangene Verfehlungen vertuscht und geheim gehalten. Die Opfer wurden abgewimmelt oder als lästige Störenfriede gebrandmarkt.
In diesem Buch erzähle ich meine Mobbing-Geschichte, gegen die meine Vorgesetzten nie eingeschritten sind, um ihre „Kollegen und Kolleginnen“ in „Amt und Würden“ zu schützen. Die Namen der angeführten Personen wurden geändert, die Orte der jeweiligen Handlungen jedoch beibehalten.
Unser Seelsorge-Team
Als ich meinen Dienst im Katharinenhospital antrete, gehören zum Seelsorgeteam zwei evangelische Pfarrer und mein Priester-Kollege Arno. Nachdem einer der evangelischen Kollegen in den Ruhestand geht, gelingt es dem Kollegen Stolzenburg durch seine guten Kontakte zum Oberkirchenrat, dass nun auf evangelischer Seite gleich drei weitere Stellen geschaffen werden, obwohl die Anzahl der evangelischen und katholischen Patienten in unserer Klinik zumeist etwa gleich groß ist. Die neuen Stellen werden allesamt mit evangelischen Theologinnen besetzt, mit Pfarrerin Rallinger, Pfarrerin Koschinski und der Vikarin Rink. Eifrig diskutieren die drei Seelsorgerinnen bei allen Problemen und anstehenden Aufgaben sehr dienstbeflissen mit. Äußerst ungern lassen sie sich über wichtige Hintergründe informieren und treffen ihre Entscheidungen oft in völliger Unkenntnis der vorgegebenen Sachverhalte. Mir wird bald klar, dass diese Kolleginnen sich vor unseren ökumenischen Teamsitzungen untereinander über einzelne Gesprächspunkte absprechen, möglicherweise werden sie auch vorher vom Kollegen Stolzenburg entsprechend instruiert. Wie es den Anschein hat, teilt Stolzenburg ihnen vor den Teamsitzungen seine Interessen mit, um sie auf seine Linie einzustimmen, damit er bei den anstehenden Entscheidungen mit ihrer Zustimmung rechnen kann.
Es stehen immer noch dieselben Themen auf der Tagesordnung, in denen Stolzenburg selbstherrlich entscheiden wollte, solange kein katholischer Priester hier anwesend war, denn mich hatte er als katholischen Ansprechpartner nie akzeptiert. Denn ich bin nicht Pfarrer, sondern lediglich Pastoralreferent. Dieser Beruf ist neu in der katholischen Kirche. Nun aber ist mein neuer Priesterkollege Arno hier und seine drei evangelischen Kolleginnen, mit denen er sozusagen „adäquat“ verhandeln kann.
Ein Tagesordnungspunkt in unserem Seelsorgeteam ist die Anschaffung einer neuen Orgel für unseren Andachtsraum. Um dafür Spenden zu sammeln, hat Stolzenburg bei der Verwaltung angefragt, ob er für diesen Zweck auch Baufirmen anschreiben dürfe, die den neuen Funktionsbau erstellt haben. Er bekam von der Verwaltung eine Liste der beteiligten Firmen und verfasste zusammen mit einer Kollegin einen Bettelbrief, in dem er darum bittet, einen Beitrag für die neue Orgel zu spenden. Diesen Brief liest er vor und erhofft sich, dass für die Anschaffung dieses neuen Instruments rund 100.000 Euro zusammenkommen. Ich wundere mich über die hohe Summe, die er für die neue Orgel angesetzt hat, und bringe den Einwand, dass ein solch großes Instrument in dem relativ kleinen Andachtsraum doch viel zu viel Platz einnehmen würde. Es wäre eher sinnvoll, eine elektronische Sakralorgel aufzustellen, die weitaus effektiver und überdies gerade mal ein Zehntel einer Pfeifenorgel kosten würde. Da ich selbst Orgel spiele und zuhause in meinem Wohnzimmer eine Sakralorgel habe, weiß ich, welch wahre Klangwunder diese elektronischen Kirchenorgeln sind. Aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten kann man auf ihnen viel anspruchsvollere Orgelwerke spielen als auf einer kleinen Pfeifenorgel. Außerdem ist es durch die moderne Technik möglich, eine elektronische Sakralorgel so zu programmieren, dass sie Klangtöne einer real existierenden Kirchenorgel zum Erklingen bringt. Auf diese Weise kann jeder einzelne Ton einer Pfeife von einer berühmten Kirchenorgel in solch eine Computerorgel einprogrammiert werden, so dass man ein Präludium quasi auf der Passauer Domorgel oder auf einer Silbermannorgel hören kann. Doch nicht nur das Tonrepertoire kann originalgetreu wiedergeben werden, sondern auch der Klang und die Lautstärke können perfekt an den jeweiligen Raum und die darin befindliche Personenzahl angepasst werden, was bei einer Pfeifenorgel kaum möglich ist. Da Stolzenburg und die Kolleginnen keine Ahnung von den technischen Möglichkeiten einer Orgel haben, stellen sie sich ständig das Klangbild einer modernen Hammondorgel vor, wenn ich von einer elektronischen Sakralorgel spreche.
Da ich nicht einsehe, dass rund 100.000 Euro für eine Pfeifenorgel investiert werden sollen, die für den kleinen Andachtsraum viel zu groß ist und auf der man keine anspruchsvollen Orgelwerke spielen kann, überlege ich mir, was ich tun könnte, um meine Kollegen umzustimmen. Nach reiflicher Überlegung lasse ich meine Orgel von meinem Wohnzimmer in den Andachtsraum der Klinik bringen. Den evangelischen Kollegen erlaube ich, dass sie mein Instrument auch bei ihren Gottesdiensten benützen können. Und bald stellen sie fest, dass ihre Organisten durchweg positiv vom guten Klang der einzelnen Register überrascht sind. Vor allem sind sie von den vielfältigen Auswahlmöglichkeiten und Spielkombinationen begeistert. Trotzdem dauert es bei Stolzenburg und den Kolleginnen immer noch Monate, bis sie davon überzeugt sind, dass eine elektronische Sakralorgel sich für diesen kleinen Andachtsraum weitaus besser eignen würde als eine herkömmliche Pfeifenorgel.
Als es bei unserer nächsten Teamsitzung um die Aufteilung der neuen Büroräume geht, die wir im neuen Funktionsbau bekommen sollen, bringt Stolzenburg überraschenderweise nicht mehr wie früher eine fiktive Sekretärin ins Spiel, die er beim Oberkirchenrat beantragen möchte. Denn dieses Argument habe ich durch meine Rückfrage beim Oberkirchenrat geklärt. Für ihn ist nämlich gar keine Sekretärin vorgesehen, er wollte lediglich bei der Klinikverwaltung seine wichtige Funktion unterstreichen, die er als Vorsitzender der evangelischen Krankenhausseelsorger innehat. Auf diese Weise wollte er bei der Klinikverwaltung für sich zwei von insgesamt vier Seelsorgezimmer in Beschlag nehmen, die uns die Klinikverwaltung im neuen Funktionsbau zur Verfügung stellen will. Dies habe ich ihm jedoch vermasselt. Nun aber, da die Verwaltung uns nicht mehr im Funktionsbau, sondern im Wirtschaftsgebäude vier Büroräume zugeteilt hat, plädiert er jetzt dafür, dass den beiden katholischen Seelsorgern lediglich ein Raum zustehen solle, zwei Räume seien für die vier evangelischen Seelsorger vorgesehen und ein Raum solle für gemeinsame Besprechungen eingerichtet werden. Auch diesen Vorschlag lehne ich ab, da wir bereits einen gemeinsamen Besprechungsraum in der Nähe des Andachtsraumes haben, der wesentlich größer ist als diese vier Büroräume im Wirtschaftsgebäude. Daher bringe ich den Vorschlag: Jeder hauptamtliche Seelsorger, der mit einem vollen Auftrag in der Klinik arbeitet, benötigt tagsüber unbedingt eine Rückzugsmöglichkeit, in dem er in Ruhe seine Schreibarbeiten und seine Vorbereitungen für die Gottesdienste erledigen kann. Pfarrerin Koschinski, die lediglich mit einem halben Auftrag hier arbeitet, und die Vikarin, die während ihrer Ausbildung wochenlang auf Fortbildungen ist, können zusammen das Seelsorgezimmer benützen. Hier halten wir unsere monatlichen Teamsitzungen ab, ansonsten wird dieser Raum quasi als Sakristei für den Andachtsraum genutzt. Die meiste Zeit ist er nicht belegt.
Mit diesem Vorschlag ist Stolzenburg nicht einverstanden. Deshalb bringt er plötzlich wieder eine fiktive Sekretärin ins Spiel, die für ihn arbeiten werde, und möchte auf alle Fälle einen weiteren freien Raum zur Verfügung haben, falls der Oberkirchenrat für die evangelische Klinikseelsorge doch noch eine Sekretärin für ihn genehmigen sollte. Diesen Vorschlag finde ich absurd: Sich erst einen Büroraum sichern, obwohl man noch gar nicht weiß, ob die Gelder für eine Sekretärin bewilligt werden. Wieder wird lange diskutiert, geredet und argumentiert. Stolzenburg will partout nicht einsehen, dass seine Vorgehensweise unlogisch und anmaßend ist.
Um einen Kompromiss herbeizuführen, bringt mein Priesterkollege Arno schließlich folgendes Angebot. Jeder der vier hauptamtlichen Seelsorger mit Vollzeitbeschäftigung bekommt einen Raum im Wirtschaftsgebäude, so wie ich es vorgeschlagen habe. Er aber würde gern auf seinen Raum zu Gunsten der evangelischen Kolleginnen verzichten, die nur mit einem Teilauftrag beschäftigt sind, weil er ohnehin über die Mittagszeit nachhause fährt, damit er sich um seinem demente Mutter kümmern kann. Ihm würde es genügen, wenn er sich mit mir zusammen einen Büroraum teilen könnte.
Da alle Kollegen nach vier Teamsitzungen, in denen dieses Thema lang und breit behandelt wurde, endlich damit abschließen wollen, stimmen alle diesem Kompromissvorschlag zu. Allerdings lasse ich im Protokoll vermerken, dass diese Regelung nur so lange gültig ist, solange Arno und ich im Katharinenhospital zusammenarbeiten. Sobald ein Nachfolger von mir oder von Arno darauf bestehen sollte, dass er als Klinikseelsorger einen eigenen Büroraum beanspruchen möchte, muss die evangelische Klinikseelsorge diesen Raum wieder zurückgeben. Meine vorbehaltliche Zustimmung wird im Protokoll vermerkt und von allen akzeptiert. Insgeheim ärgere ich mich aber über Arno, der mit seinem Vorschlag mir in den Rücken gefallen ist. Denn nun hat Stolzenburg erreicht, was er wollte: die evangelische Klinikseelsorge bekommt drei Büroräume und wir nur einen, den ich wie bisher mit meinem katholischen Priesterkollegen teilen muss.
Und schon wieder ist ein Diskussionspunkt in unserem Team die Anschaffung einer neuen Orgel. Nach langen Beratungen und Rückfragen bei ihren Organisten, die meine Orgel nun über ein Jahr lang in ihren Gottesdiensten testen konnten, geben nun endlich die evangelischen Kollegen mir den Auftrag, ein solches Instrument bei derselben Orgelbaufirma zu kaufen, bei der ich meine Orgel erworben habe. Mit rund 30.000 Euro kostet sie nun nicht einmal ein Drittel von dem, was Stolzenburg für seine Pfeifenorgel veranschlagt hatte, die viel zu wuchtig für den Andachtsraum gewesen wäre.
Im nächsten Tagesordnungspunkt kommt er auf den neuen Funktionsbau zu sprechen, der auch Auswirkungen auf den Organisationsablauf des gesamten Klinikums habe und sehr viel Arbeit mit sich bringe. So werde demnächst eine neue Telefonanlage installiert und im ganzen Haus neue Telefonapparate mit neuen Telefonnummern vergeben. Die Telefone seien mit speziellen Funktionen ausgestattet, so dass jeder Seelsorger sich seine eigene Telefonnummer mit Anrufbeantworter, Fernabfragefunktion, Konferenzschaltung und vielen weiteren Raffinessen einrichten lassen könne. Außerdem müssen mit dem Architekten noch einige Änderungen abgeklärt werden, zum Beispiel die großzügige Gestaltung der Eingangshalle, die mit lebenden Bäumen ausgeschmückt werden soll. Da diese Baumaßnahmen jedoch unter dem Etatansatz „Kunst am Bau“ abgerechnet werden können, wofür etwa 5 % der Gesamtkosten zur Verfügung stehen, könne man relativ variabel agieren und auch andere Posten mit einberechnen. So wäre es durchaus möglich, in diesem Etatbereich einige Anschaffungen für unseren Andachtsraum unterzubringen, da er für alle Patienten zugänglich ist und ansprechende Kunstobjekte sich positiv auf den Genesungsverlauf der Patienten auswirken würden.
Die Kolleginnen sind der Auffassung, dass eine handgemalte russisch-orthodoxe Marien-Ikone für den Andachtsraum sehr schön wäre. Ich plädiere dafür, endlich unseren gemeinsamen Anrufbeantworter abzuschaffen und schlage vor, dass jeder Seelsorger die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Telefonanlage nützen sollte, so dass die Patienten und das Pflegepersonal gleich den zuständigen Seelsorger direkt anrufen können.
Den eigentlichen Grund meines Vorschlags nenne ich natürlich nicht. Es sind meine Erfahrungen mit Stolzenburg, der schon mehrmals Anrufe auf dem gemeinsamen Anrufbeantworter gelöscht hatte, die mich betrafen, so dass ich die aufgesprochenen Besuchswünsche nicht erfüllen konnte. Denn bei meinen regelmäßigen Besuchen begegnete ich ab und zu Patienten, die enttäuscht waren, weil ich nicht gekommen sei, obwohl sie ihren Besuchswunsch uns auf den gemeinsamen Anrufbeantworter gesprochen hatten. Dass es Stolzenburg war, der diese Anrufe löschte, konnte ich ihm Nachweisen und durch einige namentliche Beispiele belegen. Er tat so, als ob es ein Missverständnis gewesen sei, denn die Patienten hätten einen Pfarrer sprechen wollen und keinen Pastoralreferenten. Diese Vorfälle behielt ich für mich, denn es wäre fraglich gewesen, ob die drei Kolleginnen und Arno es akzeptiert hätten, wenn ich Stolzenburg mit diesem Vorwurf attackiert hätte. Denn Arno und die Kolleginnen sind noch nicht lange hier und können sich wohl kaum vorstellen, wie Stolzenburg hinterhältig gegen andere vorgehen kann, wenn er jemanden ins Visier genommen hat.
Der zweite Grund, weshalb ich für die Abschaffung dieses gemeinsam genutzten Anrufbeantworters bin, ist die Faulheit Stolzenburgs, der sich stur darauf verlässt, dass die anderen KollegenInnen sich für alle Patienten verantwortlich fühlen und alle Aufträge und Wünsche erledigen, die auch seine Patienten betreffen. Da er sehr unregelmäßig in die Klinik kommt, profitiert er von der gemeinsamen Nutzung des Anrufbeantworters am meisten und lässt somit alle anderen für sich arbeiten. Für ihn scheint die Ökumene vor allem darin zu bestehen, dass andere ihm die Kleinarbeit erledigen, damit er sich voll darauf konzentrieren kann, die gesamte ökumenische Klinikseelsorge nach außen hin zu präsentieren.
Was mich nun völlig irritiert, ist sein Sinneswandel als er erfahren hat, dass vom Etatposten „Kunst am Bau“ des neuen Funktionsbaues noch Gelder für den Andachtsraum abgezweigt werden könnten. Stolzenburg träumt plötzlich wieder von einer teuren, handgefertigten Pfeifenorgel. Sein vordergründiges Bestreben nach Repräsentation tritt wieder ungezügelt zutage. Eine Orgel im Andachtsraum soll seiner Ansicht nach vor allem gut aussehen, damit er als Initiator der Spendenaktion protzen kann.
Ein anderes Projekt, das er in unserem Seelsorgeteam vorstellt, ist ein neues Faltblatt, in dem die Arbeit der Klinikseelsorge vorgestellt werden soll. Bei der Gestaltung dieses neuen Faltblattes werden wir katholische Kollegen von ihm gar nicht gefragt, obwohl darin die Arbeit aller Seelsorger vorgestellt werden soll. Als er die fertige Broschüre, die mehrere Seiten umfasst, in unserem Seelsorgeteam präsentiert, finde ich es grotesk, dass auf den Bildern nur die evangelische Vikarin dargestellt wird, wie sie hingebungsvoll an einem Krankenbett sitzt und milde lächelnd einem Patienten zuhört. Obwohl sie keine Klinikseelsorge-Ausbildung und von seelsorglicher Gesprächsführung keine Ahnung hat, präsentiert er sie als Aushängeschild für die Klinikseelsorge im Katharinenhospital. Doch sein Kalkül, das hinter seiner Strategie steckt, ist mir sofort klar. Da die Vikarin sich bei dieser Präsentation in dem Faltblatt von ihm sehr geschmeichelt fühlt, wird sie sicherlich bei ihrer Ausbildungsleitung im Oberkirchenrat von ihrem großzügigen „Chef“ berichten, der sie nach Kräften fördert. Dadurch bekommt er wieder neue Vikare zur Ausbildung zugeteilt, so dass er sein Renommee unter seinesgleichen noch steigern kann. Die Vikarin erfährt durch diese bevorzugte Behandlung einen mächtigen Auftrieb und erfüllt ihm anstandslos all seine Wünsche. Und dadurch, dass er sie überdies bei den Patienten und Mitarbeitern des Katharinenhospitals sogar als Pfarrerin und Kollegin vorstellt, um ihre Person noch hervorzuheben, sichert er sich ihre Ergebenheit. Die Folge dieser Vorzugsbehandlung bekomme ich leider sehr unangenehm zu spüren. Mir gegenüber verhält sie sich im Laufe der Zeit immer schnippischer und wird zunehmend frecher. Da sie als „Pfarrerin“ fungieren darf, bekomme ich ihre Arroganz und Dreistigkeit deutlich zu spüren.
Es stellt sich die Frage, ob ich ihre herablassenden Bemerkungen nun einfach so hinnehmen soll. Wenn ich ihr Paroli bieten würde, was würde dann passieren? Wie schnell könnte es zu einem handfesten Streit kommen und ihr Ziehvater Stolzenburg, sowie ihre beiden Kolleginnen Rallinger und Koschinski wären sogleich an ihrer Seite und würden schützend ihre Hand über sie halten?
Ich rede mit Arno darüber, doch er kann nicht nachvollziehen, dass sie sich mir gegenüber so schnippisch benimmt. Er habe es nicht mitbekommen und meint, dass sie sich ihm und den anderen Kolleginnen gegenüber sehr korrekt und angemessen benehme.
Woche für Woche ertrage ich das freche Verhalten der Vikarin und manchmal bekomme ich geradezu den Eindruck, als ob sie mich wegen an den Haaren herbeigezogenen Lappalien gängeln will, nur um ihre Überlegenheit mir gegenüber herauszustellen. Und bald bemerke ich, dass Stolzenburg hinter ihren Attacken steckt. Vermutlich treiben ihn seine Rachegelüste zu diesen hinterhältigen Anfeindungen, weil ich ihm durch die Nennung von Patienten nachweisen konnte, dass er auf dem Anrufbeantworter Anrufe gelöscht hatte, die für mich bestimmt waren. Vielleicht befürchtet er sogar, dass ich es publik machen könnte und setzt nun alles daran, um mich bei seinen Kolleginnen ins schlechte Licht zu rücken. Zunehmend stelle ich fest, dass alles, was ich in unseren Teamsitzungen sage, vor allem von dieser Vikarin, die unter seinem besonderen Schutz steht, sofort zurückgewiesen wird. Ich werde vor allen anderen von ihr gegängelt, obwohl es gar nichts zu gängeln gibt, und werde mehr und mehr von ihr grundlos angefeindet. Zwar weise ich ihre Vorwürfe auf den Teamsitzungen sachlich zurück und betone, dass sie nicht befugt sei, mir irgendwelche Anweisungen, Belehrungen oder Ratschläge zu erteilen. Sofort aber sind sich Stolzenburg und die evangelischen Kolleginnen einig und kontern mit dem Argument, dass die Vikarin in unserer ökumenischen Zusammenarbeit durchaus eine persönliche Kritik mir gegenüber aussprechen dürfe.
Stolzenburg lässt sie gewähren, während bei den beiden evangelischen Kolleginnen vermutlich eher ein anderer Aspekt im Vordergrund steht. Sie stehen ihrer Vikarin vor allem deshalb bei, weil sie es als Frau mir gegenüber, einem Mann in der männerdominierten katholischen Kirche, sehr schwer habe, sich Gehör zu verschaffen. Um von ihnen zum Thema „Frau in der Kirche“ in kein Streitgespräch verwickelt zu werden, schüttle ich nur lächelnd den Kopf und lasse sie reden. Mitunter versuche ich, ihnen mit Freundlichkeit, Gelassenheit oder mit zuvorkommender Hilfsbereitschaft zu begegnen, und zeige ihnen auf diese Weise, dass ich eine gute Zusammenarbeit anstrebe.
Dass die Vikarin jederzeit mit der vollen Unterstützung von Stolzenburg rechnen kann, wird im nächsten Projekt erkennbar, das er in unserer Teamsitzung vorstellt. Der Klinik-Redakteur möchte in unserer Hauszeitschrift „KH-aktuell“ einen Artikel über die Klinikseelsorge bringen. Darin soll die Arbeit der Klinikseelsorge vorgestellt werden, damit die Patienten auf uns aufmerksam werden und die Seelsorger bei Bedarf angerufen werden können. Der Redakteur wird Fragen an die Seelsorger richten, die sie ihm beantworten sollen. Stolzenburg schlägt vor, dass er zusammen mit der Vikarin dieses Interview gestalten möchte. Deshalb will er in unserer Runde von uns verschiedene Probleme und Fallbeispiele sammeln, die er mit der Vikarin bei diesem Interview vorstellen kann. Seine Vorgehensweise ist typisch Stolzenburg. Da er selbst die Patienten äußerst selten besucht und die Vikarin kaum Erfahrungen in der seelsorglichen Arbeit mit Patienten hat, möchte er nun von uns wissen, welche Themenbereiche und Problemfälle er in dem Interview ansprechen und aufzeigen könnte. Deshalb bringe ich den Einwand, dass der Redakteur doch mit uns allen dieses Interview führen solle und nicht ausgerechnet mit Kollegen, die am wenigsten mit den Patienten Kontakt haben. Außerdem sei die Vikarin doch nicht geeignet, im Bereich der klinischen Seelsorge ein Interview zu geben. Zudem fände ich es angemessen, wenn ein katholischer Seelsorger bei dem Interview mit dabei wäre, damit in der Hauszeitschrift „KH-aktuell“ auch die katholische Seelsorge zum Zuge komme und nicht nur die evangelische Seite sich darstellen kann. Nur so könnte die ökumenische Zusammenarbeit beider Konfessionen sichtbar werden. Sogleich stimmt Arno mir zu und schlägt vor, dass ich als Interviewpartner hinzugenommen werde, da ich nach Stolzenburg mit meiner nun siebenjährigen Klinikerfahrung am längsten hier im Krankenhaus arbeite und somit das meiste Erfahrungswissen einbringen könne. Doch dieses Argument lässt Stolzenburg nicht gelten und lehnt strikt ab. Er plädiert dafür, dass bei einem solchen Interview vor allem junge Mitarbeiter zur Sprache kommen müssten. Außerdem wolle er keinen dritten Seelsorger, weil dadurch dieser Artikel zu unübersichtlich und verwirrend wirken könnte. Da ich aufgrund meiner vielen Patientenbesuche ohnehin mehr als genug zu tun habe und ich diese ohnehin schon miserable Zusammenarbeit mit den evangelischen Kollegen nicht noch weiter strapazieren will, gebe ich meinen Einwand auf und lasse Stolzenburg und die Vikarin gewähren. Was kann man in solch einer Situation schon machen, wenn gewisse Kollegen nur Eines im Sinn haben, nämlich sich selbst ständig in den Vordergrund zu drängen, obwohl sie kaum Bescheid wissen? Sie wollen sich sooft wie möglich in der Öffentlichkeit präsentieren, in der realen Seelsorge aber leisten sie so gut wie nichts.
Ähnlich ist es bei unseren großen ökumenischen Klinikseelsorger-Konferenzen, bei denen sich einmal im Jahr alle katholischen und evangelischen Klinikseelsorger aus dem Großraum Stuttgart treffen. Dort bemerke ich, wie sich unser katholischer Vorsitzender Sauer genauso wie der evangelische Kollege Stolzenburg einen kleinen „Hofstaat“ zugelegt hat. Auch er hat sich junge Kolleginnen und Kollegen um sich geschart, mit denen er vor allem deshalb gerne zusammenarbeitet, weil sie ihm besonders willfährig sind und noch sehr nach Akzeptanz und Anerkennung streben. Er beauftragt sie, für diese Konferenzen kleine Statements vorzubereiten, die sie zu Beginn der einzelnen Diskussionspunkte vortragen dürfen. Somit können alle KollegenInnen erkennen, dass er sie zu seinem „erlauchten Kreis“ erkoren hat, obwohl sie zur vorgetragenen Materie zumeist kaum eigene Erfahrungen mit einbringen können. Für Arno und mich, die nicht zu dieser „Sauer-Clique“ gehören, ist dieses Szenario amüsant. Denn manchmal referieren diese unerfahrenen KollegenInnen über Themen, von denen sie tatsächlich keine Ahnung haben.
Sauer und Stolzenburg sind bei der Auswahl ihrer Mitstreiter vor allem darauf bedacht, ihre Schützlinge von vornherein an sich zu binden, damit ihre Hausmacht in den Konferenzen gestärkt wird. Auf diese Weise fällt es den beiden Vorsitzenden um so leichter, andere KollegenInnen, die kritische Anfragen stellen, auszugrenzen oder schlichtweg zu übergehen. Natürlich frage ich mich dabei, ob ich möglicherweise eifersüchtig auf die neuen KollegenInnen bin, wenn sie von Sauer und Stolzenburg so bevorzugt und hofiert werden. Doch dieses „Ränkespiel“ berührt mich herzlich wenig, zumal ich mit meiner Arbeit derart ausgelastet bin, dass ich kaum Zeit habe, mich mit solchen Sperenzchen zu belasten.
Genauso versuche ich, mich nicht einzumischen, als die evangelische Kollegin Rallinger in unserem Seelsorgeteam den Vorschlag einbringt, im neuen Andachtsraum ein Marienbild anzubringen. Zwar wundere ich mich, dass ausgerechnet sie als evangelische Pfarrerin diesen Vorschlag macht, obwohl es in den evangelischen Kirchen doch so gut wie keine Marienfiguren und Madonnendarstellungen gibt. Sie argumentiert in „ökumenischem Sinne“, dass dieser Raum von vielen Katholiken frequentiert werde und deswegen ein Marienbildnis angebracht wäre.
Doch bald bemerke ich, dass es bei diesem Gesprächspunkt der Kollegin Rallinger und ihren beiden Kolleginnen eher um etwas anderes geht. Denn hinter Rallingers Vorschlag steht vor allem die feministische Theologie, wodurch sie das Mitwirken der Frau im göttlichen Heilsgeschehen betonen will. Dieser Aspekt soll den Gläubigen durch das Aufstellen einer Marienstatue besser ins Bewusstsein gerückt werden. Die feministische Theologie wird von unseren evangelischen Kolleginnen sehr standhaft vertreten. Das ist der eigentliche Grund, weshalb in unserem Andachtsraum der Gottesmutter Maria für alle sichtbar ein gebührender Platz eingeräumt werden soll. Mit ihrem Vorschlag rennen die Kolleginnen bei uns katholischen Seelsorgern natürlich offene Türen ein. Rallinger hat sich im Vorfeld dieser Sitzung bereits mit ihren Kolleginnen abgesprochen und mit ihnen vereinbart, dass sie uns bei der Auswahl der Madonnendarstellung keine Mitsprachemöglichkeit einräumen wollen. Sie bestehen strikt darauf, dass für unseren Andachtsraum nur eine russische Marien-Ikone in Frage käme. Alles andere sei dann doch zu sehr katholisch und wäre für die evangelischen Gottesdienstbesucher nicht hinnehmbar.
Rallingers ökumenische Teamarbeit besteht in unserer Runde vor allem darin, dass sie sich als Frau in einer von Männern regierten Gesellschaft durchsetzen kann. Zunehmend muss ich feststellen, dass sie es dabei vor allem auf mich abgesehen hat. Denn ich, der ich von einer Kirche angestellt bin, die sämtliche Frauen von kirchlichen Ämtern ausschließt, bin für sie geradezu ein leichtes Opfer, ihren Feldzug gegen diese frauenfeindliche Gesellschaft zu führen. Meinen Kollegen Arno dagegen kann, oder besser gesagt, will sie vor allem deshalb nicht angreifen, da er ebenfalls Pfarrer und damit ein ihr ebenbürtiger Kollege ist, mit dem sie diesen Kampf nicht aufnehmen will. Ich jedoch, der in dieser katholischen Männerkirche nichts zu melden habe und ohnehin als „Laie“ bezeichnet werde, an mir kann sie all ihren angestauten Frust hemmungslos abreagieren.
Schon als ich ihr zum ersten Mal begegnet bin, brachte sie spürbar zum Ausdruck, welchen Stellenwert ich bei ihr habe. Es war kurz vor dem Mittagessen, ich hatte meine Patienten auf den Krankenstationen besucht und höre in unserem Seelsorgezimmer den Anrufbeantworter ab. Da geht die Tür auf, es kommt eine sehr selbstbewusste Frau herein. Sie scheint etwas jünger zu sein als ich, ihre kurz geschnittenen Haare leuchten kastanienrot. Durch ihre pralle Körperform und ihren eng geschnittenen, kurzen Rock erhält ihr Erscheinungsbild eine auffallend strenge Note. Ihre Lippen sind dunkelrot, fast schwarz geschminkt, ein zartes Rouge bedeckt ihre rundlichen Wangen. Forsch begrüßt sie mich und blickt mich mit ihren stechenden Augen an, die von einer kräftig bläulich-violetten Schattierung umrandet sind.
„Ich bin Pfarrerin Rallinger, die Nachfolgerin von Pfarrer Honold“, sagt sie wenig galant und streckt mir ihre Hand entgegen.
„Mein Name ist Thomas Zeil“, antworte ich freundlich.
„Habe schon von Ihnen gehört“, gibt sie kurz zurück, „wie lange sind Sie hier?“
„Etwa sieben Jahre“, antworte ich brav.
„Und was haben Sie vorher gemacht, bevor Sie hierher kamen?“ fragt sie barsch.
„Ich war vorher in Ludwigsburg in einer Kirchengemeinde und war dort für die Jugendarbeit und Erwachsenenbildung zuständig. Davor war ich in …“, doch weiter komme ich nicht, denn schon werde ich mit ihrer nächsten Frage konfrontiert:
„Ach, da Sie gerade hier sind, können Sie mir doch kurz erklären, wie man diesen Anrufbeantworter bedient.“
„Gerne, ich wollte ihn sowieso gerade abhören“, und wende mich dem Gerät auf dem Schreibtisch zu:
„Hier ist der Knopf, den man drücken muss, wenn man die aufgesprochenen Anrufe abhören will“, beginne ich mit meiner Instruktion und bin gerade dabei, diesen Knopf zu drücken. Doch schon stoppt sie mich und ruft:
„Halt, lassen Sie mich das selbst machen. Wenn ich es mache, kann ich es mir besser merken.“
Ich lasse sie an das Gerät und die aufgesprochenen Wünsche werden abgespult. Auf verschiedenen Zetteln notiere ich die Nachrichten und lege sie den Kollegen ins Fach.
„Was muss ich jetzt tun, um diese Mitteilungen zu löschen?“
Ich zeige es ihr und versuche, ihre weiteren Fragen korrekt zu beantworten. Doch kaum will ich ihr die einzelnen Knöpfe erklären, unterbricht sie mich und tut, als ob sie schon alles wüsste. Obwohl ich ihr die Funktionsweise des Gerätes geduldig erkläre und großzügig über ihr schnippisches Verhalten hinwegsehe, bedankt sie sich nicht und geht stracks zur Tür hinaus mit dem Wunsch:
„So, jetzt haben wir uns ja kennengelernt. Also, dann auf eine gute Zusammenarbeit!“
Wenige Tage später steht bei mir eine Unterrichtseinheit in der Krankenpflegeschule an. Die Rallinger zeigt großes Interesse an dem Unterricht und als sie erfährt, dass ich von der Krankenpflegeschule für den Ethik-Unterricht angefragt wurde, macht sie sogleich den Vorschlag, diesen Unterricht im ökumenischen Sinne gemeinsam zu gestalten. Außerdem könnte sie bei dieser Gelegenheit die Unterrichtsräume und das ganze Prozedere kennenlernen. Ich gehe auf ihren Vorschlag ein und möchte mit ihr einen Termin vereinbaren, bei dem wir den Ablauf der Lehrstunde besprechen könnten. Doch sie schlägt vor, dass ich erst einmal selbst den Unterricht so vorbereite, wie ich ihn auch ohne ihr Beisein durchführen würde. Dann könnten wir in einem zweiten Schritt bei der gemeinsamen Besprechung die jeweiligen Inhalte und Abschnitte zwischen uns aufteilen. Auch darauf gehe ich ein und bereite den Unterricht alleine vor, da ich ihn ja auch ohne ihr Mitwirken hätte halten müssen. Bei unserem vereinbarten Termin im gemeinsamen Büro teilen wir die einzelnen Themenabschnitte unter uns auf und ich übergebe ihr die Kopien meiner Vorbereitungen.
In der Krankenpflegeschule stelle ich den Schülern die neue Kollegin vor und erteile ihr das Wort, damit sie selbst noch einiges zu ihrer Person hinzufügen kann. Sie erklärt mit ein paar Sätzen ihren bisherigen Werdegang und erläutert, weshalb sie künftig als Klinikseelsorgerin hier arbeiten möchte. Danach beginne ich mit dem ersten Themenbereich, wie ich es mit ihr abgesprochen habe. Nach dem ersten Unterrichtsabschnitt übergebe ich an sie, denn bereits bei meinen ersten Ausführungen hatte sie mich zwischendurch schon zweimal unterbrochen, um einiges aus ihrer Sicht zu ergänzen. Es scheint, dass sie es kaum erwarten kann, bis sie nun selbst an der Reihe ist. Lang und breit holt sie aus, um die Pflegeschüler nun in ihren Themenabschnitt einzuführen. Als sie nach einer Weile merkt, dass einige der Schüler bereits unruhig werden und sich gelangweilt leise miteinander unterhalten, schaut sie auf das Konzept, das ich ihr übergeben habe und leitet kurzerhand auf das darauffolgende Thema über. Nach unserer Absprache hätte eigentlich ich diesen Abschnitt unterrichten sollen. Deshalb versuche ich zu intervenieren und will sie darauf aufmerksam machen, dass sie bereits dabei sei, meinen Unterrichtsabschnitt durchzunehmen. Doch mit einer kurzen Handbewegung weist sie mich zurück und lässt sich nicht in ihren Ausführungen bremsen. Und auch jetzt kann sie kein Ende finden. Sie beginnt, auch meinen Unterrichtsteil so detailliert zu erläutern, dass es den meisten Pflegeschülern sterbenslangweilig wird. Aufgrund ihrer eintönigen Vortragsweise werden sie unruhig. Manche geben schon leise Unmutsäußerungen von sich und als ich einschreiten will, um sie darauf hinzuweisen, dass dieses Thema von mir vorgetragen werden sollte, unterbricht sie mich unwirsch:
„Ja, ja, Sie kommen schon noch dran!“
Stur erläutert sie in aller Ausführlichkeit vollends meinen Teil, wobei sie sich in ihren Erläuterungen ständig wiederholt. Immer wieder erzählt sie dieselben Inhalte, weil ihr nichts Neues dazu einfällt und verwendet lediglich bei der Behandlung der Materie unterschiedliche Formulierungen. Die Schüler haben inzwischen auf Streikmodus geschaltet und beginnen demonstrativ, miteinander zu reden. Wieder versuche ich, die Kollegin zu unterbrechen. Doch diesmal fährt sie mich derb an und faucht:
„Ich habe schon gesagt, dass Sie gleich drankommen werden! So viel Geduld müssen Sie schon noch aufbringen, bis ich alles auch richtig erklärt habe!“
Als sie nun auch meinen Unterrichtsteil in aller Ausführlichkeit dargelegt hat und zu dem Abschnitt kommt, den entsprechend unserer Absprache sie übernehmen sollte, fällt ihr jetzt erst auf, dass sie bereits meinen Unterrichtsteil durchgenommen hatte. Doch nun will sie mich quasi integrieren und fragt, ob ich zu dem, was sie bereits gesagt habe, noch etwas hinzufügen möchte? Da ich aber nicht weiß, was ich bei diesem Durcheinander noch ergänzen soll, erläutere ich einige Punkte, die ich hätte eigentlich ausführen sollen. Doch sofort unterbricht sie mich wieder und weist darauf hin, dass sie diese Aspekte gleich behandeln werde und führt den Unterricht vollends zu Ende. Ich gebe frustriert auf und setze mich auf einen freien Stuhl zu den Schülern. Enttäuscht lasse ich sie gewähren und denke dabei:
„Wenn das die ökumenische Zusammenarbeit ist, die sie hier uns vorexerziert, dann kann ich mich ja auf etwas gefasst machen!“
Den Unterricht beendet sie, indem sie die Schüler mit salbungsvollen Worten verabschiedet. Zum Schluss lobt sie vor allem sich selbst, weil sie zu dem Ergebnis gekommen sei, dass dieser ökumenisch gestaltete Unterricht doch eine gute Möglichkeit wäre, die Zusammenarbeit mit mir auf diese Weise weiterhin zu gestalten, was uns doch sehr gut gelungen sei. Total verblüfft über ihr Eigenlob, verabschiede ich mich ebenfalls von den Schülern und frage anschließend die Rallinger, ob wir nicht eine kurze Nachbesprechung über diese Unterrichtseinheit anfügen könnten. Rigoros wehrt sie ab und fragt:
„Warum denn? Es ist doch alles wunderbar gelaufen!“
Bei unseren folgenden Teamsitzungen kommt es mitunter zu heftigen Diskussionen, weil die Kollegin Rallinger es kaum aushalten kann, andere Argumente geduldig anzuhören und zu akzeptieren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es ihr gar nicht um die Sache an sich geht, sondern vor allem darum, wer von den Kollegen etwas sagen darf und wer nicht. Werden Personen von ihr akzeptiert, so werden auch deren Beiträge von ihr für gut befunden. Werden bestimmte Kollegen von ihr jedoch nicht akzeptiert, so werden deren Argumente grundsätzlich abgelehnt. Inhalte scheinen bei ihr keine Rolle zu spielen. Bei ihr geht es vor allem um Sympathie oder Antipathie. Alle Kolleginnen sind ihr grundsätzlich sympathisch, alle männlichen Kollegen sind ihr äußerst suspekt und unsympathisch.
Als ich vor sieben Jahren ins Katharinenhospital kam, gab es über Jahre hinweg lediglich zwei evangelische und zwei katholische Seelsorger. Stolzenburg wollte aber mehr. Er sah in mir lediglich einen Handlanger meines Priesterkollegen und wollte deshalb ebenfalls Mitarbeiter, die ihm untergeordnet sind. Deshalb verdoppelte er seinen Mitarbeiterstab und ließ er sich eine Vikar-Stelle und eine weitere halbe Pfarrstelle genehmigen. Seine Begründung war, dass er als Vorsitzender der evangelischen Klinikseelsorger und als Ausbilder der Vikarin nun unbedingt eine weitere Unterstützung benötige. Was sein Vorgänger nebenher bewältigte, muss Stolzenburg delegieren. Außerdem hält er regen Kontakt zu den Prälaten im Oberkirchenrat, nimmt an unterschiedlichsten Sitzungen teil und hat ständig Termine in der Kirchenpflege und anderswo.
Beim Mittagessen in der Kantine setzt er sich immer an den Tisch der Chefärzte, um mit ihnen quasi „standesgemäß“ zu speisen und gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Seine Hauptaufgabe sieht er darin, gute Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten und zu allerlei Gremien in seinem Umfeld, vor allem in seiner evangelischen Landeskirche zu pflegen. Nicht die Seelsorge an sich ist ihm wichtig, sondern das Netzwerk der Gesellschaft, wo er mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen kann, um bei Bedarf auf sie zurückzugreifen.
Wie ich des öfteren vom Pflegepersonal gehört habe, sei es nicht seine Stärke, die Patienten in ihren Zimmern zu besuchen und sie in ihrer Not oder beim Sterben zu begleiten. Deshalb werde ich vom Pflegepersonal häufig zu Sterbenden und Notfällen gerufen, bei denen ich feststellen muss, dass der Patient evangelisch ist. Wenn ich die Pflegekräfte nach solch einem Krankenbesuch dann höflich darauf hinweise, dass für diesen Patienten doch der Kollege Stolzenburg zuständig gewesen wäre, bekomme ich zur Antwort:
„Ach der! Der hält doch von jedem Patienten drei Meter Abstand! Bei dem hat man wirklich den Eindruck, dass er sich überall nur wichtig machen will und aus den Krankenzimmern so schnell wie möglich verschwindet. Da rufen wir lieber Sie an, dann wissen wir, dass die Schwerkranken und die Angehörigen gut betreut werden.“
Wieder einmal sitzen wir in unserem ökumenischen Seelsorgeteam zusammen, um über die neuesten Veränderungen in unserer Klinik zu sprechen. Diesmal bringt Stolzenburg einen Vorschlag, den er auf einer Tagung von einem Kollegen gehört habe. Dieser ließ in seinem Krankenhaus auf jeder Krankenstation ein kleines Holzkästchen auf dem Flur anbringen, um darin Bibeln und andere besinnliche Bücher für die Patienten einzustellen. Dieses Angebot fände er für unsere Klinik ebenfalls sinnvoll. Mit vielen Chefärzten habe er bereits gesprochen, die damit einverstanden wären. Wir müssten nur noch die entsprechende Literatur bestellen, die Bibeln habe er bereits bestellt. Allerdings seien sie in Leinen gebunden und müssten aus hygienischen Gründen mit einer abwaschbaren Selbstklebefolie eingebunden werden. Die evangelischen Kolleginnen ärgern sich über seine eigenmächtige Vorgehensweise, denn es hätte auch Bibeln mit Plastikeinband gegeben, die man nicht nachträglich mit Folien hätte einbinden müssen. Stolzenburg schlägt vor, dass wir wie üblich die Kosten für die Anschaffungskosten der Bücher je zur Hälfte zwischen der evangelischen und katholischen Klinikseelsorge aufteilen. Ebenso müsste der Arbeitsaufwand zum Einbinden der Bibeln mit Selbstklebefolie je zur Hälfte auf die katholische und evangelische Seelsorge aufgeteilt werden. Obwohl ich mir bewusst bin, dass mit dieser Aktion viel Arbeit auf mich zukommen wird, halte ich mich bei dieser Diskussion zurück. Wie es aussieht, hat Stolzenburg vor dieser Sitzung auch diese Aktion mit seinen Kolleginnen bereits abgesprochen, so dass wir von der katholischen Seite nicht mehr viel entgegensetzen können. Also sind wir damit einverstanden, die Kosten und den Arbeitsaufwand zur Hälfte zu übernehmen.
Doch wie es bei Arno meistens bei unseren Team-Sitzungen der Fall ist, kann er auch diesmal nicht bis zum Schluss hierbleiben, da er schnell zum Hauptbahnhof eilen muss, um rechtzeitig seine S-Bahn nach Schorndorf zu erreichen. Schließlich muss er seine bettlägerige Mutter mit dem Mittagessen versorgen. Im Anschluss der Team-Sitzung übergibt die Kollegin Rallinger mir drei Kartons mit rund dreißig Bibeln, die Arno und ich mit der beigefügten Klarsichtfolie einbinden müssen. Ich trage die drei Kartons in unser Büro, das ich mit Arno teile, und nehme mir vor, die Arbeit in den nächsten Tagen zu erledigen.
Am nächsten Morgen zeige ich Arno, welche Arbeit wir uns aufgrund unseres gestrigen Beschlusses aufgeladen haben. Als er die drei Kartons mit den Bibeln sieht, wird es ihm Angst und Bange. Mit dem Argument, dass er total überlastet sei, weil er in anderen Gemeinden einige Gottesdienste übernehmen und zu Hause seine Mutter pflegen müsse, könne er beim besten Willen diese Arbeit nicht auch noch übernehmen. Sein Verhalten ist mal wieder typisch. Bei einem Beschluss, der viel Arbeit mit sich bringt, stimmt er erst zu, will sich dann aber wegen anderer Verpflichtungen aus dem Staub machen. So sehr mir seine Drückebergerei gegen den Strich geht, übernehme ich in den kommenden Wochen auch seinen Arbeitsanteil und binde abends nach meinen Patientenbesuchen die Bibeln ein. Die evangelischen KollegenInnen sind zu viert und können die zusätzliche Arbeit leicht bewältigen, ich dagegen muss alles alleine machen und sitze viermal länger an diesem stupiden Geschäft. Und Arno, der vom Umfang her genau die gleiche Patientenanzahl zu versorgen hat wie ich, klinkt sich einfach aus.
Wenn ich nun in den folgenden Tagen den Anrufbeantworter abhöre, treffe ich ständig die drei evangelischen Kolleginnen in unserem gemeinsamen Seelsorgezimmer. In gemütlicher Runde sitzen sie beisammen, trinken Kaffee und binden ihre Bibeln ein. Bereits nach wenigen Tagen sind sie fertig, lediglich sieben Bibeln lassen sie in einem Karton neben dem Schreibtisch stehen, auf dem ein Zettel angebracht ist, dass Stolzenburg diese Bibeln einbinden müsse.
Nach etwa drei Wochen bin ich mit meinem Anteil fertig und stelle in unserem gemeinsamen Seelsorgezimmer meine in Klarsichtfolie eingebundenen Bibeln zu den anderen hinzu. Der Karton aber mit den sieben unbearbeiteten Bibeln steht weiterhin wochenlang unberührt neben dem Schreibtisch. Doch eines Tages steht er auf dem Schreibtisch mit einem Zettel, worauf die Rallinger dem Kollegen Stolzenburg Folgendes mitteilt:
„Lieber Peter, wir haben unseren Teil der Bibeln eingebunden, den Rest musst du machen.“
Doch auch dieser Hinweis verfehlt seine Wirkung. Der Karton bleibt mitten auf dem Schreibtisch stehen. Stolzenburg scheint nicht daran zu denken, sich an die Arbeit zu machen und seinen Teil der Bibeln einzubinden, obwohl er diese Aktion initiiert hatte. Einige Tage später rücke ich den Karton etwas zur Seite, damit ich besser die Mitteilungen des Anrufbeantworters auf dem Schreibtisch notieren kann. Ich bin echt gespannt darauf, wie lange dieser Karton auf dem Schreibtisch stehen bleibt. Der Zettel wird eines Tages entfernt, doch nach wenigen Tagen ist er durch einen neuen ersetzt. Der Karton bleibt wie angewurzelt stehen und scheint für alle der sichtbare Ausdruck einer kleinen Machtprobe zu sein, die zwischen den evangelischen Kolleginnen und dem Kollegen Stolzenburg ausgetragen wird. Auch Arno amüsiert sich und ist voller Erwartung, wie dieses Spielchen enden wird. Wenn wir uns begegnen, grinst er mir vielsagend zu.
Doch den evangelischen Kolleginnen bleibt indessen nicht verborgen, dass wir mit großem Interesse ihr Machtspielchen beobachten. Ungebremst lassen sie ihren Unmut über Stolzenburg aus und zeigen mir mit ihren aggressiven Blicken, dass an diesem Karton die „Frauenfeindlichkeit“ der kirchlichen Männergesellschaft deutlich sichtbar wird. Aus diesem Grunde behandeln sie nun auch mich und Arno äußerst schnippisch, obwohl ich doch unseren Teil erledigt habe. Das zählt aber anscheinend nichts. Trotzdem werde auch ich quasi in „Sippenhaft“ genommen, weil Männer sich gewöhnlich für solche niederen Arbeiten, wie Bücher einbinden, einfach zu gut sind.
Eines Tages, als ich in unser gemeinsames Büro komme, sitzt die Vikarin missmutig am Couchtisch und bindet die restlichen sieben Bibeln in Klarsichtfolie ein. Mit hochrotem Kopf ignoriert sie mich, sie erwidert auch nicht meinen Gruß. Ihr bockiges Verhalten verrät mir, dass sie sich dem Wunsch ihres „Chefs“ gefügt hat und nun diese Arbeit für ihn übernehmen muss. Da sie nach ihrer Ausbildungszeit von ihm eine Beurteilung benötigt, kann sie sich nicht gegen seine Anweisung sträuben. Bisher hatte er sie äußerst bevorzugt behandelt. Im neuesten Klinikseelsorge-Prospekt durfte sie sogar als „Pfarrerin“ am Krankenbett posieren. Und jetzt muss sie seine Bibeln in Klarsichtfolie einbinden und wird in dieser Situation ausgerechnet von mir ertappt! Dass sie meinen Gruß nicht erwidern kann und ihr die blanke Wut ins Gesicht steigt, als sie mich sieht, zeigt mir, dass es zwischen ihr und Stolzenburg ordentlich gekracht haben muss.
Wie uns von der Verwaltung mitgeteilt wird, soll eine neue Telefonanlage installiert werden, die uns vielfältige Möglichkeiten bietet. So zum Beispiel kann sich jeder Seelsorger nun eine separate Telefonnummer mit eigener Anrufbox freischalten lassen. Als ich diese Möglichkeit in unsere Team-Sitzung einbringe, ist Stolzenburg sofort dagegen. Er will unsere gemeinsame Telefonnummer keinesfalls aufgeben mit der Begründung, dass diese Nummer schon bestens bekannt und jede Änderung für die Klinikseelsorge nicht gut sei. In unserem Seelsorgeteam entspinnt sich eine langwierige und zähe Auseinandersetzung. Stolzenburg sträubt sich mit aller Macht dagegen. Er will unbedingt die bisherige Rufnummer beibehalten. Sein eigentlicher und unausgesprochener Grund ist jedoch allen klar. Nur mit einer gemeinsamen Rufnummer kann er weiterhin tagelang vom Katharinenhospital wegbleiben, da er ja weiß, dass die KollegenInnen regelmäßig den Anrufbeantworter abhöre. Hätte er eine eigene Nummer und würden die Patienten ihre Wünsche, die ihn betreffen, künftig auf seine Anrufbox sprechen, dann käme sehr schnell ans Tageslicht, dass er nicht ordentlich seiner Arbeit nachgeht. Außerdem bietet die neue Telefonanlage auch die Möglichkeit, eine Anrufumleitung auf andere Kollegen zu schalten. Deshalb plädiere ich dafür, dass jeder eine eigene Rufnummer erhalten solle. Nur so könnten die Patienten und das Pflegepersonal direkt den Seelsorger anrufen, der gewünscht werde. Bei seiner Abwesenheit kann ihn durch die Anrufumleitung ein anderer Kollege bzw. Kollegin vertreten. Doch auch diese Möglichkeit will Stolzenburg nicht akzeptieren. Für seine Verweigerungshaltung bringt er nie ein fundiertes Argument und lehnt auch die Möglichkeit der Anrufumleitung strikt ab. Ganz offensichtlich will er bei seiner Abwesenheit keine seiner Kolleginnen fragen müssen, ob er seine Anrufe auf einen ihrer Telefonapparate umstellen darf. Die bisherige gemeinsame Rufnummer ist ihm viel lieber, denn somit kann er weiterhin sein lasches Arbeitspensum beibehalten.
Doch ich bleibe hartnäckig. Nach mehreren langwierigen Team-Sitzungen einigen wir uns schließlich darauf, dass wir zwei offizielle Telefonnummern einrichten lassen, eine für die katholische Seelsorge und eine für die evangelische Seelsorge. Somit können Patienten und Pflegepersonal nun wenigstens den Klinikseelsorger der eigenen Konfession direkt anrufen. Mir war vor allem wichtig, dass Stolzenburg nun keinen Zugriff mehr auf Anrufe hat, die mich betreffen. Somit kann er sie nicht mehr löschen.
Bei den übrigen Tagesordnungspunkten mische ich mich nicht ein. Da ich von Arno bei vielen Verhandlungspunkten keine Unterstützung erwarten kann, zeige ich mich kooperativ und übernehme freiwillig die Aufgabe, den neuen Andachtsraum bautechnisch abzunehmen und besorge die Korrespondenz mit der Verwaltung bezüglich einiger Baumängel. Auch gewisse Änderungswünsche, die von den Kollegen angemahnt werden, übermittle ich dem Bausachverständigen. Da einige Decken-Strahler der Beleuchtungsanlage nicht richtig angeschlossen sind, die Mikrofon-Steckdosen im Altarraum falsch installiert wurden, eine Schranktür nicht abschließbar ist, das Notruf-Telefon nicht funktioniert und das Mischpult für die Sprechanlage und die Weiterschaltung unserer Gottesdienste in den Krankenhausfunk nicht installiert wurden, gebe ich diese Mängel an die Bauverwaltung weiter. Außerdem muss die Belüftungsanlage und die Schalldämmung der Trennwand zum benachbarten Konferenzraum verbessert werden, da im Andachtsraum während unserer Gottesdienste jedes Wort von nebenan deutlich zu hören ist. Auch viele andere Kleinigkeiten, die wir in unserem Seelsorgeteam besprechen, gebe ich an die Handwerker weiter. Am Waschbecken im Andachtsraum lasse ich einen Handtuchhalter anbringen, für die Osterkerze stelle ich meinen eigenen Kerzenständer zur Verfügung, zwei neue Altartücher gebe ich in Auftrag und lasse sie nach Maß anfertigen, außerdem kaufe ich für den neuen Andachtsraum verschiedene Blumenvasen.
Da ich meine Orgel in den Andachtsraum transportieren ließ, nehme ich die Gelegenheit wahr, gelegentlich während meiner Mittagspause einige Bach-Präludien zu spielen. Hier kann ich mein Instrument nun mit größerer Lautstärke erklingen lassen als zuhause und die Akustik dieses Raumes testen. Obwohl der Andachtsraum im Verhältnis zu einer Kirche sehr klein ist, lässt sich trotzdem durch den eingebauten Nachhalleffekt meiner Orgel ein fantastisches Klangerlebnis erzeugen, so dass der Eindruck entsteht, man würde in einer gewaltigen Kathedrale an einem Orgelkonzert teilnehmen. Diesen Nachhalleffekt habe ich zuhause in meinem Wohnzimmer oft gerne benutzt, wenn ich mit aufgesetztem Kopfhörer spielte.
Da ich hier nun die Möglichkeit habe, im Katharinenhospital kleine Orgelkonzerte zu gestalten, lade ich abends die Patienten zu meinen Musikdarbietungen ein. Für meine Orgelkonzerte erstelle ich jeweils Faltblätter, auf dem ich die dargebotenen Werke kurz vorstelle und erläutere. Meine Konzerte wären für die evangelischen KollegenInnen eine gute Möglichkeit gewesen, meine Orgel mit ihren Variationsmöglichkeiten kennenzulernen. Doch leider nehmen sie diese Gelegenheit nicht wahr, meine Konzert-Programme, die ich in unserem gemeinsamen Büro und auf allen Krankenstationen auslege, werden von ihnen ignoriert.
Da mir die Zusammenarbeit mit den Pfarrern und Pfarrerinnen zunehmend zu schaffen macht, schaue ich mich um, wie ich dieser Tretmühle zukünftig entkommen könnte. Deshalb beginne eine psychotherapeutische Ausbildung im Fachgebiet der „Logotherapie und Existenzanalyse“ in München. Diese berufsbegleitende Ausbildung dauert fünf Jahre und ist so geplant, dass die Vorlesungen, die Blockseminare und Supervisionen zumeist an den Wochenenden von Freitagabend bis zum Sonntagnachmittag stattfinden. Die Ausbildung wird ergänzt durch verschiedene Fachtagungen, in denen Vorträge über psychische Krankheitsbilder und ihre Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden. Da ich im Katharinenhospital täglich mit sterbenden und trauernden Menschen zu tun habe, wähle ich als Thema meiner Abschlussarbeit: „Das Phänomen der Trauer“.
Um mich selbst in diesen Themenbereich besser einzuarbeiten, biete ich im Katharinenhospital mehrere Trauerseminare an. In fünfzehn Abenden können die Teilnehmer von ihrer persönlichen leidvollen Erfahrung berichten und ihren schmerzvollen Verlust beweinen und beklagen, um auf diese Weise ihre Situation zu bewältigen. Manche von ihnen haben auch im evangelischen Bildungshaus „Hospitalhof“ in Stuttgart an Trauerseminaren teilgenommen, die der evangelische Dekan Kumpf gemeinsam mit einer Psychologin angeboten hatte. Allerdings bemängelten sie, dass es ihnen auf diesen Seminaren kaum möglich war, über ihre persönlichen Probleme zu sprechen, weil zu viele Teilnehmer daran teilnahmen. Außerdem habe Kumpf sehr viel geredet und diese Veranstaltung wie eine besinnliche Dichterlesung mit nachdenklichen Vortragstexten gestaltet.
Wenn wir Klinikseelsorger in unserer Klinik irgendwelche Veranstaltungen anbieten und durchführen wollten, konnten wir uns an Frau Schneider, Chefsekretärin in der Verwaltung, wenden, die für die notwendige Raumbelegung sorgte. Gerne gab sie mir Tipps, als ich in unserer Klinik eine Tagung für die katholischen Klinikseelsorger unserer Diözese mit über sechzig Teilnehmern organisieren musste.
Bei solchen Vorbereitungen komme ich mit ihr ins Plaudern, so dass sie im Laufe der Zeit Vertrauen zu mir fasst. Bisweilen ruft sie mich gelegentlich abends zuhause an und erzählt mir von ihren Problemen aus ihrem persönlichen Alltag. Denn die gewaltige Umstellung mit dem neuen Klinikmanagement macht ihr schwer zu schaffen. Sie bleibt zwar offiziell als Chefsekretärin auf ihrem Posten, doch dadurch, dass die gesamte Verwaltung grundlegend umgestaltet wird und viele ihrer vertrauten Mitarbeiter auf andere Stellen versetzt werden, fühlt sie sich auf ihrem Arbeitsplatz nicht mehr wohl.
Als ich sie eines Tages in der Hauptverwaltung besuche, um für einen meiner Vorträge den Hörsaal reservieren zu lassen, erzählt sie, dass sie demnächst in den Ruhestand gehe. Mit großem Bedauern nehme ich es zur Kenntnis, doch dann gesteht sie mir, dass dieser Schritt ihr ausgesprochen leicht falle, denn die letzten Jahre seien für sie die schwersten gewesen.
Als wir Seelsorger zu unserer ökumenischen Teamsitzung zusammenkommen, erwähne ich den bevorstehenden Abschied von Frau Schneider und halte es für angebracht, ihr einen Blumenstrauß zu überreichen. Üblicherweise lehnen die evangelischen Kolleginnen alles kategorisch ab, wenn ich einen Vorschlag einbringe. Auch diesmal findet mein Vorschlag unter ihnen zunächst keine Zustimmung. Als jedoch Arno erkennt, dass mein Vorschlag bei ihnen auf Ablehnung stößt, empfiehlt er, dass ich doch diesen Strauß besorgen und ihn Frau Schneider an ihrem letzten Arbeitstag überreichen solle. Sein Vorschlag wird von ihnen zögerlich akzeptiert und schließlich einstimmig angenommen. Als Frau Schneider im Ruhestand ist, ruft sie mich weiterhin abends zuhause an, um ihre Probleme mit mir zu besprechen.
Das Netz zieht sich zusammen
Wie jeden Morgen gehe ich ins Katharinenhospital, hole bei der zentralen Patientenaufnahme die Formulare ab, auf denen die Patienten ankreuzen können, ob sie den Besuch eines Seelsorgers wünschen. Da ich von meinen Kollegen zumeist der erste bin, der mit seiner Arbeit beginnt, kommt diese Aufgabe mir zu. Ich lege die Anmeldebogen der evangelischen Patienten im Seelsorgezimmer auf den Schreibtisch, höre die Patientenwünsche auf unserem Anrufbeantworter ab und erledige dringende Angelegenheiten sofort. Die Nachrichten für die evangelischen Kollegen lösche ich nicht, so dass sie von ihnen selbst abgehört werden können. Danach gehe ich in den Andachtsraum und schaue, ob alles in Ordnung ist, denn manchmal kommt es vor, dass sämtliche Stühle von irgendwelchen Besuchern kreuz und quer durcheinander gestellt wurden, weil sie sich dort zum Zeitvertreib aufgehalten und den Raum unordentlich verlassen haben. Außerdem bereite ich mich bei dieser Gelegenheit in einer kurzen Besinnung auf meine bevorstehende Arbeit vor.
Als ich heute aber den Andachtsraum betrete, bin ich perplex. Der Andachtsraum ist hell erleuchtet, alle Kerzen brennen, ganz so als ob nun gleich ein Gottesdienst beginnen würde. Auch meine Orgel steht offen und ist eingeschaltet. Die Manuale sind frei zugänglich, auch die Lichtstrahler auf Noten und Tastatur sind an. Wie kann das sein? Wurde das Instrument die ganze Nacht über nicht ausgeschaltet? Nachdem ich die Kerzen am Altar und vor der Marien-Ikone gelöscht habe, setze ich mich auf den Orgelbock, aktiviere einige Register und spiele mehrere Akkorde, um zu prüfen, ob sie noch funktionieren. Auf Anhieb kann ich keinen gravierenden Defekt feststellen. Doch als ich die einzelnen Register überprüfe, stelle ich fest, dass im Register „Vierfache Mixtur“, in den „Zimbeln“ und bei der „Rohrflöte“ manche Orgeltöne nicht mehr richtig klingen. Ich vermute, dass von einem Kollegen oder einer Kollegin der Orgelschlüssel an jemanden ausgegeben wurde, der anschließend weder die Kerzen löschte noch die Orgel wieder ordnungsgemäß abgeschaltet und verschlossen hat. Als ich zurück ins gemeinsame Seelsorgezimmer gehe, überlege ich, was ich nun tun könnte, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Den Vorfall notiere ich kurz auf einem Zettel, hefte ihn für alle sichtbar ans Schwarze Brett und bitte die Kollegen, künftig den Orgelschlüssel nur an solche Personen auszugeben, die von mir persönlich in mein Instrument eingeführt wurden. Somit möchte ich verhindern, dass irgendwelche Freizeitmusiker mein Instrument wie eine Pop-Orgel benützen, darauf herumhämmern und es zurücklassen, als ob es ein vergammeltes Spielzeug wäre.
In den folgenden Tagen frage ich jeden meiner Kolleginnen und Kollegen, wer von ihnen den Orgelschlüssel an eine fremde Person ausgegeben hat, denn die Reparatur der drei beschädigten Register würde ich mir gerne erstatten lassen. Doch leider bekomme ich keine befriedigende Antwort. Jeder behauptet, dass er den Schlüssel nicht an fremde Personen weitergegeben habe. Wie aber kann jemand an den Orgelschlüssel kommen, wenn er hier in unserem gemeinsamen Büro aufbewahrt wird? Nur die Kollegen und die Reinigungskraft haben doch Zugang zu unserem Seelsorgezimmer.
Da niemand von den Kolleginnen und Kollegen es zugeben will, dass er oder sie den Orgelschlüssel an eine unbefugte Person ausgegeben hat, lege ich ein kleines Notizbuch in den Spieltisch meiner Orgel, in dem jeder Organist sich mit Datum einzutragen hat, damit ich nun nachzuvollziehen kann, von wem das Instrument benutzt wird, um gegebenenfalls den Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Kollegen nehmen meinen Hinweis zur Kenntnis und die Organisten tragen sich ordnungsgemäß in das Notizbuch ein.
Schon wenige Wochen nach diesem Vorfall muss ich erneut dieselbe Erfahrung machen. Montagmorgen komme ich in den Andachtsraum, wieder ist er hell erleuchtet, alle Kerzen brennen, das Mischpult der Übertragungsanlage für den Krankenhausfunk ist eingeschaltet, der Schrank, in dem sämtliche Utensilien für unsere Gottesdienste untergebracht sind, steht weit offen und, was mich am meisten ärgert, meine Orgel ist wiederum eingeschaltet und alle Strahler hell erleuchtet. Schnell lösche ich die Kerzen, schließe Schrank und Orgel ab, schalte die Übertragungsanlage sowie sämtliche Lichter aus und gehe zurück ins gemeinsame Seelsorgezimmer, um auf dem Gottesdienstplan nachzusehen, wer von den Kollegen gestern den Gottesdienst gehalten hat. Und wer war es? Genau wie ich es vermutet habe. Es war die evangelische Kollegin Rallinger. Auch letztes Mal, als ich den Andachtsraum in derselben Weise angetroffen habe, muss sie es gewesen sein, die den Orgelschlüssel an einen Hobbymusiker ausgegeben hatte. Sie gab es schlichtweg nicht zu und tat so, als ob sie nichts davon wüsste. Da sie montags immer frei nimmt, wenn sie zuvor am Sonntag ihren Gottesdienst hielt, schreibe ich ihr einen Zettel und lege ihn in ihr Fach. Darauf vermerke ich, dass ich den Andachtsraum entsprechend vorgefunden habe und bitte sie, künftig nach dem Gottesdienst die Kerzen wegen Brandgefahr zu löschen und meine Orgel ordnungsgemäß abzuschließen.
Wenige Tage später treffe ich nachmittags einen jungen Patienten im Andachtsraum, der auf meiner Orgel spielt. Ich bleibe eine Weile an der Eingangstür stehen und höre ihm zu. Da er immer wieder ein anderes Register einschaltet und einige Töne ausprobiert, ohne dass er ein Orgelstück zu spielen beginnt, gehe ich zu ihm und frage ihn, ob er mir kurz mal eine kleine Kostprobe seines Könnens vorspielen könnte. Darauf gibt er zur Antwort, dass er gar nicht spielen kann, sondern einfach nur mal ausprobieren möchte, wie eine Orgel überhaupt funktioniert. Als ich ihn frage, wie er denn zu dem Schlüssel der Orgel gekommen sei, antwortet er, dass er in unserem Seelsorgezimmer gefragt habe, ob er auf der Orgel spielen dürfe. Daraufhin habe er von einer Frau den Schlüssel bekommen. Ich frage ihn, ob er mir die Dame denn kurz mal beschreiben könne. Sie habe kastanienrote Haare, sei nicht allzu groß und leicht untersetzt. Er beschreibt eindeutig das Erscheinungsbild der Rallinger und fragt verunsichert, ob es denn nicht in Ordnung sei, wenn er diese Orgel ausprobiere? Ich erkläre ihm, dass die Kollegin ihm den Schlüssel erst hätte geben dürfen, wenn er zuvor in das Instrument eingeführt worden sei. Dann zeige ich ihm kurz alle Register und die verschiedenen Kombinationen, sowie einige sonstige Raffinessen und bitte ihn, in diesem kleinen Kirchenraum die Orgel nicht auf volle Lautstärke aufzudrehen, damit die Mitarbeiter im Funktionsbau nicht gestört werden. Der junge Mann bedankt sich und meint, dass er es sich doch etwas einfacher vorgestellt habe, auf solch einem Instrument zu spielen.
Während ich meine Patienten besuche, geht mir dieses Ereignis durch den Kopf. Nun weiß ich nicht so recht, wie ich mit meiner evangelischen Kollegin umgehen soll. Nachdem ich einige Patienten besucht habe, kommt mir die Begebenheit geradezu lächerlich vor und ich beschließe, es dabei zu belassen. Schließlich will ich mit der Rallinger wegen ihrer verbiesterten Nachlässigkeit keinen Streit vom Zaun brechen.
Als ich ein paar Sonntage später einen Patientengottesdienst halten muss und unserer Organistin, Frau Leiss, den Orgelschlüssel geben will, muss ich feststellen, dass er nicht an seinem Platz liegt. Ich schaue in den Fächern der Kolleginnen und Kollegen nach, stöbere sämtliche Schubladen und Schränke unseres gemeinsamen Büros durch, doch nirgends ist der Schlüssel zu finden. Frau Leiss muss ich nun mitteilen, dass der Orgelschlüsse nicht auffindbar ist und sie die Lieder in meinem Gottesdienst nicht begleiten kann. So nach und nach wird mir klar, dass die Rallinger sich strikt weigert, meine Bitte zu befolgen. Enttäuscht schreibe ich nach dem Gottesdienst folgende Zeilen auf einen Zettel und lege ihn ihr ins Fach:
„Liebe Kati,
ich bitte Dich dringend, künftig nicht mehr fremde Organisten ohne vorherige persönliche Einführung durch mich auf meiner Orgel spielen zu lassen! Die Orgel ist kompliziert und muss erklärt werden! Ich bitte Dich, Dich endlich an diese Vereinbarung zu halten. Ebenso bitte ich Dich, es auch mir mitzuteilen, wenn Du den Orgelschlüssel woanders deponierst, damit auch ich ihn gegebenenfalls holen kann, wenn ich ihn benötige.
Mit freundlichem Gruß, Thomas.“
Am nächsten Tag liegt der Orgelschlüssel in meinem Fach und als ich sie wenige Tage danach auf einer Krankenstation antreffe, kommt sie auf mich zu, entschuldigt sich und erklärt, dass sie den Schlüssel versehentlich mit nachhause genommen habe. Sie habe ihn einem Organisten gegeben, der darauf üben wollte. Als er ihn zurückgab, habe sie ihn einfach in ihre Tasche gesteckt und ganz vergessen, ihn in mein Fach zu legen. Ich nehme ihre Entschuldigung an, bitte sie aber, künftig nicht mehr Fremde auf der Orgel spielen zu lassen. Doch mein Wunsch scheint ihr nicht zu behagen. Kaum habe ich ausgesprochen, kontert sie schnippisch:
„Ja, ja, nun hab dich mal nicht so!“
Lange schaue ich sie an, lächele süßsauer und gehe weiter. Dass sie trotzdem den Orgelschlüssel an fremde Personen aushändigt, die das Instrument gar nicht kennen, verstehe ich nicht. Doch im Laufe der Zeit geht mir auf, warum sie das tut. Weil sie einen so ruppigen und barschen Umgangston pflegt, mit dem sie ihre Organisten gängelt, hat sie einen höheren „Verschleiß“ an Organisten als andere Kollegen, weil sie nicht mehr bereit sind, in ihren Gottesdiensten zu spielen. So ist sie darauf angewiesen, auf alle erdenklichen Möglichkeiten neue Orgelspieler ausfindig zu machen. Durch ihre schroffe Umgangsform, ihre oft dezidierten Sonderwünsche, die haargenau so ausgeführt werden müssen, wie sie es gerne möchte, und ihre harsche Kritik, wenn ihr etwas nicht passt, verprellt sie sämtliche Organisten. Außerdem kann sie ihre Termine nicht längerfristig planen, so dass sich die Organisten auf ihre kurzfristigen Terminwünsche nicht einstellen können, wie sie es gerne hätte. Das ist auch der Grund, weshalb sich nie einer ihrer Organisten bei mir vorstellt, um sich in das Instrument einweisen zu lassen. Deshalb gibt Rallinger weiterhin den Orgelschlüssel an fremde Personen aus, wie es ihr gerade in den Sinn kommt, und vergisst danach, ihn in mein Fach zurückzulegen. Und manchmal vergisst sie sogar, wo sie ihn überhaupt abgelegt hat. Um von ihren eigenen Fehlern abzulenken, schimpft sie ständig hinter meinem Rücken über mich und über mein angeblich unkollegiales Verhalten, worunter sie zu leiden habe. Diese hinterhältige Hetze ist natürlich Wasser auf die Mühle des Kollegen Stolzenburg. Auch er sieht mich ja schon immer als einen „Assistenten“, wie es mein früherer Priesterkollege getan hatte. Auch er war der Meinung, dass ich zu tun hätte, was er als Priester von mir verlange. Gegen diese permanente Degradierung konnte ich mich nie zu Wehr setzen. Zwar versuchte ich, gegen diese mir zugewiesene Assistenten-Rolle anzukämpfen, doch was kann man schon machen, wenn fünf Pfarrer und Pfarrerinnen einer Meinung sind? Und bei wem hätte ich mir Unterstützung holen können? Sämtliche Herren im Bischöflichen Ordinariat sind doch ebenfalls Priester!
Auch in unseren ökumenischen Zusammenkünften zeigen diese Pfarrerinnen und Pfarrer bei unseren Terminabsprachen, dass sie keinen Wert auf meine Zusammenarbeit legen. Bei der Planung von Teamsitzungen werden nur solche Termine berücksichtigt, bei denen sie und die Vikarin Zeit haben. Ich dagegen werde nie gefragt und schlichtweg übergangen. Die Folge ist, dass ich an unseren „ökumenischen“ Teamsitzungen nicht mehr regelmäßig teilnehmen kann, da ich diese Termine oft gar nicht mitbekomme. Lediglich aus ihren Sitzungsprotokollen erfahre ich, worüber sie gesprochen haben, denn diese legen sie mir weiterhin in mein Fach.
Das einzig Gute daran ist, ich muss ihr besserwisserisches Getue und ihre herablassende Art, mit der sie mit mir umgehen, nicht mehr ertragen. Wie weltfremd sie dabei argumentierten und wie wenig Ahnung sie von vielen Dingen haben, das muss ich mir nun nicht mehr anhören. Was haben sie denn auch außer ihrem Theologiestudium schon gelernt? Viel Theorie und wenig Praxis! Und dieses Unwissen gepaart mit einer exorbitanten Selbstüberschätzung! Zuweilen finde ich es geradezu lächerlich, über welche Kleinigkeiten und Lappalien sie unendlich lange reden können und über welche belanglose Begebenheiten sie sich echauffieren, wenn irgendetwas nicht so verläuft, wie sie es sich vorgestellt haben.
Eines Tages lese ich in einem ihrer Sitzungsprotokolle, dass die Klinikseelsorge nun in ein neues Seelsorgezimmer umziehen soll, das uns von der Klinikverwaltung im neu gebauten Funktionsbau in der Nähe des Andachtsraumes zugeteilt wurde. Dieser Umzug soll innerhalb von zwei Tagen erfolgen, weil unser jetziges gemeinsames Büro beim Hörsaal, wo früher unsere Gottesdienste stattfanden, von den Handwerkern renoviert werden muss. Aus dem Protokoll ihrer Teamsitzung entnehme ich, dass am ersten Umzugstag die katholischen Kollegen ihre Sachen ausräumen sollen, am zweiten Tag sind dann die evangelischen Kollegen mit dem Umzug dran. Mein Kollege Arno muss mal wieder kurzfristig an diesem für uns angesetzten Umzugstag in der Domgemeinde St. Eberhard einen Gottesdienst übernehmen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als diese gesamte Umzugsprozedur alleine zu bewerkstelligen. Einen ganzen Tag lang bin ich damit beschäftigt, all unsere Sachen aus dem bisherigen Büro auszuräumen und hinüber ins neue Seelsorgezimmer zu bringen, um dort wieder alles Stück für Stück einzusortieren.