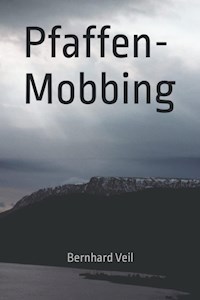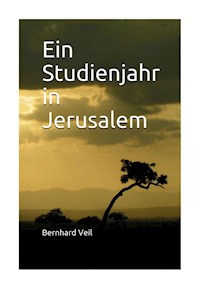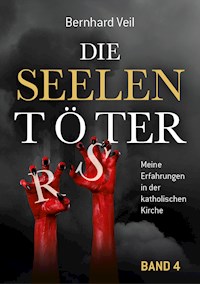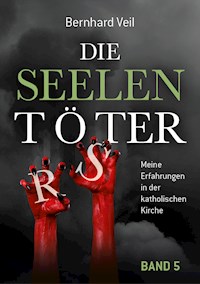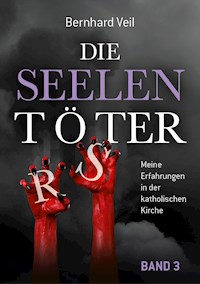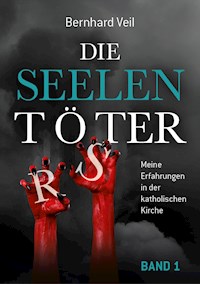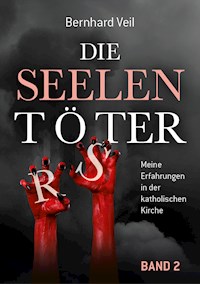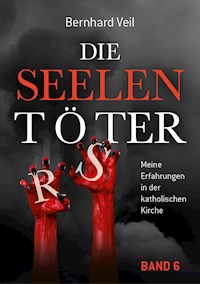
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit falschen Behauptungen, entwürdigenden Äußerungen und Verleumdungsbriefen versuchen die Pfarrerinnen und Pfarrer im Katharinenhospital, ihren Kollegen Thomas von seinem Arbeitsplatz wegzumobben. In seinem Umfeld verbreiten sie Lügengeschichten und erklären, dass es für sie eine Zumutung sei, mit ihm zusammenzuarbeiten. Von seinen Vorgesetzten kann er keine Hilfe erwarten, da sie ebenfalls allesamt Priester und Kleriker sind. Schließlich gelingt es ihnen, Thomas durch massive Verleumdungen zu diskreditieren. Somit ist sein Schicksal besiegelt. Er wird nach Geislingen versetzt. Dort bekommt er jedoch keine ordentliche Arbeitsumschreibung, so dass er auch hier der Willkür seines neuen Vorgesetzten hilflos ausgeliefert ist. Seine früheren Arbeitskollegen geben aber immer noch keine Ruhe. Durch Streuung von Halbwahrheiten und Falschinformationen setzen sie Thomas nach, indem sie ihn auf diversen Tagungen und Konferenzen in Verruf bringen. Sein neuer Kollege, ein Diakon, greift begierig diese üblen Nachreden auf und kostet sie in seinem neuen Arbeitsumfeld schamlos zu seinen Gunsten aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Attacken ohne Ende
Paul zeigt sein wahres Gesicht
Unterschiedliche Behandlung
Jegliche Hoffnung schwindet
In der Rehabilitationsklinik
Zurück von der Reha
Adventsfeier
Umzug zur Schwäbischen Alb
Die überaus wichtige Klinikseelsorge
Aufgedeckte Unregelmäßigkeiten
Die neue Geschäftsordnung
Die Lage ändert sich
Gespräch im Bischöflichen Ordinariat
Priesterliche Teamarbeit
Die Hetzkampagne geht weiter
Mein neuer Arbeitsbereich
Der Chef und die anderen
Willkür ohne Ende
Rechtlos geduldet
Aufschlussreiche Informationen
Leidige Zusammenarbeit
Eine ordentliche Arbeitsumschreibung?
Amüsant und doch bedenklich
Rückblicke
Alles geht einmal zu Ende
Impressum
Bernhard Veil
Die Seelentöter
Meine Erfahrungen in der
katholischen Kirche
Band 6
Das Endspiel beginnt
ISBN 9789463670203
2020 Bookmundo Osiander
2. Auflage
Alle Rechte liegen beim Autor.
Umschlaggestaltung: Hannes Klein / jkdtp
Vorwort
Unter der Reihe „Die Seelentöter“ berichte ich von meinen Erfahrungen, die ich als Mitarbeiter in der katholischen Kirche erlebt habe. Damit der Focus der beschriebenen Personen nicht nur auf Priester, Pfarrer und sonstige Kleriker gerichtet ist, habe ich mehrere Episoden aus meinem Leben und Werdegang hinzugefügt.
Alle Namen der beschriebenen Personen wurden abgeändert, die angeführten Institutionen und Handlungsorte jedoch beibehalten, so dass sich jeder ein Bild darüber machen kann, was sich vor wenigen Jahren an diesen Schauplätzen ereignet hat. Die zitierten Schriftstücke sind im Originaltext wiedergegeben, lediglich die Namen wurden geändert. Alle angeführten Briefe und schriftlichen Belege sind wortwörtlich zitiert, so dass der Leser erkennen kann, welche Konsequenzen die kirchlichen Entscheidungsträger aus den vorgegebenen Situationen gezogen haben. Um das Kostenrisiko in Grenzen zu halten, habe ich auf ein Lektorat verzichtet. Sollten sich im Text jedoch Fehler eingeschlichen haben, dann bitte ich Sie, mir diese Mängel zur Berichtigung mitzuteilen.
E-Mail-Adresse: [email protected]
Attacken ohne Ende
Seit Paul Gegenfalz im Katharinenhospital mein neuer Kollege ist, habe ich endlich wieder eine einigermaßen geregelte Arbeitszeit. Zwar werde ich auch weiterhin nachts zu Notfällen oder zu Patienten, die im Sterben liegen, in die Klinik gerufen, doch diese Anrufe sind nun doch etwas weniger geworden, seit er hier ist. Über zwei Jahre lang war ich allein für die katholischen Patienten rund um die Uhr zuständig, was mir viel freie Zeit und auch so manchen Schlaf geraubt hatte. Doch vor allem belasteten mich die evangelischen Kollegen mit ihren hinterhältigen Verleumdungen und aufreibenden Attacken. Es war Mobbing der fiesesten Art. Obwohl ich meine Vorgesetzten mehrmals ausführlich mündlich und schriftlich in Kenntnis gesetzt habe und sie alle genauestens darüber Bescheid wussten, haben sie nichts unternommen, sondern es stillschweigend zugelassen. Sie haben geschwiegen und sind nie dagegen eingeschritten. Einige haben meine Widersacher in ihrem boshaften Treiben sogar noch unterstützt. Nie wurde ihnen Einhalt geboten, geschweige denn, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen wurden. Um diese schreckliche Zeit überhaupt durchstehen zu können, musste ich mir immer wieder gewisse Leuchtmarken setzen. Nur so konnte ich mir für diese dunkle Zeit immer wieder kleine Hoffnungsschimmer setzen, auf die ich dann zusteuern konnte. Als ich vor Weihnachten des vergangenen Jahres die Mitteilung bekam, dass ich endlich einen neuen katholischen Kollegen bekommen würde, meldete ich mich gleich im Frühjahr zu einer interessanten Studienreise durch Südfrankreich an, die jetzt im Spätherbst stattfand. Damals hatte ich gedacht, dass ich mir nach dieser langen stressigen Zeit nun guten Gewissens einen solchen Reisegenuss gönnen könnte und war der Meinung, dass mein neuer Kollege sich in diesem dreiviertel Jahr dann einigermaßen gut in die Klinikseelsorge hier eingearbeitet hat. Allerdings rechnete ich nicht damit, dass er nach seinem Krankenhausseelsorge-Praktikum und nach seiner Klinikseelsorge-Ausbildung dann nochmals elf Wochen für aufgelaufenen Urlaub und Fortbildungsmaßnahmen frei nehmen würde. Durch meinen bereits fest eingeplanten Urlaub ließ es sich aber nicht mehr vermeiden, dass sich meine Urlaubspläne mit seiner Abwesenheit um drei Tage überschnitten haben.
Kaum bin ich zurück, bringen die evangelischen Kolleginnen diese Überschneidung unserer Urlaubspläne bei unserer ökumenischen Teamsitzung sofort zur Sprache. Weil sie aber meinen Kollegen Paul nicht kritisieren wollen, gehen sie sofort wie die Geier auf mich los, schimpfen auf mich mit den altbekannten Vorwürfen ein, wobei sie Pauls Abwesenheit mit keinem Wort kritisieren. Er bleibt von jeglicher Kritik verschont, so dass er froh und frei mit frischem Elan seiner Arbeit nachgehen kann. Ich dagegen werde sofort nach meinem Urlaub von allen wieder in die Mangel genommen, als ob ich ein Kapitalverbrechen begangen hätte. Die Kollegin Koschinski motzte mich an und beschuldigte mich mit ihren alt bekannten Kamellen und legte permanent dieselbe Platte auf:
„Als der Kollege Gegenfalz auf seiner Fortbildung war, habe ich wieder wegen einer Krankensalbung einen Priester von außerhalb suchen müssen. Herr Zeil war wie üblich nicht hier. Und deshalb mussten wir seine Aufgabe mitübernehmen! Nie ist er am Telefon hier erreichbar, wenn Anrufe für die katholische Seelsorge eingehen.“
Koschinski tut, als ob ich lediglich für den Telefondienst zuständig wäre und die übrigen Pfarrer und Pfarrerinnen die eigentliche Seelsorgearbeit vollbringen müssten. In ihrer Kritik erwähnt sie sogar, dass Paul zwar ebenfalls abwesend war. Als Grund dafür erwähnt sie aber lediglich seine Fortbildung, nicht aber, dass er ebenso vier Wochen Urlaub genommen hatte. Seine Abwesenheit wird von ihr somit beschönigt, mir dagegen lastet sie diese drei Tage unserer gleichzeitigen Abwesenheit als schuldhaftes Vergehen an, obwohl ich nur zehn Tage weg war. Im Grund genommen wäre der Sachverhalt ja nicht der Rede wert, denn wenn unsere Klinikseelsorger-Tagungen und unsere Dekanatskonferenzen stattfinden, dann sind sowohl die evangelischen Kollegen als auch wir nicht im Krankenhaus erreichbar. In anderen Krankenhäusern käme ohnehin keiner auf die Idee, einen anderen Kollegen zu beschuldigen, weil er gerade mal nicht anwesend ist, wenn dringend ein Pfarrer oder Priester gewünscht wird. Doch hier in unserer „ökumenischen Zusammenarbeit“ ist dieses Thema zum Dauerbrenner geworden. Und nur deshalb, weil ich auf diese Weise am besten eines dienstlichen Vergehens beschuldigt werden kann. Und weil sie andere Gründe nicht vorbringen können, beschuldigen sie mich permanent bei jeder Sitzung mit demselben Delikt, obwohl sie diesen Tatbestand genauso gegen meinen Kollegen Paul vorbringen könnten. Er aber bleibt von ihnen verschont, er ist ja Priester!
Bei ihren ständigen Beschuldigungen mag sicherlich auch ein gewisser Neid oder Frust eine Rolle spielen, denn die evangelischen Kolleginnen und ihr Kollege Stolzenburg werden so gut wie nie zu einem Patienten gerufen. Weil sie sich das aber nicht eingestehen können, reagieren sie ihren Frust sofort an mir ab, sobald sie für einen katholischen Patienten einen Seelsorger rufen müssen. Außerdem wissen sie, dass sie nach Lust und Laune ihre Gehässigkeit an mir abreagieren und ihrer Kritik ungehindert freien Lauf lassen können, weil niemand dagegen einschreitet. Doch was soll ich tun? Jeder Widerspruch ist zwecklos und würde sofort zu einem entsetzlichen Eklat führen. Denn sobald ich etwas sage, sind sie sich sofort einig und gehen wie Furien auf mich los. Deshalb lasse ich sie reden und lächele gelangweilt vor mich hin. Doch innerlich gehen mir diese ständigen Beschuldigungen gewaltig auf den Geist.
Nun aber ist Paul hier. Schon dieser Umstand ist für mich eine große Entlastung. Dass bei meiner Rückkehr aus meinem Urlaub auch noch mein Zettel in unserem gemeinsamen Büro am Schwarzen Brett hing, auf dem ich ihnen meine Abwesenheit bekannt gegeben hatte, zeigt mir, dass sie nun nicht mehr so ohne weiteres mir alles in die Schuhe schieben können, was ihnen gerade einfällt. Denn früher hatte vermutlich eine Kollegin immer meine Mitteilungen abgehängt und konnte den anderen gegenüber behaupten, ich würde ständig unentschuldigt fehlen. Trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Paul ihren verleumderischen Behauptungen nicht insgeheim doch mehr Glauben schenken will, als er mir gegenüber zugibt. Denn jedes Mal, wenn ich ihm etwas von meiner schrecklichen Vergangenheit erzählen möchte, wie sie mit mir umgegangen sind und immer noch umgehen, blockt er sofort ab und will nichts davon wissen. Den evangelischen Kolleginnen aber hört er bei seinen gemeinsamen Mittagessen geduldig zu, denn ansonsten würde er auch von ihnen nicht mehr so ohne weiteres akzeptiert werden.
Durch die ständigen Rangeleien und Anfeindungen bin ich mittlerweile sehr dünnhäutig geworden. Zunehmend beschleicht mich das Gefühl, dass ich in den Augen meiner Kollegen und Kolleginnen an meinem Arbeitsplatz entbehrlich geworden bin und ich nicht mehr gebraucht werde, da für die katholische Klinikseelsorge im Katharinenhospital ja wieder ein Priester zur Verfügung steht. Mag sein, dass ich mir das alles nur einbilde, weil ich jetzt nicht mehr so stark gefordert bin. Jedenfalls bekomme ich unterschwellig mit, dass Stolzenburg und die evangelischen Kolleginnen mich bei Paul mit allen Mitteln madig zu machen versuchen. Jede Gelegenheit nehmen sie wahr, mir irgendwelche Fehler und Versäumnisse anzulasten. Wenn ich mich ihm gegenüber aber rechtfertigen will, gibt er mir zu verstehen, dass er sich aus all diesen Konflikten heraushalten will. Ihrem intriganten Ränkespiel kann er sich aber trotzdem nicht entziehen, da er ihre diffamierenden Äußerungen ja nicht zurückweisen kann, um sie nicht zu verprellen.
Als ich Paul eines Morgens in der Eingangshalle der Klinik begegne, kommt er lachend auf mich zu uns berichtet:
„Ich glaube, demnächst wird bezüglich der Sprechstunden, die wir hier anbieten, etwas auf dich zukommen!“
Ich kann mir zwar nicht so recht vorstellen, was er damit meint und frage ihn:
„Warum? Es läuft doch alles gut so. Oder nicht?“
„Ich halte mich da ganz raus“, schmunzelt er, „das sollen sie dir lieber selbst sagen. Es geht um die Sprechstunden und das Abendgebet, wo du dich ja ganz ausgeklinkt hast, solange du hier allein warst. Doch da ich jetzt hier bin, fällt dieses Argument der Überbelastung ja weg. Deshalb sind die evangelischen Kolleginnen der Meinung, dass du dich abwechslungsweise wieder daran beteiligen müsstest.“
„Gut“, antworte ich, „dann sollen sie ihr Anliegen ruhig in der nächsten Teamsitzung vorbringen“, antworte ich und bin gespannt, welche neue Attacke sie wieder gegen mich reiten werden. Insgeheim bin ich aber froh, dass er mich wenigstens vorgewarnt hat.
„Na, na, ich glaube, dass für dich diese Sache nicht so ganz angenehm sein wird“, erhebt Paul warnend seine Stimme, „denn sie wollen mal wieder ein ernstes Wörtchen mit dir reden!“
Es klingt fast so, als würde auch er seine Freude daran haben, wenn sie schon wieder einen Angriff gegen mich starten wollen.
„Gut, wir werden ja sehen, was sie vorhaben“, antworte ich ihm und bin gespannt, was da auf mich zukommt.
Bei der nächsten Teamsitzung bringen die evangelischen Kollegen den Wunsch vor, dass ich wieder wie früher wöchentlich eine Sprechstunde anbieten und abwechslungsweise das wöchentlich stattfindende Abendgebet im Andachtsraum abhalten müsse. Natürlich ist es die Koschinski, die diesen Wunsch in ihrem äußerst unangenehmen und oberlehrerhaften Befehlston an mich richtet. Sie schließt ihre Aufforderung mit der Bemerkung:
„Ihre Schonzeit ist nun abgelaufen! Nachdem nun der Kollege Gegenfalz schon eine geraume Zeit hier ist, können Sie, Herr Zeil, sich nicht mehr auf die Ausrede berufen, dass Sie hier allein die ganze katholische Seelsorge bewältigen müssen.“
Auf ihre überspitzte Formulierung gehe ich nicht weiter ein, sondern berichtige sie lediglich:
„Als diese Sprechstunden hier eingeführt wurden, war ich lediglich dazu bereit, für ein halbes Jahr wie alle anderen eine Sprechstunde anzubieten. Damals hatten wir vereinbart, dass zuerst geprüft werden solle, ob diese Sprechstunden von den Patienten überhaupt angenommen werden. Da aber nie ein Patient in meine Sprechstunde kam, um ein seelsorgerliches Gespräch mit mir zu führen, sah ich es nicht mehr ein, nur unnütz in unserem Seelsorgezimmer herumzusitzen. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass es viel sinnvoller ist, die Patienten auf den Krankenstationen zu besuchen, statt hier die Zeit zu verplempern. Und außerdem“, so bemerke ich ironisch, „sollten diese Sprechstunden doch wohl nur deshalb angeboten werden, dass bei den Leuten und vor allem bei der Klinik-Verwaltung der Eindruck entstehen sollte, es würden in unserem Büro wichtige Gespräche stattfinden. Denn durch die mattierten Glaswände ist ja von draußen leicht erkennbar, wenn hier das Licht brennt. Ist es aber aus, könnte man den Eindruck haben, dass hier nichts gearbeitet wird. Andererseits sitzt man während dieser Sprechstunden hier nur sinnlos herum, weil eh keiner kommt. Das war doch ursprünglich auch der Grund, weshalb ich dagegen war, diesen Raum für die Seelsorge zu übernehmen. Er ist zwar sehr zentral gelegen, hat aber den Nachteil, dass man von außen jederzeit sehen kann, ob sich hier jemand aufhält oder nicht. Und nur das Licht brennen lassen, wie schon des öfteren vorgeschlagen und dann auch noch mit Stimmenmehrheit von den evangelischen Kollegen beschlossen wurde, damit draußen die Leute den Eindruck haben, hier würde gearbeitet, ist doch reine Energieverschwendung und geradezu lächerlich, mehr aber auch nicht.“
„Das ist doch unmöglich“, fährt die Koschinski mich unwirsch an. Doch ich fahre fort und rufe:
„Halt, ich bin noch nicht fertig. Genauso ist es doch mit dem Abendgebet! Es findet jeden Mittwochabend um 18 Uhr statt. Die meisten Patienten haben um diese Zeit noch ihre Besuche oder sitzen beim Abendessen. Bei mir haben höchstens ein oder zwei Patienten am Abendgebet teilgenommen. Meistens kam jedoch gar keiner. Auch in dieser Zeit kann ich mit ein paar Besuchen auf den Krankenstationen doch wesentlich mehr Patienten erreichen als durch dieses Abendgebet im Andachtsraum, bei dem fast nie jemand anwesend ist.“
Sichtlich ist den evangelischen Kolleginnen anzumerken, dass sie wie auf Kohlen sitzen und ihnen meine Argumentationsweise völlig zuwider ist. Paul dagegen hält sich bei der ganzen Diskussion wie immer sehr vornehm zurück, vor allem auch dann, wenn ich von ihnen so unwirsch angegangen werde. Ihr Zorn könnte ja ansonsten auch ihn treffen. Da es nun aber so aussieht, dass die evangelischen Kolleginnen mit mir zu keiner Einigung kommen, faucht die Rallinger nun plötzlich ihn an:
„Sag doch du auch einmal etwas! Du warst doch auch dafür, dass er die Sprechstunde und das Abendgebet wieder halten soll. Du hast doch sogar die Sache ins Rollen gebracht und jetzt hältst du dich so zurück!“
Peinlich berührt von diesem plötzlichen Angriff, stottert er erst etwas daher und erklärte schließlich:
„Ja, Thomas, auch ich glaube, dass es doch ganz gut wäre, wenn du ebenfalls wieder bei diesen Sprechstunden mitmachen würdest. Dann wäre es auch viel einfacher für mich, wenn einer von uns ausfällt, dass wir einander vertreten könnten.“
Nun wird mir klar, wer eigentlich die treibende Kraft war und mich zu dieser Sprechstunde und zum Abendgebet verpflichten wollte. Da mein Kollege Paul jeden Montag seine Sprechstunde halten muss und die evangelischen Kollegen ihn nicht vertreten, weil sie grundsätzlich montags auf ihren freien Tag nicht verzichten wollen, er aber ebenfalls gelegentlich montags gerne frei haben möchte, soll nun ich die Sprechstunden wieder abhalten, damit er mich als Vertretung einspannen kann. Selbst aber wollte er mit diesem Anliegen nicht auf mich zukommen! Vielmehr benützt er diese Kampfhennen dazu, um diese Attacke gegen mich zu reiten. Als ihr Angriff aber nun zu scheitern drohte, musste auch er Farbe bekennen und zugeben, dass es vor allem sein Wunsch war, dass ich bei den Sprechstunden wieder mit ins Boot geholt werde. Um es nicht erneut zu einem Streitgespräch kommen zu lassen, zeige ich mich kompromissbereit und willige ein. So bieten die evangelischen Kollegen weiterhin jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ihre Sprechstunden an, damit sie wie gewohnt ihr verlängertes Wochenende gegebenenfalls auf Montag und Freitag ausdehnen können. Den Montag übernimmt mein Kollege Gegenfalz ganz so, wie es Arno gemacht hatte, so dass ich nun wieder am Freitag meine unnütze Sprechstunde absitzen muss. Doch kaum habe ich meine Einwilligung dazu gegeben, kommt wenige Tage später die Koschinski in meine Sprechstunde und sagt:
„Sie haben ja gewollt, dass Sie jetzt freitags wieder eine Sprechstunde anbieten, dann müssen Sie nun auch dafür sorgen, dass die Sprechstundenzeiten auf den Begrüßungskarten für die Patienten und auf den Hinweisschildern vor unserem gemeinsamen Seelsorgezimmer und im Andachtsraum entsprechend abgeändert werden. Am besten, Sie lassen dafür Aufkleber mit den neuen Sprechstundenzeiten drucken, dann können Sie damit die Begrüßungskarten überkleben.“
„Wer hat das gewollt?“, frage ich erstaunt.
„Ja, Sie haben doch das so gewollt, wer denn sonst?“, faucht sie mich barsch an, „Sie wollen doch nun wieder Ihre Sprechstunde hier anbieten!“
„Wegen einer einzigen zusätzlichen Sprechstunde, zu der sowieso keiner kommt, soll ich jetzt auch noch neue Aufkleber drucken lassen und dafür unnötig Geld ausgeben? Und womöglich soll ich dann auch noch stundenlang mehrere tausend Begrüßungskarten ganz alleine überkleben? Ich glaub, da tickt es bei Ihnen wohl irgendwo nicht ganz richtig! Nicht ich habe diese Sprechstunde gewollt, sondern Sie und Ihre Kollegen. Sie haben doch diesen Wunsch im Team eingebracht und ich habe lediglich zugestimmt! Ich bin Ihrem Wunsch entgegengekommen und nicht umgekehrt. Wenn Sie also neue Aufkleber drucken lassen wollen, dann machen Sie das doch bitte selbst. Ich jedenfalls mache diesen Unsinn nicht mit“, entgegne ich fest entschlossen, worauf sie wutentbrannt abdampft.
Am nächsten Morgen kommt mir Paul entgegen und sagt:
„Die Kollegin Koschinski hat bei mir angerufen und hat mir berichtet, dass es mit dir anscheinend wieder Zoff gegeben hat.“
Da ich aber von einem „Zoff“ nichts weiß, frage ich ihn:
„Warum? Was hat sie denn dir erzählt?“
„Du hättest dich geweigert, die Aufkleber für die Begrüßungskarten drucken zu lassen und außerdem willst du die Hinweisschilder mit deiner neuen Sprechstunde nicht entsprechend abändern“, teilt er mir unverhohlen mit.
Daraufhin erkläre ich ihm:
„Ja, das mit den Aufklebern stimmt, das andere mit dem Hinweisschild aber nicht. Auf den Hinweisschildern an unserem gemeinsamen Büro und im Andachtsraum werde ich meine Sprechstunde einfügen.“
Am selben Abend setze ich mich zuhause an meinen PC und drucke ein Blatt Papier mit den angebotenen Sprechstunden aus, wobei ich meine Sprechstunde am Freitag wie versprochen hinter denen meiner Kollegen einfüge. Dabei übernehme ich, wie sie es auf den bisherigen Hinweisschildern gemacht hatten, ihre Namen mit ihrem jeweiligen Zusatz „Pfarrer“ beziehungsweise „Pfarrerin“ und füge hinter meinem Namen meinen akademischen Titel „Diplom-Theologe“ und meine psychotherapeutische Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse hinzu. Meine Berufsbezeichnung „Pastoralreferent“ lasse ich weg, weil diese Berufsbezeichnung immer noch unbekannt ist und die Leute ja gar nicht wissen, dass dafür ein abgeschlossenes Theologiestudium mit einer dreijährigen pastoral-praktischen Ausbildung erforderlich ist.
Als ich am nächsten Tag das Hinweisschild an unserem gemeinsamen Büro mit den ausgedruckten Sprechstundenzeiten überkleben will, sitzen in unserem gemeinsamen Büro wie üblich die evangelischen Pfarrerinnen bei ihrer Kaffeerunde zusammen und begutachten mein Druckwerk. Gnädig wie eine strenge Oberlehrerin, schaut die Kollegin Koschinski das Blatt mit meiner zusätzlich aufgeführten Sprechstunde an, schüttelt den Kopf und sagt:
„So kann man das aber nicht stehen lassen! Diplom-Theologe! Wie das schon klingt! Und das mit Ihrem Psychologie-Kurs, den Sie da gemacht haben? Also der muss ja wirklich nicht erwähnt werden! Wir sind der Meinung, dass Ihr Name ausreicht, alles andere ist Unsinn.“
„Das war kein Psychologie-Kurs, sondern eine psychotherapeutische Ausbildung, die fünf Jahre gedauert hat. Dafür musste ich eine schriftliche Abschlussarbeit verfassen und musste mehrere schriftliche Prüfungen ablegen. Und außerdem, alle Firmen sind bemüht, ihren Kunden durch entsprechende Qualifikationszusätze anzuzeigen, dass sie ein qualifiziertes Personal haben, das von ihnen auch entsprechend bezahlt wird. Und hier soll dieser Grundsatz wohl nur für Pfarrer und Pfarrerinnen gelten? Für mich aber nicht? Von ihnen lasse ich mir doch nicht vorschreiben, wie ich mich hier zu präsentieren habe! Das kann ich ja wohl noch selbst bestimmen“, entgegne ich ihr entschieden.
Doch nun schalten sich auch die beiden anderen Kolleginnen ein und sind einhellig der Meinung, dass sie mit meiner „Selbstdarstellung“ absolut nicht einverstanden sind. Sie machen mich lächerlich und schlagen vor, dass diese Sache unbedingt auf der nächsten Teamsitzung geklärt werden müsse. Erst dann könne ich dieses Hinweisschild mit meiner Sprechstunde entsprechend ihrem gemeinsamen Beschluss hier anbringen. Gegen diese vereinte Übermacht kann ich nun allerdings nichts mehr ausrichten. Ich nehme mein Sprechstunden-Hinweisschild wieder ab und verlasse wortlos das Büro.
Am späten Nachmittag treffe ich Paul, der bereits von den evangelischen Kolleginnen informiert wurde, dass mein Entwurf zum Überkleben des Hinweisschildes von ihnen abgelehnt werde. Ich erkläre ihm, wie ich es gestaltet habe und teile ihm mit, dass sie auf der nächsten Teamsitzung darüber beratschlagen wollen. Dabei äußere ich die Befürchtung, dass es mal wieder ein endloses Palaver werden könnte. Verständnisvoll lacht er und meint:
„Das kann ich mir recht gut vorstellen! So, wie ich sie mittlerweile kenne, haben sie an allem etwas auszusetzen. Wenn mir das passiert wäre, dann wäre ich auch ausgerastet.“
„Ausgerastet?“, frage ich erstaunt zurück, „haben sie tatsächlich gesagt, dass ich ausgerastet sei?“
Lachend nickt er, worauf ich ihm antworte:
„Das ist doch unmöglich! Wenn ich nicht alles so ausführe, wie diese Damen es wünschen, und ihnen widerspreche, dann nennen sie das gleich 'ausrasten'.“
Kopfschüttelnd und lächelnd hört er mir zu und ich sehe ihm an, dass er heilfroh ist, nicht im Kreuzfeuer ihrer Kritik zu stehen. Doch nun bringt er folgenden Vorschlag:
„Wir können ja ganz neue Begrüßungskarten drucken lassen. Dann bräuchte man gar keine Extra-Aufkleber drucken und könnte sich das Überkleben der alten Karten sparen.“
„Aber es sind noch mehrere tausend Begrüßungskarten vorhanden. Soll man denn die einfach wegwerfen nur wegen dieser einen zusätzlichen Sprechstunde, zu der doch sowieso keiner kommt?“, frage ich erstaunt.
Diesen Einwand wehrt er jedoch ab und meint:
„Die jetzigen Karten sind ja nicht gerade besonders geschmackvoll gestaltet. Man könnte die neuen Karten mit schönen Bildern oder Grafiken bedrucken, damit sie einladender wirken. Vielleicht kannst du unter deinen Dias, die du in Israel gemacht hast, mal nachschauen, ob du da nicht einige Bilder zur Gestaltung der neuen Karten beisteuern kannst.“
Als er auf diese Weise mir eine Neuauflage der Begrüßungskarten schmackhaft machen will, bemerke ich, dass er das schon alles mit den evangelischen Kolleginnen abgeklärt hat. Deshalb stimme ich ihm zu und erkläre mich bereit, in den nächsten Tagen einige meiner Dias mit Motiven vom Heiligen Land in sein Fach zu legen. Er ist sichtlich erfreut, dass ich auf seinen Vorschlag eingehe und sagt schmunzelnd:
„Wenn ich dann mit den evangelischen Kolleginnen zusammensitze, um die Bilder für die Begrüßungskarten auszuwählen, werde ich ihnen natürlich nicht sagen, dass diese Dias von dir sind. Sonst würden sie ja gleich von vornherein diese Bilder ablehnen. Sie könnten es ja nicht ausstehen, wenn die neuen Begrüßungskarten mit deinen Bildern bedruckt werden.“
Ich stimme ihm zu und lege ihm am nächsten Tag einige Dias mit Motiven vom Heiligen Land in sein Fach.
Paul zeigt sein wahres Gesicht
Um mich meinem neuen Kollegen Paul gegenüber stets loyal zu verhalten, übernehme ich häufig Aufgaben für ihn, die ich gar nicht tun müsste. Auch weil er sich im Katharinenhospital noch nicht überall auskennt, komme ich ihm in Vielem entgegen, um ihm meine gutwillige Zusammenarbeit zu zeigen. Als wir in unserem ökumenischen Team die bevorstehende Patienten-Weihnachtsfeier besprechen, stellen wir fest, dass dieses Jahr entsprechend dem jährlichen Wechsel wieder die katholischen Klinikseelsorger für die Organisation dieser Veranstaltung zuständig sind. Mit dieser lapidaren Feststellung wurde in den vergangenen Jahren üblicherweise dieser Programmpunkt in unseren Teamsitzungen abgehakt. Doch nun meldet sich hierzu sofort die Kollegin Koschinski zu Wort und gibt in ihrer wichtigtuerischen Art die Empfehlung:
„Ich fände es gut, wenn dieses Jahr der Kollege Paul die Ansprache übernimmt, damit er bei den Patienten und Mitarbeitern im Haus noch besser bekannt wird.“
Dass diese Empfehlung nichts mit den Patienten und auch nichts mit den Mitarbeitern zu tun hat, ist sofort allen klar. Denn die Patienten sind nur relativ kurz hier im Haus und lernen ohnehin nur diesen Seelsorger kennen, der für ihre Krankenstation zuständig ist, vorausgesetzt dass er sie überhaupt besucht. Und die Mitarbeiter unserer Klinik haben zumeist gar keine Zeit, an dieser Patienten-Weihnachtsfeier teilzunehmen, da sie arbeiten müssen. Sollten sie jedoch frei haben, dann kommt bestimmt kein einziger von ihnen extra wegen unserer Patienten-Weihnachtsfeier hierher ins Krankenhaus, zumal diese Feier vor allem für unsere Patienten abgehalten wird und nicht für die Mitarbeiter. In ihrer übereifrigen Fürsorge möchte die Kollegin Koschinski durch ihre vorlaute Äußerung lediglich darauf Einfluss nehmen, dass nicht ich, sondern mein Kollege Paul die Weihnachtsansprache hält, mehr aber auch nicht. Da mir ihre ständige Einmischung in unsere Angelegenheiten so ziemlich auf den Wecker geht, weise ich ihren Vorschlag zurück und erkläre:
„Bei uns war es schon immer so, dass derjenige, der die Organisation dieser Weihnachtsfeier ausrichtet, auch gleichzeitig die Ansprache dazu hält. Und das schon deshalb, weil er den thematischen Schwerpunkt dieser Feier bestimmt.“
Auf meinen Einwand reagiert die Koschinski jedoch äußerst gereizt. Theatralisch streckt sie mal wieder beide Hände empor, schaut dabei zur Decke hinauf, und ruft laut in die Runde:
„Natürlich, natürlich, Herr Zeil! Ich wollte ja auch nur einen Vorschlag machen und sagen, was ich für sinnvoll erachte.“
Die weiteren Tagesordnungspunkte werden wie üblich mit langem und ausführlichem Gelaber durchgeackert. Die Übertragungsanlage, die unsere Gottesdienste vom Andachtsraum auf die Hörmuscheln in die Patientenzimmer überträgt, funktioniert nicht überall. Der Aufbahrungsraum ist immer noch nicht so gestaltet, wie es einige Kolleginnen gerne hätten, und dann steht außerdem noch die Frage an, wie meine Sprechstunde auf den Begrüßungskarten formuliert werden soll, ebenso auf dem Hinweisschild, das an unserem gemeinsamen Büro angebracht ist. Nach langem Hin und Her sind sich alle einig, dass ein akademischer Titel wie „Diplom-Theologe“ nichts mit Seelsorgearbeit zu tun habe und daher nicht angemessen sei. Auch meine psychotherapeutische Ausbildung soll nicht erwähnt werden, da wir ja keine „Psychologische Beratungsstelle“, sondern die Krankenhausseelsorge sind. Daher plädieren die evangelischen Kollegen einstimmig dafür, dass hinter der Zeitangabe meiner Sprechstunde lediglich mein Name „Herr Zeil“ stehen solle, mehr aber nicht. Auf meinen Einwand, dass doch auch ihr Titel „Pfarrer“ beziehungsweise „Pfarrerin“ anfügt werde, echauffieren sie sich heftig über mein Unverständnis:
„Das ist doch gerade das Typische an der Seelsorge, dass Pfarrerinnen und Pfarrer hier ihren Dienst tun!“, blökt die Rallinger mich spöttisch an, „begreifst du denn das nicht?“
„Das ist doch selbstverständlich, dass unser Beruf für die Seelsorge hier ausschlaggebend ist!“, stimmt Koschinski ihr zu und wispert mit hämischem Blick zu mir herüber, „dem geht so etwas wohl nie in den Kopf.“
Als die Kolleginnen sich weiterhin über mich lustig machen, weil ich angeblich so verblendet sei, sehe ich es nicht ein, dass lediglich mein Name genügen müsse, um mich und meine berufliche Arbeit zu präsentieren. Deshalb drohe ich damit, keine Sprechstunden anzubieten, falls ich nicht ebenfalls meine fachliche Qualifikation zu meiner Namensnennung hinzufügen darf.
„Mit Ihnen haben wir immer nur Probleme“, schreit mich Koschinski an und ihre Kollegin Rallinger pflichtet ihr bei:
„Aber wirklich, mit so einem kann man doch nicht zusammenarbeiten! Immer mit seinen Sonderwürstchen! Der hält doch unsere ganze Arbeit hier auf! Mit dem kommen wir doch nie weiter! Es ist und bleibt eine einzige Katastrophe!“
Obwohl diese despektierlichen Äußerungen mich innerlich sehr treffen, bleibe ich ruhig und zeige mich unnachgiebig. Als sie sich wieder beruhigt haben und keiner weiß, wie es nun weitergehen soll, sagt Paul:
„Vielleicht könnten wir es mit einem Kompromiss versuchen? Anstatt der beiden Zusätze, die Thomas hinter seinem Namen anfügen möchte, könnten wir ihm vielleicht wenigstens einen dieser beiden Namenszusätze genehmigen. Es fragt sich dann nur welchen?“
Mit Zornesröte im Gesicht schauen sich die evangelischen Kolleginnen einander an, Stolzenburg hält sich zurück. Da auf den eingebrachten Kompromiss von Paul keine Zustimmung kommt, wird er konkret und schlägt vor:
„Also ich finde, dass der Zusatz „Dipl.-Theol.“ durchaus angemessen ist. Das mit der psychotherapeutischen Ausbildung würde ich auch nicht für gutheißen. Das klingt eher wie auf einem Schild bei einer psychologischen Beratungsstelle. Deshalb stelle ich den Antrag, dass hinter dem Namen von Thomas Zeil der Zusatz „Dipl.-Theol.“ angefügt wird. Er hebt die Hand und fragt: Wer ist dafür?“
Zögerlich heben die evangelischen Kollegen nacheinander die Hand, ich enthalte mich der Stimme und somit wird dieser Kompromissvorschlag per Mehrheitsbeschluss von ihnen abgesegnet. Nach dieser Abstimmung frage ich mich, was wohl der eigentliche Grund dafür ist, dass sie meinen Wunsch nicht akzeptieren wollten. Weshalb sind sie so strikt dagegen, wenn ich meinen Studienabschluss in Theologie und meine psychotherapeutische Qualifikation meinem Namen hinzufügen möchte? Sind sie mir tatsächlich so neidisch, weil ich eben mehr zu bieten habe als sie? Befürchten sie, dass zu meinen Sprechstunden dann mehr Patienten kommen als zu ihren? Oder liegt es daran, dass sie über den gemeinsamen Anrufbeantworter und die vielen Telefonanrufe bereits mitbekommen haben, wie oft ich von vielen Patienten und vom Pflegepersonal gewünscht und zu einem Gespräch gerufen werde? Sind sie tatsächlich so neidisch, weil ich weitaus häufiger angefragt werde als sie? Ständig hocken sie doch in unserem gemeinsamen Seelsorgezimmer und bekommen mit, wenn ein Anruf für mich eingeht. Haben sie vor lauter Neid mich bei meinen Vorgesetzten deshalb madig gemacht, weil sie doch jederzeit am Telefon erreichbar sind, ich aber nicht? Und haben sie deshalb die Besuchswünsche der Patienten an mich nicht weitergegeben, damit ich sie nicht besuchen kann, so dass die Patienten und das Pflegepersonal von mir enttäuscht werden sollen? Dass so viel Neid und Missgunst im Spiel ist, hätte ich nie gedacht. Ist das wohl auch der Grund, weshalb ich von meinen Vorgesetzten nie unterstützt wurde? Sollen deshalb nur Priester, Pfarrer und Pfarrerinnen den Schutz und die Gunst der Vorgesetzten erhalten, damit sie als die „wahren Seelsorger“ zur Geltung kommen? Verweigern sie mir deshalb meinen Wunsch, meine Berufsabschlüsse öffentlich kund zu machen, um ihre Vorrangigkeit mir gegenüber abzusichern? Nie hätte ich gedacht, dass berufliche Qualifikationen in unserer Kirche so wenig gefragt sind. Obwohl mir meine Verwaltungsausbildung in vielen Bereichen schon oft von Nutzen war, wenn ich in Ludwigsburg mit dem Kirchenpfleger oder auch hier im Krankenhaus mit den Verwaltungsangestellten so einiges zu klären hatte, verzichte ich selbstverständlich darauf, auch diesen Berufsabschluss zu nennen. Und trotzdem, auch da könnte so mancher Patient sein Herz bei mir ausschütten, wenn er schlechte Erfahrungen mit Behörden machen musste und fachlichen Rat gebrauchen könnte. Auch hier könnte ich weitaus mehr bewirken als ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, die in solchen Fragestellungen lediglich liebevolle Gefühlsduseleien verabreichen können. Wie oft habe ich bei meinen Gesprächen mit so manchem Patienten ganz lapidare und alltägliche Probleme besprochen. Theologische Fragen sind ohnehin oft zweitrangig. Vielleicht werde ich auch deshalb von vielen Patienten und vom Pflegepersonal so akzeptiert, weil sie merken, dass sie mit mir über alles reden können und ich die Menschen nicht nur vom kirchlichen und theologischen Aspekt aus betrachte. Weil aber Stolzenburg und die evangelischen Kolleginnen vor Jahren beschlossen haben, alle Angelegenheiten der Klinikseelsorge im Katharinenhospital in „ökumenischem Sinne“ mit Mehrheitsbeschluss zu regeln, hatte ich als Einzelner nie eine Chance, andere Sichtweisen in diese Runde einzubringen.
Als ich wenige Tage später mit meinem Kollegen Paul die bevorstehende Patienten-Weihnachtsfeier bespreche, kommt er auf den Vorschlag der evangelischen Kollegin Koschinski zurück und meint, dass es doch durchaus sinnvoll sei, wenn er die Ansprache dieses Jahr übernehmen würde. Ich könnte ihm ja dann bei der Organisation etwas behilflich sein. Ich gebe ihm zu bedenken, dass durchaus viele Einzelheiten zu berücksichtigen seien und er doch erst einmal miterleben solle, wie die Weihnachtsfeier hier im Katharinenhospital vonstatten geht. Dann könne er ja beim nächsten mal diese Feier organisieren und die Ansprache übernehmen. Doch er bleibt stur. Obwohl er gar nicht weiß, wie diese Weihnachtsfeier hier abläuft und keine Ahnung davon hat, was alles getan werden muss, besteht er darauf, dass er diese Weihnachtsfeier gestalten will. Ich vermute, dass ihn die evangelischen Kolleginnen dazu aufgestachelt haben. Ohne lange zu zögern, gehe ich auf seinen Vorschlag ein und suche in meinem Aktenschrank die Faltblätter der vergangenen Jahre heraus, damit er ein ähnliches Programm zusammenstellen kann. Ich erkläre ihm, dass zuerst mit der Verwaltung ein Termin vereinbart werden müsse, um die Besucherhalle für diese Veranstaltung zu reservieren. Wenn dieser Termin festgelegt sei, müssen die Männer der Haustechnik benachrichtigt werden, damit sie die Übertragungsanlage, die Mikrofone und Verstärker installieren, das Klavier herbeischaffen und für die Bestuhlung sorgen können. Eine Musikgruppe oder ein kleiner Chor muss gesucht und engagiert werden, vom Pflegepersonal müssen zwei oder drei Leute angesprochen werden, die einen besinnlichen Text vortragen, und außerdem müssen der Verwaltungsdirektor und ein Chefarzt gebeten werden, eine Ansprache oder ein Grußwort zu sprechen. Angemessene Weihnachtslieder müssen herausgesucht und in den Programmverlauf integriert, sowie ein Bildmotiv für den zu erstellenden Flyer besorgt werden, damit dieses Faltblatt von der Verwaltung gedruckt und an die Patienten verteilt werden kann.
Da mein Kollege angesichts dieser vielfältigen organisatorischen Aufgaben sich überfordert zeigt, bittet er mich, ihm dabei zu helfen und diese Dinge zu erledigen, da ich ja schon wissen würde, an wen ich mich bei diesen verschiedenen Aufgaben wenden könnte. So bleibt mir also nichts anderes übrig, mehr oder weniger für ihn diese Weihnachtsfeier zu organisieren, damit er dann nur noch seine Ansprache halten kann.
In Absprache mit der Verwaltung lege ich den Termin auf Mittwoch, den 16. Dezember fest. Denn angeblich hat der Verwaltungsdirektor nur an diesem Tag Zeit, um an der Weihnachtsfeier teilzunehmen und seine Ansprache zu halten. Gleich danach hefte ich in unserem gemeinsamen Seelsorgezimmer einen Zettel mit diesem Termin ans Schwarze Brett, damit meine Kollegen und Kolleginnen möglichst frühzeitig darüber informiert sind und sich diesen Termin in ihrem Kalender vormerken können. Auf diese Weise bekommen alle nun mit, dass ich die Organisation dieser Feier übernommen habe. Sofort hat die Koschinski wieder etwas daran auszusetzen und heftet gleich darauf einen zweiter Zettel dazu, auf dem Folgendes steht:
„Ich finde es nicht gut, wenn der Termin für die Weihnachtsfeier ein Mittwoch, also Abendgebetstermin ist. In den Jahren zuvor gab es Donnerstag oder Dienstag auch schon genug Möglichkeiten. Neuester Stand, nachdem Verwaltungsdirektor Weiß am 15. Dezember nicht im Hause ist: Donnerstag 17. 12.!“
Da mir diese Terminverschiebung doch sehr sonderbar vorkommt, rufe ich die Chefsekretärin des Verwaltungsdirektors an, die mir sehr wohlgesonnen ist, und frage sie, wie es denn dazu kam, dass die Weihnachtsfeier nun am Donnerstag stattfindet, wo sie mir doch mitgeteilt habe, dass ihr Chef lediglich am Mittwoch Zeit habe? Sie klagt sofort:
„Oh je, Herr Zeil! Sie glauben es nicht! Ihre Kollegin Koschinski hat sich darüber empört, weil wir die Weihnachtsfeier auf Mittwoch gelegt haben. Da mittwochs immer im Andachtsraum das Abendgebet stattfinden würde, hat sie uns solange bekniet und mit uns herumgestritten, bis mein Chef dann schließlich nachgab und seinen Auswärtstermin verschoben hat. Er ist ja wirklich euch Krankenhausseelsorgern sehr wohlgesonnen! Aber über diese Pfarrerin hat er sich dann schon so ziemlich geärgert!“
Ich kann es nicht fassen. Nun hat doch tatsächlich die Koschinski sich hintenherum in meine Arbeit eingemischt und mit der Verwaltung einen anderen Termin ausgehandelt, weil sie das Abendgebet an diesem Mittwochabend absolut nicht ausfallen lassen wollte. Da zu diesem Abendgebet normalerweise höchstens ein oder zwei Patienten kommen, oft aber auch gar keiner anwesend ist, bin ich selbstverständlich auf den Vorschlag des Verwaltungsdirektors eingegangen, zumal er angeblich sehr unter Zeitdruck stand. Doch wenn dieser Koschinski etwas nicht passt, setzt sie ihren Willen unnachgiebig durch. Selbst der Verwaltungsdirektor des größten Krankenhauses von Stuttgart muss nach ihrer Pfeife tanzen! Ob sie allerdings ebenfalls so rigoros ihren Willen durchgesetzt hätte, wenn mein Kollege Paul diese Feier organisieren würde, ist fraglich. Vielleicht wollte sie mir nur wieder einmal zeigen, dass sie es sehr viel besser machen kann. Außerdem macht es ihr wohl besonders viel Spaß, in meine Arbeit hineinzuregieren und ständig an allem herumzukritisieren. Das alte Spiel geht unvermindert weiter! Alles, was ich mache, wird bemängelt und geändert.
Als ich Paul auf diese Terminänderung anspreche und ihn ironisch frage, ob denn nun die Kollegin Koschinski die Organisation der Weihnachtsfeier übernommen habe, zeigt er sich hilflos und meint, dass „man halt um des lieben Friedens willen“ nun mal ihr übereifriges Engagement doch ertragen müsse. Ich bekomme bei ihm den Eindruck, dass er es wohl für selbstverständlich erachtet, dass ich für ihn die zeitaufwändige Organisation der Weihnachtsfeier übernehmen soll und mir zusätzlich auch noch die Einmischung der evangelischen Kolleginnen gefallen lassen muss. Mehr und mehr fühle ich mich von ihm ausgenützt und spüre, dass er zwar ständig von mir meine loyale Zusammenarbeit einfordert, andererseits mich aber nie unterstützt oder verteidigt, wenn ich von den evangelischen Kolleginnen angefeindet und schikaniert werde. Und wenn ich ihn auf sein Verhalten anspreche, dass er doch ab und zu in solchen schwierigen Situationen Stellung für mich nehmen könnte, erwidert er jedes Mal:
„Ich möchte mich aus diesen Konflikten heraushalten. Das ist ganz Eure Sache, wie Ihr miteinander umgeht.“
Immer mehr stelle ich fest, dass er nichts, aber auch gar nichts für mich tun will und mich ständig im Regen stehen lässt. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich irgendwann einmal von ihm abserviert werde, wenn er sich hier im Katharinenhospital vollends eingearbeitet hat.
Kaum ist die Weihnachtsfeier vorbei, bringt in unserem ökumenischen Team die Kollegin Rallinger den Vorschlag ein, dass sie mit Paul zusammen auf allen Krankenstationen die Hinweisschilder der Krankenseelsorge neu gestalten möchte. Mich wundert, dass dieses Thema schon wieder behandelt werden soll, denn es ist gerade einmal zwei Monate her, dass diese Schilder im ganzen Haus neu gestaltet und ausgetauscht wurden. Doch inzwischen hat die Kollegin Rallinger in einem der umliegenden Krankenhäuser andere Hinweisschilder mit anderem Design gesehen, die ihr außerordentlich gut gefallen haben. Dieses Design möchte sie unbedingt übernehmen und neue Hinweisschilder drucken lassen. Mit Beschluss der Kollegen wird festgelegt, dass auf der nächsten gemeinsamen Teamsitzung die Gestaltung der neuen Schilder besprochen werden soll. Insgeheim bin ich total gegen diesen Vorschlag, halte mich aber bei der Debatte ganz zurück und enthalte mich meiner Stimme, als der Druck der neuen Hinweisschilder beschlossen wird. Schließlich will ich nicht als Einziger gegen die Initiative der Kollegen stimmen, auch wenn ich nicht einsehe, dass nach zwei Monaten schon wieder Geld für solch einen unnützen Firlefanz ausgegeben werden soll, der nur einen ungeheuren Arbeitsaufwand verursacht, jedoch für die Patienten und fürs Personal gar nichts bringt. Im Gegenteil! Wenn nun auch noch die Namen der einzelnen Klinikseelsorger auf diesen Schildern aufgeführt werden, dann müssen bei jedem Stellenwechsel eines Klinikseelsorgers sämtliche Hinweisschilder für die Stationen neu gedruckt und ausgetauscht werden. Der ganze Arbeitsaufwand kann dann jedes Mal wieder von Neuem beginnen.
Als wir jedoch zu diesem Punkt der Tagesordnung kommen, bei dem es darum geht, was genau auf den neuen Schildern aufgeführt werden soll, stellen die Kolleginnen Rallinger und Koschinski die einzelnen Vorschläge für die neuen Hinweisschilder vor. Als ich sie näher betrachte, muss ich nun allerdings feststellen, dass sie jetzt vorhaben, künftig auf den neuen Hinweisschildern nur die Namen der Pfarrer und Pfarrerinnen aufzuführen, nicht aber meinen Namen. Deshalb frage ich sie:
„Warum soll denn ich nicht mit meinem Namen auf diesen Schildern aufgeführt werden?“
Doch darauf bekomme ich gar keine Antwort. Ich schaue in die Runde. Betretenes Schweigen. Und nochmals frage ich sie:
„Warum soll denn mein Name auf diesen Schildern nicht aufgeführt werden? Warum sollen denn nur die Pfarrer und Pfarrerinnen genannt werden?“
Doch wieder bekomme ich keine Antwort. Alle schweigen, keine Reaktion. Ich muss tief durchatmen. Dann sage ich langsam und deutlich:
„Noch bin ich hier im Haus und bin von der Diözese hier als hauptamtlicher Klinikseelsorger angestellt. Daher erwarte ich auch, dass ich wie jeder andere auf diesen Schildern aufgeführt werde, ansonsten werde ich das Bischöfliche Ordinariat informieren.“
Betroffenes Schweigen steht im Raum, keiner wagt etwas zu sagen. Was mich bei dieser Vorgehensweise aber besonders ärgert, ist die Tatsache, dass mein Kollege Paul sich auch bei dieser Auseinandersetzung wiederum total zurückhält. Allzu deutlich kann ich aus seinem Verhalten entnehmen, dass er sich bereits im Vorfeld über diese Aktion mit den evangelischen Kolleginnen geeinigt hat und mich völlig ignorieren will. Mit seiner Zustimmung soll ich jetzt nicht einmal mehr auf den neuen Hinweisschildern erwähnt werden. Über diese niederträchtige und hinterhältige Vorgehensweise kann ich erneut nur meine eigenen Vermutungen anstellen. Eine ehrliche Antwort würde ich ja ohnehin nicht bekommen, wenn ich sie auf ihr erbärmliches Gebaren ansprechen würde. Da sie sich mittlerweile inzwischen in allem einig sind, wenn es um meine Person und meine Interessen geht, kann ich von ihnen wohl nichts mehr erwarten. Bei jedem Wunsch, bei jeder Berücksichtigung meiner Person habe ich nur neue Streitgespräche und neue Auseinandersetzungen, nur neuen Spott und Hohn zu erwarten. Ich frage mich, ob sie inzwischen sogar von meinem Vorgesetzten, Pfarrer Sauer, oder gar vom Bischöflichen Ordinariat bereits instruiert wurden und sie mich so behandeln sollen, als ob ich schon gar nicht mehr hier wäre? Vielleicht wird es ohnehin nur noch wenige Wochen dauern, bis ich vollends das Feld hier räumen muss? Es scheint jedenfalls so zu sein, als ob sie bereits fest damit rechnen könnten, dass ich nicht mehr lange hier arbeiten werde. Soll ich etwa deshalb auf den neuen Hinweisschildern nicht mehr aufgeführt werden? Doch andererseits, als ich damit gedroht habe, diesen Vorfall ans Bischöfliche Ordinariat zu melden, lenkten sie sofort ein. Was soll denn das nun bedeuten? Soll dieses Mobbing unvermindert so weitergehen? Und Paul hat bei diesem schändlichen Treiben bereits von Anfang an mitgemacht, will es aber nie zugeben! Welch ein hinterhältiges Intrigenspiel treibt er eigentlich mit mir? Fühlt er sich von mir denn nicht durchschaut? Fragen über Fragen türmen sich auf. Es ist zum Verrückt-werden! Doch jetzt, da sie anscheinend alle nicht wollen, dass ich meine Drohung wahrmache, geht es bei unserer Auseinandersetzung nur noch darum, wie und auf welche Weise ich auf diesen Schildern erwähnt werden soll. Die Kolleginnen und Kollegen sind sich einig, dass sie ihre Berufsbezeichnung Pfarrer beziehungsweise Pfarrerin zu ihrem Namen selbstverständlich hinzufügen. Mir aber wollen sie nicht zugestehen, dass ich zu meinem Namen irgendeine meiner beruflichen Qualifikationen hinzufügen darf. Wieder sind sie sich alle einig, dass nur sie als Pfarrerinnen und Pfarrer für die Klinikseelsorge relevant sind. Bei mir würde es völlig ausreichen, wenn auf dem Hinweisschild lediglich mein Name aufgeführt werde, mehr aber nicht. Doch ich bleibe stur und bin nicht damit einverstanden. Und wieder erkläre ich:
„Es ist doch sinnvoll, wenn die Leute auf dem Schild erkennen können, dass die katholische Kirche in der Krankenhausseelsorge neben einem Priester namens Paul Gegenfalz auch noch einen zweiten qualifizierten Mitarbeiter eingestellt hat. Jede Firma, die etwas auf sich hält, wirbt doch bei ihren Kunden damit, dass sie qualifiziertes Personal vorweisen kann, das übrigens auch teuer bezahlt werden muss. Und bei uns soll das verschwiegen werden, nur wie die Pfarrer und Pfarrerinnen das nicht wollen?“
Mein Argument wird von allen übergangen. Sie halten es nicht einmal für nötig, eine adäquates Gegenargument zu liefern, sondern lachen verächtlich über mich:
„So kann man es natürlich auch interpretieren! Du willst dich doch nur wichtig machen und so tun, als ob du hier etwas Besonderes wärst!“, giftet mich Rallinger wütend an. Und die Koschinski pflichtet ihr bei:
„Nein Herr Zeil, wir bestimmen hier alle gemeinsam mit Mehrheitsbeschluss, wie wir uns auf diesen Schildern präsentieren wollen. Und bei uns können Sie, Herr Zeil, nicht ihre Sonderwürstchen braten. Sie können hier nicht tun und lassen, was Sie wollen. Für die Klinikseelsorge sind vor allem wir Pfarrer und Pfarrerinnen zuständig und Sie haben sich uns zu fügen!“
Wiederum halten sich auch bei dieser Auseinandersetzung der Kollege Stolzenburg und mein katholischer Kollege Paul vornehm zurück. Sie überlassen es diesen „Kampfhennen“, mich zu malträtieren und lächerlich zu machen. Sie tun absolut nichts, wenn es darum geht, dass auch ich einen adäquaten Platz und Stellenwert hier im Kreise der Klinikseelsorger bekomme. Da ich aber standhaft bleibe und nicht nachgebe und erneut damit drohe, beim Bischöflichen Ordinariat eine schriftliche Auskunft einzuholen, ob ich meinen akademischen Titel und meine fachliche Qualifikation auf den Hinweisschildern anführen darf, lenkt Paul mal wieder ein und schlägt einen Kompromiss vor. Es ist derselbe Kompromiss, den wir bereits bei den Begrüßungskarten ausgehandelt haben. Somit darf ich lediglich den Titel „Diplom-Theologe“ als Berufsbezeichnung meinem Namen hinzufügen, mehr jedoch nicht. Obwohl ich es nicht einsehe, weshalb meine psychotherapeutische Ausbildung nicht ebenfalls genannt werden darf, stimme ich „um des lieben Friedens willen“ auch diesem Kompromiss wieder zu. Allerdings habe ich mal wieder deutlich zu spüren bekommen, dass Paul mich in meinen Auseinandersetzungen mit den evangelischen Kolleginnen nicht im Geringsten unterstützt. Er brachte seinen Kompromiss nur deshalb erneut ins Spiel, damit wir bei dieser langatmigen Streiterei endlich zu einem Abschluss kommen.
Unterschiedliche Behandlung
Wieder stehen in unserer Diözese die Wahlen für die MAV (Mitarbeitervertretungen) an, zu der alle Bediensteten vom Bischöflichen Ordinariat angeschrieben werden, um Kandidaten dafür zu suchen und vorzuschlagen. Mit meinem Kollegen Hans Fetzer vom Bürgerhospital und der Kollegin Dagmar Bauer-Stock vom Karl-Olga-Krankenhaus machte ich keine guten Erfahrungen, als ich sie wegen meiner Mobbing-Situation um ihre Unterstützung gebeten hatte. Ihr anbiederndes Verhalten bei Pfarrer Sauer, der sich selbst durch Intervention beim Stadtdekan Karst zu meinem Vorgesetzten erhob, ärgerte mich sehr. Da mir bekannt ist, dass die Sauer-Karner-Mürther-Clique auch anderen Kollegen ein Dorn im Auge ist, wurde ich sofort von mehreren Kollegen als Kandidat für diese Wahl vorgeschlagen und von ihnen unterstützt in der Hoffnung, dass durch mich diese Seilschaft Sauer-Karner-Mürther endlich zurückgedrängt werde. Meine Kandidatur wird meinem Vorgesetzten, Pfarrer Sauer und seiner gesamten Clique gewiss nicht gefallen. Doch da ich von mehreren Kollegen unterstützt werde, kann er nichts dagegen machen. Und siehe da, ich werde tatsächlich mit einer erstaunlich guten Stimmenzahl in diese Mitarbeitervertretung gewählt. Allerdings sind erneut die Kollegen Fetzer und Bauer-Stock in diesem Gremium vertreten, so dass ich mich auf so manch kontroverse Sichtweise der arbeitsrechtlichen Vorgängen einstellen muss. Ich gebe zu, dass ein weiterer Aspekt für mich eine wichtige Rolle spielte, mich in dieses Gremium wählen zu lassen. Es ist meine eigene Mobbing-Situation, die nun zunehmend prekärer wird. Da ich jetzt weiß, dass auch Paul die Intrigen und fiesen Attacken des Kollegen Stolzenburg und der evangelischen Kolleginnen unterstützt, und dies insgeheim wohl schon immer getan hat, muss ich nun alles unternehmen, mir meinen Arbeitsplatz zu erhalten. Denn seit den letzten Auseinandersetzungen fühle ich mich wie auf einem Schleudersitz, aus dem ich jederzeit herauskatapultiert werden könnte. Um dieser Gefahr einen Riegel vorzuschieben und selbst mehr Einfluss in arbeitsrechtliche Vorgänge zu gewinnen, habe ich die Wahl zur Mitarbeitervertretung angenommen. Zwar bin ich mir bewusst, dass einige Sitzungstermine auf mich zukommen werden, doch ich denke, dass diese sich durchaus bewältigen lassen, zumal sich mein neuer Priesterkollege Paul im Katharinenhospital inzwischen gut eingearbeitet hat.
Somit sitze ich im Gremium der MAV für die Klinikseelsorger, die von Hans Fetzer geleitet wird. Deutlich bekomme ich seine Abneigung und die der Kollegin Bauer-Stock zu spüren. Wie könnte es auch anders sein, sie fühlen sich in gewisser Weise von mir kontrolliert. Da ich aber nicht zur Seilschaft Sauer-Karner-Mürther gehöre, hatten sie nicht damit gerechnet, dass ich auf Anhieb mehr Stimmen bekam als sie und mit so großer Mehrheit in dieses Gremium gewählt wurde. Bald lerne ich bei diesen Sitzungen die Gepflogenheiten kennen, mit welchen Problemen und Anträgen sie konfrontiert werden und vor allem, welche Rechte sich diese Mitarbeitervertreter gegenüber ihren eigenen Vorgesetzten herausnehmen. Dabei bemerke ich, dass sie sich selbst an ihren Arbeitsplätzen wesentlich mehr Freiheiten genehmigen, als es mir meine Vorgesetzten im Katharinenhospital jemals zugestanden haben. So müssen sie sich in ihren Krankenhäusern keineswegs von ihren evangelischen Kollegen beaufsichtigen und bevormunden lassen, wie ich es mir seit meinem Dienstantritt im Katharinenhospital gefallen lassen musste. Auf einer der folgenden Sitzungen nehme ich die Gelegenheit wahr und spreche ganz offen diese überaus lästigen Bedingungen an, die mir Pfarrer Sauer auferlegt hatte, als Arno Rappe gestorben ist. Er hatte damals die Dienst- und Fachaufsicht, die ursprünglich Stadtdekan Karst von der Domgemeinde St. Eberhard über mich ausübte, regelwidrig auf sich übertragen lassen, weil ich damals durch einen Verleumdungsbrief des evangelischen Dekans Kumpf auf betreiben meiner evangelischen Kollegen diffamiert wurde. Daraufhin forderte Sauer von mir, dass ich meine Urlaubswünsche künftig bei folgenden Personen schriftlich einreichen muss:
beim Stadtdekan Karst, da meine Arbeitsstelle im Katharinenhospital zu seiner Pfarrei gehört,beim Dekan von St. Fidelis, der nach einer Umstrukturierung nun mein Vorgesetzter im Dekanat ist,bei meinem Priesterkollegen im Katharinenhospital, mit dem ich meinen Urlaub ohnehin absprechen muss,beim Personalreferat im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg undbei ihm selbst, Pfarrer Sauer, der als Vorsitzender unserer katholischen Klinikseelsorger informiert sein will, wenn ich im Katharinenhospital nicht anwesend bin.Sauer machte mir aufgrund des Verleumdungsbriefs des evangelischen Dekans schwere Vorwürfe, weil angeblich Beschwerden bei ihm eingegangen seien. Von wem diese Beschwerden kamen, sagte er nie. Strikt verlangte er von mir, seine Anordnung zu befolgen. Somit musste ich mich seinen Wünschen beugen und jedes Mal diese aufwändige Prozedur starten und an alle aufgeführten Personen einen Brief mit meinen Urlaubsmeldungen schreiben, obwohl dies weder in meiner Arbeitsumschreibung, noch aus sonstigen dienstrechtlichen Vorschriften herauszulesen war. Diesen Aufwand, jedes Mal für meine Urlaubsmeldungen fünf Briefe zu schreiben, wollte ich nicht mehr hinnehmen, zumal ich erkannt habe, wie bei meinen Kollegen in den anderen Krankenhäusern die Urlaubsmeldung geregelt ist. Sie müssen ihren Urlaub lediglich ihrem Dekan und dem Personalreferat im Bischöflichen Ordinariat melden, mehr jedoch nicht. Deshalb bringe ich auf einer unserer Sitzungen bei der Mitarbeitervertretung die Prozedur meiner Urlaubsmeldung auf die Tagesordnung, so dass sich nun auch meine MAV-Kollegen damit befassen müssen. Nachdem ich meine Situation geschildert habe, fassen sie den Beschluss, bei unserem Vorsitzenden der katholischen Klinikseelsorger, Pfarrer Rainer Sauer, diesbezüglich nachzuhaken und der Kollege Fetzer schreibt folgenden Brief:
Lieber Rainer,
eine Unklarheit ist aufgetaucht, die zu bereinigen uns als Mitarbeitervertreter wichtig erscheint und die Dich und eventuell auch andere Kollegen in der Funktion eines Inhabers des Klinikseelsorgepfarramtes betrifft. Nach Auskunft von Thomas Zeil wurde er schon vor längerer Zeit (ca. drei Jahren) von dir aufgefordert, Dir seinen Urlaub anzuzeigen, während zum Beispiel ich und meines Wissens auch andere Kollegen dies als Pflicht nur gegenüber dem Dekan als Dienstvorgesetzten haben und Dich lediglich im Rahmen einer internen Information über längere (Urlaubs-) Abwesenheiten benachrichtigen.
Da eine (dienstrechtliche) Regelung für alle gleich sein sollte, möchten wir Dich bitten, zu einer Klärung in dieser Sache beizutragen (eine schriftliche Anfrage und Antwort schiene dazu am hilfreichsten):
Gibt es für Thomas Zeil und/oder andere in dieser Frage der Urlaubsgenehmigung eigene Regelungen? Und wenn ja: welche Begründungen gibt es dafür?
Mit herzlichem Gruß, Hans Fetzer
Zur Kenntnis auch an das Bischöfliche Ordinariat, Personalreferat, P. Seiler
Zehn Tage später erhalte ich ein Schreiben vom Kollegen Fetzer mir folgendem Inhalt:
Lieber Thomas,
mein Schreiben an Rainer Sauer in Deiner Angelegenheit wirst Du erhalten haben – hier nun die Kopie von seiner Antwort:
keine Verpflichtung zur Urlaubsmeldung/-absprache/-genehmigung im dienstrechtlichen Sinne (dafür ist generell der Dekan zuständig)
lediglich eine Bitte zur Information im Blick auf die (nicht endgültig definierte) Aufgaben des Inhabers eines Klinikenpfarramtes für Koordination und Kooperation.
Warum dieser Punkt in der Vergangenheit unterschiedlich aufgefasst wurde und zu Dissens führte, ist für uns nicht zu klären; die Sachlage jedenfalls ist meines Erachtens mit der Antwort von Rainer Sauer geklärt, deinem Anliegen damit entsprochen und unsere Aufgabe – wie ich hoffe, zu Deiner Zufriedenheit – erfüllt.
Mit freundlichen Grüßen,
Hans Fetzer
Seinem Brief legt Fetzer eine Kopie das Antwortschreiben von Pfarrer Sauer bei, in dem es heißt:
Lieber Hans,
zur Klärung deiner Frage bezüglich Urlaubs-Mitteilung möchte ich folgendes bemerken:
Wie Du selber weißt, habe ich immer in Konferenzen wie auch in persönlichem Gespräch darum gebeten, mir den Urlaub mitzuteilen. Meine Begründung für diese Bitte ist, dass ich bei Anfragen, die ans Krankenhauspfarramt kommen, Auskunft geben kann, warum der jeweilige Krankenhausseelsorger nicht zu erreichen ist. Diese Anfragen kommen, obwohl ja eine Vertretung geregelt sein sollte. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass Urlaubsgesuche dem zuständigen Dekan eingereicht werden müssen.
Ich bin mir sicher, dass ich niemals diese Bitte als eine Dienstverpflichtung dargestellt und behandelt habe, auch Thomas Zeil gegenüber nicht. Ich kann mir nicht erklären, wie Thomas Zeil zu einer solchen Behauptung kommt. Zudem habe ich dies Thomas Zeil auch schon wiederholt deutlich dargelegt. Ich verstehe nicht, warum Thomas Zeil dies weiterhin nicht akzeptiert.
Es ist für mich selbstverständlich, dass eine dienstrechtliche Regelung entweder für alle oder für keinen zu gelten hat.
Ich hoffe, Deine Frage klar beantwortet zu haben und grüße Dich,
Rainer Sauer
Kopie zur Kenntnisnahme an:
Domdekan Bopp
Personalreferat, P. Seiler
Über diesen Brief kann ich nur lachen. Jedes Mal, wenn er mich erwähnt, nennt er meinen Vor- und Zunamen. Man kann buchstäblich aus diesem Schreiben herauslesen, wie er schäumt vor Wut. Mit einer sachlichen Klärung oder einer nüchternen Auseinandersetzung über einen strittigen Sachverhalt hat dieser Brief nichts zu tun. Im Gegenteil, er versucht jetzt im Nachhinein es so darzustellen, als ob er gar nichts damit zu tun hätte, dass ich an fünf verschiedene Personen meinen Urlaub melden muss. Er tut so, als ob ich selbst auf diese absurde Idee gekommen wäre! Dabei war es doch seine Anordnung, die er einführte, als Arno gestorben ist, so dass ich nun jedes Mal diese fünf Briefe schreiben muss, wenn ich ein paar Tage freinehmen oder Urlaub beantragen möchte. Diese Anordnung hat doch er getroffen, weil er ständig den hinterhältigen Verleumdungen meiner evangelischen Kollegen geglaubt hatte! Nach meiner telefonischen Rücksprache bei Referent Seiler im Bischöflichen Ordinariat, der mir dann auch noch bestätigt hatte, dass ich mich diesen Anordnungen von Sauer beugen müsse, habe ich mich zähneknirschend diesem dämlichen Schwachsinn dann beugen müssen! Auf solch eine bescheuerte Idee bin doch ich nicht gekommen! Sicherlich, weder in meiner Arbeitsumschreibung, noch in irgendwelchen anderen dienstrechtlichen Unterlagen ist festgelegt, dass ein kirchlicher Mitarbeiter an fünf verschiedene Dienststellen seinen Urlaub melden muss. Wenn ich aber von bösartigen und intriganten Kollegen heimlich angeschwärzt werde, die behaupten, dass ich unentschuldigt von meinem Dienst fernbleibe, so frage ich mich, ob solche Auflagen einfach zusätzlich verhängt werden können? Und da Sauer nie diese Denunzianten namentlich nannte und immer so getan hatte, als ob irgendwelche Patienten oder das Pflegepersonal sich über mich beschweren würden, musste ich diese Anordnung einfach akzeptieren. Auch Referent Seiler vom Personalreferat wollte mich von dieser schikanösen Auflage nie befreien! Auch er hat es nie für nötig befunden zu klären, wer mich ständig beschuldigt, dass ich angeblich unerlaubt von meinem Dienst fernbleiben würde. Wenn die eigenen Vorgesetzten gegen Lügen und Verleumdungen nicht einschreiten, kann jeder über einen unerwünschten Mitarbeiter herziehen und ihn verleumden. Und darf sich dabei sicher sein, dass er nie dafür zur Rechenschaft gezogen wird! Deshalb konnte Sauer auch meinen evangelischen Kolleginnen in allem entgegenkommen und ihnen ihre Schikanen gestatten, so dass sie mir meine Arbeit im Katharinenhospital zur Hölle machen konnten. Wie leicht hätte er ihr böses Gerede stoppen können, wenn er nur ein einziges Mal konkret nachgefragt hätte, wann ich meinen Dienst vernachlässigt oder unentschuldigt gefehlt habe. Da sie ihm aber nie eine konkrete Auskunft geben mussten, konnten sie ihre bösartigen Anschuldigungen endlos fortsetzen. Stattdessen hielt er diese Gerüchteküche absichtlich ständig am köcheln, denn dadurch konnte er seine eigene Unfähigkeit kaschieren und bezweckte zudem, dass mein Ruf vollends beschädigt wurde und auch er mit seinen ungerechtfertigten Beschuldigungen Recht behielt. Eigene Fehler zugeben oder seine eigene Meinung ändern und sich gar für sein konspiratives Verhalten entschuldigen, das kommt für einen Kleriker ohnehin nie in Frage! Da ein Einlenken von ihm nicht zu erwarten ist und ich in meinem Arbeitsumfeld bezüglich meiner Mobbing-Situation keine Veränderung erwarten kann, muss ich weiterhin davon ausgehen, dass Gerüchte über mich verbreitetet werden dürfen und niemand dagegen etwas unternehmen wird. Auch nach dem Dreiergespräch mit Domdekan Bopp ist nicht daran zu denken, dass eine Besserung in meiner Arbeitssituation eintreten wird, obwohl er in meiner Anwesenheit Pfarrer Sauer auf seine Versäumnisse angesprochen hatte.
Dass Sauer von seinem Antwortschreiben an Fetzer sogar zwei Kopien ans Bischöfliche Ordinariat sandte, nämlich an Domdekan Bopp und an Referent Seiler, zeigt, wie sehr er sich über mein Argument der Ungleichbehandlung geärgert haben muss. Weil Fetzer seine schriftliche Anfrage zusätzlich an Referent Seiler nach Rottenburg sandte, musste sich Sauer selbstverständlich auch ihm gegenüber mit einem Antwortschreiben verteidigen. Doch dass er außerdem auch noch den Domdekan Bopp über unsere erneute Zwistigkeit informierte, war völlig unnötig.
Im Grunde genommen wäre es von Fetzer gar nicht notwendig gewesen, auch das Bischöfliche Ordinariat über diese Angelegenheit zu informieren. Da aber Fetzer mit Sauer verbandelt ist, hat er diese Vorgehensweise sicherlich im Vorfeld mit ihm abgesprochen, um mich erneut als „Querulant“ im Bischöflichen Ordinariat in Misskredit zu bringen, denn mir ging es ja lediglich darum, meinen Urlaub nicht mehr an fünf verschiedene Stellen schriftlich melden zu müssen. Wie ich aber im Nachhinein feststellen muss, hat Fetzer dieses Problem in seinem Brief an Sauer gar nicht geschildert. Er fragte ihn lediglich, ob ich ihm als „Vorsitzender der Klinikseelsorger“ meine Urlaubsmeldungen schicken müsse. Die vier übrigen Dienststellen nannte er in seiner Anfrage nicht. Die Schikane und Ungleichbehandlung wurde somit gar nicht angesprochen.
Noch ein weiterer Aspekt könnte ebenfalls eine Rolle spielen, dass Fetzer kein Interesse hat, diese Ungleichbehandlung sachlich richtigzustellen. Als ich vor einigen Wochen bei einer Tagung der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse teilgenommen hatte, erfuhr ich von einer Teilnehmerin, dass Fetzer die Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse begonnen hatte, aber nach einiger Zeit aufgab und nicht zu Ende führte. Ob ihm diese Ausbildung zu anstrengend war oder ob er die Prüfungen nicht schaffte, wusste sie nicht. Es kann durchaus sein, dass Fetzer mich wegen meiner psychotherapeutischen Ausbildung als Konkurrent betrachtet, jetzt um so mehr, seit ich mich in die MAV wählen ließ und er aufgrund seiner Nähe zur Sauer-Karner-Mürther-Clique bei vielen Kollegen an Glaubwürdigkeit eingebüßt hatte. Auf solche Neid-Aspekte zu achten, bin ich von meinem Naturell her gar nicht gewohnt. Erst eine Kollegin hatte mich vor Jahren auf den Aspekt des Neides aufmerksam gemacht, als sie mir von meinem Kollegen Karl Schmerl vom Krankenhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt erzählte, der mir sehr neidisch auf meine Dienststelle sei, weil er in einer Runde von Kollegen die Absicht geäußert habe, dass es sein Wunschtraum wäre, irgendwann einmal Klinikseelsorger im Katharinenhospital zu sein. Das wäre für ihn sozusagen die Spitze seiner Kariere. War Neid wohl auch der Grund, weshalb er in Heidelberg bei unserer Klinikseelsorger-Ausbildung so abfällig über mich redete? Jedenfalls scheint es so zu sein, dass ich allein aufgrund meines Arbeitsplatzes im Katharinenhospital keinen Mangel an missgünstigen und neidischen Kollegen habe. Und wie dieser Briefwechsel zwischen dem Kollegen Fetzer und Pfarrer Sauer mal wieder zeigt, wird jeder Wunsch, eine Erleichterung meiner Arbeitssituation herbeizuführen, sofort in völlig verdrehter Weise ans Bischöfliche Ordinariat weitergeleitet, um mich dort als unbequemen und streitsüchtigen Mitarbeiter darzustellen.
Jegliche Hoffnung schwindet
Die jahrelangen Intrigen, Anfeindungen und Verleumdungen, dazu noch das scheinheilige und heuchlerische Getue meiner Kolleginnen und Kollegen verbrämt mit ihrem pastoralen Gehabe, setzt mir ungemein zu. Wer nicht hinter diese Kulissen und Fassaden schauen kann, ist sicherlich der Auffassung, dass meine Kolleginnen und Kollegen sehr liebe und gutmütige Menschen sind, die keiner Fliege etwas zuleide tun können. Wie kaltblütig sie aber gegen andere vorgehen, wenn etwas nicht nach ihrem Willen geht, und wie rigoros sie jemanden abservieren und mundtot machen, habe ich nicht nur selbst, sondern auch bei anderen kirchlichen Mitarbeitern erlebt. Gerade weil ich in meinem beruflichen Umfeld so viele arglistige Kollegen kennengelernt habe, wurde mein Vertrauen in die kirchlichen Mitarbeiter aufs Gründlichste zerstört. Meine Zuversicht, dass ich an meinem Arbeitsplatz etwas zum Positiven verändern könnte, und meine Hoffnung auf eine unbeschwerte Zusammenarbeit mit ihnen sind mittlerweile auf den Nullpunkt gesunken. Die vielen Gespräche, die nicht enden wollende Suche nach Hilfe, Anerkennung und Erleichterung in meiner beruflichen Situation zehrt gewaltig an meinen Nerven. An einen ruhigen und erholsamen Schlaf ist nicht mehr zu denken. Meine Angst und Befürchtung, dass schon am nächsten Tag eine neue Attacke gegen mich geritten wird, hält mein Nervenkostüm pausenlos in Alarmbereitschaft und bei jedem Gespräch mit einem Kollegen oder gar mit einem Vorgesetzten gerate ich innerlich in Panik. Ständig befinde ich mich in einer „Hab-Acht-Stellung“, denn jeden Tag kann mich jemand beschuldigen und irgendein Versäumnis oder Versagen anlasten. Niemand wird mir beistehen und diese Lügner und Verleumder zur Verantwortung ziehen.
Dass ich psychisch am Ende und nur noch ein Schatten meiner Selbst bin, ist mir längst bewusst. Mit schweren Depressionen gehe ich zu meinem Hausarzt und schildere ihm meine Situation, ohne ihm die genauen Hintergründe zu erklären. Vermutlich könnte er auch gar nicht verstehen, dass es solche Schikanen und Mobbing-Situationen unter den kirchlichen Mitarbeitern gibt. Deshalb schildere ich ihm lediglich meine körperlichen Symptome, die ich auf meine große Arbeitsbelastung im Krankenhaus zurückführe. Er empfiehlt mir, unbedingt einige Wochen aus meinem Umfeld wegzugehen und eine Auszeit zu nehmen. Er verordnet mir eine Rehabilitationsmaßnahme in einer psychosomatischen Klinik, damit ich mich von diesen stressbedingten Einflüssen regenerieren kann. Notgedrungen stimme ich seinem Vorschlag zu, worauf er alles in die Wege leitet, mir diese Reha-Maßnahme zu ermöglichen.
Sämtliche Termine und alle anstehenden Patientengespräche versuche ich so bald wie möglich zu erledigen, damit ich für die nächsten sechs Wochen meine Arbeit im Katharinenhospital unterbrechen kann. Aufgrund meiner Trauerseminare und meiner Vorträge bei verschiedenen Bildungseinrichtungen werde ich oft von Menschen aufgesucht, die mit mir über ihre Probleme und über ihre unverarbeitete Trauer sprechen wollen. Da viele unter ihren Ängsten und depressiven Verstimmungen leiden und dafür viel zu wenige Therapieplätze vorhanden sind, bringe ich es kaum fertig, sie abzuweisen, wenn sie mich um einige Gesprächstermine bitten. Vor allem Teilnehmer, die mich in meinen Trauerseminaren näher kennengelernt haben, kann ich kaum abweisen oder vertrösten.