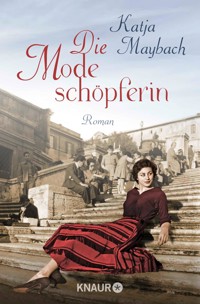6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine schicksalshafte Verbindung … Der Familiengeheimnisroman »Die Stunde der Schwestern« von Katja Maybach jetzt als eBook bei dotbooks. Als Christian Dior den New Chic erfand und Coco mit ihrem Chanel-Kostüm weltbekannt wurde … Im eleganten Paris der 50er Jahre war Fleur als Mannequin eine Berühmtheit – bis sie von einem Tag auf den anderen verschwand. Jahrzehnte später stößt die Pariser Modedesignerin Bérénice auf Fotos der faszinierenden Schönheit. Wie ist es möglich, dass sie Fleur wie aus dem Gesicht geschnitten ist? Bérénice beginnt, Nachforschungen über die vergessene Ikone ihrer Zeit anzustellen. So deckt sie nach und nach die Geschichte zweier Schwestern auf, die das Schicksal auseinandertrieb – und deren Liebe von dunklen Wolken der Eifersucht überschattet wurde … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der berührende Schicksalsroman »Die Stunde der Schwestern« von Katja Maybach. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Christian Dior den New Chic erfand und Coco mit ihrem Chanel-Kostüm weltbekannt wurde … Im eleganten Paris der 50er Jahre war Fleur als Mannequin eine Berühmtheit – bis sie von einem Tag auf den anderen verschwand. Jahrzehnte später stößt die Pariser Modedesignerin Bérénice auf Fotos der faszinierenden Schönheit. Wie ist es möglich, dass sie Fleur wie aus dem Gesicht geschnitten ist? Bérénice beginnt, Nachforschungen über die vergessene Ikone ihrer Zeit anzustellen. So deckt sie nach und nach die Geschichte zweier Schwestern auf, die das Schicksal auseinandertrieb – und deren Liebe von dunklen Wolken der Eifersucht überschattet wurde …
Über die Autorin:
Katja Maybach hat seit jeher zwei große Leidenschaften: das Schreiben und die Mode. Nach einer langen und bewegenden Karriere in der Modebranche, unter anderem in Paris, beschloss sie, ihre zweite Leidenschaft zum Beruf zu machen und begann, erfolgreich Romane zu schreiben. Sie hat zwei erwachsene Kinder und lebt heute in München.
Bei dotbooks veröffentlichte Katja Maybach:
»Melodie der Erinnerung«
»Das Haus unter den Zypressen«
»Der Duft von Rosenöl und Minze«
Die Website der Autorin: katja-maybach.de
Die Autorin im Internet: facebook.com/katja.maybach
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Copyright © der Originalausgabe 2012 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Magdalena Kowalik / Kuzmenko Viktoria photografer / Fab_1 / Olga Semenova / MM_Photos
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-428-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Stunde der Schwestern« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Katja Maybach
Die Stunde der Schwestern
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
April 2001Paris und Saint-Emile
Durch den schmalen Spalt der Schlafzimmertür beobachtete Hippolyte seine Frau, wie sie den Kopf ein wenig zur Seite neigte, um aus dem Fenster zu sehen. Müdigkeit und Erschöpfung zeigten sich auf Bérénice' schönem Gesicht, während sie einen Moment still zusah, wie sich der Morgenhimmel über den grauen Dächern von Paris zu einem dunstigen Gelb verfärbte.
Vielleicht dachte sie in diesem Moment an einen anderen Morgen, den auch Hippolyte niemals vergessen konnte. Der Tag, als der Mistral über die Hügel heraufwehte und den Duft der fernen Lavendelfelder herüberbrachte.
Es war der Morgen ihrer Hochzeit gewesen, als Bérénice mit dem Fahrrad den Weg durch die Weinberge herauffuhr. Unentschlossen war sie vor dem alten Steinhaus mit seinen hellblauen Fensterläden, dem Maison Bleue, stehen geblieben, verfangen in Zweifel, ob es richtig gewesen war, zu kommen. Sie hatte sich heimlich aus dem Haus ihrer Mutter geschlichen und war losgefahren, um ihren Verlobten vor der kirchlichen Trauung noch einmal schnell zu umarmen. Hippolyte hatte die ganze Nacht vor fieberhafter Erwartung nicht schlafen können und saß bereits seit der frühen Morgendämmerung unter dem alten Olivenbaum, der mit seinen knorrigen Ästen fast die ganze Vorderfront des Hauses verdeckte. Als er Bérénice im hellen Morgenlicht dort stehen sah, fing sein Herz an zu hämmern. Er war aufgesprungen und ihr mit offenen Armen entgegengelaufen, während der Wind heftig an seinen Haaren zerrte und ihm den Atem nahm.
Es war ein Moment vollkommenen Glücks gewesen, ein Augenblick, der die Erfüllung all seiner Träume in sich barg.
Hippolyte ließ sich zurück auf das weiche Kissen fallen und schloss die Augen. Vier Jahre waren vergangen, seit sie das Weingut La Maison Bleue verlassen mussten. Damals wollte Bérénice nach Paris, um hier ein neues Leben zu beginnen, weit weg von der Provence. War sie jetzt glücklich? In dieser lauten Stadt, die niemals schlief? Hippolyte wusste es nicht. In diesen vier Jahren, in denen sie sich mit ihren außergewöhnlichen Arbeiten in der Haute Couture zu etablieren suchte und oft die Nächte durcharbeiten musste, war er als Vertreter für südafrikanische Weine durch Frankreich gefahren, um Provisionen kämpfend, die oft gekürzt wurden, wenn ein Kunde nicht bezahlt hatte. War er dann für ein paar Tage zu Hause, redeten sie über Geldprobleme, ihre Miete, das geringe Honorar, das Bérénice in der Haute Couture verdiente. Der tägliche Kampf um die Existenz hatte sie beide ausgelaugt. Jeder war versunken in seinen Problemen, und es gab keine Zärtlichkeit, nur noch Schweigen und Fremdheit zwischen ihnen. Aber vielleicht wollten sie das auch nicht anders: nicht sprechen müssen über die Vergangenheit, über die Geschehnisse jener Nacht, die ihr Leben verändert hatte.
Hippolyte hörte, wie Bérénice sich erhob und die kleine Arbeitslampe auf dem Tisch ausknipste. Da stand er mit einem Ruck auf und trat aus dem Dunkel des Schlafzimmers hinaus seiner Frau entgegen.
»Ich muss mit dir reden.«
Doch als er in das blasse Gesicht von Bérénice sah, die sich fröstelnd den alten Bademantel um die Schultern zog, konnte er nicht mehr von seiner Einsamkeit sprechen, auch nicht über seine Sehnsucht nach der Stille der Weinberge, den intensiven Farben des Lavendels und den Sonnenblumen, über die sich der tiefblaue Himmel der Provence spannte. Wenn er als Kind den Hang hinter seinem Elternhaus hochgestiegen war, musste er sich einen schmalen Weg durch stachelige Brombeersträucher bahnen, begleitet von dem lauten Zirpen der Grillen und dem starken Duft nach Thymian und Basilikum, die im Garten seiner Mutter wuchsen. Diese Erinnerung nahm ihn immer mehr gefangen, ließ ihn nicht los, bis er vor einigen Tagen eine Entscheidung getroffen hatte.
Während seine Gedanken wieder abschweiften, wartete er auf eine Reaktion seiner Frau, vielleicht Interesse an seinen Plänen, Neugierde, was er mit ihr besprechen wollte. Doch Bérénice warf ihm nur einen flüchtigen Blick zu, griff sich den Karton, der auf dem Stuhl neben ihr bereitstand, und stellte ihn auf den Tisch. Vorsichtig schichtete sie die zarten Organzablüten hinein und bedeckte sie mit Seidenpapier. Ihre Stickereien waren kleine Kunstwerke. Dieses besondere Talent hatte sie von ihrer Mutter Denise geerbt, die ausgefallene Stickereien für die »Damen der Gesellschaft« der kleinen Stadt Saint-Emile anfertigte. Vor sechs Wochen hatte Bérénice den Auftrag des Couture-Hauses Maxime Malraux angenommen. Hippolyte wusste, dass sie nur bezahlt wurde, wenn ihre Arbeiten dem Designer gefielen.
»Soll ich dir einen Kaffee kochen?«, bot Hippolyte an, der plötzlich nicht mehr den Mut fand, über seine Entscheidung zu sprechen.
Bérénice schüttelte den Kopf und hastete in das Schlafzimmer. »Nein danke«, rief sie über die Schulter, »ich habe vor einer Stunde geduscht und schon gefrühstückt.«
Hippolyte antwortete nicht sofort. Er lehnte sich gegen den Türpfosten und sah seiner Frau zu, wie sie im Halbdunkel aus dem Bademantel schlüpfte, ihn auf das zerwühlte Bett warf und den schmalen Kleiderschrank öffnete. Das schwache Licht, das durch den Fensterladen hereindrang, gab ihrem blassen Gesicht einen schimmernden Reiz und umspielte die Konturen ihres schlanken Körpers. Rasch schlüpfte sie in ein schmales schwarzes Kleid und zog am Rücken den Reißverschluss hoch. Sie trug es, wenn sie in die Modehäuser ging, um ihre Arbeiten abzuliefern. Schwarz war die Farbe der internationalen Modeszene. Bérénice lief in das angrenzende kleine Badezimmer, fuhr sich mit der Hand schnell durch die kurzen dunklen Haare, legte etwas Rouge auf und zog mit einem tiefroten Stift ihre vollen Lippen nach. Dann kam sie zurück und griff hastig nach ihrer Handtasche und dem großen Karton. Wieder spürte Hippolyte, wie ihr ganzes Wesen von ihm fortstrebte.
»Warum?« Er lief ihr nach, packte sie und grub seine Finger in ihren Oberarm. Bérénice blieb ruhig stehen, und so ließ er sie wieder los. »Ich weiß, ich bin schuld, ich weiß, ich hätte damals in dieser Nacht nicht nach Saint-Emile in die Kneipe gehen und unser Weingut verspielen dürfen. Ich weiß, ich hätte mich nicht betrinken sollen, und ich weiß auch, ich bin schuld, dass du in dieser Nacht ...«
Jedes »weiß« betonte er, und beim letzten Satz verlor er die Beherrschung und schrie seiner Frau das Wort ins Gesicht. Doch als Bérénice stumm blieb und nichts erwiderte, brach er den Satz abrupt ab und fuhr sich resigniert mit der Hand übers Gesicht. Für einen Moment zögerte Bérénice, dann wandte sie sich ab und öffnete die Wohnungstür. Doch Hippolyte stellte ihr noch eine letzte Frage, jene Frage, die ihn seit vier Jahren quälte: »Du kannst mir immer noch nicht verzeihen, nicht wahr?«
Ohne sich nach ihrem Mann umzudrehen, antwortete Bérénice leise: »Nein, Hippolyte, nein, ich denke, das kann ich nicht.«
Tiefe Hoffnungslosigkeit stand zwischen ihnen, bis Bérénice die Wohnung verließ und geräuschlos die Tür hinter sich zuzog.
***
»Wo ist sie, wo sind die Blumen? Wieso ist diese Frau noch nicht da? Hat sie verschlafen, hat man ihr nicht gesagt, dass ich die Blüten jetzt brauche, jetzt, sofort und nicht irgendwann, wenn es dieser Frau passt?«
Als Bérénice die Stufen hinaufhastete, hörte sie bereits im Treppenhaus die männliche Stimme, die sich ungehalten über sie ausließ. Das musste Maxime Malraux sein, der legendäre Designer, den sie nur von Fotos kannte, denn sonst übergab sie am Empfang ihre Arbeiten einer Mitarbeiterin des Couturiers. Heute aber hatte sie sich verspätet, so hatte man sie hinauf ins »Allerheiligste«, das Atelier des Meisters, geschickt.
»Entschuldigen Sie!«
Außer Atem betrat Bérénice den hellen Raum mit seinen hohen Fenstern, den langen Arbeitstischen und den vielen Wandspiegeln. Hier stand Maxime Malraux, klein und zierlich zwischen Stoffrollen, Kleiderpuppen, Skizzen und Fotos. Alle Augen waren auf Bérénice gerichtet, und ihr Gruß wurde kaum erwidert. Schweigend beobachtete man, wie sie den Karton auf den nächststehenden Tisch schob, den Deckel öffnete und jede einzelne Blüte vorsichtig herausnahm. Jemand war ihr gefolgt, und als sie sich überrascht umsah, stand Maxime dicht hinter ihr. Seine dunklen Augen, umrandet von einem dezenten Lidstrich, weiteten sich in fassungslosem Staunen, als er jetzt so nahe vor ihr stand.
Bérénice fühlte sich unbehaglich und entfernte sich mit einem kleinen Schritt möglichst unauffällig von ihm, während sie ihre Blüten auf dem Tisch ausbreitete. Sie spürte seinen intensiven Blick, der sie nicht loslassen wollte, und sie erschrak über die Blässe seines Gesichts und die Starrheit seines Blicks. Steif und mit einer langsamen Bewegung streckte er ihr die Hand entgegen, die sie nur zögernd nahm.
»Wie heißen Sie?«
Seine Stimme klang heiser, und Bérénice bemerkte, dass die Mitarbeiter das Benehmen des Designers ungewöhnlich fanden und ihn befremdet beobachteten. »Bérénice Mouret. Ich arbeite seit vier Jahren für Ihr Haus.« Sie wurde unruhig. Was wollte er von ihr?
»Ich weiß, ich weiß«, murmelte er. »Ich bewundere jedes Mal Ihre Arbeiten, sie entsprechen genau meinen Visionen. Aber sagen Sie … Bérénice, wo kommen Sie her? Sind Sie in Paris aufgewachsen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich komme aus Saint-Emile, einer kleinen Stadt in der Provence. Warum wollen Sie das wissen?«
»Saint-Emile«, wiederholte er nervös, ohne auf ihre Frage einzugehen. »Saint-Emile, ja, ja … genau. Wie ist Ihr Mädchenname?«
»Vanessa ist hier.« Die Stimme von Raul, Maximes Assistenten, überschlug sich fast. »Sie hat nur zwei Stunden Zeit, dann muss sie zum Flughafen. Bitte, Maxime, wir müssen die Anprobe mit ihr machen.«
Mit einer Handbewegung brachte Maxime seinen Assistenten zum Schweigen.
»Aubry«, antwortete Bérénice, die auf seine Frage einging, um den launischen Designer nicht zu verärgern, der nervös mit einer der Organzablüten herumspielte. Bérénice spürte, dass ihn etwas beschäftigte und völlig aus der Fassung gebracht hatte …
»Fleur«, flüsterte er, »Fleur …«, und sah sie an.
»Maxime, bitte!« Rauls Stimme kletterte die Skala der Hysterie ganz nach oben, doch der Designer beachtete ihn nicht.
»Wunderschön, ich habe mich schon oft gefragt, wer diese Künstlerin ist, die solche kleinen Meisterwerke kreiert.« Malraux' Hände zitterten, und in Gedanken schien er weit fort zu sein. Immer noch drehte er eine der Blüten in seiner Hand und zerrte nervös an den winzigen kleinen Perlen, mit denen sie besetzt war. Abrupt hob er den Kopf. »Nun, meine liebe Bérénice Mouret, Sie werden es nicht bereuen, für mich zu arbeiten, das verspreche ich Ihnen.«
»Maxime! Bitte!«
Jetzt löste sich der Designer vom Tisch und ging zu den Wartenden, und Bérénice begriff, dass sie entlassen war. Keiner beachtete sie mehr, alle scharten sich um das Model Vanessa, das in der Mitte des Raums stand und in ein schwarzes Abendkleid aus zartem Chiffon schlüpfte, an das Camilla, die langjährige Chefdirektrice des Hauses Malraux, die Organzablüten befestigte.
Unter der Tür drehte sich Bérénice rasch noch einmal um und fing einen nachdenklichen Blick von Maxime auf. Doch als sie ihm zum Abschied zunicken wollte, wandte er sich rasch ab.
Sie werden es nicht bereuen … Malraux' Worte gingen Bérénice nicht aus dem Kopf, während sie langsam die Treppe hinunterging. Was hatte dieser launische Künstler, der längst den Zenit seiner Karriere überschritten hatte, damit gemeint? Was würde sie nicht bereuen?
***
»Hippolyte?«
Als es still blieb, schlüpfte Bérénice rasch aus ihren hohen Schuhen, lief durch den Wohnraum und stieß die Tür zum Schlafzimmer auf.
»Hallo?«
Ungläubig stellte sie fest, dass sämtliche Sachen ihres Mannes fehlten. Die Tür seines Schranks stand weit offen, er war komplett leer, auch sein Koffer und die große Leinentasche fehlten. Bérénice versuchte, durchzuatmen und sich zu beruhigen. Noch am Morgen hatte Hippolyte das Gespräch mit ihr gesucht, doch sie hatte ihn abgewehrt. Aber musste er nicht wissen, wie sehr sie unter Druck gestanden hatte? Hippolyte hatte seinen Job vor zwei Wochen aufgegeben und mehrmals von Plänen gesprochen, die noch nicht wirklich spruchreif seien. Ratlos sank Bérénice auf das breite Bett und schob den achtlos hingeworfenen Bademantel zur Seite. Dabei erfühlte sie ein Kuvert. Verwundert ergriff sie es, doch ihre Hand fing an zu zittern, und ihr Herz raste. Reglos blieb sie sitzen, ahnte bereits, was Hippolyte ihr geschrieben hatte. Er zog die Konsequenz aus ihrer Unversöhnlichkeit, setzte einer quälenden Ehe ein Ende. Lange sah sie auf den Brief hinunter, drehte und wendete ihn zwischen ihren Fingern, bis sie ihn mit einem Ruck öffnete.
Ma chère Bérénice,nie sind wir glücklich geworden in Paris, der Stadt, der ich nichts abgewinnen konnte und die mir und uns keinen Segen brachte.
Vor einer Woche habe ich mit meinem alten Freund Bernard gesprochen. Er hat mir erzählt, dass das Weingut, unser Maison Bleue, zum Verkauf steht. Du weißt, Bernard ist inzwischen Leiter der größten Bank in Saint-Emile, und er gibt mir einen Kredit, damit ich das Gut zurückkaufen kann. Es scheint ziemlich heruntergewirtschaftet zu sein, doch ich bin überzeugt, ich kann es schaffen. Darin sehe ich die Aufgabe meines Lebens.
Bérénice, heute Morgen wollte ich Dich fragen, ob Du mit mir gehen willst. Aber Deine Ablehnung mir gegenüber hat mir gezeigt, dass diese Frage sich erübrigt hat.
Liebe kann verzeihen, doch Du konntest es nicht.
Also habe ich endlich den Mut gefunden zu erkennen, dass unsere Liebe vorbei ist und dass ich allein gehen muss.Hippolyte
Bérénice ließ sich langsam auf die Kissen zurückfallen, den Brief an sich gepresst. Hippolyte hatte sie verlassen. Während ihrer Abwesenheit hatte er sich heimlich, still und leise davongeschlichen. Doch Bérénice empfand nichts, gar nichts. Wut oder Schmerz wollten sich nicht einstellen. Sie war einfach nur müde nach der schlaflosen Nacht, in der sie durchgearbeitet hatte. Sie horchte der Stille in der Wohnung nach, lauschte angestrengt auf den Lärm, der gedämpft von der Straße herauf bis zum vierten Stock drang. Irgendwann läutete das Telefon, dann wurde es wieder still, bis es erneut anfing und so lange klingelte, bis Bérénice mit müder Hand nach dem Hörer griff.
Sie war enttäuscht, dass es nicht Hippolyte war, sondern ein Henri Meyer aus der Vertragsabteilung von Maxime Malraux:
»Monsieur möchte Ihnen ein Angebot machen, sind Sie daran interessiert?«
»Was für ein Angebot?« Bérénice verstand nicht.
»Monsieur schlägt Ihnen einen festen Vertrag vor. Sie bekommen ein eigenes Atelier in unserem Haus mit mehreren Stickerinnen, die für Sie arbeiten werden. Das Gehalt ist sehr großzügig, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben«, fügte Henri Meyer hinzu, da Bérénice, völlig überrumpelt von diesem Vorschlag, schwieg. Seit vier Jahren arbeitete sie für den Designer, bekam wenig Geld und erntete kaum Anerkennung.
»Wieso so plötzlich?«, fragte sie misstrauisch, sie konnte es nicht begreifen. Heute Morgen war sie Maxime Malraux zum ersten Mal begegnet, und schon bekam sie ein lukratives Angebot. »Wieso? Ich verstehe es einfach nicht.« Noch während sie dies sagte, wurde ihr plötzlich klar, was das bedeutete: keine Existenzsorgen mehr, keine Angst, wenn der Monat zu Ende ging und sie sich fragen musste, ob das Geld für die nächste Miete reichte.
Meyers Stimme klang ein wenig genervt, als sie so zögernd reagierte. »Wahrscheinlich haben Sie Monsieur heute mit Ihrer Arbeit so überzeugt, dass er Ihnen dieses Angebot macht. Er sagte, dass er es Ihnen gegenüber bereits erwähnt habe. Wir schicken Ihnen in den nächsten Tagen einen Vertragsentwurf zu. Sie können sehr zufrieden sein, so ein großzügiges Angebot macht Maxime Malraux selten. Ehrlich gestanden, habe ich einen solchen Vertrag noch nie aufgesetzt, und ich arbeite bereits seit fünfzehn Jahren für ihn.«
»Ja natürlich, danke. Ich freue mich.« Bérénice blieb einsilbig, und als sich Henri Meyer schon längst verabschiedet und aufgelegt hatte, saß sie noch immer auf dem Bett, den Hörer in der Hand.
Irgendwann erhob sie sich endlich und schlüpfte aus ihrem Kleid, brühte sich in der Küche einen Tee auf, stellte Kanne und Tasse auf ein Tablett und ging damit ins Wohnzimmer. Als sie sich aufs Sofa setzte, spürte sie, wie müde sie war. Eingehüllt in ihre warme Decke, dämmerte sie in einen leichten Schlaf hinüber, doch immer wieder schreckte sie hoch, da sie glaubte, Hippolyte sei zurückgekommen.
Und so verstrich langsam der Tag. Es wurde Abend, und Bérénice hatte nicht die Kraft, den Arm auszustrecken und die Lampe neben dem Sofa anzuknipsen. So kam der Moment, in dem der Schmerz sie überwältigte. Heftiger, durchdringender, als sie erwartet hatte.
Erneut klingelte das Telefon, und wieder ließ sie es lange läuten, bis sie endlich abhob. Es war ihre Mutter Denise, und Bérénice unterdrückte den Impuls, einfach aufzulegen.
»Maman? Was gibt's?«
»Was es gibt?«, wiederholte Denise. »Seit Wochen höre ich nichts von dir, und du fragst mich, was es gibt?« Vorwurf schwang in Denise' Stimme mit. »Ist irgendetwas passiert, das ich wissen sollte?«
Von einer Sekunde zur anderen entschied sich Bérénice, nichts von Hippolyte zu erzählen, und so berichtete sie über das Angebot von Maxime Malraux. »Er ist einer der berühmtesten Designer Europas«, setzte sie erklärend hinzu.
»Maxime Malraux?« Denise wiederholte den Namen, während sie jede Silbe, schwer atmend, langsam betonte.
»Maman?«, rief Bérénice besorgt in den Hörer. »Geht es dir gut?«
»Natürlich. Wieso sollte es mir schlechtgehen?« Die Antwort ihrer Mutter klang gereizt und aufgeregt. »Ich bin nur erstaunt, nichts weiter. Ich wusste nicht, dass du für ihn arbeitest.«
»Doch, ich habe es dir irgendwann einmal erzählt.« Bérénice versuchte, sich zu beherrschen. Wie so oft geriet sie bei ihrer Mutter in die schwächere Position und hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen.
»Nein, nein Bérénice, das hast du mir nie gesagt. Du hast andere Namen genannt. Chanel, Lanvin, aber Malraux …«
»Maman«, unterbrach Bérénice ihre aufgeregte Mutter. »Was ist denn los? Für dich spielt es doch keine Rolle, für wen ich arbeite. Vielleicht habe ich den Namen wirklich nicht erwähnt, aber du kennst die Modemacher doch nur aus den Zeitungen.«
»Und?«, fragte Denise nach einer kleinen Pause, in der sie sich offenbar beruhigt hatte. »Wie sieht das Angebot aus?«
Bérénice erzählte von dem lukrativen Vertrag, dem eigenen Atelier im Hause Malraux. Doch sie hatte das Gefühl, ihre Mutter hörte ihr kaum zu. »Freust du dich nicht für mich?«, fragte sie gereizt.
»Doch, doch natürlich. Dann hast du wenigstens finanziell ausgesorgt. Was sagt Hippolyte dazu?«
»Er ist nicht da, er weiß es noch nicht«, erwiderte Bérénice wahrheitsgemäß.
»Ach so, ja … ja … Aber wieso hat dir Malraux auf einmal dieses Angebot gemacht? Ist irgendetwas passiert?«
Bérénice hörte das Misstrauen in der Stimme ihrer Mutter.
»Ich weiß es nicht. Obwohl ich seit vier Jahren für das Haus Malraux arbeite, habe ich ihn erst heute kennengelernt. Es war irgendwie eigenartig. Als er mich sah, wurde er blass und nannte mich … »Bérénice überlegte, bis ihr der Name wieder einfiel. »Fleur. Ja, er sagte: ›Fleur‹, und er wollte alles genau wissen, woher ich komme, wie mein Mädchenname ist und …«
Aus dem Hörer drang ein gurgelnder Laut, dann war wieder ein schweres Atmen zu hören. Bérénice wartete besorgt, bis sich Denise offenbar wieder beruhigt hatte und gleichgültig meinte, der Designer habe sie sicher mit jemandem verwechselt, der ihr ähnlich sehe, schließlich habe er tagtäglich mit Frauen zu tun, und der Jüngste sei er wohl auch nicht mehr. »Bérénice, ich muss jetzt Schluss machen, meine Ratatouille brennt an. Salut!«
Denise beendete das Gespräch eilig, und langsam legte Bérénice auf. Die Reaktion ihrer Mutter auf Maxime Malraux war seltsam. Aber vielleicht ging es Denise einfach nicht so gut. Hatte sie nicht neulich über Herzbeschwerden geklagt? Es war jetzt dunkel in der Wohnung, doch Bérénice machte kein Licht an, sondern rollte sich auf dem Sofa zusammen, zog die Decke hoch und vergrub ihr Gesicht in den Kissen. Sie vermisste Hippolyte, sie sehnte sich nach ihm, und sie bereute, dass sie so unversöhnlich geblieben war. Konnte sie ihm wirklich nicht verzeihen, nach all diesen Jahren? Liebe kann verzeihen …, hatte er geschrieben. Sie hatte es nicht gekonnt.
War ihre Liebe so wenig wert gewesen?
***
In Saint-Emile stand Denise Aubry-Déschartes reglos in ihrer Diele, noch lange, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte. Mit beiden Händen umschloss sie ihre Kehle, um das trockene Schluchzen zu unterdrücken, das ihren ganzen Körper erbeben ließ und nicht aufhören wollte, auch als sie sich gegen die Wand lehnte und versuchte, ihren Atem wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Spiegel auf der anderen Seite warf ihr das Bild einer alten Frau zurück, mit rot gefärbten Haaren, einem verzerrten blassen Gesicht und weit aufgerissenen Augen. Einmal hatte es ja kommen müssen! Sie hatte es immer gewusst. Irgendwann, aber doch nicht jetzt! Irgendwann einmal, vielleicht ... Bérénice hatte eine Spur in die Vergangenheit entdeckt. Sie war arglos, aber wie lange noch? Denise hatte jedes Gefühl für Zeit verloren, bis sie endlich ihre Hände sinken ließ, frei atmen konnte und dann langsam in die Küche ging, um den Topf mit der angebrannten Ratatouille vom Herd zu ziehen. Was sollte sie tun, wer konnte ihr helfen, was sollte sie ihrer Tochter sagen?
Nach einer Weile gab sie sich einen Ruck, verließ die Küche und stieg, vorsichtig auf ihr steifes Bein achtend, die Wendeltreppe hinunter, die direkt in ihre Schneiderei führte.
Am Nachmittag hatte sie das grüne Taftkleid auf den Ständer gehängt, das sie heute Abend noch bügeln wollte. Die Frau des Arztes Julien Devereux hatte es in Auftrag gegeben, um es bei der Hochzeit ihrer Tochter zu tragen. Auf dem langen Zuschneidetisch lag die Rolle mit der kostbaren weißen Spitze, aus der Denise das Brautkleid für die Arzttochter zuschneiden wollte. Eine Familie, beliebt und angesehen in der Stadt, ohne Sorgen, ohne schreckliche Geheimnisse. So hatte sie sich vor Jahren ihre Ehe und ihr Leben vorgestellt, als sie Etienne Aubry, den reichen und geachteten Apotheker heiratete. Doch es war anders gekommen. Auch jetzt noch, mit sechsundsechzig Jahren, musste sie sich ihr Geld mühsam verdienen, indem sie für andere Frauen nähte, stickte und ausbesserte.
Denise schlüpfte in ihren dunklen Mantel, der über einem Stuhl hing, und ließ ihren Blick achtlos durch den Raum schweifen. Gleichgültig stellte sie fest, dass die Farbe an den dunkelroten Wänden bereits abblätterte und in den barocken kleinen Wandleuchten zwei Glühbirnen fehlten. Hier war sie aufgewachsen, zwischen Stoffrollen, Schnittmustern und Schachteln voller Knöpfe, bei ihrer Mutter Joselle, die auch schon für die »Damen der Gesellschaft« von Saint-Emile nähte. Und hier hatte sie nach der Scheidung ihre geliebte Tochter Bérénice großgezogen.
Denise griff sich ans Herz, das nicht aufhören wollte, hart und heftig zu schlagen. Dann verließ sie entschlossen das Haus und sperrte hinter sich die Eingangstür zu. Die enge Rue Boursicault mit ihren niedrigen weißen Häusern war wie ausgestorben, und Denise' Schritte verlangsamten sich, je näher sie der Place de la Victoire kam. Seit Jahren mied sie diesen kleinen runden Platz mit dem gotischen Rathaus, dem schmalen hohen Haus der Apotheke, dem Hotel Excelsior und dem alten Juweliergeschäft, in dem man seine Eheringe bestellte und das Tafelsilber putzen ließ. Denise ging am Café La Danseuse mit seiner roten Markise vorbei, das bereits geschlossen hatte. Sie warf einen flüchtigen Blick auf das Schaufenster und erinnerte sich an den Duft von Biskuits, frischen Brioches und Schokoladenkuchen, als sie vor vielen Jahren jeden Samstag hier eine Torte gekauft hatte. Sie sah einige Leute, die in die Rue de la Galérie einbogen, um in die alte Rathauskneipe Cochon d'Or zu gehen. An den Samstagen kamen die Männer aus den Weinbergen in die Stadt herunter, verbrachten den Abend in der Gaststube, tranken ihren Pastis und fachsimpelten über die Trauben, das Wetter und den Mistral. In dieser Kneipe hatte Hippolyte vor vier Jahren gesessen und das Weingut seiner Eltern verspielt.
Schritt für Schritt näherte sich Denise der Apotheke. Es musste schon spät sein, da der Platz ausgestorben dalag, doch in der Apotheke brannte noch Licht, und so drückte Denise die Türklinke hinunter und betrat den Raum.
Nichts hatte sich verändert. Die hohen Regale standen an den mit dunklem Holz vertäfelten Wänden, davor die Medikamentenschränke mit den vielen kleinen Schubladen. Auch die weißen Porzellandosen, gefüllt mit Heilkräutern aus der Gegend, hatten ihren Platz immer noch auf der langen Theke. Dahinter stand Etienne Aubry, über die Waage aus Messing gebeugt, und war dabei, eine kleine braune Tüte mit Lavendelblüten zu füllen. Ein alter Mann in einem weißen Kittel, mit einem grauen, ungepflegt wirkenden Bart. Als sich die Tür öffnete, sah er hoch und starrte Denise aus ungläubigen Augen entgegen, während sie sich am Geländer festhielt und die drei Stufen herunterkam.
»Guten Abend.« Denise' Stimme klang hoch und ängstlich wie die eines Kindes.
»Was willst du?«, fragte Etienne schroff, kniff die Augen zusammen und schob die kleine Brille auf die Stirn. Dabei fiel ihm die Tüte mit den Lavendelblüten aus der zitternden Hand.
»Wir sind uns seit Jahren aus dem Weg gegangen«, begann Denise umständlich. »Ich glaube, es ist Zeit, dass wir miteinander reden.«
»Das glaube ich kaum«, wies der Apotheker ihren Vorschlag hart zurück. »Ich wüsste auch nicht, worüber.«
Denise' Mund war ausgetrocknet, sie hatte das Gefühl, ihr würden die Sinne schwinden und sie müsse ohnmächtig auf den harten Holzboden fallen. Aus ihrem Kopf wich jeder Gedanke, jedes Wort, das sie sagen wollte. Etienne beobachtete sie, jede kleinste Bewegung. Sie krampfte ihre Hände um die Handtasche, die sie wie zum Schutz gegen die Brust gepresst hielt. Mit jedem Atemzug sog sie den Geruch der Vergangenheit ein, den Geruch nach altem Holz und Kräutern. Er erinnerte sie an den Tag, als sie zum ersten Mal diesen Raum betreten hatte und dieser Geruch ihr eine grässliche Übelkeit verursachte. Wie hatte sie ihn und dieses Haus gehasst, und wie sehr hatte sie im Laufe ihrer Ehe gelernt, Etienne zu hassen ...
»Bérénice hat angerufen.« Nur mit größter Mühe brachte sie die Worte über die Lippen, bereits in der Gewissheit, einen Fehler zu machen. Sie hätte nicht kommen dürfen.
»Und? Was habe ich damit zu tun?«
»Sie hat eine Anstellung bei Maxime Malraux, und er nannte sie ... er nannte sie ... Fleur!«
»Irgendwann wird Bérénice es herausfinden, es war immer nur eine Frage der Zeit. Aber das interessiert mich nicht, nicht mehr. Und das weißt du auch. Also, komm nie wieder hierher! Ich sage dir: nie wieder.« Etiennes Gesicht verzerrte sich, und in Denise stieg die alte peinigende Angst wieder hoch.
»Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll.«
Während Denise den Satz aussprach, spürte sie, dass Etiennes Verbitterung genauso tief saß wie vor Jahren. Beharrlich schwieg er, und beharrlich verweigerte er ihr jede Hilfe. In feindseligem Schweigen sah er sie an, doch in seinem Blick erkannte Denise eine gewisse Bewunderung für ihren Mut, gekommen zu sein. Trotzdem wusste sie, dass er niemals aufhören würde, sie zu verachten. Doch konnte sie vergessen, was er ihr angetan hatte? Auch ihr Hass gegen ihn schien grenzenlos, und auch ihre Haltung blieb unversöhnlich.
Die Vergangenheit ließ sich nicht auslöschen, die Erinnerung kam zurück, die Schuld blieb ungesühnt. So drehte Denise sich wortlos um und verließ unter dem heiteren Gebimmel der Türglocke die Apotheke.
Etienne verharrte einen Moment hinter der Theke, dann hastete er ans Schaufenster. Verborgen hinter dem halbhohen weißen Spitzenvorhang, beobachtete er Denise auf ihrem Weg über den Platz. Er ballte die Fäuste in den Taschen seines weißen Kittels und presste die Lippen aufeinander.
»Denise Déschartes«, murmelte er verächtlich und schnaubte durch die Nase. Eine kleine Schneiderin, die sich Designerin nannte. Denise, die ihn in eine Ehe gezwungen hatte, um in die Gesellschaft von Saint-Emile aufzusteigen und in der Stadt eine Rolle zu spielen. Als Madame Aubry, Frau des Apothekers Etienne Aubry, Sohn aus einer reichen und sehr angesehenen Familie des Orts. Freudlos lachte Etienne in sich hinein und starrte Denise weiterhin nach. Sie hatte sich sein Vertrauen erschlichen, ihm Verständnis vorgeheuchelt, er hatte sich ihr geöffnet, und sie? Sie wollte nur eine gute Partie machen. Kein Mann in Saint-Emile hatte sich für Denise interessiert, und nur er war so dumm gewesen, sich von ihr einfangen zu lassen.
Im Licht der Straßenlaterne überquerte sie langsam den kleinen Platz. Sie war dick geworden, und sie versuchte, mit der Länge ihres schwarzen Mantels ihr Gebrechen zu verbergen. Warum war sie gekommen? Warum hatte sie seine Ruhe gestört, die Vergangenheit aufgerührt? Mit ihrem schleppenden Gang, mit dem sie das steife Bein nachzog, erinnerte sie ihn an diesen einen furchtbaren Tag. Doch es war noch viel schlimmer gekommen.
»Ich bin nicht schuldig, nicht schuldig.« Seine Finger krallten sich in seine Handflächen, bis es schmerzte. Nein, es war sie, die den Schaden angerichtet hatte, an ihm und seiner Seele. Einen Schaden, den sie nie mehr gutmachen konnte.
Etienne kehrte zur Waage zurück. Langsam und ächzend ging er in die Knie, sammelte mit beiden Händen die heruntergefallenen Blüten vom Boden auf und warf sie in den Mülleimer. Mühsam zog er sich am Tisch wieder hoch. Er zögerte, dann holte er aus der Tasche seines Kittels einen kleinen Schlüssel und öffnete die Schublade unter der Theke. Er griff hinein und zog ein altes ausgeschnittenes Zeitungsfoto heraus.
»Fleur«, murmelte er. Fleur, die Frau, die ihn abgewiesen hatte, sich über ihn lustig gemacht und ihn verachtet hatte. Der alte Mann stöhnte auf. »Fleur«, flüsterte er, »Fleur ...« Und seine von Adern durchzogene und mit Altersflecken bedeckte Hand fuhr zart über das Foto.
Kapitel 2
Ende September 2001Saint-Emile
Die heiße Septembersonne blendete Hippolyte, als er aus dem Auto stieg und zu den Weinbergen hinübersah. Kein Schatten, kein leichtes Lüftchen brachte Abkühlung, milderte die sengende Hitze.
Auf den Hängen kamen die Arbeiter beim Pflücken der Trauben nur schrittweise voran. Sie mussten sich bücken, hockten mit ihren Scheren auf der Erde, standen wieder auf, musterten sorgfältig jede Traube, bevor sie sie in flache Kisten legten.
Frank, Hippolytes Mitarbeiter, winkte ihm zu und kam von den Rebreihen herüber. Er war erhitzt, strahlte aber Genugtuung aus, als er Hippolyte auf die Schulter klopfte.
»Das gibt einen guten Wein, genau richtig für einen Neuanfang. Wie war's auf der Bank?« Ein scharfer Blick streifte Hippolytes Gesicht. »Hast du Erfolg gehabt?«
Hippolyte nickte und zog ein Kuvert aus der Innentasche seiner hellen Leinenjacke. »Hier steht es schwarz auf weiß, wir bekommen einen weiteren Kredit.«
Mit dem Kuvert fächelte er sich Kühlung zu, er war erschöpft, angespannt, doch sichtlich zufrieden. Vor einem halben Jahr war er zurückgekommen, und die Monate harter Arbeit waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen, auch die Unsicherheit vor dem heutigen Termin bei der Bank hatte an seinen Nerven gezerrt. Jetzt sog er tief die sonnendurchglühte Luft ein.
»Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir in die schwarzen Zahlen kommen, aber wir werden es schaffen.«
»Klar«, antwortete Frank und grinste. »Hast du je daran gezweifelt?«
Hippolyte lächelte gleichgültig und zuckte mit den Schultern.
»Ich hole uns einen Pastis«, schlug Frank vor, »zum Anstoßen.« Und er verschwand im Haus.
Hippolytes Blick wanderte über die Weinberge, die Landschaft seiner Kindheit. Er hatte sie genauso wiedergefunden, wie er sie vor vier Jahren verlassen hatte. Sie machte ihn glücklich und gab ihm das Gefühl von Zufriedenheit. Wie hatte er das Haus und die Umgebung vermisst, wie hatte er es nur vier Jahre ohne seine Heimat, sein Zuhause ausgehalten, und wie glücklich war er, dass La Maison Bleue wieder ihm gehörte.
»Wie geht es Bérénice?« Frank war mit der Flasche unter dem Arm und zwei Gläsern aus dem Haus gekommen. Er durfte Hippolyte das fragen, denn er war sein ältester und bester Freund, der nach seiner Rückkehr alles stehen und liegen gelassen hatte, um mit ihm zusammen das Weingut wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Hippolyte wartete, bis Frank die Gläser gefüllt hatte, prostete ihm zu und nahm einen kräftigen Schluck. Er atmete durch und ließ sich Zeit, bevor er antwortete: »Ich habe vor einigen Wochen mit ihr telefoniert, es scheint ihr sehr gutzugehen. Finanziell hat sie ausgesorgt. Endlich«, fügte er leise hinzu.
»Und dieser Designer? Ich meine ...« Frank zögerte, bevor er weitersprach. »Ist das ihr Freund?«
Frank hatte nicht verstehen können, dass Hippolyte allein aus Paris zurückgekehrt war.
»Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber sie hat keine Affäre mit ihm, wenn du das meinst. Er interessiert sich nicht für Frauen. Seine Modenschau im August war nicht sehr erfolgreich; nur die bestickten Abendkleider, die wurden in allen Zeitungen erwähnt. Und das war das Werk von Bérénice«, stellte Hippolyte stolz fest. »Sie liebt Paris, und sie scheint glücklich über die neue berufliche Herausforderung zu sein. Sie bereitet schon die nächste Kollektion für die Show im Februar vor. Sie hat also alle Hände voll zu tun.«
Hippolytes Stimme klang voller Energie, ein wenig zu sehr, wie er fand, doch er wollte nicht zugeben, wie sehr er Bérénice vermisste. Nicht einmal vor sich selbst. Er vermisste sie jeden Tag, jeden Abend. Hier im Maison Bleue kamen die Erinnerungen zurück, nicht nur an die Nacht, die ihnen zum Verhängnis geworden war, sondern auch an die langen Spaziergänge in den Lavendelfeldern, an Sonntage, an denen sie in einem idyllischen Gartenrestaurant der Umgebung gegessen hatten. Wie oft dachte er in den letzten Wochen an die Nächte, die so heiß gewesen waren, dass sie nicht schlafen konnten, aufstanden und den kleinen Hügel hinaufliefen. Daran, wie sie sich im Licht des hellen Mondes zärtlich umarmt hatten und schweigend auf das laute Zirpen der Zikaden lauschten.
Er durfte nicht daran denken, nicht jetzt. Heute hatte er einen großen Erfolg verbuchen können, indem er den Direktor der Bank von seinen Plänen überzeugte. Er sollte glücklich sein. Während er sein Glas langsam leerte, ließ er seinen Blick über das alte Steinhaus mit den hellblauen Fensterläden und Türen gleiten, bis er an dem alten knorrigen Olivenbaum hängenblieb, dessen silbrige Blätter in der flirrenden Hitze zitterten und glänzten.
In Gedanken und Erinnerungen versunken, merkte er nicht, dass Frank ihm sofort wieder nachschenkte.
»Ich denke, die Zeit in Paris hat unsere Ehe zerstört«, sinnierte er laut. »Ich hatte immer geglaubt, es ist diese Nacht gewesen, damals ... von der ich dir erzählt habe ... obwohl ...«
»Du meinst, als du das Weingut verspielt hast?«
Hippolyte nickte und trank langsam, Schluck für Schluck. Der Pastis und die Hitze des Nachmittags benebelten ihm die Sinne und lösten seine Zunge.
»Das war es nicht, nicht nur. In dieser Nacht war Bérénice allein im Haus, und da hat sie ...« Hippolyte sprach nicht weiter. Er starrte auf sein leeres Glas und drehte es nachdenklich in der Hand. »Es war Paris«, betonte er nach einer kleinen Pause.
Frank klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter, das war seine Art, dem Freund sein Mitgefühl zu zeigen. »Aber du wolltest etwas sagen. Bérénice war allein hier oben, und da ...«
»Nicht so wichtig«, wich Hippolyte aus.
Schweigend beobachteten sie die Arbeiter in den Weinbergen, bis lautes Hundegebell die Stille des Nachmittags zerriss. Überrascht drehten sich die beiden um und sahen eine junge Frau den Hügel neben dem Haus herunterkommen. Ein großer Hund lief und tanzte vor ihr her, unbekümmert bellte er die Arbeiter in den Feldern an, drehte sich um sich selbst, schnappte nach seinem Schwanz und rannte dann auf Frank und Hippolyte zu.
»Tristan«, rief die junge Frau, »hierher, sofort!«
Doch der Hund überhörte den Befehl und schnupperte gut gelaunt an den Beinen der beiden Männer.
»Tristan, was für ein hässlicher Name für einen Hund!« Frank grinste.
»Ist ja auch ein hässlicher Hund.« Hippolyte lachte und wehrte das große Tier ab, das an ihm hochsprang, seine Pfoten auf Hippolytes Schultern legte und ihn aus großen braunen Augen ansah.
»Entschuldigung, er ist erst drei Monate alt. Er weiß noch nicht, dass er gehorchen sollte.«
Atemlos stand die junge Frau vor den beiden Freunden. Sie nahm ihren großen Strohhut ab und fuhr sich mit der Hand durch das lange blonde Haar. Fasziniert verfolgten die beiden die Bewegung ihres Kopfes, als sie die schönen Haare in den Nacken warf. Sie trug Jeans und eine karierte Bluse, die sie in der Taille verknotet hatte, und ihre Füße steckten in klobigen braunen Schnürschuhen.
Der Hund schnupperte jetzt interessiert an Hippolytes altem Pick-up, hob das Bein und pinkelte gegen den hinteren Reifen. War es die Sonne, der Alkohol oder die Nähe einer schönen Frau, dass Hippolyte in Lachen ausbrach und sich kaum mehr beruhigen wollte?
»Marie-Luise Winter«, stellte die Frau sich vor und erzählte, dass sie das kleine Haus hinter dem Weinberg gekauft habe. »Nun gibt es ein Problem, und deswegen bin ich hier.«
Beide Männer versicherten bereitwillig, bei der Lösung helfen zu wollen, und so erklärte sie, dass sie ihren Mietwagen bereits abgegeben habe, ihre Freundin aber erst in drei Tagen aus Deutschland kommen könnte.
»Sie bringt mir mein Auto. Aber vor einer Stunde rief sie mich an, dass sie es nicht früher schafft. Und nun brauche ich dringend Glühbirnen, Batterien und Lebensmittel. Fährt einer von Ihnen zufällig in die Stadt und könnte mich mitnehmen?«
Erwartungsvoll sah sie die beiden Männer an. Frank musste zurück zu den Arbeitern, was er zutiefst bedauerte, und so bot Hippolyte sich an, sie in die Stadt zu fahren. Er öffnete ihr die Wagentür, und Tristan sprang unaufgefordert hinten auf, wo er es sich zwischen leeren Kisten bequem machte.
Der Wagen rumpelte über den steinigen Weg hinunter in die Stadt.
»Wir fahren am besten zu Robert, da bekommen Sie fast alles. Daneben gibt es ein Geschäft mit frischem Obst und Gemüse, und die beste Bäckerei von Saint-Emile liegt auch nur zwei Häuser weiter«, erklärte Hippolyte. Er spürte, wie die junge Frau ihn heimlich von der Seite beobachtete. Zunächst war er einsilbig geblieben, hatte sich nur kurz vorgestellt, dann waren sie schweigend weitergefahren.
»Machen Sie Ferien hier?«, fragte er ungeschickt, als die ersten Häuser von Saint-Emile auftauchten.
»Ich werde hier wohnen«, erklärte Marie-Luise schlicht. »Ich habe mich scheiden lassen und von meiner Abfindung das kleine Haus gekauft. Arbeiten kann ich überall.«
Sie machte eine kleine Pause und wartete, bis Hippolyte die Frage nach ihrem Beruf stellte.
»Ich übersetze Romane aus dem Deutschen ins Französische und umgekehrt. Meine Mutter war Französin, und mein Vater ist Deutscher«, fügte sie hinzu. »Und Sie? Was machen Sie?«
Marie-Luise lächelte ihn rasch von der Seite an, doch da waren sie bereits vor Roberts großem Geschäft angekommen, und Hippolyte war erleichtert, aussteigen zu können. Was sollte er ihr auch erzählen? Er war vierundvierzig Jahre alt, seine krausen dunklen Haare begannen sich zu lichten, er lebte von seiner Frau getrennt, er war ein Versager, der versuchte, auf dem Weingut seiner Vorfahren wieder Fuß zu fassen. Er hatte sich bis über beide Ohren bei der Bank verschuldet, und wenn der diesjährige Wein sich nicht wirklich gut verkaufte, hatte er alles verloren.
Rasch lief er um den Wagen herum und öffnete Marie-Luise die Tür, erleichtert, nicht sofort antworten zu müssen.
»Tristan, du bleibst sitzen!«, schärfte Marie ihrem Hund ein. Sie wandte ihm den Kopf zu, und als sie ausstieg, stolperte sie. Hippolyte fing sie auf. Einen kleinen Moment drückte er sie an sich, und er spürte ihren Körper und atmete den zarten Duft ihrer Haut nach Jugend und Sonne ein. Ihre Nähe verwirrte ihn, der Alkohol machte ihm Mut, und so beugte er sich zu ihr und küsste ihre Lippen, die sich bereitwillig öffneten.
Nur langsam ließ er sie nach dem langen Kuss los. Die beiden sahen sich verwirrt an, jeder wollte schnell betonen, dass es eigentlich nicht seine Art war ... Doch dann lächelten sie und wussten, dass es gut und richtig gewesen war.
Als Hippolyte ihr leicht die Haare aus dem Gesicht strich, spürte er, dass sie beobachtet wurden, und als er sich rasch umdrehte, sah er direkt in die Augen von Denise Aubry-Déschartes, seiner Schwiegermutter, die auf der anderen Straßenseite stand und feindselig zu ihnen herüberstarrte.
Kapitel 3
Oktober 2001Paris
Es war Herbst geworden, einer dieser grauen, nassen Tage in Paris. An den Bäumen in der Avenue Montaigne hing kein Blatt mehr, und am Himmel war kein Licht zu sehen. Ein Tag, an dem das Wetter die schlechte Laune im Atelier noch schlechter werden ließ, als sie die letzten Tage bereits gewesen war.
Obwohl es spät am Abend war und jeder nach Hause wollte, peinigte Maxime seine Mitarbeiter mit Launen, Ausbrüchen und ständig neuen Ideen, die er sofort wieder verwarf.
»Die Show ist im Februar, und er führt sich auf, als wäre sie morgen«, flüsterte Raul übellaunig hinter vorgehaltener Hand. Neben ihm stand Jean Bergé, der bekannte Modefotograf, der gekommen war, um mit dem Designer Entwürfe durchzusprechen, die er für die amerikanische Vogue fotografieren sollte. Doch Maxime war mit den Skizzen für ein Abendkleid nicht zufrieden, egal, was sein Team ihm vorschlug.
Die Stimmung der Mitarbeiter war aufgeladen mit Hysterie und Aggression gegen Maxime. Bérénice stahl sich leise aus dem Atelier, denn es ging um Entwürfe, die nicht bestickt wurden. Jean Bergé jedoch war ihr nachgelaufen und holte sie auf der Treppe ein. »Haben Sie Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen?«
Bérénice blieb stehen und zögerte für einen Moment. Jean sah sehr gut aus. Er war groß, schlank, und die Lederjacke, die er lässig über die Schultern gehängt hatte, passte gut zu seinen blonden Haaren und den blauen Augen. Doch dann lehnte sie freundlich ab und lief weiter. Vor dem Eingang holte Jean sie erneut ein und drückte ihr seine Visitenkarte in die Hand. Er verabschiedete sich rasch und stieg wieder die Treppe hinauf ins Atelier. Achtlos steckte Bérénice seine Karte in ihre Handtasche. Sie hatte es eilig, vor dem nächsten Regenguss nach Hause zu kommen. Aber direkt vor der großen Eingangstür mit den schmiedeeisernen Blumenranken drehte sie sich noch einmal um.
»Vielleicht irgendwann einmal ...«, rief sie dem Fotografen nach, bevor die schwere Tür hinter ihr zufiel.
Sie lief rasch die Avenue Montaigne entlang bis zum Rond Point. Ein heftiger Wind war aufgekommen, starker Regen setzte bereits ein, und völlig durchnässt tauchte Bérénice in die Metro-Station ab.
Zu Hause angekommen, ging sie unter die Dusche, kochte sich einen starken Kaffee und setzte sich an den kleinen runden Küchentisch. Unkonzentriert blätterte sie in einer alten Modezeitung, doch ihre Gedanken beschäftigten sich mit Jean Bergé. Seine Einladung war überraschend gekommen. Er wollte mit ihr ausgehen, aber wollte sie das auch? Jean wurden viele Affären nachgesagt. Also lieber nicht, entschied sie und trank einen Schluck von ihrem heißen Kaffee. Im Haus mit den vier Stockwerken war es still, trotz des schlechten Wetters schien an diesem Freitagabend niemand zu Hause zu sein. Wieder lag ein einsames Wochenende vor ihr.
Als das Telefon läutete, blieb sie sitzen. Sicher war es Maxime, der sich über ihr rasches Verschwinden beklagen wollte. So ließ sie es läuten, doch als es ein zweites Mal ansetzte, erhob sie sich, ging ins Wohnzimmer und griff unlustig nach dem Hörer.
Es war ihre Mutter.
»Wie geht es dir?«, fragte Denise in mitleidigem Ton. Seit Bérénice ihr von der Trennung von Hippolyte erzählt hatte, rief sie fast täglich bei ihrer Tochter an, um ihr »beizustehen«, wie sie es nannte.
»Gut, wirklich gut«, antwortete Bérénice automatisch.
»Ach ja? Das wundert mich. Aber dann weißt du es wahrscheinlich noch nicht.«
»Was weiß ich noch nicht?« Bérénice unterdrückte einen ungeduldigen Seufzer.
Denise machte eine kunstvolle Pause, bevor sie weitersprach: »Ich habe es ja schon seit Wochen geahnt, ich wollte dich nur nicht beunruhigen.«
»Maman, was ist denn?« Bérénice wurde ungeduldig.
»Dein Mann hat sich ja schnell getröstet. Mit einer bildhübschen jungen Deutschen. Die ganze Stadt spricht darüber, denn Hippolyte zeigt sich oft und gern mit ihr.«
Denise wartete die Wirkung ihrer Worte ab, doch Bérénice reagierte kaum, blieb einsilbig und erklärte dann, Hippolyte habe doch das Recht dazu, schließlich seien sie bereits seit einem halben Jahr getrennt. Sie beendete das Gespräch mit einer gemurmelten Entschuldigung, bevor Denise noch einmal etwas sagen konnte.
Den Hörer immer noch in der Hand, ließ Bérénice sich aufs Sofa fallen. Ihrer Mutter gegenüber hatte sie Hippolyte verteidigt, doch jetzt überfiel sie der Schmerz über die Neuigkeit heftig und durchdringend. Sie hatte nicht daran gedacht, dass Hippolyte sich wieder verlieben könnte. Vielleicht irgendwann einmal, aber nicht jetzt, so schnell, so bald nach ihrer Trennung. Offenbar glaubte er, es sei Zeit, ein neues Leben zu beginnen. Das sollte sie vielleicht auch, doch das Gefühl der Enttäuschung war da, und es wäre sinnlos gewesen, es zu ignorieren.
Da griff Bérénice nach ihrer Tasche, die auf dem Tisch stand, holte entschlossen die Karte von Jean Bergé heraus und wählte seine Nummer.
***
»Ich bin gern hier.«
Jean Bergé rückte Bérénice den Stuhl zurecht und nahm ihr gegenüber an dem kleinen Tisch Platz. »Ich mag die familiäre Atmosphäre«, erzählte er weiter, während Bérénice sich neugierig umsah. Sie hatte schon viel von diesem Lokal gehört, das für seine klassische französische Küche bekannt war. Kellner mit langen weißen Schürzen balancierten große Tabletts über die Köpfe der Gäste hinweg, es war eng, heiß und laut, aber es duftete wunderbar. Bérénice fühlte sich sofort wohl. Jean bestellte Champagner, und während sie ihre Hummersuppe löffelten, erzählte er von Fotoaufnahmen in Amerika, in der Karibik und in Asien. Es war lange her, seit Bérénice sich mit einem Mann verabredet hatte. Das lag Jahre zurück, denn es war immer Hippolyte gewesen, mit dem sie ausgegangen war. Doch Jean verstand es, ihr leichtes Unbehagen mit seiner lockeren Unterhaltung zu zerstreuen, und so beantwortete sie bereitwillig seine Frage, ob sie allein lebe oder verheiratet sei.
»Mein Mann und ich haben uns nach zwanzig Jahren getrennt. Die letzten vier Jahre lebten wir in Paris, besser gesagt, ich lebte in Paris, mein Mann war beruflich ständig unterwegs.«
»Was ist Ihr Mann von Beruf?«, wollte Jean wissen.
»In dieser Zeit war mein Mann Vertreter für südafrikanische Weine, hielt sich viel in Südafrika auf und bereiste ganz Frankreich. Aber im vergangenen April ist er in die Provence zurückgegangen und konnte dort das Weingut seiner Familie zurückkaufen. Er ist glücklich«, fügte sie nach einer kurzen Pause hinzu. Plötzlich hatte sie keinen Appetit mehr.
»Und Sie, Bérénice? Haben Sie Design studiert? Seit wann arbeiten Sie für Maxime?«
»Wollen Sie das wirklich wissen?« Sie sah hoch und fing ein Lächeln von Jean auf, der sie interessiert beobachtete.
»Sonst hätte ich nicht gefragt«, war seine Antwort.