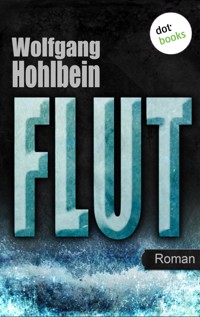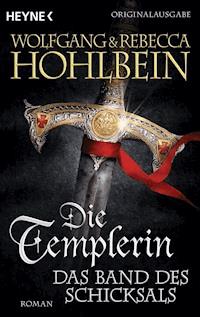
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Templerin-Serie
- Sprache: Deutsch
Anno Domini 1187: Die »Templerin« Robin hält sich vor den Tempelrittern versteckt. Ihr geheimes Wissen darf nie ans Licht kommen. Seit zwei Jahren lebt sie inkognito in einer jüdischen Siedlung am Niederrhein und hat seither nichts von ihrer kleinen Tochter in der Levante gehört. Jetzt schlägt sie alle Ermahnungen in den Wind und machte sich zu ihr auf den Weg. Just hat der Papst mit einer Bulle zum Dritten Kreuzzug aufgerufen ... Mit von der Partie: Friedrich Barbarossa, Philipp II. von Frankreich und Richard Löwenherz von England – und es wird offenbar, wer der geheimnisvolle Vater der Waise Robin ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
WOLFGANG UND REBECCA
HOHLBEIN
DIE
TEMPLERIN
DAS BAND DES
SCHICKSALS
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Das Buch
Anno Domini 1187: Die »Templerin« Robin hält sich vor den Tempelrittern versteckt. Ihr geheimes Wissen darf nie ans Licht kommen. Seit zwei Jahren lebt sie inkognito in einer jüdischen Siedlung am Niederrhein und hat seither nichts von ihrer kleinen Tochter in der Levante gehört. Jetzt schlägt sie alle Ermahnungen in den Wind und macht sich zu ihr auf den Weg. Just hat der Papst mit einer Bulle zum Dritten Kreuzzug aufgerufen ... Mit von der Partie: Friedrich Barbarossa, Philipp II. von Frankreich und Richard Löwenherz von England – und es wird offenbar, wer der geheimnisvolle Vater der Waise Robin ist.
Die Autoren
Wolfgang Hohlbein wurde 1953 in Weimar geboren. Mit seinen in insgesamt 37 Sprachen übersetzten Romanen aus den verschiedensten Genres – Thriller, Horror, Science-Fiction und historischer Roman – ist er einer der erfolgreichsten deutschen Autoren überhaupt. Er lebt in der Nähe von Düsseldorf.
Rebecca Hohlbein, geboren 1977, führt das Erbe ihrer berühmten Familie weiter und hat bereits mehrere Jugendbücher geschrieben und sich einen Namen als Autorin bei gemeinsamen Projekten mit ihrem Vater Wolfgang Hohlbein gemacht. Bei Heyne erschien zuletzt ihr gemeinsamer Roman Die Templerin – Das Testament Gottes. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Neuss.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. KAPITEL
»Du hast das Schacharit versäumt.«
Robin fuhr leicht zusammen, als Abel ben Jakobs ruhige Stimme zu ihr in Zaras Box drang. Aber statt sich zu dem Rabbi der jüdischen Gemeinde herumzudrehen, hielt sie nur für einen kleinen Moment in ihrem Tun inne und deutete ein Schulterzucken an, ehe sie damit fortfuhr, der jungen Araberstute die Schulter zu striegeln. Sie wollte allein sein – heute noch viel mehr als sonst. Außerdem wusste sie ohnehin, was gleich kam: eine persönliche Nachhilfestunde in der Lehre der Tora oder des Talmuds nämlich, oder zumindest eine Zusammenfassung dessen, was im Rahmen der morgendlichen Gebete zwischen den Juden des Dorfes diskutiert worden war. Denn das war es, was die Juden, unter denen sie seit rund zwei Jahren lebte, neben ihrer Neigung, noch um den Preis für die allerletzte Linse im Sack zu verhandeln, am allerliebsten taten: diskutieren. Sie diskutierten jede noch so belanglose Kleinigkeit aus, ganz gleich ob es nun um religiöse Themen ging, für die der Talmud eine umfassende Grundlage bot, oder bloß um die Frage, ob die Fellfarbe eines Pferdes eher als noch braun oder doch schon fast schwarz zu benennen war.
Übertroffen wurde ihr Diskussionsdrang bestenfalls von ihrem Hang zu ausschweifendem Geläster hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand, obwohl letztere Eigenschaft unter den Frauen der Siedlung weit ausgeprägter war als unter den Männern, sodass Robin in mehr als vierundzwanzig Monaten noch keine einzige Freundin gefunden hatte. Aber das wollte sie auch gar nicht.
Auch die zweijährige Zara quittierte Abels Ankunft bloß mit einem unwilligen Hufscharren. Sie genoss die Fellpflege sichtlich – sofern niemand außer Robin die Striegelbürste hielt. Zara war nicht die prächtigste Stute der Zucht und die eigenwilligste noch dazu. Aber vielleicht war genau das der Grund, weshalb Robin sie von den insgesamt neun Ein- bis Dreijährigen, die sie in diesem Sommer verantwortete, am meisten mochte.
»Obwohl du weißt, dass donnerstags zum Schacharit zusätzlich aus der Tora gelesen wird«, schalt Rabbi Abel ben Jakob sie nun aus dem schmalen Hintereingang des Stalles heraus. Von seinem Standpunkt aus schlängelte sich ein schmaler Kiesweg an den Stallungen und Wohnhäusern entlang bis zur schlichten Synagoge der Siedlung, sodass seine Schritte auf dem Weg hierher hörbar geknirscht haben mussten. Robin war so sehr in Gedanken gewesen, dass sie ihn trotzdem nicht hatte kommen hören.
Ob Emma die Geburt ihres ersten Fohlens wohl gut überstand? Josh hatte sich eine Fessel verstaucht, aber die Schwellung war bereits zurückgegangen. Die Öle, die der Stallmeister David ben Noah bestellt hatte, waren immer noch nicht eingetroffen, und langsam wurden ihr die Vorräte knapp. Vielleicht sollte sie zum Gladbacher Markt reiten und die nötigsten Tinkturen und Kräuter selbst besorgen?
Im ersten Jahr bei Abel und seinesgleichen hatte Robin sich keinen Zoll jenseits vom Gelände der Gemeinde bewegt; die Furcht, von irgendjemand erkannt und an die Templer verraten zu werden, saß einfach zu tief. Doch in den vergangenen Wochen hatte sie sich wenigstens sporadisch wieder unter das christliche Volk abseits der jüdischen Mauern gewagt, denn selbst wenn sie jemand begegnete, der sie aus der Vergangenheit kannte, würde sie inzwischen niemand wiedererkennen.
Ihr Haar war stark gewachsen, sodass es unter dem Kopftuch heraus, das sie wie alle jüdischen Frauen trug, in sanften Wellen bis über ihre Hüften fiel, sofern sie es nicht zu einem Zopf zusammenflocht oder hochsteckte. Außerdem war es deutlich dunkler geworden, seit sie die goldene und – wie es ihr schien – viel größere Sonne Jerusalems hinter sich gelassen hatte. Darüber hinaus hatte Robin abgenommen, obwohl sie schon zuvor von schlanker Gestalt gewesen war. Darum wirkte sie längst dürr und geradezu verloren in dem bodenlangen, schlichten Kleid mit den albernen Bommeln am Saum, Zizit genannt, das man ihr bei ihrer Ankunft in der Siedlung überlassen hatte und welches seitdem nur ab und an notdürftig geflickt, aber nie ausgetauscht worden war. Robin legte keinen Wert darauf.
Apropos erneuern: Mindestens drei der Pferde benötigten neue Hufeisen. Sie sollte David bitten, den Schmied herbeizuordern ...
Es gab so vieles, worüber sie sich den Kopf zerbrechen konnte – und vor allem genug Arbeit, mit der sie sich von dem Gedanken ablenken konnte, welches Datum heute war. Und was das für sie bedeutete.
Zara schnaubte nervös, und so ließ Robin nun doch von ihrem Fell ab und bedachte den alten Mann widerwillig mit einem Schulterblick. Hinter der schmalen Tür, in der Abel lehnte, erstreckten sich fünfzig Ar Weide, die dem Gestüt angehörten, und schließlich – abgegrenzt durch einen unverhältnismäßig hohen, vom benachbarten Gutshof mit zahlreichen rostigen Nägeln gespickten Zaun – einige Hektar Ackerland, auf dem das bald reife Korn goldgelb in der aufgehenden Sonne glänzte. Ben Abels Gestalt bildete nur einen schwarzen Schattenschnitt mit Schlapphut gegen das grelle Licht in seinem Rücken.
Seit Robin im ersten Winter nach ihrer Ankunft informell die alleinige Verantwortung für das Gestüt übernommen hatte, trennte ein weiterer, kaum mehr als hüfthoher Lattenzaun die Weide von den gefährlichen Nägeln im Holz der Nachbarn. Letztere interessierten sich für die Menschen in der kleinen jüdischen Siedlung am Niederrhein in etwa so arg wie eine Schmeißfliege für das Zinssystem – zumindest solange sie sich unauffällig verhielten, das abgezäunte Dorf nicht allzu oft verließen und niemand Grund für Schmähungen und wilde Spekulationen (abseits der üblichen) boten. Letztlich profitierten die Christen in der Nähe immer wieder von gutem Fleisch, das die Juden verramschten, weil es bei der strengen Prozedur des Schlachtens irgendwelche Abweichungen gegeben hatte und darum für nicht koscher und mithin ungenießbar befunden wurde.
Jedenfalls ließ man die Juden in der Nähe des Gladbacher Münsters meist in Frieden. Von Respekt vor der anderen Kultur und Religion war man jedoch auch hier weit entfernt. Und darum scherte es den Christen Jakob, dessen Acker an das Gestüt angrenzte, auch einen feuchten Dreck, dass sich die Tiere der erbsündigen Juden alle Nase lang an rostigen Nägeln und groben Holzsplittern verletzten. Wie dem auch sei: Seit Robin das rund zwanzig Tiere fassende Gestüt leitete – Geschäftsangelegenheiten ausgeschlossen –, ging es den Tieren in einiger Hinsicht deutlich besser, was sich zum Wohlwollen des Stallmeisters auch in den Zahlen bemerkbar machte. Der zusätzliche Zaun kostete zwar ein paar Schritte Weide, trug aber deutlich zu Wert und Wohlbefinden der Tiere bei. Und Robin fühlte sich bei den Tieren wohl. Selbst das ungestümste Fohlen, der stolzeste Hengst oder die unberechenbarste Stute würde nie eine Intrige gegen sie stricken, noch sie in eine Falle locken oder sich in Missionierungsambitionen verlieren. Den Tieren konnte sie vertrauen, den Menschen kaum.
Nicht einmal Rabbi Abel, obwohl er der Einzige in der Siedlung war, der zumindest einen gewissen Teil ihrer wahren Geschichte kannte – der wusste, wer sie wirklich war und wie sie hieß. Aber nicht zuletzt war es außerdem nicht etwa ein Mensch gewesen, der Salims Tod ein Stück weit gerächt hatte, indem es dessen Mörder getötet hatte, sondern ein Pferd ...
»Ich habe bei der Auswahl des Textes an dich gedacht«, bemerkte der Rabbi nun und schritt zu ihr in Zaras Box. »Ich habe die Entstehungsgeschichte aus dem Ersten Buch Mose gelesen.«
»Dann habe ich wieder nichts verpasst«, antwortete Robin desinteressiert und streichelte Zara die Nüstern. »Ich kenne das Alte Testament, Rabbi. Auch die christlichen Gelehrten lesen dann und wann daraus vor.«
Sie verstaute die Striegelbürste in ihrer ledernen Bauchtasche und zog einen grobzinkigen Kamm hervor, mit dem sie sich an Zaras Mähne zu schaffen machte. Nein, dachte sie, Zara war wahrlich keine Schönheit. Tatsächlich stutzte sie Mähne und Fell hin und wieder vorsichtig mit einer großen Schere, weil es so ungleichmäßig wuchs, dass es anderenfalls aussah, als wäre die Stute unter einen Pflug geraten. Ihr Gemüt war so leicht reizbar, dass sich nicht einmal die Hengste in ihre Nähe wagten. Aber das machte nichts. Wenig ansehnlich und unberechenbar, wie sie war, war sie zur Zucht ohnehin nicht geeignet.
»Wie kannst du das wissen?«, entgegnete ben Jakob. »Schließlich warst du nicht dabei. Und anders als die christlichen Gelehrten lege ich Wert darauf, die alten Schriften nicht nur vorzutragen, sondern sie auch zu erläutern. Ich möchte keine Gemeinde aus dummen Trotteln, die mir blind aufs Wort gehorcht. Es geht nicht nur ums Verstehen, ein jeder soll auch begreifen, was geschrieben steht. Wusstest du, dass der, dessen Namen niemand sagen soll, dem Menschen keineswegs die Bestimmung gab, die Erde zu besitzen und über sie zu herrschen, wie mancher Christ in seiner Ignoranz behauptet, Jael?«
Worte, die nicht unvernünftig klangen, Robin aber viel zu sehr an Johannes von Nablus aus dem Inneren Kreis der Templer erinnerten; an jenen Tatzenkreuz tragenden Ritter, der in zahllosen Stunden an einem abgestandenen Weiher fernab der nächsten größeren Ortschaft auf sie eingeredet hatte, während sie nichts anderes wollte, als dass man ihr ihre Tochter zurückgab ... Ihr einziges Kind und alles, was ihr von Salim geblieben war. Ihr kleines Mädchen, das sie nur einen winzig kurzen Moment hatte in die Arme schließen dürfen, ehe ein anderer es ihr erneut raubte ...
Abels Belehrungen waren so ziemlich das Letzte, was sie heute gebrauchen konnte.
»Die Weltherrschaft war nicht mein Plan«, winkte Robin gereizt ab. »Der Stall reicht mir.« Ganz nebenher hatte sie mit jeglichen religiösen Ambitionen längst abgeschlossen. Auch nach mehr als vierundzwanzig Monaten, war sie weit davon entfernt, ihren neuen, falschen Namen zu lieben – obwohl ihr natürlich klar war, dass es auch dann besser war, wenn der Rabbi sie nicht bei ihrem richtigen Namen nannte, wenn sie anscheinend unter sich waren. Manchmal hatten die Wände in der Siedlung Ohren. Meistens Shilohs, denn die eifersüchtige Schwiegertochter des Rabbis ließ keine Gelegenheit aus, Robin auf jede denkbare Weise zu drangsalieren.
Robin zwängte sich in der Enge des Ganges zwischen den Boxen an dem alten Juden vorbei und füllte einen Eimer mit Hafer aus einem Leinensack, den sie dann in Zaras Futtertrog entleerte.
Aber Rabbi Abel ben Jakob ließ von der schwachen Hoffnung, doch noch einen Plausch oder gar eine philosophische Auseinandersetzung über die Tora zu beginnen, noch nicht ab.
»Willst du denn gar nicht wissen, was wirklich gemeint ist, wenn die Schriften vom Ebenbild des Allmächtigen sprechen, Robin? Von der großen Aufgabe, die dem Menschen tatsächlich in die Hand gelegt ist? Vom Streben nach der Heiligkeit des Unaussprechlichen?«
»Nein«, antwortete Robin geradeheraus. »Könnte ich mich jetzt bitte in Ruhe meiner Arbeit widmen, Rabbi? Auch du verdienst sehr gut daran, vergiss das nicht.«
»Das weiß ich.« Abel nickte und betrachtete sie mitfühlend, während sie Zara eine weiche Decke über den Rücken legte. Es war nicht kalt, obwohl der Tag gerade erst hereinbrach, aber die Stute liebte es, eine weiche Decke zu tragen. Vermutlich hatte sie Schmerzen in den Wirbeln, was wahrscheinlich auch der Grund für ihre Reizbarkeit war.
»Dennoch würde ich aus dem Ton, in dem du mit mir sprichst, Undank schließen, wenn ich nicht ich wäre«, stellte der Rabbi fest und kämmte sich den langen, krausen Bart mit gespreizten Fingern. »Aber ich bin ich, und ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Was bedrückt dich?«
»Nichts.« Robin zupfte die Baumwolldecke zurecht und betrachtete die Stute fachkundig. Eine warme, weiche Baumwolldecke ganz nach Zaras Geschmack, dachte sie mit einem Anflug von Zufriedenheit. An nichts anderes denken. Nur an Zara. Nur an die Tiere, nur an den Stall. Auf gar keinen Fall an diesen Tag, an das Datum, an die Vergangenheit ...
Darum war Robin bis tief in die Nacht bei den Pferden geblieben, hatte auf dem Heuboden geschlafen und sich schon vor dem Morgengrauen daran gemacht, die Boxen auszumisten. Sie wollte sich ablenken, nicht nachdenken. Und schon gar nicht wollte sie darüber reden. Abel sollte gehen. Am besten sofort.
Stattdessen wagte sich der Rabbi nun erneut in die Box, und aus irgendeinem Grund verzichtete Zara dieses Mal aufs Herumtänzeln und beließ es bei einem mahnenden Schnauben.
»Du weißt, dass du über alles mit mir reden kannst, Jael«, sagter er und senkte eine Hand auf ihre dürre Schulter. »Du weißt, dass ich nicht den Anspruch erhebe, alles nachvollziehen zu können. Ich möchte dich nur verstehen. Und du sollst wissen, dass ich immer für dich da bin. Vertrau mir.«
Robin kämpfte gegen den Drang an, die Hand des alten Juden abzuschütteln. Stattdessen kniff sie die Lider zusammen und versuchte ruhig und bewusst ein- und auszuatmen.
»Heute ist Leilas Geburtstag«, flüsterte sie nach einem Moment widerwillig und schob Abel beiseite, um irgendetwas zu tun. Etwas anderes als zu reden. Etwas anderes als sich zu erinnern. Mehr als die Erinnerung schmerzte nur die Hilflosigkeit, die damit einherging. Und das endlose Warten ...
»Leila?«, erkundigte sich Salusch, der den Stall in diesem Moment durch das große Tor betrat, das zum Haupthof führte. Obwohl Robin so leise gesprochen hatte, hatte er zumindest den letzten Satz offenbar vernommen.
Robin schluckte.
»Leas Fohlen«, log Rabbi Abel ben Jakob geistesgegenwärtig an seinen ältesten Sohn gewandt, der nun lächelnd, aber neugierig eine seiner goldblonden, buschigen Brauen nach links oben zog und dabei das rechte Auge halb zukniff.
Salusch war ein Meister im Grimassenschneiden und neben seinem Vater, dem Rabbi, der Einzige in der Siedlung, dem Robin – zumindest in alltäglichen Dingen – fast uneingeschränkt vertraute. Er war ein ruhiger, gemütlicher Kerl von sonniger Natur, ein paar Jahre älter als Robin und beinahe das, was sie einen Freund zum Pferdestehlen nennen würde, wenn sich die Formulierung nicht der Umstände halber verboten hätte. Und Salusch kein solch ausgemachter Feigling gewesen wäre.
So traf es sich nur gut, dass sie seine helfende Hand keineswegs zum Diebstahl von irgendetwas benötigte, sondern bloß hin und wieder in Anspruch nahm, wenn im Rahmen der Zucht gerade Not am Mann war. Wenn sich zum Beispiel einer der Burschen erkältet hatte oder um einen freien Tag bat, um länger im Talmud zu lesen. So wie heute.
Selten hatte Robin die beiden Jungen lieber freigestellt, als an diesem Tag, der der Geburtstag ihrer Tochter war, von der Salusch nichts wusste und auch nichts erfahren sollte. Salusch wusste, dass sie sich in der Siedlung vor irgendjemand, nach dem er lieber nicht fragen sollte, versteckte. Mehr nicht. Und so sollte es auch bleiben, denn dass sein Vater (wenngleich nie in böser Absicht) immer wieder in alten, offenen Wunden schabte, genügte Robin vollauf. Das musste nicht auch noch Salusch tun.
»Leas Fohlen ist heute ein Jahr alt geworden und bekommt darum einen Namen von ihr«, führte der Rabbi seine Notlüge weiter aus. Robin schenkte ihm einen kurzen, dankbaren Blick. »Jael hat sich offensichtlich für Leila entschieden.«
Salusch zog eine Schnute. Er verfügte über genug Menschenkenntnis, zu wissen, dass sie ihm etwas vorspielten, verzichtete aber darauf, nachzuhaken. Stattdessen schüttelte er nur andeutungsweise den Kopf und schlüpfte seinerseits in die Rolle des Arg- und Ahnungslosen.
»Oh. Die Sache mit den Namen für die Pferde. Davids Reizthema schlechthin ...« Er lächelte und hakte dann nach: »Was bedeutet Leila?«
»Es bedeutet die Nacht«, antwortete Robin und nickte nachdrücklich, um Abels Lüge zu bekräftigen. »Ich finde es sehr passend. Obwohl kaum eine Nacht so dunkel sein kann wie Leila.«
Salusch nickte, kehrte ihr den breiten Rücken zu und schritt zielsicher auf eine Box am hinteren Ende des Stalles zu.
»David schickt mich, Aaron zu holen und auf dem Markt zum Gladbacher Münster zu verkaufen«, erklärte er, während er das Zaumzeug des Zweijährigen vom Haken nahm und den Riegel zu seiner Box zurückschob.
»Aber Aaron sollte bleiben!«, protestierte Robin und eilte zu Salusch hin. »Ich habe David gebeten, ihn mir für die Zucht zu lassen!«
Hinter ihnen erklang eine Stimme. »Und David hat deine Bitte offenbar abgelehnt, indem er entschieden hat, dass heute ein guter Tag ist, sehr viel Geld mit ihm zu verdienen. Wenn ein Narr auf den Markt geht, freuen sich die Krämer ...«
Der Neuankömmling, der sich da einmischte, war David ben Noah selbst. Er schob seinen Wanst durch das Tor und an Salusch vorbei, der Robin mit einer entschuldigenden Grimasse bedachte.
»Ich bin mir sicher, dass Salusch für Aaron ein ansehnliches Sümmchen mit nach Hause bringt«, sagte er. »Die lästerlichen Lumpen des Münsters beherbergen dieser Tage gut betuchten Besuch aus Köln. Sicher haben sie auch die eine oder andere Schickse in eine Kaschemme einquartiert, der eine hübsche Stute gut gefiele.«
Er ließ den Blick sachkundig zwischen mehreren Stuten umherschweifen und zwirbelte dabei eine seiner graubraunen Ohrlocken zwischen den Fingerspitzen.
»Lass mich überlegen ... Diese hier.« Er deutete auf eine hellbraune Stute in einer der mittleren Boxen, während er sich mit den Fingern der anderen Hand unter der Kippa am Kopf kratzte.
»Lilith«, schlug Salusch vor.
»Von mir aus«, seufzte ben Noah. »Nimm auch dieses Tier mit. Es ist nicht besonders groß, aber für ein Christenweib reicht es allemal. Außerdem hat sie immer noch nicht geworfen, nicht ein einziges Mal in vier Jahren. Sie ist unnütz für das Geschäft.«
Robin versah Abel mit einem Hilfe suchenden Blick, aber der zuckte nur bedauernd die Schultern unter seinem langen, weißen Gebetsmantel. Er war ein weiser Mann. Als Rabbi war es seine Aufgabe, seiner Gemeinde in philosophischen, moralischen und religiösen Fragen zur Seite zu stehen, aber er hatte keineswegs eine Anführerposition oder etwas Vergleichbares inne. Niemand hier hatte das. Jeder tat, was er am besten konnte, und verantwortete das, was er tat. Salusch zum Beispiel hielt sich meist in der kleinen Schreinerei auf, die die Siedlung ebenfalls ihr Eigen nannte. Und David verantwortete eben die Zucht. Oder zumindest die geschäftlichen Dinge, die damit einhergingen.
»Du verdienst mehr an Aaron, wenn du ihn behältst und er sein Blut an seine Nachkommen weitergeben kann!«, argumentierte Robin und bemühte sich nach Kräften, weniger aufgebracht zu klingen, als sie war. Es war wirklich dumm, einen ihrer besten Hengste zu verkaufen, das sollte doch wirklich niemand besser verstehen als der Stallmeister, der den Wert jedes einzelnen Tieres jeden Abend vor dem Einschlafen in sämtliche ihm bekannte Währungen umrechnete und etwaige Gewinnspanne unter allen denkbaren Umständen im Kopf überschlug, während er bei seiner Frau lag. So schätzte Robin ihn zumindest ein.
»Es gibt andere Araberhengste, die ebenso guten Blutes sind«, winkte David ab. »Und Emmanuel ben Ruben wird uns bald neue Pferde aus dem Morgenland schicken. Ich will seinem Boten ungern einen Schuldschein dafür aushändigen ... Diese beiden Tiere hier also. Ich verlasse mich auf dich.«
Er klopfte Salusch auf den Rücken und wandte sich zum Gehen.
»Ben Ruben verlangt keine Zinsen von uns!«, wandte Robin ein, eilte zum Stallmeister hin und vertrat ihm den Weg. »Es würde ihm nichts ausmachen, ein paar Monate auf ...«
»Jael!«, unterbrach David ben Noah sie scharf und zog die runzelige Stirn in strenge Falten. »Wir haben eine Vereinbarung: Du kümmerst dich um Wohl und Gedeih der Tiere, ich um den Verkauf. Ich werde nicht mit dir darüber debattieren, welches Pferd wann und zu welchem Preis die Zucht verlässt, und du musst dich nicht für all die unnötigen Kleinigkeiten entschuldigen, die du überall in diesem Stall verteilst. Angefangen bei der Decke auf Zaras Rücken, bis hin zu den teuren Ölen, mit denen du ihre Hufe beschmierst. Und nicht zuletzt für Zara selbst, obwohl sie uns niemals auch nur einen einzigen Taler einbringen wird und nicht einmal als Reittier taugt. Haben wir uns verstanden?«
Robin schwieg. Ihre Kiefer mahlten.
»Sehr gut.« David nickte und schob sie beiseite, um den Stall zu verlassen, hielt aber auf halbem Wege noch einmal inne. »Und wenn du einen guten Rat von einem dummen alten Mann entgegennehmen kannst, Jael: Häng dein Herz nicht zu sehr an die Pferde. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass du ihnen keine Namen geben sollst.«
David ben Noah verschwand über den Hof in der kleinen Lehmhütte, in der er Pergamentrollen mit endlosen Zahlenreihen vollzukritzeln pflegte, und Robin ließ die Schultern hängen und trat zu Salusch in die Box, um ihm widerwillig dabei zur Hand zu gehen, Aaron für den Ritt zum Gladbacher Markt vorzubereiten.
»Er hat recht«, merkte Salusch vorsichtig an. »In dem Moment, wo du ihnen Namen gibst, verschenkst du einen kleinen Teil deines Herzens an sie. Ich merke es bei mir selbst, obwohl ich die meiste Zeit in der Schreinerei verbringe und nur selten im Stall bin.«
Robin zurrte gereizt einen Riemen fest.
»Aber Leila gefällt mir trotzdem«, fügte Salusch lächelnd hinzu und tätschelte dem Hengst den Nacken. »Gibt es eine Geschichte zu dem Namen, oder ist er dir einfach so eingefallen?«
»Nein«, sagte Robin brüsk und drückte Salusch das Ende einer Kordel in die Hand, die sie am Geschirr des Hengstes befestigte. »Es gibt keine Geschichte.«
»Das Vergessenwollen verlängert das Exil«, wandte der Rabbi ein, der nun etwas an sie herangetreten war. »Die Erlösung heißt Erinnerung ... Ich möchte, dass du Salusch zum Münster begleitest, Jael. Der Ritt wird dir guttun.«
»Mir geht es hervorragend«, lehnte Robin ab. »Und ich habe genug zu tun.«
»Eine großartige Idee!«, strahlte Salusch. »Bitte, Jael – begleite mich. Die Sonne lacht, der Himmel ist klar. Und Shiloh hat mir einen großen Sack voller Proviant zusammengepackt. Ich kann das beim besten Willen nicht alles allein verdrücken.«
»Deine Frau wird hellauf begeistert sein.« Robin rollte die Augen.
»Wo sind Kenan und Elias?«, erkundigte sich der Rabbi und legte den Kopf in den Nacken, als vermutete er seine beiden jüngsten Söhne auf dem Heuboden.
»Ich habe sie freigestellt«, antwortete Robin. »Vermutlich lernen sie.«
»Davon wüsste ich!« Abel stemmte die Hände in die Seiten. »Erst letzte Woche hast du sie an zwei Tagen freigestellt. Wenn sie zu viel Zeit haben, spinnen sie nur Unsinn aus. Ich werde sie zurückschicken, und sie werden deine Arbeit übernehmen.«
»Kommt nicht in...«, begann Robin, aber Rabbi Abel schnitt ihr mit einer Geste das Wort ab.
»Geh mit Salusch!«, entschied er. »Euch beiden wird ein Tag abseits der Siedlung guttun. Und bevor du es sagst: Shiloh wird nichts davon erfahren. Von mir nicht und auch von sonst niemand. Im Gegensatz zu meiner reizenden Schwiegertochter, weiß ich nämlich sehr wohl, dass ich meinem Sohn voll und ganz vertrauen kann. Darüber hinaus habe ich sie gerade in die Mikwe geschickt.«
»Sie hat Ava das Gesicht zerkratzt«, erklärte Salusch betreten. Robin war nicht die einzige Frau, die immer wieder unter seiner Gattin zu leiden hatte.
»Sie braucht ein paar Tage, um wieder zu sich selbst zu finden«, seufzte Abel. »Oder auch Jahre ... Also?«
Robin trat unentschlossen von einem Fuß auf den anderen. Sie wusste, dass der Rabbi es gut mit ihr meinte. Offenbar war er der Meinung, dass die Tagesreise sie von ihren düsteren Erinnerungen ablenkte und auf andere Gedanken brächte. Und vielleicht benötigte auch Salusch ein paar Stunden, in denen er sich abseits der Gemeinde einem offenen Ohr anvertrauen und den Rat einer Frau einholen konnte.
Mit Shiloh hatte er eine echte Strafe geheiratet – wofür auch immer. Robin hatte keine Idee, was sich ein harmoniesüchtiger, behäbiger Kerl wie Salusch hätte zuschulden kommen lassen können, dass er mit einem hysterischen Ungeheuer geschlagen gehörte, wie Shiloh eines war.
Aber wann war Gott, das Schicksal oder wer auch immer schon gerecht?
Jedenfalls wurden ihr die Ausreden knapp – selbst und allem voran vor sich selbst. War das, was der Rabbi ihr anbot, nicht das, was sie selbst wollte, wonach ihr selbst am allermeisten der Sinn stand? Nach Abstand, Ruhe und vor allem Ablenkung? War sie nicht genau darum hier und schuftete sich seit den frühen Morgenstunden die Hände rau und striegelte die Pferde fast wund?
Salusch und Abel maßen sie erwartungsvoll, und Robin gab sich geschlagen und seufzte tief. Letztlich, dachte sie bei sich, konnte sie mit Saluschs Sorgen deutlich besser umgehen als mit ihren eigenen. So wäre am Ende des Tages vielleicht allen geholfen, wenn sie ihn begleitete. Und um die überfälligen Öle konnte sie sich bei dieser Gelegenheit gleich auch noch kümmern.
»In Ordnung«, willigte sie ein und steuerte auf Liliths Box zu, um auch sie für den Verkauf vorzubereiten. »Aber Shiloh erfährt wirklich nichts davon. Sie würde mir die Augen ausstechen. Beide.«
»Langsam und qualvoll, und zwar mit heißen Stopfnadeln«, bestätigte Salusch mit leidiger Miene, schüttelte dann aber lachend den Kopf. »Ich werde schon auf dich achtgeben, seltsames Weib. Sowohl auf dem Ritt als auch an allen anderen Tagen. Ich freue mich, dass du mich begleitest. Ich bin mir sicher, dass es ein spannender Tag wird. Und ein ertragreicher bestimmt noch dazu.«
»Mein Vater hat recht mit dem, was er sagt«, bemerkte Salusch unvermittelt, als sie eine Weile nebeneinanderher in westliche Richtung geritten waren und die Siedlung zu einem weißen Fleck hinter all dem Goldgelb des Korns zusammengeschmolzen war.
Robin zuckte die ihm zugewandte Schulter.
»Womit?«, fragte sie, ohne den Ältesten des Rabbis anzusehen.
»Das mit dem Vergessenwollen und dem Exil«, erklärte Salusch und trieb sein Pferd ein wenig dichter an Robin heran. »Wie lange willst du diese Fassade noch aufrechterhalten, Jael?«
Robin schüttelte unwillig den Kopf und sah weg. Zu ihrer Linken rückte der Jakobshof mit seinem großen, neuen Kornspeicher näher, nach rechts hin erstreckte sich der Weizen bis fast zum Horizont. Zwar waren sie nicht die Einzigen, die den schmalen Pfad am Gladbach entlang zu früher Stunde nutzten, aber die nächsten Marktbesucher waren nur unscharf in mehr als hundert Schritt Entfernung zu erkennen. Nun, da sie wirklich ganz ohne Zweifel unter sich waren, wäre es in Ordnung gewesen, wenn Salusch sie bei ihrem echten Namen genannt hätte. Aber den kannte er nicht, und das war bestimmt ganz richtig so.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, log sie.
»Doch, das weißt du«, stellte der Jude fest. »Und ich weiß, dass das, was ich weiß, längst nicht alles ist, was mein Vater und du mir verheimlicht.« Er beobachtete sie aufmerksam aus den hellblauen Augen in seinem immerfort freundlich wirkenden Gesicht, während er hinzusetzte: »Ich bin mir sicher, dass es etwas mit diesem Namen zu tun hat. Mit Leila. Siehst du?«
»Was sehe ich?«, fauchte Robin, der es jetzt schon leid tat, dass sie sich zu diesem Ritt hatte überreden lassen. Besser, sie hätte sich weiterhin mit der Arbeit im Stall abgelenkt. Besser, sie wäre allein bei den Pferden geblieben, die keine Fragen stellten, wenn sie für einen winzigen Moment die Augen schloss und ein paar Tränen ins frische Stroh fallen ließ.
Dass sie sich inzwischen als Jael ben Simon, eine vermeintliche Nichte Emmanuel ben Rubens aus Israel, zumindest stundenweise wieder aus dem Schutz der jüdischen Gemeinde wagte, bedeutete noch lange nicht, dass sie die Gefahr, die von Vulgar zu Bravia und seinen Schergen ausging, nicht mehr als solche erkannte, sondern zeigte nur ihr Vertrauen darin, dass die Veränderung, die in den vergangenen Jahren mit ihr vonstattengegangen war, inzwischen schwer genug wog, nicht mehr auf Anhieb erkannt zu werden. Auch nicht von Menschen, die sie aus früheren Zeiten näher kannten. Solange niemand ihren Namen in der Öffentlichkeit nannte oder sie sich versehentlich auf andere Weise verriet.
Von ihrer Vorgeschichte, einschließlich Salim und Leila, wusste jedenfalls einzig der Rabbi, der beim ersten Gespräch unter vier Augen auf einem Mindestmaß von Vertrauen und Ehrlichkeit bestanden hatte, wenn sie den Schutz seiner Gemeinde ich Anspruch nehmen wollte – Freundin ben Rubens hin oder her. Dabei war Salusch auch nach zwei Jahren noch der Einzige, der ihr so etwas wie ein Freund in ihrem neuen Zuhause geworden war, das sie insgeheim nach wie vor ihr Versteck nannte. Zwar hatte es immer wieder Augenblicke gegeben, wo sie nicht übersehen konnte, wie sehr er sich wünschte, sie würde ihm die eine oder andere geheimnisvolle Perle von der Kette ihrer Vergangenheit herüberreichen, aber er hatte nicht ein einziges Mal versucht, irgendetwas aus ihr herauszukitzeln. Nicht einmal andeutungsweise.
Bis jetzt. Dabei war es so, wie es war, für alle das Beste. Ihr Vertrauen war gefährlicher Schmuck – und verzichtbarer noch dazu. Saluschs Wohl lag ihr am Herzen.
Und nicht zuletzt wollte sie nicht immer wieder daran erinnert werden.
Leila ...
Auf den Tag acht Jahren zuvor hatte sie das Licht der Welt erblickt; in der Wüste der Roten Geister, um den Preis von mehr Blut und Tränen, als Robin bis dahin zusammengenommen vergossen hatte. Wäre die Wüstenprinzessin Tahenkat nicht gewesen, ihre gleichsam wilde wie weise Schwiegermutter, hätte Robin ihr eigenes Leben für das ihrer Tochter eingebüßt, davon war sie fest überzeugt. Aber obwohl es später hieß, dass selbst die Zeltplanen mit ihrem Blut getränkt gewesen seien, hatte sie überlebt: In einer Nacht, so tiefschwarz wie Leilas Haar, hatte sie einem Mädchen das Leben geschenkt, das das ewige Funkeln des Sternenhimmels mit ihren großen, klugen Augen eingefangen und jeden Tag ihres jungen Lebens damit erhellt, erheitert oder aber in den Wahnsinn getrieben hatte, je nach Gemütslage.
Ob sie immer noch so glänzten wie damals, als sie sie zuletzt gesehen, ein letztes Mal in die Arme geschlossen hatte? Ungestüm und lebensfroh, mit schier unstillbarem Wissenshunger und unablässig brennender Neugier auf alles und jeden gleichsam gesegnet wie geschlagen? Manchmal, an besonderen Tagen, wie der heutige einer war, fragte sie sich, ob Leila sich all das, was sie ausmachte, in der Obhut ihres Schwiegervaters hatte bewahren können. Oder hatte Raschid sie gebrochen, ihren außergewöhnlichen Charakter gezähmt, sie zu der hübschen, kleinen Zimmerpflanze beschnitten, die sie nie hatte werden wollen? Ob sie sie überhaupt noch wiedererkennen würde, wenn sie beide eines Tages vielleicht doch noch einmal einander begegneten ...?
Nicht dass Robin sich dieser Hoffnung ernsthaft hingab, denn Sheik Raschid Sinan hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er sie für die schlechte Mutter hielt, die sie vielleicht auch war. Das Versprechen ihres muselmanischen Schwiegervaters, ihr den schriftlichen Kontakt zu gewähren, hatte er nur ein einziges Mal eingehalten.
Etwa drei Monate nach ihrer Ankunft bei ben Abel hatte sie Emmanuel in Jerusalem ein erstes Schreiben zukommen lassen, das er an Sheik Raschid Sinan weitergegeben hatte und in dem sie beschrieb, was sich zugetragen habe und wohin sie gegangen sei. Und Sinan hatte tatsächlich geantwortet: Was Robins zuletzt arg zerrüttetes Verhältnis zu den Templern und ihre anschließende Flucht anbelange, wolle er nichts damit zu tun haben. Seine Geschäftsbeziehungen in die Reihen jedweder Christen stünden ohnehin auf bröckeligem Fundament, seit Guido von Lusignan das Königreich Jerusalem regiere und sich die Spannungen zwischen Muslimen und Christen auch in der Heiligen Stadt zunehmend bemerkbar machten. Er könne es sich zwar nicht erlauben, ihr Obdach zu gewähren, was einer groben Provokation seiner Nochhandelsfreunde gleichkäme, wolle sein Versprechen, nicht zwischen seiner Enkelin und seiner Schwiegertochter zu stehen, aber grundsätzlich einhalten. Wie zum Beweis für seine Worte, lag seinem Schreiben ein Bild bei, das Leila auf ein Stück Pergament gekritzelt hatte. Es zeigte ein Kamel und ein Ferkel unter einer Palme. Robins Herz hatte jubiliert.
Zu früh, wie sich bald gezeigt hatte.
Von allen anderen Briefen, die sie ihm über Emmanuel anvertraut hatte, war nicht ein einziger weiterer beantwortet worden. Leilas Bild trug sie in ihrem Lederbeutel wie eine Reliquie, die sie immer, wenn sie das inzwischen abgegriffene Pergament entfaltete, zu Tränen rührte.
Vielleicht hatte Sheik Raschid Sinan sich umentschieden und hielt ihre weiteren Briefe unter Verschluss oder verbrannte sie sogar. Und selbst wenn es irgendeine ganz harmlose Erklärung gab oder Raschid morgen tot umfiel oder er es sich schlicht anders überlegte: War es um Leilas Sicherheit wegen nicht trotzdem besser, wenn Robin sich zumindest räumlich von ihr fernhielt? Brachte sie nicht immer nur Unglück über alle, die sie liebte?
All diese Fragen quälten sie zunehmend, und der Drang, den Schutz der Juden hinter sich zurückzulassen und sich auf die Suche nach Antworten zu begeben, ließ nicht nach, sondern wuchs stetig an. Die Ungewissheit, wie es ihrer geliebten Tochter wohl ergangen sein mochte, und die Erinnerung an das, was geschehen war, taten entsetzlich weh.
Heute ganz besonders. Als wäre es gestern erst passiert, als hätte sie ihr Kind vor wenigen Stunden erst verloren.
»Du bist zusammengefahren, als ich den Namen genannt habe«, sagte Salusch nun. »Ich beobachte dich, Jael. Schon sehr lange und sehr genau. Wer ist Leila?«
Wie der Vater, so der Sohn, dachte Robin bei sich. Vor weniger als einer Stunde erst hatte Rabbi Abel sinngemäß dasselbe zu ihr gesagt. Aber das sprach sie nicht aus.
»Du solltest lieber Shiloh beobachten«, versuchte sie stattdessen vom Thema abzulenken und trieb Lilith an, um zwei, drei Schritte Vorsprung zu gewinnen. »Jedes Mal wenn du sie aus den Augen lässt, verletzt sie eine andere Frau.«
»Ja, sie ist sehr eifersüchtig«, seufzte Salusch und holte ungeachtet der Offensichtlichkeit, mit der Robin ihm bedeutet hatte, dass er ihr nicht zu nahe kommen solle, rasch zu ihr auf, wobei er Aaron am Strick hinter sich herzog. »Und was ich dir jetzt verrate, habe ich nie einem Menschen zuvor erzählt«, setzte Salusch hinzu. »Hin und wieder schlägt Shiloh sogar mich. Sie bespuckt mich, sie tritt mir wie versehentlich auf die Füße, und vergangene Woche Montag hat sie mich sogar gebissen. Hier.« Er krempelte den linken Ärmel seines Gewandes mit den Zähnen zurück und streckte den Unterarm in Robins Richtung. »Sieh dir das an. Es ist immer noch tiefdunkelblau. Sie hat so heftig zugebissen, dass ich dachte, sie wollte mir ein Stück Fleisch aus dem Arm reißen.«
Robin erschrak beim Anblick der dunklen Spuren, die Shilohs Zähne in der Haut ihres Mannes hinterlassen hatten. Wenn es wirklich anderthalb Wochen her war, dass dieses grausame Weibsbild mit Salusch aneinandergeraten war, dann musste es wirklich eine schmerzhafte Erfahrung für ihn sein.
Trotzdem ließ sie den Blick nach nur halbherziger Prüfung demonstrativ am Gladbach entlangwandern, denn sie hatte Saluschs Kalkül längst durchschaut: Ich erzähle dir etwas, was niemand weiß, und du vertraust mir eines deiner Geheimnisse an ...
So dachte er wohl. Aber darauf wollte sie sich nicht einlassen. So etwas hatte Salusch zuvor noch nie versucht, und Robin fand, dass er sich einen denkbar ungünstigen Tag dafür ausgesucht hatte, diese leicht aufdringliche Seite an sich zu entdecken.
»Trenne dich von ihr«, sagte sie darum nur und kniff die Lider zusammen, weil sie im Gestrüpp an der Böschung zum Bach eine Bewegung ausmachte. Ja, da war etwas am Ufer ... In vielleicht dreißig oder vierzig Schritten Entfernung. Zu groß für einen Hund und zu klein für einen erwachsenen Menschen. Ein Kind vielleicht. Sie konnte es nicht genau erkennen, weil das grell auf dem Wasser tanzende Sonnenlicht sie blendete. Außerdem verbarg sich das Etwas zu mehr als der Hälfte im dichten Ufergestrüpp.
»Willst du denn gar nicht wissen, warum sie es getan hat?«, erkundigte sich Salusch ein wenig gekränkt.
»Nein«, antwortete Robin ehrlich. Abgesehen davon, dass das Ausmaß der von Shiloh ausgehenden Gewalt sie zwar erschreckte, die Mitteilung darüber sie aber alles andere als unvorbereitet traf, weil Saluschs Weib für ihre hysterischen Anfälle aus heiterem Himmel berühmt-berüchtigt war, gab es für sie schlicht nichts, was rechtfertigen konnte, einem Menschen, den man angeblich liebte, etwas so Boshaftes anzutun.
Außerdem war sie sich jetzt sicher, dass es sich bei dem Etwas am Ufer tatsächlich um ein Kind handelte. Ebenso deutlich erkannte sie, dass es sich absichtlich im Gestrüpp zu verstecken suchte. Sie zügelte Lilith leicht und tätschelte ihren Hals. Vermutlich wollte der Bengel oder die Göre sie erschrecken, so genau konnte sie es immer noch nicht sehen. Sie nickte sachte in Richtung des Kindes, aber Salusch bemerkte ihre Geste nicht, weil er den Kopf gesenkt hielt.
»Ich sag’s dir trotzdem«, sagte er. Nicht nur aus seiner Haltung, sondern auch aus seiner Stimme klang Scham, aber weder das noch Robins demonstrative Gleichgültigkeit, hinderten ihn daran, fortzufahren: »Sie ist wütend, weil ich ihr immer noch kein Kind geschenkt habe. Seit vier Jahren sind wir verheiratet, seit ebenso langer Zeit nötigt sie mich mit allen verfügbaren Mitteln, spätestens jede dritte Nacht bei ihr zu liegen. Ausgenommen die Zeit, die sie in der Mikwe zubringt, und das ist zum Glück nicht wenig. Und trotzdem hat sie noch nicht ein einziges Mal empfangen. Sie sagt, ich sei ein Versager. Und ein Betrüger noch dazu. Sie glaubt, ich verschwende meinen Samen an andere Frauen und lasse ihr nur das unbrauchbare Wasser.«
Robin zog eine Grimasse, sagte aber nichts. Sie hatte das nicht wissen wollen, und schon gar nicht so genau.
»Wo du gerade von Wasser sprichst, da drüben ...«, begann sie, aber Salusch beachtete sie weiterhin nicht. Wahrscheinlich glaubte er, dass sie ihn nur vom Thema abbringen wolle, um allzu vertrauliche Konversationen zu vermeiden. Und völlig falsch lag er damit ja nicht. Nur gab es gerade einen weiteren guten Grund, das Reden einzustellen und sich in Achtsamkeit zu üben.
»Glaubst du das auch, Robin?«, fragte Salusch. »Dass ich ein Versager bin, weil es mir einfach nicht gelingt, ein Kind zu zeugen? Dass ich nur nutzloses Wasser hervorbringe, weil ...«
Ein großer Klumpen aus nassem Dreck, Algen und Ungezieferlarven landete klatschend in Saluschs Gesicht. Der Rest seines Satzes versiegte in einem feuchten Keuchen seinerseits, dem erschrockenen Schnauben der jäh herumtänzelnden Pferde und im schallenden Gelächter zweier Kinder, die jetzt aus dem Gestrüpp an der Böschung auf den Pfad hüpften, ihre Zungen zeigten und freche Grimassen schnitten, ehe sie Hand in Hand über den schmalen Bach sprangen und zielsicher auf den Jakobshof zurannten.
»Verfluchte Gojim!«, schimpfte Salusch. Mit den Fingern kämmte er sich Schlamm, Grünzeug und Kröten-eier aus dem dichten, blonden Bart, aber allzu verärgert klang er dabei trotzdem nicht. So leicht war Salusch nicht aus der Ruhe zu bringen. Da musste schon ein ausgewachsener Froschregen mit Blindschleichenbeilage her. Mindestens.
»Kinder ...« Robin zuckte die Achseln und sah dem Jungen und dem kleineren Mädchen, die in Richtung Jakobshof liefen, kopfschüttelnd nach, ehe sie Lilith wieder vorantrieb.
»Ja ... Kinder« Salusch nickte. »Glaubst du also auch, dass ich Shiloh kein Kind schenken kann, weil ich ... Also, weil ...«
Robin seufzte. Offenbar wollte ihr Freund sich unbedingt vor ihr bloßstellen, sie würde ihn nicht davon abhalten können. Letztlich würde sie sich ja trotzdem nicht zu einer Art Gegengeständnis nötigen lassen müssen. »Weil was, Salusch?«, hakte sie also widerwillig nach.
»Ich betrüge sie nicht!« Salusch hob abwehrend eine Hand und schüttelte die goldenen Ohrlocken in der sommerlichen Brise, die ihnen um die Ohren pfiff. »Höchstens, na ja ... höchstens mit mir selbst«, gestand er kleinlaut.
Das war nun wirklich eine Auskunft, auf die Robin gern verzichtet hätte.
»Salusch, bitte!«, stöhnte sie. »Ich weiß nicht, warum du mir all diese Dinge erzählst, die mich nicht das Geringste angehen. Und schon gar nicht weiß ich, was du von mir hören willst. Wende dich an deinen Vater, der wird dir sicher etwas dazu sagen können.«
»Damit du weißt, dass du mir vertrauen kannst«, erklärte Salusch, was Robin ohnehin längst geahnt hatte. »Ich bin ehrlich zu dir, also kannst du auch ehrlich zu mir sein. Die Menschen in der Siedlung halten dich für verrückt. Für dumm, ungläubig und unbelehrbar. Aber das bist du nicht. Nichts von alledem. Du bist nicht Jael ben Simon.«
»Und vor allen Dingen bin ich gleich nicht mehr da, wenn du nicht aufhörst zu schwatzen«, fauchte Robin und bremste Lilith etwas härter als beabsichtigt. »Wir können gemeinsam nach Gladbach reiten, oder du reitest allein, Salusch. Du wirst dir mein Vertrauen nicht erbetteln, ganz gleich welche Peinlichkeiten du mir gegenüber preisgibst. Ich weiß, du meinst es nicht böse, und offensichtlich hat dein Vater dich auf mich angesetzt, weil er glaubt, dass ich jemand wie dich brauche. Ein offenes Ohr und eine starke Schulter zum Anlehnen und all diesen Unsinn. Aber dem ist nicht so. Ich brauche weder dich noch sonst irgendjemand. Hast du mich verstanden?«
Ihre Worte waren eine zu harte Wahl und taten ihr schon leid, ehe sie sie ganz ausgesprochen hatte. Aber nicht allein ihr Stolz, sondern allem voran ihr Bestreben, nicht weiter mit persönlichen Fragen gequält zu werden, hielten Robin davon ab, auch nur eine Silbe zurückzunehmen oder sich gar bei ihrem Freund zu entschuldigen. Der hatte sein Pferd ebenfalls gezügelt und musterte sie nun aus seinen klaren, hellen Augen in einer eigenwilligen Mischung aus Erschrecken, Enttäuschung, Unverständnis und Mitgefühl.
»Gut«, willigte er nach einem unangenehm langen Moment des Schweigens ein. »Wenn du darauf bestehst, soll es eben so sein. Wenn du es so willst, behandle ich dich weiterhin wie die ewige Fremde, in deren Rolle du dich offenbar so wohl fühlst. Wenn du alles als Angriff auslegst, sehe ich davon ab, dir beide Hände zu reichen und dich an ein trockenes Ufer zu ziehen, obwohl ich klar und deutlich sehe, dass du in Einsamkeit ertrinkst.« Er ließ die kräftigen Schultern hängen, wandte sich wieder von ihr ab und trieb Aaron am goldglänzenden Korn entlang. »Solltest du es dir irgendwann anders überlegen, werde ich weiterhin für dich da sein«, setzte er hinzu.
Robin schloss kurz die Augen, atmete die lauwarme und doch frische Luft des Sommermorgens ein, um sich wieder zu sammeln, und drückte Lilith sanft die Fersen in die Seiten, damit sie wieder Schritt aufnahm.
Einerseits fühlte sie sich im Recht: Vertrauen ließ sich nicht erbetteln, ihres am allerwenigsten. Andererseits tat es ihr wirklich leid, so hart mit Salusch ins Gericht zu gehen, der ihr in all den Jahren nie etwas Böses getan hatte, sondern ihr bei jeder sich bietenden Gelegenheit bei der Arbeit zur Hand ging, und von dem sie sehr genau wusste, dass er einer von sehr wenigen Menschen in der Siedlung war, die niemals hinter vorgehaltener Hand über sie lästerten oder sich lustig machten.
In ihrem früheren Leben hätte der Jude ein echter Freund für sie sein können. Ein durch und durch liebenswerter, herzensguter Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte und sich tatsächlich eher von seiner Frau verprügeln ließ, als dass er die Stimme gegen sie erhob oder sich auch nur beim Rabbi über sie beklagte.
Aber ihr altes Leben war vorbei. In ihrem neuen Leben war sie allein. Denn nur allein fühlte sie sich sicher.
Robin gab sich trotzdem einen Ruck. Sie musste ihre Grundhaltung ja nicht unbedingt ändern und konnte sich dabei dennoch etwas weniger verständnislos und kaltherzig geben.
»Salusch?«, sagte sie verhalten und zwang sich, dem Juden kurz in die Augen zu blicken, als er sich zu ihr herumdrehte.
Salusch lächelte offenherzig. »Ja?«, antwortete er.
So war er eben, dachte Robin und fühlte sich umso schlechter. Unerschütterlich in seiner Treuherzigkeit und Freundlichkeit, niemals nachtragend und immer bereit, jemand, der ihm eine Hand abhackte, mit der verbliebenen die Stiefel zu flicken, wenn man ihn nur höflich darum bat.
»Was Shiloh angeht ...« Robin seufzte tief und holte wieder zum Erstgeborenen des Rabbis auf. »Schlag das nächste Mal einfach zurück. Versohl ihr den Hintern, bis sie nicht mehr weiß, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Wenigstens ein einziges Mal. Ich glaube, sie braucht das.«
2. KAPITEL
»Du warst großartig!« Robin strahlte, als sie den Markt nach Einbruch der Dunkelheit wieder verließen. An Ezras Sattel baumelte ein Sack voller Öle und Kräuter, an Robins Gürtel nichtsdestoweniger ein prall gefüllter Lederbeutel, in dem die Münzen mit jedem Schritt, den Aaron zurücklegte, fröhlich klimperten. »David wird Augen machen, wenn er sieht, welchen Betrag du aus den beiden Tieren geholt hast«, lobte sie den Salusch.
»Und vor allem wird er sich darüber wundern, dass du deinen Lieblingsgaul trotzdem wieder mit nach Hause bringst«, antwortete er.
Das Funkeln seiner Augen in der Dunkelheit verriet das zufriedene Lächeln, das über seine Miene huschte. Robin erwiderte es voller Dankbarkeit. Für einen Moment blickte sie still in den sternenklaren Himmel hinauf und sog die warme Sommernachtsluft tief ein. Für einen kleinen Augenblick war die Welt wieder in Ordnung. Sie ritt auf einem Pferd, das sie nicht hergeben wollte, neben einem Freund, der sie unterstützte, wo immer er konnte. Was Salusch für sie getan hatte, spendete ihr ein wenig Trost an diesem düsteren Tag, und morgen sah die Welt gewiss wieder ganz anders aus. Morgen würde sie sie endlich so annehmen können, wie sie eben war, und sich von ganzem Herzen an ihrem persönlichen, kleinen Glück erfreuen, das das Gestüt für sie bedeutete.
»Die beiden waren kaum mehr als die Hälfte wert. Aber den Stammbaum bis zu Kaiser Barbarossas Schlachtross hat dieser stumpfsinnige Pfaffe mir blind abgekauft.« Salusch lachte. »Ich kann selbst kaum fassen, wie einfach das war.«
Auch Lilith hatte den Besitzer gewechselt. Salusch hatte die junge Stute dem gleichen Kleriker aufgeschwatzt, dem er auch sein eigenes, ohnehin in die Jahre gekommenes Reitpferd verkauft hatte. Dem Juden war es gleich, wer ihn über Stock und Stein trug, Hauptsache, er musste nicht zu Fuß gehen. Und so ritt er jetzt eben Ezra, wozu er nichts anderes tun musste, als sich auf dessen Rücken zu halten, weil der Hengst Robin aufs Wort folgte.
»Trotzdem solltest du dich an den Gedanken gewöhnen, dass du Aaron nicht mehr allzu lange behalten wirst«, sagte der Jude nach einer Weile. »Wenn Emmanuels Freund aus Jerusalem nicht bald eintrifft, wird David ihn weiterhin verkaufen wollen.«
»Emmanuels Pferde kamen noch immer pünktlich«, winkte Robin ab. »Das sagt zumindest David.«
Der bald bevorstehende Besuch des Vertrauten ihres alten Bekannten und Geschäftsfreundes aus dem Heiligen Land war ein weiterer kleiner Lichtblick in all der Finsternis, in der sie sich noch heute Mittag so verloren gefühlt hatte. Vielleicht brachte er endlich einen neuen Brief für sie mit? Auf jeden Fall würde sie ihm gewiss das Versprechen abringen können, ein weiteres Schreiben ins Morgenland zu tragen – wobei sie dieses Mal nachdrücklich auf einer Antwort bestehen würde ...
»Und er hat laut dem Stallmeister auch noch immer wunderbare Tiere geschickt«, sagte sie. Wahrheitsgemäß fügte sie hinzu: »Mir war ursprünglich gar nicht bewusst gewesen, dass Emmanuel auch mit Pferden handelt.«
Mit den ersten Arabern, die Emmanuel aus dem Morgenland an den nasskalten Niederrhein gebracht hatte, hatte er vor vielen Jahren den Grundstein für den ansehnlichen Erfolg der Zucht gelegt. Im Vergleich zu den prachtvollen, meist schwarzen Pferden der Muselmanen, wirkten die Tiere, die hierzulande immer noch weit in der Überzahl waren, geradezu mickrig. Auch die Kreuzun-gen aus beiden Rassen, wie beispielsweise Ezra eine war, konnten mit einem echten Vollblutaraber längst nicht mithalten.
Salusch zügelte Ezra und saß ab. Robin bremste Aaron.
»Was ist?«, fragte sie alarmiert.
»Nichts«, erwiderte Salusch und hielt ihr eine Hand hin. »Komm, lass uns ein Stück laufen, vielleicht eine Rast einlegen und endlich all den Abfall aus der Speisekam-mer vertilgen, den Shiloh mir so reichlich in den Beutel gestopft hat.« Als Robin sich bereits vom Rücken des Hengstes geschwungen hatte, setzte er hinzu: »Ich will, dass du mir mehr erzählst ...«
Sie wandte sich abrupt ab und wollte sofort wieder aufsitzen, aber Salusch hielt sie an der Hand gepackt zurück und zog sie dicht zu sich heran.
»Ich weiß, dass du dich fürchtest, Jael, wenngleich ich keine Vorstellung habe, wovor«, sagte er. »Nicht die geringste. Aber ich weiß auch, dass du mir vertrauen kannst. Immer und jederzeit. Unter allen Umständen. Und ich sehe, dass du einsam und unglücklich bist. Das will ich nicht. Wir sind Freunde. Was umso bemerkenswerter ist, als wir doch auch nach zwei Jahren immer noch so gut wie nichts voneinander wissen.«
Robin presste die Lippen aufeinander und wandte den Blick ab. Sie spürte, wie ihre Augen zu glühen begannen, und versuchte ihre Hand zurückzuziehen. Niemand sollte sie berühren, auch und erst recht nicht Salusch. Niemand sollte sie weinen und diese elende Schwäche sehen. Diese Schwäche, die sie erst ihren Mann und schließlich ihre Tochter gekostet hatte ...
Plötzlich war alles wieder, wie gehabt: Heute war Leilas Geburtstag, und Robin fühlte sich unbeschreiblich elend. Gleichzeitig schämte sie sich, und auch darum versuchte sie sich aus Saluschs Griff zu winden, aber der Jude ließ sie nicht wieder davonlaufen. Sie konnte sich nicht einmal von ihm wegdrehen, weil er sie nun noch dichter zu sich heranzog und ihren Kopf mit sanfter Gewalt gegen seine Brust drückte.
Robin spürte seinen ruhigen Herzschlag und fühlte die Wärme seiner Haut unter dem dünnen Leinengewand.
Oder war das nur ihr eigener Puls ...?
Robin erinnerte sich daran, wie sie ihr Ohr auf Salims Leichnam gedrückt hatte. Wie sie dem Herzschlag des Sarazenen, der Liebe ihres Lebens, zu lauschen geglaubt hatte, Leichenfäule mit Wundbrand verwechselnd, weil sie es einfach nicht hatte wahrhaben wollen, weil sie seinen Tod im Wahn schlicht und ergreifend ausgeblendet hatte ...
Sie versteifte sich. Ihr Magen zog sich schmerzlich zusammen.
»Ich habe dich zu gern, als dass ich zusehen könnte, wie du im Stillen leidest«, redete Salusch leise auf sie ein. »Es ist dir überlassen, der Gemeinde die Verrückte aus Jerusalem vorzuspielen, die man hierher geschickt hat, weil sie ihrer Familie nichts als Kummer bereitet. Du spielst die Rolle übrigens sehr gut. Kaum jemand zweifelt an deiner Mär.« Er lächelte und hob ihr Kinn mit den Fingerspitzen an, um ihr geradewegs in die Augen zu sehen. »Nur ich. Ich weiß, dass du weder verrückt noch unbequem bist. Ich weiß, dass du große Sorgen hast, über die du nicht sprechen willst, mit denen du allein aber niemals fertig wirst. Ich sagte doch: Ich beobachte dich. Weil ich dich gern habe, Jael. Sehr gern.«
Robin versuchte, den bitteren Kloß hinunterzuschlucken, der sich in ihrer Kehle zusammenbraute. Aber es gelang ihr nicht. O zum Teufel – warum mussten Freud und Leid nur stets so eng beieinander wohnen? Weshalb musste Salusch sie plötzlich so unter Druck setzen, wieso konnte nicht alles einfach bleiben, wie es war? Sie und er lebten ihr neues, anderes Leben in der unausgesprochenen Vereinbarung, dass der Kalender auf das Jahr null nach egal zurückgedreht war und eine andere Zeit begonnen hatte. Sie mochten sich einfach. Zwischen ihnen beiden war das Gestern Vergangenheit und nicht der Rede wert. Und das war doch alles gut so!
Oder?
Nein, das war es nicht. Und im Grunde ihres Herzens wusste Robin das auch selbst. Nicht nur weil heute Leilas Geburtstag war, sondern in so vielen Momenten, in denen sie sich wünschte, dass alles anders verlaufen wäre, dass sie niemals mit diesen dreimal verfluchten Templern zusammengestoßen wäre, dass sie Salim am besten nie kennengelernt hätte, als mit ansehen zu müssen, wie er starb, wie sein Vater ihre Tochter raubte, wie alles, was sie mit Schmerz, Entbehrungen und unendlich viel Herzblut gewonnen hatte, plötzlich zu einem Haufen ebenso nutzloser wie gefährlich scharfer Scherben zusammenfiel. Momente, in denen sie spürte, wie entsetzlich allein sie in Wirklichkeit war.
Momente, in denen nur Salusch sie beobachtete. Insgeheim.
»Ich mag dich auch, Salusch«, flüsterte sie. »Aber ...« Sie schüttelte den Kopf. »Wozu sollte das gut sein?«
»Was?«, hakte Salusch nach.
Robin holte tief Luft und heftete ihren Blick fest in seinen. Salusch würde lächeln, das wusste sie. Er lächelte immer. Aber sie wollte wissen, was er wirklich fühlte, wenn sie wenigstens ein Stück weit mit dem herausrückte, was er wissen wollte.
»Ich bin Christin«, sagte sie.
Und tatsächlich: Da war ein kurzes Flackern in seinen blauen Augen. Erschrecken? Ärger? Abneigung?
Salusch schob sie auf Armeslänge von sich weg.
»Zum Teufel, eine Schickse!«, entfuhr es ihm übermäßig pikiert. »Los, Jael! Lauf! Ich suche noch schnell nach etwas, womit ich dich anzünden kann ... Warte!« Er lachte und zog sie wieder zu sich heran, schob ihr Kopftuch über die Schultern und wuschelte ihr durch die schlaffen Locken. »Und darum spielst du dem Dorf eine Bekloppte aus dem Morgenland vor?« Er schüttelte den Kopf. »Du erzählst mir nichts Neues. Du gehst nach Möglichkeit nicht mit den anderen Frauen in die Mikwe, bist kaum in der Lage, einen hebräischen Satz korrekt auszusprechen und wartest auf die geheimen Handzeichen meines Vaters, die dir sagen, in welcher Reihenfolge du die Speisen zu dir nehmen sollst. Ich bin nicht blind, und die meisten anderen auch nicht. Du kannst es auch ihnen sagen. Ein paar werden hinter dir auf den Boden spucken, aber mehr auch nicht. Zumindest nicht in unserer Siedlung. Mein Vater wird nie davon ablassen, uns alle an die Tugend der Nächstenliebe zu erinnern. Den meisten wird es gefallen, endlich zu erfahren, warum du vier von fünf Gebeten ausfallen lässt. Du könntest endlich Freunde finden. Neben mir.«
Robin hob schwach die Achseln und deutete ein Kopfschütteln an.
»Aber daran liegt dir nichts«, stellte Salusch betrübt fest. »Ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, dass du den Pferden mehr vertraust als den Menschen, Jael, aber ... O verdammt!«
Mein Name ist nicht Jael, sondern Robin! Robin unterdrückte die Worte, die ihr plötzlich wie heiße Kohlen auf der Zunge brannten, fast mit Gewalt. Ich bin mit einem Sarazenen verheiratet, der vor zweieinhalb Jahren vor meinen Augen gestorben ist, in meinen Armen sogar – aber ich habe es nicht gesehen, verstehst du das, Salusch? Kannst du dir vorstellen, wie es ist, einen Menschen, den man liebt, beim Sterben zu beobachten, ohne es zu sehen? Und wenn man den Tod auch noch verschuldet, weil man als Ehefrau und Mutter auf ganzer Linie versagt und seine Familie aus purem Egoismus in eine tödliche Gefahr nach der nächsten manövriert hat? Weil man unfähig war, sein Kind zu erziehen, auf es aufzupassen und es zu erziehen? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Schwiegervater einem sagt, dass man keine gute Mutter sein kann – und damit auch noch recht hat? Hast du eine Vorstellung davon, wie es einem das Herz zerreißt, wenn man hilflos zusehen muss, wie jemand einem das eigene Kind nimmt?!
Nein, das alles wusste Salusch nicht. Nichts davon konnte er wissen, und nichts davon sollte er wissen. Und erst recht sollte er nicht den Fehler begehen, auch nur einen halben Schritt in ihr altes Leben zu wagen, das sie samt und sonders hinter sich gelassen hatte, um sich in einer kleinen Siedlung am Niederrhein davor zu verstecken. Vor ihrem alten Leben und vor ihren Feinden, die keinen Lidschlag zögern würden, sich jeden, der ihr nahestand, zum Feind zu machen oder gleich zu enthaupten.
Doch ehe Robin in Versuchung geraten konnte, eine Silbe der tausend Worte auszusprechen, die ihr plötzlich auf der Zunge brannten, bemerkte sie, dass der Jude über ihre Schulter hinweg über das nächtliche Feld starrte. Und als er seine Umklammerung lockerte und Robin seinem Blick folgte, verpufften all ihre persönlichen Sorgen zur Bedeutungslosigkeit.
»Der Jakobshof!«, entfuhr es Salusch in der Sekunde, als sie das Fürchterliche selbst erblickte. »Er brennt!«
Grellgelbe und rote Flammen züngelten meterhoch in der nächtlichen Finsternis, wo sich der neue Kornspeicher des christlichen Nachbarn befand, und Robin spürte, wie ihr Herz stockte. Sie zögerte keinen Moment und schwang sich binnen eines Atemzuges in Aarons Sattel, um ihn praktisch aus dem Stand in Galopp zu setzen. So schnell seine Hufe ihn trugen, preschte der Hengst durch das hüfthohe Korn, dicht gefolgt von Ezra mit Salusch, der ebenfalls rasch aufgesessen war.
Zielsicher jagten sie über den Gladbach hinweg auf den Nachbarshof zu, den sie wie das lodernde Tor zur Hölle selbst nach der Dunkelheit der Nacht geifern sahen. Minuten später, die sich wie Stunden anfühlten, erreichten sie das Grundstück, und aus der Nähe betrachtet, wirkte das Inferno umso entmutigender. Sowohl der Viehstall als auch der neue Kornspeicher des Jakobshofs brannten lichterloh. Ein paar Schweine und teils brennendes Geflügel jagten panisch über den Hof – längst zehrten die Flammen auch am Wohnhaus der Bauernfamilie, die neben einer Robin nicht bekannten Menge von Kindern eine Magd, zwei Knechte, die Mutter der Kinder sowie Jakob selbst zählte. Es gab ein oberes Stockwerk im Wohnhaus, und Robin sandte ein Stoßgebet an eine unbestimmte Größe, dass sich die Familie zum Schlafen genau dorthin zurückgezogen hatte, statt in der Stube zu nächtigen. Oder dass sie sich – noch besser – längst ins Freie geflüchtet hatten. Denn auch aus dem äußersten Fenster des Untergeschosses schlugen bereits die ersten Flammen ins Freie.
Offenbar gab es einen Durchgang zwischen Kornspeicher und Wohnbereich. Gefährlicher architektonischer Unsinn, weil sich das Feuer so rasch seinen Weg durch den schmalen, tunnelartigen und wahrscheinlich mit Stroh oder Spänen ausgelegten Flur hatte bahnen können.
Beißender Qualm fraß sich in Robins Lunge, als sie Aaron nun so dicht an den Hof herantrieb, wie es möglich war, ohne den Hengst zu gefährden. Sie sprang aus dem Sattel.
»Oben!«, keuchte eine zierliche Frau, die Robin nur als rußige Geistergestalt in all dem Rauch ausmachen konnte, der aus Kornspeicher und Viehstall drang. »Ludger ist oben im Kornspeicher ... Die Kerzen ... Wir haben ... Ich habe versucht, ihn zu wecken, aber er wacht einfach nicht auf ... Er schläft einfach weiter, und ich konnte nicht ... Ich bin zu schwach, ihn ...«
»Wo sind die Kinder?«, unterbrach Robin die hervorgehusteten Worte der junge Frau.
Wer auch immer sich jetzt noch im Kornspeicher befand, war ohnehin nicht mehr zu retten, so grausam das auch war. Sie packte die Magd an den Schultern, weil die anstelle einer Antwort nur kraftlos die Augen verdrehte und zusammenzubrechen drohte.
»Wo sind die Kinder?«, wiederholte Robin laut und nachdrücklich. Sie musste sich beherrschen, dass sie die junge Frau nicht ungehalten durchschüttelte.
Das ruß- und tränenverschmierte Gesicht der Magd verwandelte sich in eine entsetzte Grimasse. Offenbar begriff sie mit einem Mal, dass die Flammen, die sie möglicherweise selbst verschuldet hatte, nicht nur ihren Begleiter im Kornspeicher bedrohten, sondern auch die gesamte Familie ihres Herrn.
»Auch ... oben ...«, presste sie mühsam hervor. Salusch fing sie auf, als ihre Beine plötzlich ihr Gewicht nicht mehr trugen. »Im Dachgeschoss ... Jakob und Else ... sind ...«
Mehr brachte sie nicht hervor. In diesem Moment verließ sie endgültig die Kraft, sodass sie zu Robins Füßen auf den Boden geschlagen wäre, hätte Salusch sie nicht gehalten. Mit unerwarteter Leichtigkeit schwang der Jude sich die Magd über die Schulter und trug sie einige Schritte ins freie Feld hinaus, ehe er zu Robin aufschloss, die das Wohnhaus der Familie schon erreicht hatte, wo sie die Haustür kurzerhand auftrat.
Dichter, schwarzer Rauch schlug ihr entgegen. Mit der einen Hand wickelte Robin sich ihr Kopftuch um Mund und Nase, während sie sich mit der anderen voran durch das tiefdunkle, beißende Grau tastete, das ihr Tränen in die Augen trieb und ihre Haut versengte. Sie glaubte zu spüren, wie sich die feinen Härchen im Nacken und an der Stirn in der Hitze kräuselten und zu heißer Asche zerfielen, aber das spielte jetzt keine Rolle.