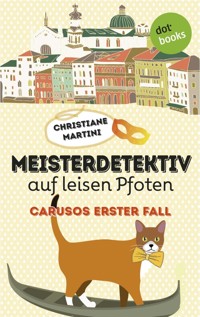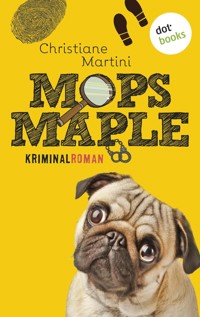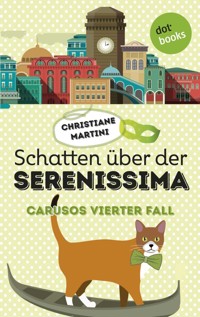Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit: Der mitreißende Historienroman »Die Tochter der Kräuterhexe« von Christiane Martini als eBook bei dotbooks. Zwischen teuflischem Irrglauben und den Stürmen der Zeit … Bayern, 1702: Ihre Mutter wurde als Hexe hingerichtet – und die junge Anna dazu verurteilt, den Rest ihres Lebens in einem Kloster zu dienen. Doch auf dem beschwerlichen Weg durch tiefe Alpenschluchten gelingt es Anna, den Häschern der Inquisition zu entkommen. In einer kleinen Marktgemeinde findet sie als Mann verkleidet Unterschlupf und Anstellung bei einem Geigenbauer. Hier hofft sie auf einen Neubeginn – bis Anna sich in den Handwerksgesellen Moritz verliebt und beide Opfer einer Intrige werden, in die ihr Meister und ein skrupelloser, venezianischer Söldner verstrickt sind. Anna bleibt nur eine Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen: Sie muss die gefährliche Reise ins ferne Venedig wagen ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende historische Roman »Die Tochter der Kräuterhexe« von Christiane Martini. Der Roman ist auch bekannt unter »Die Meisterin aus Mittenwald« und wird Fans von Andrea Schacht und Sabine Martin begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwischen teuflischem Irrglauben und den Stürmen der Zeit … Bayern, 1702: Ihre Mutter wurde als Hexe hingerichtet – und die junge Anna dazu verurteilt, den Rest ihres Lebens in einem Kloster zu dienen. Doch auf dem beschwerlichen Weg durch tiefe Alpenschluchten gelingt es Anna, den Häschern der Inquisition zu entkommen. In einer kleinen Marktgemeinde findet sie als Mann verkleidet Unterschlupf und Anstellung bei einem Geigenbauer. Hier hofft sie auf einen Neubeginn – bis Anna sich in den Handwerksgesellen Moritz verliebt und beide Opfer einer Intrige werden, in die ihr Meister und ein skrupelloser, venezianischer Söldner verstrickt sind. Anna bleibt nur eine Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen: Sie muss die gefährliche Reise ins ferne Venedig wagen ...
Über die Autorin:
Christiane Martini ist Autorin und Musikerin. Sie liebt es, an ihrem Schreibtisch mit Blick in den Garten zu sitzen und an vielfältigen Projekten zu arbeiten. Dazu gehören Romane in verschiedenen Genres, von Cosy Crime über historische Romane bis Familiensagas, wie auch musikalische Lehrwerke und Drehbücher. Mit ihrer Tochter gründete sie 2021 die Plattform »Writers Concept«, mit der sie angehende AutorInnen unterstützen und den Artist Lounge Podcast, in dem sie mit KünstlerInnen aus verschiedensten Kunstrichtungen sprechen. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien als Autorin und Musikerin. Mit ihrer Familie und Beagle Buddy lebt sie in der Nähe von Frankfurt.
Christiane Martini veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romane »Mops Maple« und »Saitensprung mit Kontrabass« sowie ihre humorvollen Kriminalromane »Tote Oma mit Schuss«, »Tote Oma auf Eis«, »Tote Oma Ahoi!« und »Tote Oma im Weihnachtsfieber«. Die ersten drei »Tote Oma«-Bände sind auch im Sammelband »Mord mit Seebrise« erhältlich.
Die Reihe um den schlauen Kater Caruso und seine Katzenbande umfasst bei dotbooks die folgenden Bände:»Meisterdetektiv auf leisen Pfoten – Carusos erster Fall«»Venezianischer Mord – Carusos zweiter Fall«»Die venezianische Schachspielerin – Carusos dritter Fall«»Schatten über der Serenissima – Carusos vierter Fall«Alle vier Fälle sind auch im Sammelband erhältlich: »Mord in der Lagunenstadt – Kater Caruso ermittelt in Venedig«.
***
Aktualisierte eBook-Lizenzausgabe Juni 2023
Dieses Buch erschien bereits unter dem Titel »Die Meisterin aus Mittenwald« 2014 im Monogramm Verlag und 2015 bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2014 Monogramm Verlag, Weyhe
Copyright © der eBook-Lizenzausgabe 2015 und 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/hoverfly, Kathy SG, ifi Studio und eines Gemäldes von Luca Carlevarijs »Piazza San Marco«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-784-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Tochter der Kräuterhexe«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christiane Martini
Die Tochter der Kräuterhexe
Historischer Roman
Stephan, Katharina und Victor gewidmet, die mit mir eine unvergessliche Recherchefahrt nach Mittenwald unternommen haben. Ihr seid so wundervoll!
Prolog
Es war finstere Nacht. In einen dunklen Umhang gehüllt ging der Padre ruhigen Schrittes über die Ponte della Paglia, er hatte keinen Schlaf finden können. Plötzlich blieb er stehen, denn in sein Ohr drangen die Klänge unglaublich traurigen Violinspiels. Ergriffen blickte er sich um. Woher kam nur diese anrührende Musik? Da war doch nur das schmutzige Wasser des Rio di Palazzo, das verzagt plätscherte, die dunklen Gemäuer des Dogenpalastes und die grauschwarzen, hoffnungslosen Mauern des Prigione Nuove, die vor ihm emporragten. Der Priester legte die Hände andächtig ineinander, verharrte still und lauschte. Nach einer Weile gab es für ihn keinen Zweifel mehr, die Klänge drangen aus dem Gefängnis heraus.
»Die Beklemmung der Haft muss schwer auf dem Eingesperrten lasten«, dachte der Padre, »nur allzu verzweifelt klingt sein Spiel. Aber ein Mensch mit so tiefen Empfindungen, gesegnet mit einer solchen Gabe, kann nicht hinter diese schmutzigen Gefängnismauern gehören. Jemand, der in dieser Weise Violine spielt, ist kein übler Mensch, dessen bin ich gewiss. Warum nur, um Gottes Willen, hat man ihn in ein erbärmliches Verlies gesperrt? Ein einfacher Taschendieb oder unbedeutender Missetäter, der dort einsitzen muss, ist er wohl nicht.«
Das Licht der Laterne erhaschte das Haar des Priesters, es war ungewöhnlich rot. Er hielt sich an den feuchten Steinen der Mauer fest und schloss die Augen.
»Warum wohl hat man dem Gefangenen die Geige nicht abgenommen?«, ging es ihm durch den Kopf. »Ob er eine für Venedig bedeutende Person ist? Doch kenne ich jeden, der Violine spielt und sein Instrument beherrscht.« In Gedanken ging er eine Reihe von Namen durch: »Scarlatti, Lotti, Corelli … Mit Corelli habe ich noch vor ein paar Tagen einen Becher guten Weines geleert. Und die beiden anderen sind rechtschaffene Musiker. Strano – sehr seltsam. Womöglich hat man den Gefangenen mit dem Schiff hergebracht, vielleicht ist er ein Galeerensträfling und kommt gar nicht aus Venedig, sondern aus Tirol oder Bayern.« Der Priester wusste, dass Venedig für seine Galeeren häufig Häftlinge einkaufte und solcherlei Geschäfte gerne mit dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern betrieb. »Dann müsste er ein Hochverräter, Schmuggler, Totschläger oder gar ein Mörder sein, aber dann hätte man ihm gewiss nicht das Instrument gelassen. Nur, was hat er sich zuschulden kommen lassen?«
Der Priester senkte den Kopf, um dem Violinspiel noch aufmerksamer zu lauschen. Er bemerkte, dass sich die Trostlosigkeit der harmonischen Wendungen änderte. Es waren nun nicht mehr Schmerz und Unglück, die aus den Mauern des Gefängnisses zu flüchten versuchten, sondern tiefe Sehnsucht.
»Auch wenn ich mir geschworen habe, den Ort des Grauens nicht mehr so schnell zu betreten, muss ich alsbald in die Zelle dieses Menschen gelangen, um seiner ansichtig zu werden. Ich muss wissen, wer da spielt und erfahren, wer die wundervolle Violine gebaut hat.«
Plötzlich verklang das Geigenspiel und zurück blieb eisige, bedrückende Stille. Enttäuscht, jedoch mit großer Entschlossenheit, wendete sich Antonio Vivaldi zum Gehen und verschwand in der Dunkelheit der Serenissima.
Teil 1
Kapitel 1
Seit den frühen Vormittagsstunden brannte die Augustsonne unermüdlich hernieder. Mücken und Bremsen surrten durch die Luft und belagerten den Tross der Inquisition, der auf dem Weg zu einem Kloster in den Alpen war. Auf dem vorderen Fuhrwerk saß ein Mädchen, schön von Gestalt, aber mit nach innen gekehrtem, tieftraurigem Blick. Der Inquisitor hatte bestimmt, sie zur Errettung ihrer Seele in die Obhut eines Nonnenordens zu geben.
Langsam bewegten sich Pferde und Reiter in der sengenden Hitze. Plötzlich kam Wind auf und fuhr durch die Blätter des buschgesäumten Pfades. Doch die kurzzeitige Luftbewegung verflog wieder und zurück blieb die unbarmherzige Wärme.
Anna wischte sich über die feuchte Stirn und zog einen mit kleinen Muscheln verzierten Messingkamm aus ihren langen Haaren. Dieses floss ihr wie glänzendes Gold über die Schultern. Das Mädchen schaute den Kamm an und strich zärtlich mit den Fingerspitzen über ihn. Er war ein Geschenk, mit dem ihre Mutter, Maria Muringer, sie zu ihrem siebzehnten Geburtstag überrascht hatte. Dieser Tag lag gar nicht lange zurück, es war vor drei Monaten gewesen, Frühsommer in Augsburg, man schrieb das Jahr 1703.
Anna und ihre Mutter streiften durch die saftigen Blumen- und Kräuterwiesen hinter den mächtigen Stadtmauern Augsburgs. Es war ein wahres Vergnügen für sie, denn das Gras raschelte sachte im Wind, bunte Falter tänzelten heiter herum und Vögel pfiffen ausgelassen ihre Melodien. Wiesenglockenblumen, Graslilien, Sonnenröschen, Schafgarbe, Margeriten und Sandthymian leuchteten in einem Wildblütenmeer um die Wette.
An diesem Nachmittag hätte man glauben können, ein Maler habe seinen Pinsel in Farbe getaucht, um die Welt damit zu verschönern. Es war aber nicht eine auf Leinwand gemalte Idylle, sondern die Wirklichkeit. Denn über allem lag dieser wunderbare Duft des Sommers, den selbst der vollendetste Maler nicht hätte festhalten können.
Anna lief durch die Wiesen und suchte Kamillenblüten für Tee. Außerdem schaute sie nach Wiesensalbei, denn eine Nachbarin klagte über unangenehme Halsschmerzen und dagegen gab es kein besseres Mittel, als mit einem Salbeiaufguss zu gurgeln.
Am frühen Nachmittag breitete Annas Mutter eine Decke unter einer mächtigen Eiche am schattigen Rand des Haunstetter Waldes aus. Sie legten sich nebeneinander, blickten in die dicht gewachsene Krone und schauten versonnen den vorüberziehenden Wolken nach. Dabei aßen sie frisch gepflückte Johannisbeeren und ein Stück selbst gebackenen Kuchen.
Anna verschränkte die Arme hinter dem Kopf, dabei fiel ihr eine Haarsträhne ins Gesicht. Sie kicherte übermütig und versuchte sie zurückzupusten, aber es wollte ihr nicht gelingen. Schließlich strich ihre Mutter die Strähne nach hinten – das tat sie oft, denn Anna besaß nur ein verschlissenes Band, um ihre Haare zu zähmen. Wenn sie herumlief oder singend durch die Küche tanzte, lösten sich immer wieder einzelne Locken heraus – und dann hatte sie ihrer überraschten Tochter den wunderschönen Kamm ins Haar gesteckt.
»Für dich, mein Kind, damit du deine Locken ordentlich aufstecken kannst.« Sie hatte stolz gelächelt, während sie sprach.
Anna hatte die Haarpracht ihrer Mutter geerbt. Der einzige Unterschied war der rote Farbton, der Marias Haare im Schein der Sonne wie Feuer lodern ließ.
Anna konnte ihr Glück kaum fassen. Einen solch kostbaren Kamm hatte sie bisher noch nicht besessen. Sie war sich bewusst, dass ihre Mutter dafür viele Näharbeiten an den Abenden bei Kerzenschein unter größten Mühen verrichtet haben musste und bestimmt mehr Wäsche als üblich für die Nachbarn in der Umgebung gewaschen hatte. Ein Geschenk dieser Art hätten sich ihre Eltern sonst nicht leisten können – ihr Vater hatte als Schreiner, Möbel- und Kunsttischler gut zu tun, aber es reichte trotzdem immer nur für das Nötigste. Einen kleinen Betrag legte die Mutter stets zurück, er war für außergewöhnliche Anschaffungen oder Reparaturen gedacht. – Anna sprang auf, fasste ihre Mutter an beiden Händen und zog sie zu sich hoch, dann umarmten sie sich glücklich und liefen tanzend und ausgelassen über die Wiese, bis sie lachend wieder auf die Decke sanken.
Anna wurde jäh aus ihrem Tagtraum gerissen, denn sie waren soeben mit dem Fuhrwerk, auf dem sie saß, über einen dicken Stein gerumpelt. Der Mann, der vorne auf dem Gefährt hockte, musste ihn wohl übersehen haben. Das Fuhrwerk holperte arg und geriet in Schieflage. Der Mann fluchte und schimpfte aufs Übelste vor sich hin, er zog und zerrte an seinen Riemen, damit der Gaul nicht durchging, und lehnte sich mit aller Kraft seines Körpergewichtes in die entgegengesetzte Richtung. Es dauerte einen Moment, doch schließlich gelang es ihm, das Fuhrwerk wieder unter Kontrolle zu bringen.
Anna atmete erleichtert aus. Sie lockerte langsam ihre Hände, die eine Holzlatte des Gefährts fest umklammert hielten. Sie hatte befürchtet, sie würde mitsamt dem Fuhrwerk in den Graben kippen und dabei erschlagen werden. Doch das Unglück hatte sich noch einmal davongeschlichen.
Anna, die die Natur so liebte, nahm die Schönheit des Wäldchens, das satte Sommergrün des Gesträuchs, das zugewachsene Dickicht, den plätschernden Bach, an dem sie vorbeifuhren, und die fröhlich vor sich hin zwitschernden Vögel gar nicht wahr. Stattdessen zog sich ihr vor Verzweiflung der Magen zusammen, denn sie hatte unentwegt die grauenvollen Bilder vor Augen, wie die Männer der Inquisition ihre Mutter in einen schäbigen Sack gepackt, ihn zugeschnürt und in den Fluss geworfen hatten.
»Bist du eine Hexe«, hatte der Inquisitor gerufen, »dann hilf dir selbst und befreie dich aus dem Sack.«
Das Wasser hatte arg gespritzt und für einen Moment war der Sack versunken. Doch war er an der Wasseroberfläche wieder aufgetaucht und hatte ungewöhnlich ruhig im Fluss geschaukelt.
Anna hatte sich vor der Vollstreckung des Urteils von ihrer Mutter verabschieden dürfen. In einem unbeobachteten Moment steckte sie ihr ein Tüchlein zu, in das sie Blüten des giftigen Fingerhuts gehüllt hatte.
Das Mädchen kannte die Wirkung vieler Kräuter. Ihre Mutter hatte ihr von Kindheit an die heilende Kraft der Pflanzen beigebracht. Eine Kunst, auf die sich angeblich nur Hexen verstehen, so hatte die Inquisition geurteilt und Maria Muringer der Hexerei beschuldigt. Anna wusste es besser, es hatte nichts mit Übersinnlichem zu tun, nur mit Erfahrung und dem daraus resultierenden Wissen um die Heilkraft der Pflanzen. Überall wuchsen diese wunderbaren Gewächse: Löwenzahn, Kamille, Wegerich, Wacholder, Mädesüß … am Waldrand, auf Wiesen oder auch mitten in der Stadt. Und alle besaßen ihre ganz besonderen, natürlichen Kräfte.
Ihre Mutter heilte einst den Knochenbruch einer Freundin, die im Winter auf dem Weg in die Wäscherei ausgerutscht war und sich das Handgelenk gebrochen hatte. Sie behandelte den Bruch erfolgreich mit Beinwellwurz und Ackerschachtelhalmtee.
Maria war sich sicher, dass es für alle Krankheiten eine wirkungsvolle Pflanze gab. Dass sie eines Tages hilflos zusehen müsste, wie ein geliebter Mensch mit dem Tod ringen und sterben würde, hatte sie niemals für möglich gehalten.
Vor vier Wochen jedoch war Annas Vater an einem schlimmen Fieber erkrankt. Er verletzte sich beim Arbeiten in seiner Werkstatt mit einem Messer an der Hand. Umschläge sollten die Infektion heilen und ein Pflanzensud das aufkommende Fieber senken. Unglückseligerweise gelang es Maria nicht, die Infektion in den Griff zu bekommen. Annas Vater starb mit vergiftetem Blut in den Armen ihrer Mutter. Die Schwester des Vaters, die der Familie Muringer eigentlich liebevoll zugetan war, kam über den Tod ihres Bruders nicht hinweg. Sie beschuldigte Maria, an seinem Ableben schuld zu sein. Schließlich verfluchte sie Marias Kräuterkunst und verriet die Schwägerin an die Inquisition.
Anna kannte nicht nur viele heilende Pflanzen, sondern auch die giftigen, heimtückischen Wirkungen manch unscheinbaren Krautes oder wunderschönen Gewächses in der nahen Umgebung. So auch den Fingerhut mit seinen prächtigen violetten Blütenhüten. Der Verzehr mehrerer dieser Blüten führte nach wenigen Sekunden zum Herzstillstand.
Als Anna Abschied von ihrer Mutter nahm und ihr heimlich das Tuch mit den violetten Blüten zusteckte, hatte Maria wissend genickt.
»Du wirst es schaffen, mein Kind, das weiß ich«, flüsterte sie ihrer Tochter zum Abschied zu. »Hüte dich vor den bösen Männern. Verfolge die Erfüllung deiner Träume. Lebe und liebe – und finde deinen Onkel in Venedig.« Bei den letzten Worten hatte man ihre Mutter weggezerrt.
»Mutter, geliebte Mutter«, hatte Anna gewimmert, und auch nun schluchzten diese Worte aus ihr heraus. Tränen flossen über ihre Wangen und tropften auf den Muschelkamm. Anna steckte ihn behutsam in ihre Haare zurück, umschlang die Knie und gab sich dem Schmerz hin. Sie wollte schreien, um die schrecklichen Bilder nicht mehr sehen und die üblen Stimmen nicht hören zu müssen, die sie im Geiste quälten. Sie konnte diese böse Welt nicht fassen und so verschwamm sie in einem Meer aus Tränen und löste sich in einem matten Schleier auf. Doch wieder bahnten sich die grauenvollen Bilder den Weg und bohrten sich in ihr Bewusstsein.
»Die rothaarige Hexe soll sterben, Hexe, Hexe«, schrien die Menschen, die sich neugierig am Ufer des Lechs zur Gottesprobe versammelt hatten.
Es war lange her, dass man in Augsburg eine Hexe verurteilt hatte. An solch einer Sensation wollten viele Menschen teilhaben. Die Stimmung unter den Leuten war unangenehm, die einen hatten Angst, andere schimpften vor irrwitziger Wut gegen Hexenmagie. Es gab aber auch die jenigen, die voller Mitleid mit Maria Muringer waren und sie eigentlich sehr schätzten. Dennoch wollten auch sie sehen, was passieren würde.
»Bestimmt ist die Tochter auch eine Hexe«, rief plötzlich jemand.
»Werft sie doch gleich hinterher«, grölte ein anderer.
Die Menge trieb nach vorne. Sie versuchten an einer Absperrung vorbeizugelangen, um an Anna heranzukommen. Da ertönte auf einmal die Stimme des Inquisitors: »Haltet ein, brecht den Stab nicht zu früh über sie. Lasst uns sehen, ob die Muringer Hexe gleich aus dem Fluss herausspringt.« Er machte eine Pause und blickte die Leute an. »Oder, ob sie womöglich doch keine magischen Kräfte besitzt.« Der Inquisitor blickte aufs Wasser und für einen Augenblick beruhigte sich die Menge.
In dem Sack war keine Bewegung zu sehen. Nur Anna wusste, dass ihre Mutter längst nicht mehr am Leben war und dass das Gift des Fingerhuts ihr die Qualen des jämmerlichen Ertrinkens genommen hatte.
Nach ein paar Minuten befahl der Inquisitor seinen Leuten, den Sack herauszuziehen. Zwei Männer stiegen mit Stöcken bewaffnet in den Fluss. Sie schubsten ihn vorsichtig an.
»Bist du eine Hexe, dann komm jetzt heraus«, meinte der eine. Der andere überprüfte, ob der Sack noch immer verschlossen war.
»Alles ist nach wie vor gut verschnürt, daraus ist niemand entwichen.«
»So holt ihn her«, rief der Inquisitor.
Die Männer schoben den Sack mit ihren Stöcken ans Ufer. Die Sache schien ihnen aber nicht ganz geheuer zu sein. Zwei weitere Männer mussten helfen, den Sack an Land zu schaffen. Dann schnitt der Inquisitor höchstpersönlich den Strick durch.
»Mein Gott, sie ist tot«, rief eine junge Frau und schlug entsetzt die Hände vor ihr Gesicht. Sie hatte sich ganz nach vorne gedrängt, um den besten Blick auf den Inhalt des Sackes werfen zu können.
Die Menge fing an zu murmeln. Anna spürte das wilde Pochen ihres Herzens im Ohr und aufgeregte Äußerungen der umstehenden Menschen schwirrten um sie herum: » … unschuldig … gemeiner Mord … die arme Tochter …« Die noch eben gefasste Stimmung schien umzuschlagen. Sie richtete sich diesmal gegen den Inquisitor. Dieser erhob die Hände, um die Menschen zu beruhigen: »Ihr könnt froh sein«, rief er, »die Muringer ist keine Hexe. Ihre Seele wird unbeschadet in Gottes Reich aufgenommen werden. Tut Buße, ihr Christenmenschen, lebt bescheiden und werdet nicht ketzerisch, sonst steht euch eine ähnliche Probe bevor.«
Die Menge ließ sich mit diesen Worten jedoch nicht besänftigen oder Bange machen. Der Inquisitor sah ihre verachtenden Blicke. Er hatte die Menschen nicht mehr unter Kontrolle, er befürchtete, dass sie jeden Moment über ihn herfallen würden. Mit aufgebrachter Stimme schrie er seine Männer an: »Tut etwas, treibt sie auseinander.«
Des Inquisitors Gefolge führte den Befehl sofort aus, mit gezückten Waffen und wutschnaubenden Gebärden drängten sie die Menge zurück. Ein großer Tumult entstand. Alle schrien durcheinander, eine alte Frau wurde zu Boden gestürzt und verletzte sich am Kopf, ein Kind fing bitterlich an zu weinen und wurde von seiner Mutter ängstlich weggezerrt.
»Geht nach Hause«, rief der Inquisitor ihnen nach, »und hütet euch vor auffälligem Benehmen, andernfalls wird es euch genauso ergehen. Ihr wisst, es wurden auch schon Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.« Er hatte sich derart ereifert, dass seine Stimme fast umkippte und er nach Luft japste. »Ich werde für euch beten. Geht mit Gott, in nomine patris et filii et spiritus sancti«, brachte er mit ausgebreiteten Armen nur noch röchelnd hervor. Dann sank er erschöpft auf einen Stein nieder und legte sein Gesicht in beide Hände. Eine Beklemmung schien ihm den Hals zuzudrücken, sein Herzschlag beschleunigte sich und er musste heftig atmen. Niemals zuvor in seinem Leben war ihm die Furcht so den Nacken hinaufgekrochen, niemals zuvor hatte er derartig an sich gezweifelt, niemals zuvor hatte er sich so seiner Schwäche geschämt.
Erstarrt vor Entsetzen blickte Anna zunächst den Inquisitor an. Dann wagte sie einen Blick auf ihre tote Mutter. Marias leichenblasses Gesicht war von den verstümmelten, abgeschnittenen Haaren umrahmt und schaute leblos aus dem Sack heraus. Anna wollte sich zu ihr bücken, sie wachrütteln, doch da packte sie plötzlich jemand von hinten, um sie wegzuzerren.
»Lasst mich los«, schrie Anna hysterisch und schlug mit den Armen wild um sich, »ich will bei meiner Mutter bleiben.«
Ein zweiter Mann eilte herbei, um das Mädchen zu bändigen. Gemeinsam schleppten sie Anna zu einem Fuhrwerk und hoben sie grob hinauf. Dann blieb einer der beiden Männer vor dem Karren stehen und passte auf, dass sie sitzen blieb.
Der Inquisitor hatte mit gebrochener Stimme angeordnet, Anna schnellstmöglich aus Augsburg fortzubringen. Er wollte noch in dieser Stunde seine Reise zu einem Kloster in den Alpen fortsetzen.
Eigentlich war der Inquisitor, Jakobus von Schaffhausen, mit seinen Männern auf der Durchreise von Ulm nach Mittenwald gewesen. Er gehörte dem Orden der Dominikaner an und war vom Ulmer Prior des Ordens beauftragt worden, in Augsburg den Baumeister für die Errichtung einer Konventkirche des Klosters auszuwählen. Außerdem sollte er dem Prior aus dem Bergdorf eine für ihn in Auftrag gegebene Violine mitbringen.
Der Inquisitor kannte Mittenwald bisher nicht. Lieber wäre er in Ulm geblieben, als bei dem feuchtwarmen Wetter eine anstrengende Fahrt in die Berge anzutreten. Aber er musste sich den Anordnungen fügen. Das erste Ziel war Augsburg gewesen.
Von Schaffhausen und seine Männer hatten im Dunkeln, bei sternklarem Himmel, gerade das nördliche Wertachbrucker Tor passiert, als plötzlich am Firmament ein leuchtender Himmelskörper hinab zur Erde schoss. Er verglühte zwar nach wenigen Sekunden, trotzdem zuckte der Inquisitor erschreckt zusammen, denn eine solche Erscheinung hatte schon häufig Unangenehmes angekündigt. Mit einem bedrückten Gefühl fuhr er in die vornehme Fuggerstadt ein.
Am nächsten Tag wurden ihm tatsächlich allerlei Nachrichten zugetragen, die ihm gar nicht gefielen. Die Ernte sei durch einen Hagelsturm verdorben, ein schreckliches Fieber habe einige Menschen sterben lassen, eine böse Frau treibe ihr Unwesen in Augsburg, ein rothaariges Kräuterweib rühre heimlich in ihrer Stube Gemische an, sie sei schuld am Dahinsiechen vieler Menschen, die Rothaarige sei eine Hexe.
Und dann waren der Ratsherr, ein wohlhabender Fugger und ein Pfarrer zu Schaffhausen gekommen und forderten von ihm, das Urteil über eine Frau namens Maria Muringer zu sprechen, von der sie befürchteten, dass sie eine Hexe sei. Es dürfe nicht noch Schlimmeres in Augsburg passieren. Falls der Inquisitor dies nicht tun wolle, würden sie den Bischof um Hilfe bitten.
Wie leicht konnte von Schaffhausen diese Augsburger Obrigkeit durchschauen. Sie hatten einen Sündenbock gesucht, dem sie die Unbill der letzten Monate – Stürme, Gewitter, Krankheit und Tod – anlasten konnten. Und in der Muringer hatten sie endlich einen gefunden.
Der Inquisitor fühlte sich hin- und hergerissen. Der letzte Hexenprozess in Augsburg lag viele Jahre zurück. Er persönlich glaubte nicht mehr an den Hexenwahn, mehr noch, er verabscheute die mit ihm einhergehende Hysterie. Dennoch spürte er den Druck, den die einflussreichen Herren ausübten. Schaffhausen wollte sich mit dem Bischof nicht auseinandersetzen müssen und von ihm gar gerügt werden, vielmehr erhoffte er sich ein noch höheres und erträglicheres Amt in der kirchlichen Hierarchie.
Der Bischof war viel konservativer und fanatischer in seinem Denken. Er wäre sicher für die Untersuchung eines Hexenverdachts, würde sich aber bestimmt nicht selber die Hände schmutzig machen wollen, genauso wenig wie die hohen Herren Augsburgs. Gegen seine innere Überzeugung hörte sich der Inquisitor daher weitere Vorwürfe gegen Maria Muringer an.
Eine aufgeregte Frau kam zu ihm und behauptete, die Hexe habe ihren Bruder getötet. Es fügten sich die Anschuldigungen so ineinander, dass der Inquisitor nicht umhin kam, Maria Muringer der Hexerei wegen anzuklagen. Er hatte sie festnehmen lassen und persönlich im Fronhof verhört. Da ein Apotheker sich für ihre Unschuld einsetzte und beteuerte, dass er die Frau des Öfteren beauftragt habe, aus den Augsburger Wiesen Heilkräuter für seine Apotheke zu suchen und sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen gewiss auch dadurch erlangt und vertieft habe, verurteilte der Inquisitor sie nicht durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, sondern ordnete stattdessen die Gottesprobe an.
»Gott wird entscheiden, ob sie schuldig ist.« Hinter dieser Aussage versteckte sich von Schaffhausen. Dennoch tobte sein schlechtes Gewissen in ihm, es schien ihn fast zerreißen zu wollen. Ein beklemmendes Glühen machte ihn schier verrückt.
Die verbleibende Zeit bis zur Vollstreckung verbrachte er in tiefem Gebet. Doch den faulen Geschmack seiner Schwäche konnte er nicht verdrängen, er klebte in seinem Rachen und ließ sich durch nichts hinunterspülen.
Vor den Augsburgern aber durfte und wollte er sich seine Zweifel auf keinen Fall anmerken lassen.
Mit dem ersten Hahnenschrei hatte man Maria Muringer aus dem Jakobertor hinausgeführt und zum Ufer des Lechs gebracht. Dort wurde sie vor den Augen vieler Schaulustiger gefesselt. Dann packte der Inquisitor Maria am Kopf und löste ihre roten Haare. In diesem Moment fuhr ein blitzendes Licht in sie hinein und ließ sie wie Feuer brennen. Augenblicklich ließ der Inquisitor die Muringer los und wischte sich erschreckt über die Hände.
War das ein Zeichen Gottes? Sollte er von seinem Urteil ablassen und die Frau begnadigen? Es wurde ihm schwindelig und er geriet ins Wanken. Einer seiner Männer eilte zu ihm hin und stützte ihn.
Ich darf keine Schwäche zeigen, dachte er und rief: »Habt ihr gesehen, welche Kraft in dieser Frau steckt?« Er schubste Maria beiseite. Sie fiel direkt vor Annas Füße, die die Gelegenheit nutzte, ihre Mutter zu umarmen.
»Lasst das Mädchen ruhig Abschied nehmen«, meinte der Inquisitor. »Sie soll stets vor Augen haben …« Die letzten Worte hatte er leise vor sich hin gemurmelt. – Was tat er da nur? Nicht er war Rechtsprecher über Leben und Tod, das würde Gott übernehmen. Gott war es, der ihn hier handeln ließ.
»Gott, Gott, Gott, hilf mit, bitte verlass mich nicht«, betete er lautlos.
Dann befahl er einem seiner Männer, der Frau die Haare abzuschneiden und sie und das rote Büschel in einen Sack zu packen.
Anna durfte ihre Mutter nicht beerdigen, es blieb keine Zeit dafür. Sie hoffte, dass der Apotheker für eine Grabstelle sorgen würde.
Die Männer der Inquisition kümmerten sich in einem Innenhof um den Tross, die Wagen und die Pferde. Sie hatten Anna auf ein Fuhrwerk geschafft, das mit Proviant beladen wurde, und dort hockte sie nun stumm in ihrer Verzweiflung. Der Hof war erfüllt vom Wiehern und Schnauben der Pferde, die sich unruhig auf der Stelle bewegten. Der Gestank von Mist kroch übelriechend zwischen den Mauern hin und her. Nach einer Weile war die Kutsche des Inquisitors zur Abfahrt bereit und der Tross mit dem Vertreter der Inquisition ruckte an und setzte sich langsam in Bewegung. Die Wagen und Gäule polterten laut über die Pflastersteine. Das Fuhrwerk, auf dem Anna saß, wurde von einem braunen, hochschultrigen Kaltblüter gezogen.
Anna saß lange regungslos da. Sie verließen ihre Heimatstadt Augsburg, den Ort, an dem sie glücklich gewesen war, den Boden, in dem ihr geliebter Vater ruhte und in dem man ihre Mutter hoffentlich begraben würde. Sie schloss die Augen, um die aufflammende Beklemmung zu vertreiben. Niemals durfte sie in ein Kloster gehen, das wusste sie, wenn man sie einsperrte, würde sie verrückt werden. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Niemand durfte sie wegsperren, um sie mundtod zu machen.
»Der Inquisitor wird seine gerechte Strafe bekommen«, das schwor sich Anna.
Am Rande der Via Claudia Augusta, der alten Römerstraße, standen einige Neugierige.
»Das arme Mädchen«, hörte Anna jemanden sagen, » … und wenn sie vielleicht die Hexe ist …, Hexe, Hexe …«
»Fort mit euch«, rief der Mann vorne auf dem Fuhrwerk.
Anna nahm die Menschen und die Umgebung nur schemenhaft wahr, der dichte Nebel aus Schmerz und tiefer Leere nahm ihr jede Sicht. Das Grauen war in ihr Herz gebrannt. Plötzlich wurde ihr übel und sie musste sich übergeben. Der Mann auf dem Kutschbock reichte ihr eine Flasche mit Wasser: »Hier, trink das, Mädchen, dann wirst du dich besser fühlen«, lächelte er ihr mitfühlend zu und zeigte dabei seine verfaulten Zähne. Anna überkam ein erneuter Würgeanfall, diesmal aus Ekel und weil der Mann widerlich nach Schweiß stank. Trotzdem nahm sie das Wasser dankbar an.
Der Tross polterte über die hölzerne Zugbrücke zum roten Tor hinaus und ließ Augsburg hinter sich zurück. Sie fuhren am angrenzenden Haunstetter Wald vorbei, durch den ein für Schmuggler beliebter Pfad führte, in Richtung Friedenau.
Nach einiger Zeit wurde Anna vom Schaukeln des Fuhrwerks schwindelig und es überkam sie eine bleierne Müdigkeit, sodass sie sich auf die Seite legte und vor Erschöpfung einschlief. Als sie erwachte, schreckte sie hoch, denn sie hatte die schrecklichen Geschehnisse vor Augen und schaute sich ängstlich um.
»Wo sind wir?«, fragte sie mit leiser Stimme den Mann auf dem Fuhrwerk, sie kannte die Gegend nicht.
»Na, Mädchen, bist du wieder wach? Hast aber tief geschlafen. Wir sind ein gutes Stück vor Klosterlechfeld. Dort an der Seite ist ein Beutel mit einem Laib Brot, kannst dir was abbrechen, musst doch ziemlichen Hunger haben.«
Anna versuchte, nicht auf seine Zähne zu blicken und den Schweißgeruch zu ignorieren. Sie griff nach dem Brot, riss sich ein großes Stück ab und aß es gierig bis zum letzten Happen auf. Danach hatte sie noch immer Hunger, aber sie traute sich nicht, ein weiteres Stück abzubrechen. Außerdem spürte sie, dass ihre Kehle unangenehm trocken war.
»Iss, bis du satt bist, Wasser steht daneben, nimm es ruhig«, sagte der Mann freundlich, als ob er Annas Gedanken erraten hätte.
Sie nahm ein paar kräftige Züge und fühlte sich etwas gestärkt.
»Vor mir brauchst du keine Angst zu haben«, sprach der Mann. »Ich gehöre nicht zu den üblen Kerlen der Inquisition. Mein Name ist Manfred Steyer und ich habe den Auftrag erhalten, diesen Wagen nach Mittenwald zu fahren. Vorne fährt die Leibgarde des Inquisitors, Jakobus von Schaffhausen. Vor diesen Männern musst du dich in Acht nehmen. Gib ihnen keinen Grund, auf dich aufmerksam zu werden. Hinter uns reiten auch noch zwei Männer der Inquisitionskommission, vermeide es am besten, sie anzublicken.«
Anna schlang sich ihr Tuch fester um die Schultern. Es fröstelte sie von innen heraus. Was sollte nur werden? Tagelang würde sie diesen Männern ausgeliefert sein. Sie versuchte, sich auf dem Wagen etwas bequemer hinzusetzen. Ihre Schultern schmerzten und der Rücken tat weh. Anna löste ihre hochgesteckten Haare, legte den Kopf etwas nach hinten und bewegte ihn leicht hin und her, um sich zu entspannen. Plötzlich schnaubte das Pferd, das hinter dem Wagen mit seinem Reiter ritt. Sie öffnete erschrocken die Augen und blickte direkt in das Gesicht des Mannes, der auf dem Pferd saß. Er nickte ihr grinsend zu. Anna wendete sofort ihren Blick ab und steckte sich die Haare geschwind auf dem Hinterkopf zusammen. Dann schaute sie in eine andere Richtung.
In der Ferne konnte sie etwas Dunkles erkennen, das sich bewegte und näher kam. Nach einem Moment erkannte sie die Gestalt eines Reitermanns, der in schnellem Tempo auf den Tross zugaloppierte.
Kapitel 2
Moritz Eibinger strich beglückt über die fertige Fichtendecke. Sie war für eine Geige bestimmt, deren Ahornboden ebenfalls ausgearbeitet auf seiner Werkbank lag.
Für den Boden hatte er ausgezeichnetes Ahornholz gefunden. Er hatte es in der Mitte durchgeschnitten und es dann wie ein Buch geöffnet. Enge Jahresringe wurden sichtbar, die beim Zusammenfügen ein perfektes Bild abgaben. Nach außen, zu den Rändern hin, wurden die Ringe wieder etwas breiter.
Moritz war sehr zufrieden mit seiner Arbeit, und der Auftraggeber, ein wohlhabender Herr, würde es hoffentlich auch sein.
Das Holz hatte viele Jahre im »Allerheiligsten« seines Meisters, dem Holzlager, trocknen, ruhen und reifen können. Nun würde daraus Schritt für Schritt eine, so hoffte Moritz, wunderbar klingende Geige werden.
»Na, träumst du wieder?«, meinte Geigenbaumeister Dürnholz mit einem gewissen Unterton. »Du solltest dir ein Mädchen suchen, das du streicheln kannst.«
Moritz zuckte zusammen, er hatte nicht bemerkt, dass ihn der Meister beobachtete, und fühlte sich ertappt, denn er hatte tatsächlich an eine junge Frau gedacht.
Sie hieß Elise, war eine Schankmaid und sang manchmal in einem Wirtshaus gleich um die Ecke zur Unterhaltung der Gäste. Elise war hübsch. Sie hatte große blaue Augen, ein Stupsnäschen, volle Lippen und einen wohlgeformten Körper mit zarten Rundungen. Ihre Stimme war nicht fein, eher verrucht gefärbt, aber das störte Moritz nicht, im Gegenteil, er mochte den rauen Klang sehr gerne.
Er hatte Elise an zwei Abenden im Wirtshaus gesehen, während er dort mit seinem Zimmergenossen Alois ein Bier trank. Seitdem träumte er von ihr und davon, sie in seine Arme nehmen zu dürfen.
Er wusste nicht, wie alt sie war und ob sie einen Liebsten hatte. Diese Gedanken schob er beiseite. Aber während der Arbeit musste er immer wieder an sie denken.
Moritz war in einer Geigenbauwerkstatt in Mittenwald, bei Meister Dürnholz, in der Lehre. Er fühlte sich in der Werkstatt, in der es nach Holz und Leim duftete, sehr wohl. Zu seinem Bedauern waren es bisher nur verschiedene Teilschritte, die er absolvierte. Mal war es das Vollenden der Decke oder des Bodens, oder es waren die Zargen, die er durch Erhitzen in Form bog. An das Griffbrett mit der Schnecke und den Wirbeln hatte ihn der Meister noch nicht herangeführt.
»Das kommt später«, sagte er immer. Moritz enttäuschte das sehr, es ging ihm nicht schnell genug voran.
Er nahm häufig die eine oder andere Geige seines Meisters zur Hand und spielte darauf. Er mochte die Instrumente, aber er dachte stets, dass ihnen ein gewisser klanglicher Schmelz fehle, ein sinnlicher Ton, der ihn doch berühren müsse. Die Sehnsucht nach diesem Klangideal behielt er aber für sich.
Dürnholz war eher einfacher Natur, klopfte gerne derbe Sprüche und Witze und vergnügte sich nach der Arbeit im Wirtshaus. Moritz mochte es überhaupt nicht, wenn der Geigenbaumeister nach durchzechten Nächten am nächsten Tag nach Alkohol roch und schlechte Laune hatte. Da er nicht verheiratet war, brachte er sich manchmal eine Dirne mit ins Haus.
Hatte er seinen Spaß und Befriedigung mit ihr gefunden, war er am nächsten Tag äußerst freundlich. Wenn es ihn aber nach einer Frau gelüstete, war er in einem unausstehlichen Gemütszustand, lief unruhig hin und her und schimpfte mürrisch über alles und jeden, der ihm in die Quere kam. Moritz versuchte dann, ihn nach Möglichkeit kaum anzusprechen.
Dürnholz war vor zwei Nächten bei einem Techtelmechtel eingeschlafen, da er zuvor im Wirtshaus zu viel Bier getrunken hatte. Die Dirne hatte dennoch das Geld aus seiner Börse genommen und war damit verschwunden. Nicht nur die Dreistigkeit der Frau, sondern das heiße Verlangen in seinem Schoß machte den Meister wütend. Er versuchte sich mit dem Lackieren einer Geige abzulenken, und strich mit seinem Pinsel gewissenhaft über ihre Decke. Jedoch zitterten seine Hände und plötzlich stieß er den Pinsel grob in den Lack hinein. Die kostbare Flüssigkeit hinterließ dicke Spritzer auf dem Instrument.
»Hinterlistiges Weibsstück«, fluchte er. »Du sollst meinen Pinsel noch spüren.« Dann sprang er auf und rannte aus der Werkstatt hinaus.
Moritz hatte Dürnholz zornig zugesehen. Nicht, dass ihm der Meister leid tat, nein, es war die Geige. Verhunzt lag sie auf der Werkbank und blickte ihn jämmerlich an.
Er musste etwas tun, damit sie ihren Glanz erhalten würde. Eine Weile wartete er ab. Als der Meister nicht wieder erschien, nahm er sich des Instrumentes an und trug mit sanften, vorsichtigen Bewegungen, ebenso wie er es bei Dürnholz viele Male beobachtet hatte, Schicht um Schicht den fein duftenden Lack auf die Geige auf. Schließlich waren die üblen Spritzer verschwunden.
Meister Dürnholz erschien erst am Nachmittag wieder, pfeifend und gut gelaunt.
»Er hat also sein Verlangen gestillt«, dachte Moritz.
Dürnholz ging zu seiner Werkbank und besah sich das Instrument.
»Gut siehst du aus, bist doch ein Meisterstück geworden«, sagte er nur. Moritz konnte an Dürnholz’ Mimik nicht feststellen, ob diesem bewusst war, dass sein Lehrling die Lackspritzer korrigiert und den Rest der Geige fein säuberlich mit Lack bestrichen hatte. Oder ob der Meister seinen Wutausbruch und unachtsamen Umgang mit dem Instrument längst vergessen hatte?
Moritz war erst seit einigen Monaten in der Lehre des Geigenbaumeisters. Er war fleißig und sehr begabt für das diffizile Handwerk und lernte die verschiedenen Fertigungsabfolgen sehr schnell. Zuvor war er in seinem Heimatort bei einem Schreiner für ein Jahr in der Lehre gewesen, denn den Umgang mit Holz mochte Moritz schon immer.
Seit er ein kleiner junger Junge war, spielte Moritz auf der Geige seines Großvaters. Er liebte ihren Klang außerordentlich, sodass in ihm der Wunsch reifte, das Geigenbauhandwerk zu erlernen. Sein Vater war von dieser Idee gar nicht recht begeistert gewesen, denn Moritz’ Familie verstand sich auf das Bierbrauen und sein Vater hatte gehofft, dass Moritz, dem er von Kindheitstagen an alle nötigen Brauschritte beigebracht hatte, diese Zunft weiterführen würde. Die Familie führte ein Gasthaus mit dem kraftvollen Namen »Zum Riesen«, an dessen Eingangsseite sich ein fein ziselierter Brauereistern befand, der Zunftstern der Bierbrauer, auf den Moritz’ Vater sehr stolz war.
Moritz liebte den Geruch der Maische und den Geschmack eines guten Bieres, dennoch war ihm die immer gleiche Vorgehensweise bei der Bierherstellung einfach zu langweilig und mit der Liebe zur Musik, dem Duft von Holz und seinem handwerklichen Umgang nicht im Geringsten zu vergleichen.
Moritz’ Vater hatte lange gebraucht, um den Wunsch seines ältesten Sohnes zu akzeptieren, sich mit Holz zu beschäftigen, und gewährte ihm, eine Schreinerlehre zu absolvieren. Zum Glück hatte Moritz Zwillingsbrüder, die von der Bierbrauerei völlig begeistert waren, sie lenkten den Vater von seiner Enttäuschung über Moritz ab.
Als Moritz jedoch eines Tages den Wunsch äußerte, seine Schreinerlehre abbrechen zu dürfen, um Geigenbauer zu werden, fing er sich zunächst eine Ohrfeige seines Vaters ein. Nur dem guten Zureden seiner Mutter war es zu verdanken, dass er nachgab und einen Berufswechsel gestattete. Moritz’ Schreinermeister kannte einen Geigenbauer namens Dürnholz in Mittenwald und gab seinem Zögling ein Empfehlungsschreiben für ihn mit. Nur ungern ließ er ihn ziehen, denn er mochte Moritz sehr und verlor einen tüchtigen Lehrling.
Moritz war überglücklich und freute sich auf neue Herausforderungen und dass er endlich in das Geheimnis des Geigenbauhandwerks eingeführt würde. Dennoch fiel ihm der Abschied von zu Hause nicht leicht. Er verließ seine Familie und den kleinen Ort Bachhausen, in dem er mit seinen Eltern, Geschwistern und Freunden glücklich gelebt hatte.
Heute hatte er einen Brief aus der Heimat erhalten, denn es war der Tag seines zwanzigsten Geburtstags. Da seine Mutter nicht gut schreiben konnte, hatte sie einem ihrer Söhne den Text diktiert. Moritz erkannte die Schrift mit den kleinen eckigen Buchstaben seines Bruders Hans genau und hörte die warme Stimme seiner Mutter: »Es geht uns gut und wir vermissen dich alle sehr. Die Zwillinge Hans und Joachim mausern sich mit ihren sechzehn Jahren langsam zu jungen Männern. Mechthild ist häufig zu Besuch und lässt dich herzlich grüßen. Sei fleißig und vergiss uns nicht. Gott sei mit dir.«
»Mechthild«, dachte Moritz. Er kannte sie sein Leben lang, sie war das erste und bisher einzige Mädchen, das er geküsst hatte. Oft waren sie als Kinder gemeinsam über die Felder getobt, hatten sich geheime Unterschlüpfe gebaut und sich dort versteckt. Sie vertrauten sich ihre Träume an und Moritz spielte Mechthild häufig erfundene Melodien auf seiner Geige vor. Dann saß sie still da, lächelte ihn an und hörte andächtig zu. Sobald er aufhörte, drängte sie ihn weiterzuspielen.
Als Moritz mit der Schreinerlehre begonnen hatte, war kaum noch Zeit gewesen, Mechthild zu treffen. Ein paar Mal hatte seine Mutter sie zu einem Plausch eingeladen, es gab Gugelhupf und Hagebuttentee oder Holunderwein. Aber es waren nicht die unbeschwerten Treffen gewesen, wie sie sie als Kinder erlebt hatten. Es war kaum eine Unterhaltung in Gang gekommen. Hätte seine Mutter nicht immer wieder Fragen gestellt, wären die Stunden wohl ohne Worte verstrichen. Was war los mit ihnen? Warum waren sie so verändert? Moritz hatte sich diese Frage häufig gestellt, aber er wusste keine Antwort darauf. Am Tag seiner Abreise reichte er Mechthild förmlich die Hand. Er wollte ihr etwas Nettes sagen, da sie den Blick senkte, hatte er nur »Lebe wohl!« flüstern können.
Moritz war etwas wehmütig zumute, er versuchte seine Gedanken an zu Hause zu verscheuchen. Noch einmal strich er über die fein gemaserte Geigendecke.
»Fertig! Meister, was kann ich jetzt tun?« Dürnholz schlurfte zu Moritz hinüber und schaute sich beide Teile genau an.
»Gute Arbeit. Mach die Werkbank sauber, feg die Späne zusammen und dann ab mit dir. Du hast Geburtstag. Feiere! Such dir ein Mädel. Morgen ist auch noch ein Tag.«
Moritz wollte widersprechen, es war erst Nachmittag und er hätte gerne noch mit seinem Schropphobel das Innere der Decke geglättet. Wie sollte er sich jetzt bis zum Abend die Zeit vertreiben? Erst gegen acht Uhr war er mit Alois im Wirtshaus verabredet.
Moritz hatte nicht viel Geld. Der Lohn, den er von Meister Dürnholz bekam, war sehr gering, er reichte für die Miete des Zimmers, das er sich mit Alois teilte, und zwei warme Fleischmahlzeiten pro Woche. Aber ein Bier an seinem Geburtstag, das musste einfach sein. Moritz freute sich schon sehr auf den Abend, denn er hoffte, Elise wiederzusehen.
Er tat, was ihm der Meister aufgetragen hatte, und reinigte gewissenhaft die Werkbank und seinen Platz. Dann schnappte er sich seine Kappe und ging nach draußen. Im Hinausgehen verabschiedete er sich mit einem: »Bis morgen!«
Meister Dürnholz grummelte noch irgendetwas Unverständliches hinter ihm her.
Auf der Straße wehte Moritz ein leichter Wind entgegen, die Luft war angenehm warm.
»Eigentlich genau richtig für einen Spaziergang«, dachte er und schlenderte den schmalen Gröglweg in Richtung Obermarkt hinunter.
Mittenwald war ein kleines, beschauliches Städtchen, im Tal der Isar gelegen, zwischen dem Karwendel- und dem Wettersteingebirge. Die Menschen, die dort lebten, waren darauf bedacht, dass ihre Häuser von außen auf das Schönste verziert waren. Bunte Farben sowie filigrane und sauber gestaltete Malereien prägten das Bild der Stadt. Fast täglich sah man Lüftlmaler auf der Straße stehen, die irgendeine Verschönerung an den Häusern vornahmen. Madonnen und Engel blickten durch Wolken zu den Menschen hinunter, die vorübergingen, und feine, farbenfrohe Fresken ließen unscheinbare Häuserwände erstrahlen. Außerdem wurden Feuersbrünste, Wasserfluten und das alltägliche Leben der Gebirgsbewohner in Bilder umgesetzt.
In Mittenwald kannte sich jeder vom Sehen und man grüßte sich. Die Menschen waren einfach, aber fleißig, sie gingen Handwerksberufen nach, waren Tischler, Schmied oder Ofensetzer, Zinn- oder Kerzengießer. Auch die Frauen waren nicht untätig und arbeiteten als Hebammen, Bortenwirkerinnen, Seifensiederinnen oder Wäscherinnen und verstanden sich auf die Kunst der Filetseidenstickerei.
Außer der Geigenbauwerkstatt von Meister Dürnholz gab es noch einen weiteren Geigenbaumeister, er hieß Klotz und hatte drei Söhne: Georg, Josef und Sebastian. Mit Letzterem hatte sich Moritz angefreundet, denn Sebastian war seinerseits ein Freund von Moritz’ Freund Alois. Manchmal zogen die drei zusammen los. Auch heute würde sich Sebastian zu ihrem Treffen im Wirtshaus dazugesellen.
Im Gegensatz zu den Geigen, die Meister Dürnholz baute, war Moritz von den Instrumenten aus der Klotz-Werkstatt fasziniert. Sie hatten einen fein nuancierten Klang, der ihn tief berührte. Heimlich hatte er einige Male am Fenster gelauscht, wenn Meister Klotz eine Geige nach ihrer Fertigstellung einspielte. Das geschah sachte und mit sehr viel Liebe und Hingabe. Ton für Ton lockte der Meister die Klänge aus dem Instrument heraus.
Immer wieder hatte Moritz gefragt, ob Klotz ihn als Lehrling aufnehmen könne, aber der Meister lehnte mit der Begründung ab, dass er keinen Lehrplatz mehr frei habe.
»Lerne zunächst einmal die wichtigsten Teilanfertigungen, dann sehen wir weiter. Wenn du begabt bist, wird sich für dich in meiner Werkstatt vielleicht auch noch ein Platz finden.«
Moritz machte sich große Hoffnungen und arbeitete deswegen sehr fleißig. Umso mehr ärgerte er sich über Dürnholz, dass ihn dieser keine Fortschritte machen ließ.
Er schlenderte nun eine Nebengasse entlang, denn es war ihm spontan in den Sinn gekommen, einen Blick in Klotz` Werkstatt hineinzuwerfen. Sein Freund Sebastian arbeitete zurzeit an einer Geige, die er mit fein eingeschnittenen Intarsien verschönern wollte. Er hatte Moritz so viel davon vorgeschwärmt und ihn derartig neugierig gemacht, dass dieser nun die Gelegenheit der freien Zeit nutzte, um einen kurzen Abstecher dorthin zu machen.
Die Werkstatt hatte ein sehr schönes Schild. Es zeigte eine in Brauntönen gemalte Geige, die von Rosetten aus Metall umschlungen war. Schon von Weitem konnte Moritz das leuchtende Schild sehen, das direkt über dem Türeingang an der Hauswand angebracht war.
Jedesmal, wenn Moritz diesen Weg ging, war er in großer Aufregung.
Als er die Werkstatt erreicht hatte, schaute er neugierig durch die kleinen Butzenfenster hinein. Sebastian stand hinter der Werkbank und war in seine Arbeit vertieft.
Mit einem kleinen Messerchen schnitzte er aus den Seiten der Schnecke, direkt oberhalb der Wirbel, ein feines Ornament heraus. Sebastian arbeitete vorsichtig und mit Bedacht an dem Motiv, das er zuvor auf das Holz skizziert hatte. Jeder Kratzer, der danebengehen würde, wäre nicht mehr rückgängig zu machen.
Moritz traute sich kaum zu atmen, geschweige denn sich zu bewegen. Er schaute seinem Freund fasziniert zu. Auf keinen Fall wollte er ihn erschrecken. Sein Herz begann aufgeregt zu pochen, der Wunsch, es dem Freund gleichzutun, war groß. Sehnsüchtig betrachtete er das Griffbrett, an dessen Seite Sebastian kleine Verzierungen hineingearbeitet hatte.
»Ich werde noch besser arbeiten und Meister Klotz von meinen Fähigkeiten überzeugen«, schwor sich Moritz und ballte dabei die Fäuste energisch in seiner Jackentasche.
Wehmütig wendete er seinen Blick ab und entschloss sich weiterzugehen, denn es war nicht der geeignete Moment, um seinen Freund zu sprechen. Er war kaum zwei Schritte gegangen, da stellte sich ihm Meister Klotz in den Weg.
»Was lungerst du hier herum? Bist du ein Faulpelz und hast nichts Besseres zu tun, als deine Nase an meiner Scheibe platt zu drücken? Oder willst du gar herumschnüffeln und uns Ideen klauen?«
Moritz schaute Klotz betroffen an, der seine Stirn energisch runzelte. Er war mit einer Schürze bekleidet, die fast bis zum Boden reichte, hatte die Hände in die Hüften gestemmt und stand grimmig vor ihm.
»Nein, … natürlich nicht«, stammelte Moritz. »Ich habe meine Arbeit bei Dürnholz für heute schon erledigt. Bitte verstehen Sie doch, ich musste Sebastian einen Moment zusehen, wie er das Ornament aus der Schnecke so gekonnt herausgeschnitzt hat.
Meister Dürnholz lässt mich nur eine Decke nach der anderen anfertigen, manchmal auch einen Boden. Längst beherrsche ich diese Handgriffe, ich will mehr. Ich möchte eine Geige fertigstellen, mit allem, was dazugehört.
Aber ich will es von Ihnen lernen. In Ihrer Werkstatt werden die schönsten Instrumente gebaut, die ich mir nur vorstellen kann. Sie haben einen silbrigen Klang und sind so meisterhaft verziert.«
Jetzt musste Moritz Luft holen. Er hatte sich in begeisterte Rage geredet. Meister Klotz verzog sein Gesicht nach einem Moment unerwartet zu einem freundlichen Grinsen.
»Schon gut, jetzt beruhige dich mal, mein Junge, du brennst ja wirklich für die Sache, das gefällt mir.«
Nun schaute Sebastian aus der Tür heraus. »Herzlichen Glückwunsch, Moritz, ich habe mir schon gedacht, dass du vorbeikommst. Und wenn du schon mal da bist, dann komm auch herein.«
Moritz blickte Sebastians Vater verunsichert an. Der nickte ihm freundlich zu.
»Herein mit dir und lass dir etwas zeigen.«
Kapitel 3
Es war ein junger Reitersmann mit vollbepackten Satteltaschen, der sich dem Tross der Inquisition näherte. Anna wagte nur einen kurzen Blick auf ihn, aber der Ausdruck seines Gesichtes beruhigte sie. Er wirkte freundlich und hatte mit den bösen Männern anscheinend nichts zu tun.
»Wo reitet Ihr hin?«, fragte er einen von ihnen, der zuvorderst ritt. »Darf ich mich Euch ein Stück des Weges anschließen?«
»Nur zu, wir werden aber demnächst in Klosterlechfeld pausieren und dort auch nächtigen.«
Anna zuckte bei diesen Worten zusammen. Freiwillig würde sie gewiss kein Kloster betreten. Aber welche Möglichkeiten würden sich ihr bieten, um sich den Anweisungen des Inquisitors zu widersetzen? Zugleich war sie erleichtert und froh, dass das Ruckeln bald ein Ende haben würde. Sie sehnte sich nach Wasser, um sich zu erfrischen, und nach einem Nachtlager. Die Sonne hatte unentwegt geschienen, Anna fühlte ein Brennen und eine Staubschicht auf ihrer Haut. Mittlerweile war der Sonnenstand recht tief, sie würde bald untergehen.
Der junge Mann ritt nun auf Höhe des Fuhrwerks, auf dem Anna saß. Sie hatte die Augen geschlossen und tat so, als ob sie schlafen würde.
»Grüß Euch, ich bin Ferdinand Erweger. Wer ist das junge Mädchen da auf Eurem Gefährt?«, fragte er den Mann vorne auf dem Fuhrwerk. Dieser schnaufte mitleidsvoll.
»Ein armes Geschöpf ist sie.« Dann flüsterte er und der junge Mann musste mit seinem Pferd etwas näher herankommen, um ihn zu verstehen.
»Die Inquisitionskommission wollte ihre Mutter der Hexerei überführen und hat sie ertränkt. Das Mädel hat alles mit angesehen. Sie wird in ein Kloster gebracht und dort weggeschlossen. Was das bedeutet, könnt Ihr Euch vorstellen.«
»Dann sind die Männer hier …?«
»Seid still! Ja, es sind die Männer der heiligen Inquisition. Nehmt Euch in Acht vor denen. Traut keinem. Ich bin nur ein Handlanger und verdiene mit Fahrten mein Geld. Aber ich verabscheue, was die üblen Kerle machen.« Die letzten Worte hatte er ganz leise gesprochen, nur Anna hatte sie verstehen sollen. Sie öffnete jetzt die Augen ein wenig, in diesem Moment schaute er über seine Schulter und lächelte sie an.
»Was habt ihr zwei da zu tuscheln?«, mischte sich jetzt einer der hinteren Männer ein. »Fremder, halt Abstand. Und du, Kutscher, pass auf, wo du hinfährst. Mach deine Arbeit, schließlich wirst du nicht fürs Quasseln bezahlt.«
»Verzeiht, ich habe den Mann nur gefragt, wo ihr herkommt«, meinte Ferdinand Erweger und entfernte sich etwas von dem Karren.
Anna öffnete nun ihre Augen, um den Reiter zu betrachten. Er hatte eine angenehme Stimme und wirkte irgendwie mutig auf sie. Als sie ihn anblickte, schaute er ihr direkt ins Gesicht, zog seine Kappe, verbeugte sich leicht auf seinem Pferd und lächelte ihr freundlich zu. Anna lächelte verlegen zurück, senkte dann aber schnell wieder ihren Blick.
»Lasst das Mädel in Ruhe. Sie geht Euch nichts an«, befahl nun ein anderer der Männer.
»Tut mir leid, wollte nur freundlich sein zu dem netten Fräulein.«
»Fräulein.« Der Mann lachte schäbig.
»Das mit dem Freundlichsein überlasst mal uns«, tönte nun die Stimme des Reiters, der hinter dem Karren auf seinem Pferd saß. Dann lachte auch er. Bei diesen Worten kroch Furcht in Anna auf, sie drückte sich etwas dichter an die Wand des Fuhrwerks.
Es verging eine Viertelstunde, da öffnete sich auf einmal vor ihnen ein satt blühendes Wiesental, das sich bis zu einem freundlichen Städtchen hin erstreckte. In dessen Mitte befand sich ein langes Gebäude und gleich daneben stand eine kleine Kirche.
»Das wird Klosterlechfeld sein«, dachte Anna. Sie verspürte eine innere Unruhe. Der Anblick des Klosters machte ihr Angst. Würde der Inquisitor sie hier wegsperren wollen?
Der letzte Teil des Weges bis zum Städtchen war geschottert. Das Fuhrwerk wackelte und polterte hektisch darüber. Anna versuchte, sich auf der Seitenwand etwas abzustützen, damit es nicht allzu weh tat. Dennoch würde sie eine Menge blauer Flecken davontragen.
Als sie durch das Stadttor hindurchgelangten, hatten sich bereits eine Menge Leute davor und dahinter versammelt, um einen neugierigen Blick auf die Ankömmlinge zu werfen. Anna hörte ein Wispern und spürte viele Blicke auf sich gerichtet.
»Das sind Männer der Inquisition? Seid vorsichtig. Und die da, das ist wohl eine Hexe? Hexe …, Hexe …, Hexe …«, schien es von überall her zu flüstern.
Anna hatte sich hinter den Sitz des Kutschers gehockt und drückte sich nun in die Ecke. Sie hatte ihr Tuch etwas über den Kopf gezogen, damit man sie nicht sehen sollte. Eine innere Stimme sagte ihr unentwegt: »Du musst dich nicht verstecken, wehr dich. Tu was! Sag was! Du bist keine Hexe. Deine Mutter hätte sich nicht versteckt.«
Anna wollte etwas erwidern, aber ihre Kehle war wie zugeschnürt.
»Auf diesem Karren sitzt keine Hexe. Es ist nur ein unschuldiges Fräulein«, hörte Anna den Reitersmann zu ihrer Verteidigung sagen. Anna war ihm sehr dankbar. Sie wusste, dass er Kopf und Kragen riskierte.
Plötzlich stoppte der Tross und der Inquisitor erhob sich in seiner geöffneten Kutsche: »Ihr haltet Euch da raus«, rief er und blickte Ferdinand Erweger mit strenger Miene an. Dann wendete er sich den Leuten zu, funkelte sie böse an und rief: »Passt nur auf, wir sind eigentlich auf der Durchreise. Aber wenn mir zu Ohren kommt, dass sich unter euch jemand befindet, der sich mit Hexenmagie beschäftigt, nehme ich mir die Zeit, ihm auf die Schliche zu kommen und sorge für eine ausführliche Untersuchung. Habt ihr mich verstanden?«
Die letzten Worte hatte er gebrüllt. Die Leute wichen verängstigt von dem Tross zurück. Der Inquisitor setzte erneut an, allerdings deutlich milder: »Jetzt zeigt uns, wo sich ein guter Gasthof befindet. Bevor meine Männer und ich im Kloster übernachten, wollen wir etwas essen. Die Klosterküche ist wohl längst geschlossen.«
Er setzte sich nieder und tupfte mit einem Taschentuch über seine Stirn.
Da trat ein Junge aus der Menge hervor.
»Hier in der Seitengasse, Herr, gleich neben dem Kloster, da ist ein sehr guter Gasthof, da könnt Ihr einkehren, er gehört meinem Vater. Er hat auch eine angrenzende Scheune für Eure Pferde, wenn Ihr sie nicht im Kloster unterstellen wollt.«
»Pah, was maßt du dich an, uns Vorschläge zu machen, was mit unseren Pferden passieren soll. Und nenne mich nicht Herr, sondern spreche mich mit Euer Ehren an, verstanden?«, schimpfte der Inquisitor mit bösem Blick und wendete sich an seine Männer. »Unsere Pferde kommen in den Stall des Klosters. Auch meine Kutsche. Nur das olle Fuhrwerk mit dem Mädchen, das darf nicht dort hin, bringt es in den Wirtshausstall.«
Da seine Männer nicht sofort reagierten, befahl er noch einmal mit strenger Stimme: »Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Also macht schon.«
Der Tross setzte sich wieder in Bewegung und fuhr langsam am Kloster vorbei. Anna blickte durch ein großes Holztor in den Hof und den angrenzenden wunderschönen Garten.
Der Garten war ringsherum mit kleinen Hecken umrahmt. In seinem Inneren standen Obstbäume. Apfelbäume erkannte Anna sofort, aber auch einen Pflaumenbaum glaubte sie zu sehen. Viele blühende Beete mit Zierpflanzen und Kräutern waren von kleinen Mäuerchen umgeben. Um das Kloster herum führte eine mächtige Steinmauer, an einigen Stellen wuchs wilder Wein empor. Große alte Birken standen in ihrer Nähe und an der einen Seite thronte auf einem Podest die Skulptur der heiligen Mutter Maria.
Der Gasthof wirkte von außen einfach und nicht sehr geräumig. Aber er hatte eine angrenzende Scheune, dort konnte das Kaltblut, das Annas Karren gezogen hatte, untergestellt und mit Wasser und Hafer versorgt werden.
Mittlerweile war die Sonne untergegangen und in die Gasse kam nicht mehr viel Licht. Anna fühlte sich unbehaglich, denn bald würde die Nacht hereinbrechen – und was würde dann werden? Zumindest hatte der Inquisitor keine Andeutung gemacht, Anna in dem Kloster unterzubringen. Aber wo sollte sie schlafen? Und würde sie etwas zu essen bekommen? Sie hatte mächtigen Hunger.
Während die Männer sich um die Pferde kümmerten, blieb Anna auf dem Gefährt zusammengekauert sitzen. Es war ausgeschlossen, um Essen und einen Schlafplatz zu bitten. Sie wollte den Ratschlag des Kutschers befolgen und so wenig wie möglich auf sich aufmerksam machen.
Der Inquisitor hatte sie aber ganz und gar nicht vergessen. Er kam mit langsamen Schritten auf den Wagen und Anna zu. Als er davor stand, schaute er sie streng an, fasste mit der einen Hand nach ihrem Kinn und drehte den Kopf in seine Richtung, damit sie ihn ansehen solle.
»Du wirst heute Nacht in diesem Stall schlafen. Einer meiner Männer wird auf dich aufpassen. Und versuch nicht zu fliehen, wir werden dich überall aufspüren.« Ausgerechnet der Mann, der hinter dem Wagen geritten war und die unangenehme Bemerkung gemacht hatte, sollte die Wache übernehmen.
»Man wird dir eine Decke und Wasser bringen«, sagte der Inquisitor noch und wendete sich zum Gehen.
»Jetzt wollen wir mal sehen, was es Gutes zu essen gibt.« Jakobus von Schaffhausen rieb sich die Hände und verschwand mit seinen Männern im Gasthof. Neben der Tür war an die Wand mit großen geschwungenen Buchstaben geschrieben: »Tritt ein, bring Glück herein.«
»Was für ein Hohn«, flüsterte Anna leise. »Als wenn diese Männer Glück bringen. Sie sind Teufel in Menschengestalt.«
Anna hatte von ihrem Vater lesen und schreiben gelernt. Sie war sehr stolz darauf, denn die meisten Menschen, die sie kannte, konnten weder das eine noch das andere.
»Du brauchst gar nicht sehnsüchtig zum Gasthof rüber zu schielen. Da kommst du ohnehin nicht rein«, sagte der Mann, der zu ihrer Bewachung draußen geblieben war, abfällig. Er hatte sich Anna, die vom Fuhrwerk hinuntergeklettert war, genähert. Sie konnte seinen unangenehmen Atem spüren. Anna hatte ihn nicht gleich bemerkt und wich erschreckt vor ihm zurück.
In diesem Moment kam der kleine Wirtshausjunge herbei, der den Männern den Gasthof seiner Eltern empfohlen hatte. Er hielt eine Lampe in der Hand, Wasser in der anderen und hatte sich etwas unter den Arm geklemmt. Der Wachmann entfernte sich ein paar Schritte von Anna.
»Ich bringe für das Fräulein Decken, Wasser …« Er wurde jäh von ihm unterbrochen.
»Quassel nicht, bring alles in den Stall. Und du«, er glotzte Anna finster und mit verschlagener Miene an, »suchst dir dort einen Platz zum Schlafen, kapiert! Ach, und Bürschchen, bring mir was zu essen und Bier.«
»Jawohl, mein Herr. Ich …«
»Jetzt mach schon und verschwinde«, zeterte der Mann ungeduldig.
Der Junge gab Anna ein Zeichen, ihm zu folgen.
Im Stall war es völlig finster.
»Hab keine Angst«, sagte er freundlich. »Ich lass dir die Lampe da. Dort in der Ecke ist es trocken.« Er zeigte auf einige Grasbündel und legte eine Decke darauf.
»Hier, das ist auch noch für dich.«
Der Junge lupfte sein Hemd und zog darunter eine Hühnchenkeule hervor. »Du musst sie schnell essen, bevor der Mann dich erwischt. Sie ist nicht mehr ganz warm, tut mir leid, aber es war gar nicht einfach, sie zu stibitzen. Meine Mutter passt in der Küche wie ein Schießhund auf. Hier!«
Anna nahm die Hühnchenkeule dankbar entgegen. Sie setzte sich auf das Grasbündel und aß, so schnell sie konnte, da hörten sie plötzlich Schritte. Es war der Wachmann, der den Stall betreten hatte. Geschwind steckte Anna den Rest der Keule unter die Decke.
»Was machst du noch hier«, schimpfte der Mann den Jungen aus. »Verschwinde und bring mir endlich was zu essen. Hier riecht es doch nach Hühnchen?« Er rollte mit den Augen und blickte sich forschend um.
»Ich komme wieder«, flüsterte der Junge Anna noch zu. »Ich heiße übrigens Gustav.« Und schon flitzte er hinaus.
Der Wachmann schaute ihm hinterher, folgte ihm jedoch nicht nach draußen. Er fasste sich in den Schritt und verschloss dann die Tür von innen.
Mit langsamen Schritten kam er auf Anna zu und stellte sich breitbeinig vor sie hin.
»Dieses feine Plätzchen hast du dir also gesucht. Da wirst du aber schön schlafen können. Zuvor wollen wir aber noch ein bisschen unser Vergnügen miteinander haben, na, was meinst du?«
Er lachte frech und näherte sich mit seinem Knie ihren Beinen. Instinktiv rutschte Anna nach hinten, doch spürte sie die Stallwand kurz darauf in ihrem Rücken. Sie saß in der Falle. Der Mann presste gegen ihre Beine und versuchte sie auseinanderzudrücken. Gleichzeitig nestelte er an seiner Hose herum und beugte sich keuchend zu Anna hinunter, um sie küssen. Anna versuchte sich ihm zu entziehen, aber sie konnte nicht gleichzeitig die Beine zusammenpressen. Sie drückte mit ihren Händen gegen seinen Oberkörper, jedoch ließ er sich nicht wegschieben, er war viel zu massig.
»Lasst mich in Ruhe!«, schrie sie und schlug in ihrer Verzweiflung mit ihren Fäusten auf ihn ein.
»Sei still, du kleine Hure, du Brut einer Hexe.«