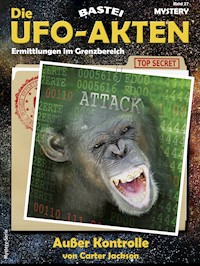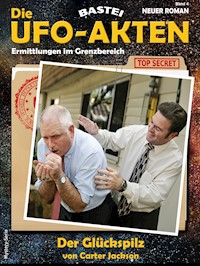1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In den Schluchten der New Yorker Bronx geht das Grauen um. Zwischen Müllbergen und Abbruchhäusern scheint eine Kreatur ihr Unwesen zu treiben, die eher ins Reich der Legenden und Horrorfilme gehört. Cliff Conroy und Judy Davenport, eigentlich wegen eines anderen Falls in New York, werden unversehens in die Geschehnisse hineingezogen.
Im Müll wird eine abgetrennte Hand entdeckt. Zwischen ihren Fingern findet die Polizei Haare, die weder Tier noch Mensch zuzuordnen sind. Und während die Wissenschaftler noch nach einer Erklärung suchen, geschieht bereits der nächste Mord!
Wer steckt dahinter? Warum wurden die Morde nur bei Vollmond verübt? Ist doch etwas dran an der Sage um den Werwolf?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Werwolf
UFO-Archiv
Vorschau
Impressum
Carter Jackson
Der Werwolf
Claremont Park, South Bronx
New York City, 30. März 2023, 23:40 Uhr
Trotz des Umstands, dass es laut Kalender Ende März und damit Frühling war, fror Andrew Kazbac erbärmlich, als er den stillgelegten U-Bahn-Tunnel in der Nähe der Webster Avenue verließ. Während er über die Bretterblockade kletterte, die eigentlich den Zugang zur Unterwelt versperren sollte, schlug er den Kragen seines schmutzigen Mantels hoch. Seine tief in die Höhlen gesunkenen Augen waren blutunterlaufen und tränten. Er sah alles wie durch eine fettige Fensterscheibe.
Hustend bahnte er sich seinen Weg. Es war zwar unwahrscheinlich, dass jemand bei Temperaturen, die derzeit kaum in die Nähe des Gefrierpunkts sanken, eine Lungenentzündung bekommen konnte, aber was war in dieser Stadt schon normal?
New York City war ein Moloch, der Menschen mit derselben Gleichgültigkeit und Leichtigkeit verschlang wie ein Leopard ein krankes, wehrloses Zebra.
Menschen wie Andrew Kazbac.
Andrew lebte bereits so lange auf der Straße, dass er nicht einmal mehr sagen konnte, wie lange genau. Vor tausend Jahren oder so hatte der kleine Elektronikhandel, in den er all seine Hoffnung und sein ganzes Geld investierte, Pleite gemacht, und nachdem die Bank alles gepfändet hatte, was er besaß, damit die Bonzen von der Wall Street einmal mehr mit ihren Kumpanen bei Chez Paul Austern in sich hineinstopfen konnten, waren ihm praktisch nur noch die Kleider geblieben, die er am Leib trug. Er hatte seine Wohnung verloren, seine Frau Melissa, die nicht eine Minute länger mit einem elenden Verlierer wie ihm verheiratet sein wollte, nachdem er kein Geld mehr besaß, das sie für Klamotten ausgeben konnte, und – was wahrscheinlich am schlimmsten war – seine Selbstachtung. Eine Weile hielt er sich mit den paar Bucks über Wasser, die er seinen Bekannten abschwatzen konnte, wohnte in billigen Motels und versuchte, sein Selbstmitleid in noch billigerem Fusel zu ertränken.
Doch die Hilfsbereitschaft seiner »Freunde« ließ schnell nach. Letztlich hatte er sich den Brüdern und Schwestern der Gosse angeschlossen und war einer der Gesichts- und Namenlosen geworden, die selbst im tiefsten Winter von den Sicherheitsbeamten aus den beheizten Wartesälen der U-Bahn-Stationen geworfen wurden. Er hatte keine Wahl, wenn er überleben wollte – sofern man dieses öde, trostlose Dahinvegetieren zwischen der nächsten kargen Mahlzeit im Obdachlosenasyl und der Suche nach einer warmen, sicheren Unterkunft für die Nacht überhaupt als »Leben« bezeichnen konnte.
Eigentlich hatte er seiner armseligen Existenz durch einen Sprung vor einen Lastwagen oder den Sturz von einem hohen Bürogebäude längst ein Ende setzen wollen. Doch um Selbstmord zu begehen, musste man nicht nur hoffnungslos verzweifelt sein, sondern auch mutig – und seinen Mut hatte Andrew schon vor etlichen Jahren verloren.
Allerdings sah es ganz danach aus, als würde sein Leiden schon bald auch ohne sein Zutun ein Ende finden. Denn anscheinend hatte er eine Nacht zu viel in zugigen, feuchten Gassen unter einer ausgebreiteten Zeitung geschlafen. Trotz T-Shirt, Pullover und Mantel, die er trug, klapperten seine Zähne unkontrolliert. Schweiß, kalt und klebrig, perlte auf seiner Stirn. Sein Kopf dröhnte so stark, als wollte er jeden Moment explodieren. Jede Bewegung, die er machte, jagte Erschütterungen wie von einem Erdbeben durch seinen mageren, unterernährten Körper. Das Fieber in seinem Inneren wütete so heftig, dass er kaum imstande war, einen klaren Gedanken zu fassen.
Mit hängenden Schultern und eingezogenem Kopf schlurfte Andrew über den schmalen, von Unkraut überwucherten Schotterweg, der vom U-Bahn-Tunnel weg in Richtung Claremont Park führte. Als er an einer Plakatwand vorbeikam, die für Avatar II warb, der schon wenige Wochen nach seiner Premiere zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden war, hustete er heftig und spie einen Ballen blutig roten Schleims aus.
Er konnte seine Lungen bei jedem Atemzug, den er tat, rasseln hören wie eine alte Zugbrücke. Es war bloß eine Frage der Zeit, bis er vor Erschöpfung einfach umfallen und nicht mehr aufstehen würde. Zwar war es irgendwie schade, dass die Oberen der Stadt dann ein Problem weniger hatten, aber er konnte weder zu einem Arzt noch ins Krankenhaus gehen, um sich helfen zu lassen, denn sein gesamtes Vermögen bestand aus zwei Dollar und sechs Cents. Damit ließ sich schwerlich eine Arztrechnung bezahlen. Und wenn die um ihr Geld »geprellten« Mediziner daraufhin die Cops rufen würden, fände er sich zu allem Überfluss auch noch für den nächsten Monat im Knast wieder, da jeder Obdachlose per Gesetz mindestens fünfzig Dollar und gültige Papiere besitzen muss, um sich in diesem ach so freien Land frei bewegen zu dürfen, ohne sich der Landstreicherei schuldig zu machen.
Kurzum: Für Andrew Kazbac gab es weder professionelle medizinische Hilfe noch Medikamente. Alles, was er tun konnte, war hoffen und beten, dass Gott in seiner grenzenlosen Güte ein Wunder geschehen ließ und ihm dabei half, die Lungenentzündung zu überwinden, oder ihm zumindest ein gnädiges Ende bescherte. Aber irgendwie glaubte er nicht daran; schließlich hatte Gott sich schon eine ganze Weile nicht mehr besonders um ihn gekümmert. Warum also ausgerechnet jetzt?
Andrew erreichte bald den Westeingang des Claremont Parks, der es von der Größe her zwar bei Weitem nicht mit dem Central Park aufnehmen konnte, diesem dafür jedoch in Sachen Kriminalität weit überlegen war, sodass sich nach Einbruch der Dunkelheit kaum ein »zivilisierter« Mensch hierher verirrte, aus Angst, von dem herumlungernden Gesindel ausgeraubt und vielleicht sogar ermordet zu werden.
Davor brauchte sich Andrew jedoch nicht zu fürchten. Es war in der Vergangenheit zwar bereits vorgekommen, dass irgendein durchgeknallter Junkie auf Cold Turkey einem seiner »Kollegen« wegen vierzehn Cents, durchgelatschter Turnschuhe und einer viertelvollen Flasche Wodka die Kehle durchgeschnitten hatte. Aber Andrew sah selbst aus nächster Nähe nicht so aus, als hätte er mehr in den Taschen als Luft.
Während er den asphaltierten Weg entlangschlurfte, der über und über mit Unrat – Zigarettenkippen, weggeworfenen Bierdosen, den Splittern der kleinen Glasphiolen, in denen Crack verkauft wurde – übersät war, nahm er kaum wahr, was um ihn herum geschah. Alles wirkte verschwommen, wie aus waberndem Nebel geformt. Das Fieber hielt Andrew fest in seinen Klauen und verzerrte die Wirklichkeit. Die Bäume, die zu beiden Seiten des Pfades in den dunklen Nachthimmel ragten und sich sanft in einer leichten Brise wiegten, wirkten wie graue Riesen, die ihre langen, zotteligen Arme schüttelten. Der Hydrant neben dem Weg erinnerte an einen Kobold, der sich in die dräuenden Schatten duckte und auf ein Opfer lauerte. Selbst der zunehmende Mond, der bleich wie das deformierte Gesicht eines toten Mannes zwischen den vorbeiziehenden Wolken hervorlugte, schien ihm seltsam fremd.
Erfahrungsgemäß wusste Andrew Kazbac, dass man in der Nähe des sogenannten Liebespavillons im Südteil des Parks meistens ungestört war. Denn die jungen Liebespaare, die es früher in Scharen zwecks einer heißen Nummer zu dem Pavillon gezogen hatte, blieben weg, seit viele Junkies und Alkoholiker diesen Teil des Parks zu ihrem bevorzugten Nachtquartier erkoren hatten.
Im Winter, wenn der Schnee durch die Straßen der Millionenstadt trieb und die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt fielen, bot der Liebespavillon nicht sonderlich viel Schutz gegen die Witterung. Aber jetzt, im Frühling, konnte man es dort in der Nacht schon aushalten, zumal anders als in vielen anderen Parks von New York nicht die Gefahr bestand, dass Cops auf Streife ihn aufspüren und fortschicken würden.
Denn auch die Polizei machte nach Möglichkeit stets einen großen Bogen um das Gebiet. Schließlich waren es die paar hundert Scheinchen, die sie im Monat verdienten, nicht wert, von irgendeinem vollkommen zugedröhnten Fixer seine schmutzige Spritze in den Rücken gestochen zu bekommen.
Andrew wischte sich mit dem Handrücken den kalten Schweiß von der Stirn. Er hatte große Mühe, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Seine Augen waren starr und glasig vor Fieber, und als es mit einem Mal leicht zu nieseln begann, bemerkte er es nicht einmal.
Benommen torkelte er den Schotterweg entlang, bis rechts, halb verborgen zwischen Bäumen, endlich der Pavillon auftauchte, der früher bei den regelmäßig abgehaltenen Parkfesten Platz für die Musikkapelle geboten hatte – damals, in den Fünfzigern, als man noch ohne Revolver nach halb zehn Uhr abends in den Supermarkt an der Ecke gehen konnte.
Angestrengt keuchend schlug der Obdachlose sich durch die Büsche und war dankbar für die Dunkelheit abseits des Asphaltweges, wo das matte, orangene Licht der Laternen ihm in den Augen schmerzte. Mit jedem einzelnen Schritt, den Kazbac tat, hatte er das Gefühl, schwächer zu werden. Regen rann seine stoppeligen, unrasierten Wangen hinab, nässte den Kragen seines Mantels.
Er überquerte langsam die Rasenfläche, die offenbar schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemäht worden war. Beinahe wäre er über eine leere Whiskeyflasche gestolpert, die im kniehohen Gras lag. Jenseits der Lichtung konnte er den kleinen Parksee ausmachen, in dessen unbewegter Oberfläche sich der Mond spiegelte, silbern und erhaben. Irgendwo in der Nähe schrie einsam ein Käuzchen, laut genug, dass das Geräusch in Andrews Hirn eindrang wie eine weißglühende Stricknadel. Schmerzerfüllt stöhnte er auf.
Dann erreichte er schließlich den Liebespavillon, der im Grunde kaum mehr als ein überdachtes Podest war. Der Geruch von Urin, Erbrochenem und verschüttetem Alkohol drang aus dem Pavillon, doch Andrew registrierte es nicht. Mit zitternden Knien stützte er sich am Treppenpfosten ab und schleppte sich schwer atmend die drei ausgelatschten Stufen hinauf, die unter seinen Schritten verhalten knirschten.
Als er oben angelangt war, hielt Andrew plötzlich verwirrt inne.
Er war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte durch die Watte, die in seinen Ohren zu stecken schien, etwas gehört zu haben.
Ein dunkles, grollendes Geräusch.
Nicht weit von sich entfernt.
Andrew Kazbac sah sich benommen um. Er ließ den Blick über die Bäume und Büsche schweifen, suchte am Rande der Lichtung nach einer Bewegung, die ihm verriet, dass irgendein Abhängiger auf der Suche nach einer weggeworfenen Injektionsnadel durchs Unterholz schlich.
Doch er konnte nichts erkennen. Alles war ruhig.
Er runzelte irritiert die Stirn. Komisch. Dabei war er sich fast sicher gewesen, dass ...
Dann hörte er das Geräusch erneut, viel näher als zuvor. Ein tiefes, unheilvolles Brummen, Rasseln oder Knurren, wie von einem alten Auto, das ums Verrecken nicht anspringen will – oder einem Tiger, der den Kreis um seine Beute immer enger zieht ...
Dieser Gedanke entlockte Andrew trotz seines apathischen, abwesenden Zustands ein amüsiertes Giggeln. Ein Raubtier im Claremont Park? Eine groteske Vorstellung!
Aber was hatte es mit dem sonderbaren Knurren – sofern es überhaupt ein Knurren war – dann auf sich?
Andrew vermochte es nicht zu sagen. Und ehrlich gestanden war es ihm auch vollkommen egal. Alles, was ihn interessierte, war er selbst beziehungsweise das, was nach all den Jahren auf der Straße noch von ihm übrig geblieben war. Was ging ihn irgendein blöder Köter an, der sich in den Büschen mit einer anderen Töle um einen Entenknochen oder was auch immer stritt?
Nichts.
Absolut rein gar nichts.
Mit einem gleichgültigen Achselzucken drehte Andrew sich um, betrat den Liebespavillon – und sah aus dem Augenwinkel heraus einen dunklen Schatten auf sich zukommen. Instinktiv wollte er sich umdrehen, eine abwehrende Haltung einnehmen ...
Doch es war zu spät.
Er wurde brutal von hinten gepackt und aus dem Pavillon gezerrt, verlor das Gleichgewicht. Automatisch griff er nach der Brüstung, wollte sich festhalten, doch dann stürzte er, einen verhaltenen Schrei auf den Lippen, die Treppenstufen hinab. Plötzlich wusste er nicht mehr, wo oben und unten war. Vor dem Pavillon schlug er hart ins Gras. Sein Gesicht machte Bekanntschaft mit dem Boden, und seine Unterlippe platzte auf. Blut floss. Um ihn herum drehte sich alles. Er konnte nicht recht begreifen, was geschehen war. Mit einem schmerzerfüllten Stöhnen rappelte Andrew sich auf, schaute sich benommen nach dem Angreifer um ... doch da war niemand.
Andrew kratzte sich verwirrt am Kinn, während ein dünner roter Blutfaden seinen Mundwinkel hinablief. Wäre er betrunken gewesen, hätte er angenommen, dass er über seine eigenen Füße gestolpert war. Aber der letzte Schluck aus einer Flasche Schnaps lag schon drei oder vier Tage zurück. Und selbst wenn seine Sinne vom Fieber umnebelt waren, bedeutete das noch lange nicht, dass er auch Halluzinationen hatte.
Oder etwa doch?
War er eben wirklich angegriffen worden?
In diesem Moment erklang das tiefe Knurren erneut, rechts von ihm, ganz nahe, im Unterholz, und es war ebenso real wie die Schmerzen, die seinen geschundenen Körper quälten. Hastig schaute Andrew in die Richtung, aus der das Geräusch kam – und machte zwischen dem dichten, vom Nieselregen feuchten Grün der Gewächse zwei gelbe Punkte aus, die wie Feuer im Kamin flackerten.
Ein Augenpaar, wild und zornig.
»Was, zum Teufel ...«, murmelte Andrew verwirrt.
Er sollte den Satz niemals beenden, denn plötzlich schnellte der dunkle Schatten vor und stürzte sich knurrend auf ihn.
Andrew wollte instinktiv die Arme hochreißen, um sich vor dem Angreifer zu schützen. Doch er hatte keine Chance, konnte nicht verhindern, dass messerscharfe Krallen den Stoff seines Mantels zerfetzten, als wäre es altes Zeitungspapier, und ihm fünf hässliche, direkt nebeneinanderliegende Fleischwunden im Brustbereich zufügten.
Er schrie auf, wich panisch zurück, während die gelben Augen ihm nachsetzten, und trotz seiner Benommenheit wurde er mit einem Mal von entsetzlicher Angst erfasst.
Von Todesangst.
Erneut hieben die Klauenhände zu, unterstützt von langen elfenbeinfarbenen Hauern, auf denen im Mondlicht kalter Speichel glänzte. Ein wütendes Knurren erfüllte die Nacht. Heißer, nach fauligem Fleisch und Blut stinkender Atem streifte das Gesicht des Obdachlosen.
Schmerz explodierte überall in seinem Körper, grässlicher, gleißender, tödlicher Schmerz. Er strauchelte, stolperte über seine eigenen Füße, taumelte, fiel rücklings zu Boden. Plötzlich, völlig unerwartet, waren seine zuvor vom Fieber umlagerten Sinne wieder klar. So bekam er in erschreckender Deutlichkeit mit, wie der unheimliche Angreifer, ein knurrender Schatten in der Dunkelheit, sich auf ihn stürzte, sah wie in Zeitlupe, wie die langen, dolchartigen Zähne des Killers nach ihm schnappten, sich wie die eisernen Kiefer einer Bärenfalle unbarmherzig um seine Kehle schlossen ...
Blut spritzte in hohem Bogen ins Gras, glänzte auf den regenfeuchten Halmen im Licht des zunehmenden Mondes so schwarz wie Teer.
Andrew Kazbacs schriller Schrei verwandelte sich in ein gutturales, feuchtes Gurgeln. Sein Körper zappelte unkontrolliert. Seine Füße peitschten durch das Gras. Dann brach sein Blick, seine Augen wurden trübe, und seine Finger hörten zögernd auf zu zucken.
Stille senkte sich über den Claremont Park.
Schwarze, tödliche Stille.
Mit glühenden, triumphierend flackernden Augen machte sich der Schatten über sein Opfer her, das leblos vor dem Pavillon im Gras lag. Regentropfen fielen in seine vor Entsetzen und Schmerz weit aufgerissenen Augen. Für einen Moment war nur das grausame Reißen, Knirschen und Knurren zu hören, mit dem der Schatten seinen Hunger stillte und seinen Durst nach Blut zu löschen versuchte.
Dann zerriss plötzlich ein zweiter Schrei die Nacht.
Der Schrei einer Frau, hoch und hysterisch.
Knurrend wirbelte der Schatten herum.
Die Frau stand keine zwanzig Meter entfernt am Rande der Lichtung. Sie trug einen alten Armeeparka und klobige Stiefel. In den Händen hielt sie Einkaufstüten, in denen sich ihre armseligen Habseligkeiten befanden. Langes fettiges Haar hing ihr in Strähnen in das hagere, herbe Gesicht. Fassungsloses Grauen spiegelte sich in ihren Zügen. Ihr Mund war noch immer zu einem stummen Schrei verzerrt.
Der Schatten zögerte keine Sekunde.
Mit der Schnelligkeit einer angreifenden Königskobra ließ er von den zerfleischten Überresten des Obdachlosen ab und schoss mit gefletschten Hauern auf die Frau zu, die wie erstarrt dastand. Ein tiefes, aggressives Knurren entrang sich seiner Kehle. Innerhalb von zwei Herzschlägen hatte er sie erreicht.
Eine krallenbewehrte Klaue sauste durch die Luft.
Der Kopf der Frau flog davon wie ein Baseball, landete ein paar Meter weiter im hohen Gras. Die Einkaufstüten fielen zu Boden und verstreuten ihren bescheidenen Inhalt, bevor der Rumpf wie ein nasser Sack in sich zusammensank.
Guelgas Schrottplatz
New York City, South Bronx, 31. März, 10:23 Uhr
Die Ratte war fast so groß wie ein Schäferhundwelpe, das Fell glänzend und grau, der nackte, gebogene Schwanz so lang wie ein Männerunterarm. Mit unruhig zwinkernden Augen schoss das Vieh unter einem vollkommen zerbeulten Chevrolet hervor, lief auf seinen kurzen Stummelbeinen zu dem verrotteten Apfel, der zwischen den aufragenden Autowracks auf dem Weg lag, und machte sich gierig über das faulige Obst her.
Ein böses Grinsen erschien auf Yusuf Guelgas kantigen Zügen. Seine Stirn lag in konzentrierten Falten. Er hatte die verdammte Ratte perfekt im Visier. Kimme, Korn und Kopf des Nagers stimmten genau überein. Langsam krümmte er den Zeigefinger um den Abzug des Browning-Kleinkalibergewehrs, kostete für einen Moment das unbeschreibliche Gefühl aus, Herr über Leben und Tod zu sein. In einer Sekunde würde das elende Vieh eine Ex-Ratte sein ...
Mit einem Mal begann das Telefon drüben in der schäbigen Bretterbaracke zu klingeln, die Guelga hochtrabend als sein »Büro« zu bezeichnen pflegte. Das Geräusch schallte schrill über den heruntergekommenen Schrottplatz Ecke Bridge Road und Bronx River Parkway.