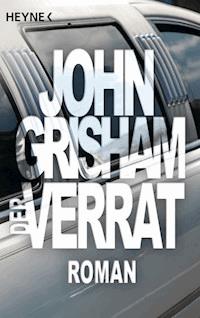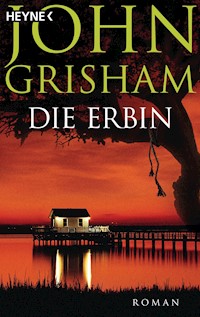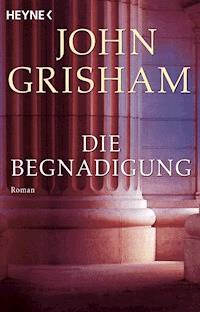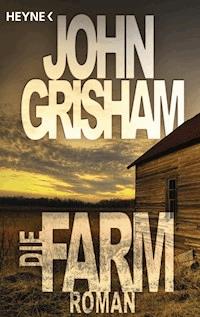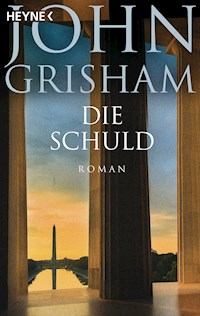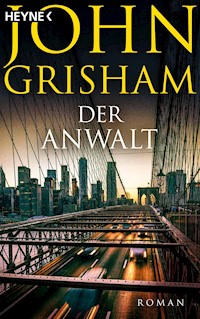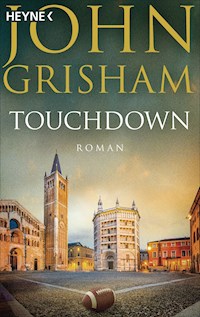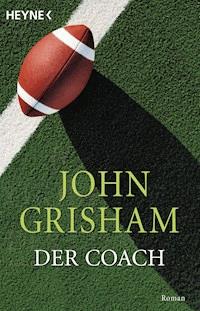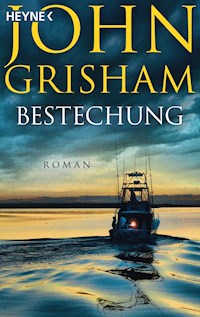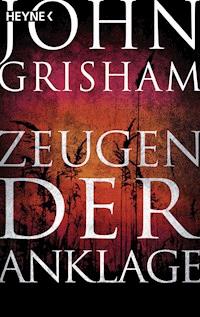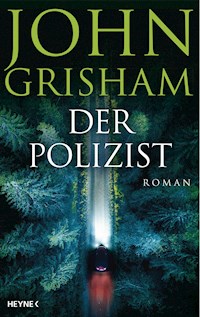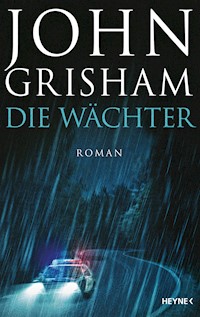
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Beklemmend, skandalös, hochaktuell
In Seabrook, Florida, wird der junge Anwalt Keith Russo erschossen. Der Mörder hinterlässt keine Spuren, es gibt keine Zeugen, keine Verdächtigen, kein Motiv. Trotzdem wird Quincy Miller verhaftet, ein junger Afroamerikaner, der früher zu den Klienten des Anwalts zählte. Miller wird verurteilt und sitzt 22 Jahre im Gefängnis. Dann schreibt er einen Brief an die Guardian Ministries, einen Zusammenschluss von Anwälten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren. Cullen Post übernimmt seinen Fall. Er ahnt nicht, dass er sich damit in Lebensgefahr begibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
JOHNGRISHAM
DIEWÄCHTER
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Bea Reiter, Imke Walsh-Araya und Kristiana Dorn-Ruhl
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Guardiansbei Doubleday, New York Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Copyright © 2019 by Belfry Holdings, Inc.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Oliver NeumannCovergestaltung und Motiv: Nele Schütz Design, München,unter Verwendung von AdobeStock/irontrybexHerstellung: Helga SchörnigSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-24396-8V005www.heyne.de
Für James McCloskey, den »Befreier«
1
Duke Russell hat die grauenvollen Verbrechen, für die er verurteilt worden ist, nicht begangen. Trotzdem soll er in einer Stunde und vierundvierzig Minuten hingerichtet werden. Wie immer in diesen entsetzlichen Nächten scheint die Uhr schneller zu ticken, je näher die letzte Stunde kommt. Ich habe schon zwei dieser Countdowns in anderen Bundesstaaten mitgemacht. Einer wurde bis zum Schluss heruntergezählt, und mein Mandant sprach seine letzten Worte. Der andere wurde wie durch ein Wunder in letzter Minute abgebrochen.
Die Uhr soll ruhig ticken – es wird nichts geschehen, jedenfalls nicht heute Abend. Die Leute, die Alabama regieren, werden es vielleicht eines Tages schaffen, Duke die Henkersmahlzeit zu servieren und ihm dann eine Nadel in den Arm zu stecken, aber nicht heute. Er sitzt erst seit neun Jahren im Todestrakt. Der Durchschnitt in diesem Bundesstaat liegt bei fünfzehn Jahren. Zwanzig ist nicht ungewöhnlich. Beim 11. Bezirksgericht in Atlanta wird ein Antrag auf Aufschub herumgereicht, und wenn er innerhalb einer Stunde auf dem Schreibtisch des richtigen Mitarbeiters landet, wird die Hinrichtung nicht stattfinden. Duke wird zu den Schrecken der Einzelhaft zurückkehren und den nächsten Tag erleben.
Er ist seit vier Jahren mein Mandant. Unterstützung bekommt er von einer Großkanzlei in Chicago, deren Anwälte viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit für ihn leisten, sowie einer Initiative gegen die Todesstrafe, die in Birmingham ansässig und schlichtweg überfordert ist. Vor vier Jahren, als ich zu dem Schluss kam, dass Duke unschuldig ist, bin ich als Frontmann dazugestoßen. Zurzeit habe ich fünf Fälle, alles Fehlurteile, jedenfalls meiner Meinung nach.
Einen meiner Mandanten habe ich sterben sehen. Ich glaube immer noch, dass er unschuldig war. Ich konnte es nur nicht rechtzeitig beweisen. Einer ist genug.
Zum dritten Mal an diesem Tag betrete ich Alabamas Todestrakt und bleibe an dem Metalldetektor vor der ersten Tür stehen, neben dem zwei finster dreinblickende Gefängniswärter ihr Revier bewachen. Einer von ihnen hält ein Klemmbrett in der Hand und starrt mich an, als hätte er seit meinem letzten Besuch vor zwei Stunden meinen Namen vergessen.
»Post, Cullen Post«, sage ich zu dem Schwachkopf. »Für Duke Russell.«
Er überfliegt das Klemmbrett, als enthielte es Informationen von entscheidender Bedeutung, findet, was er sucht, und nickt dann in Richtung einer Plastikschale, die auf einem kurzen Laufband steht. Ich lege Aktenkoffer und Handy hinein, wie vorhin schon.
»Uhr und Gürtel?«, erkundige ich mich wie ein echter Klugscheißer.
»Nein«, stößt er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ich mache zwei Schritte durch den Metalldetektor – und wieder ist es einem Anwalt, der sich für die Aufklärung von Fehlurteilen einsetzt, gelungen, den Todestrakt ohne Waffen zu betreten. Ich nehme Aktenkoffer und Handy und folge dem anderen Wärter durch einen kahlen Gang zu einer Wand aus Gitterstäben. Er nickt, steckt einen Schlüssel in den Schließmechanismus, die Gitterstäbe schieben sich zur Seite, und wir marschieren durch einen zweiten Gang noch tiefer hinein in das deprimierende Gebäude. Hinter der nächsten Ecke warten einige Männer vor einer fensterlosen Stahltür. Vier von ihnen stecken in Uniformen, zwei tragen Anzüge. Einer der beiden Letzteren ist der Gefängnisdirektor.
Er kommt mit ernstem Blick auf mich zu. »Haben Sie eine Minute Zeit?«
»Eine schon, aber mehr nicht«, erwidere ich. Wir rücken ein Stück von der Gruppe ab, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Der Direktor ist kein schlechter Mensch, er macht nur seinen Job, in dem er ziemlich neu ist, und daher hat er noch nie eine Hinrichtung durchgeführt. Außerdem ist er der Feind, und egal, was er will, von mir wird er es nicht bekommen.
Wir stecken die Köpfe zusammen wie zwei gute Freunde. »Wie sieht es aus?«, flüstert er.
Ich blicke mich um, als wollte ich die Situation einschätzen. »Also, für mich sieht es aus wie eine Hinrichtung.«
»Post, was soll das? Unsere Anwälte sagen, wir haben grünes Licht.«
»Ihre Anwälte sind Idioten. Dieses Gespräch haben wir schon einmal geführt.«
Der Direktor seufzt. »Wie stehen die Chancen?«
»Fünfzig-fünfzig«, erwidere ich. Es ist gelogen.
Das verwirrt ihn, und er weiß nicht so recht, wie er reagieren soll.
»Ich würde jetzt gern mit meinem Mandanten sprechen«, sage ich.
»Aber natürlich.« Er ist lauter geworden, als wäre er frustriert. Da nicht der Eindruck entstehen darf, dass er mir irgendwie entgegenkommt, stürmt er wutentbrannt davon. Die Wärter treten zurück, und einer von ihnen öffnet die Stahltür der Todeszelle.
Duke liegt mit geschlossenen Augen auf einer schmalen Pritsche. Zur Feier des Tages gestatten ihm die Regeln einen kleinen Farbfernseher, daher kann er einschalten, was er möchte. Der Ton ist abgestellt, und über den Bildschirm flimmern Bilder eines Waldbrands im Westen. Der Countdown für seine Hinrichtung ist keine Meldung in den landesweiten Nachrichten wert.
Jeder Bundesstaat, in dem es die Todesstrafe gibt, hat seine eigenen albernen Rituale für eine Hinrichtung, die so viel Drama wie möglich erzeugen sollen. In Alabama sind Besuche von Angehörigen mit Vollkontakt erlaubt, die in einem großen Besucherzimmer stattfinden. Um zehn Uhr abends wird der Verurteilte in die Todeszelle gebracht, die direkt neben dem Raum liegt, in dem er hingerichtet wird. Sein Anwalt und ein Geistlicher dürfen ihm Gesellschaft leisten, sonst niemand. Seine Henkersmahlzeit wird gegen 22.30 Uhr serviert, und er kann bestellen, was er möchte, mit Ausnahme von Alkohol.
»Wie geht es Ihnen?«, frage ich, als er sich aufsetzt und lächelt.
»So gut wie noch nie. Gibt es Neuigkeiten?«
»Noch nicht, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Wir sollten bald etwas hören.«
Duke ist ein 38-jähriger Weißer, und bevor er wegen Vergewaltigung und Mord verhaftet wurde, bestand sein Vorstrafenregister aus zwei Anklagen wegen Alkohol am Steuer und ein paar Strafzetteln für zu schnelles Fahren. Keine Spur von Gewalttätigkeit. Früher feierte er die Nächte durch und war immer auf Radau aus, aber nach neun Jahren in Einzelhaft ist er erheblich ruhiger geworden. Mein Job besteht darin, ihn aus dem Gefängnis zu holen, was mir im Moment wie ein verrückter Traum vorkommt.
Ich nehme die Fernbedienung und wechsle die Kanäle, bis ich einen Regionalsender aus Birmingham erwische, lasse den Ton aber auf stumm geschaltet.
»Sie scheinen aber sehr zuversichtlich zu sein«, sagt er.
»Ich kann’s mir leisten. Ich bin nicht derjenige, den die hinrichten wollen.«
»Sehr witzig, Post.«
»Entspannen Sie sich, Duke.«
»Entspannen?« Er schwingt die Füße vom Bett auf den Boden und lächelt wieder. In Anbetracht der Umstände sieht er eigentlich sehr entspannt aus. »Können Sie sich noch an Lucky Skelton erinnern?«, fragt er.
»Nein.«
»Vor ungefähr fünf Jahren haben sie ihn gekriegt, aber davor hat er drei Henkersmahlzeiten bekommen. Er ist dreimal über die Planke gelaufen, bevor sie ihn hinuntergestoßen haben. Pizza mit Salami und Cherry Cola.«
»Und was haben Sie bestellt?«
»Steak mit Pommes, dazu ein Sixpack Bier.«
»Das Bier werden Sie vermutlich nicht bekommen.«
»Post, werden Sie mich hier rausholen?«
»Heute Abend nicht, aber ich arbeite dran.«
»Wenn ich rauskomme, werde ich schnurstracks in eine Bar marschieren und so lange Bier trinken, bis ich umfalle.«
»Ich komme mit. Ah, da ist der Gouverneur.« Als er ins Bild kommt, stelle ich den Ton am Fernseher lauter.
Er steht hinter einer Reihe von Mikrofonen und wird von grellem Kameralicht angestrahlt. Dunkler Anzug, Krawatte mit Paisley-Muster, weißes Hemd, jedes gefärbte Haar akkurat mit Gel in Form gebracht. Eine Wahlkampfwerbung auf zwei Beinen. Mit dem gebührenden Ernst in der Stimme sagt er: »Ich habe Mr. Russells Fall mit aller Sorgfalt geprüft und mich ausführlich mit den Ermittlern beraten. Darüber hinaus habe ich mich mit der Familie von Emily Broone getroffen, dem Opfer von Mr. Russells Verbrechen. Ihre Angehörigen haben sich vehement gegen jegliche Form von Gnade ausgesprochen. Nachdem ich sämtliche Aspekte dieses Falls berücksichtigt habe, bin ich zu der Entscheidung gekommen, das Urteil nicht aufzuheben. Der Gerichtsbeschluss bleibt bestehen, die Hinrichtung wird stattfinden. Das Volk hat gesprochen. Das Gnadengesuch von Mr. Russell wird hiermit abgelehnt.« Der Gouverneur verkündet das mit so viel Dramatik wie möglich, dann verbeugt er sich und geht langsam rückwärts, weg von den Kameras. Seine Vorstellung ist beendet. Keine Zugabe. Vor drei Tagen hat er mir fünfzehn Minuten seiner Zeit für eine Audienz gewährt und dann anschließend seine Lieblingsreporter über unser »privates« Gespräch informiert.
Wenn seine Prüfung des Falls so gründlich wie behauptet gewesen wäre, hätte er gewusst, dass Duke Russell nichts mit der Vergewaltigung und dem Mord an Emily Broone vor elf Jahren zu tun hatte. Ich schalte den Ton wieder auf stumm und sage: »Was für eine Überraschung.«
»Hat er denn schon mal jemanden begnadigt?«, will Duke wissen.
»Natürlich nicht.«
Jemand klopft an die Tür und öffnet sie. Zwei Gefängniswärter kommen herein, einer schiebt den Rollwagen mit der Henkersmahlzeit vor sich her. Sie lassen den Wagen stehen und verschwinden. Duke starrt das Steak, die Pommes frites und ein sehr schmales Stück Schokoladenkuchen an. »Kein Bier«, stellt er fest.
»Lassen Sie sich den Eistee schmecken.«
Er setzt sich auf das Bett und greift zum Besteck. Das Essen riecht köstlich, und plötzlich fällt mir auf, dass ich seit vierundzwanzig Stunden nichts mehr in den Magen bekommen habe. »Möchten Sie ein paar Pommes?«, fragt er.
»Nein danke.«
»Ich kann das nicht alles essen. Aus irgendeinem Grund habe ich keinen großen Appetit.«
»Wie war der Besuch Ihrer Mutter?«
Duke steckt sich ein großes Stück Steak in den Mund und kaut langsam. »Nicht sehr schön, wie Sie sich vorstellen können. Viele Tränen. Es war ziemlich schlimm.«
Als das Handy in meiner Tasche vibriert, ziehe ich es heraus. »Es geht los«, sage ich nach einem Blick auf die Anruferkennung. Ich lächle Duke zu und nehme das Gespräch entgegen. Am anderen Ende ist ein Referendar vom 11. Bezirksgericht, den ich ziemlich gut kenne. Er teilt mir mit, dass sein Chef gerade einen Beschluss unterschrieben habe, der einen Aufschub der Hinrichtung anordne, mit der Begründung, dass mehr Zeit benötigt werde, um festzustellen, ob Duke Russell ein faires Verfahren bekommen habe. Ich frage, wann der Aufschub bekannt gegeben werde, und er antwortet: sofort.
Ich schaue meinen Mandanten an. »Die Hinrichtung wurde aufgeschoben. Heute Abend wird man Ihnen keine Nadel in den Arm stecken. Wie lange brauchen Sie, um das Steak zu essen?«
»Fünf Minuten«, erwidert er mit einem breiten Grinsen und schneidet sich noch ein Stück Fleisch ab.
»Können Sie mir zehn Minuten geben?«, bitte ich den Referendar. »Mein Mandant würde gern seine Henkersmahlzeit beenden.« Nach einigem Hin und Her einigen wir uns auf sieben Minuten. Ich bedanke mich, beende das Gespräch und gebe eine Telefonnummer ein. »Beeilen Sie sich«, sage ich währenddessen zu Duke. Er hat plötzlich den Appetit wiedergefunden und schaufelt sich das Essen mit großem Vergnügen in den Mund.
Der Architekt von Dukes Fehlurteil ist ein Kleinstadtstaatsanwalt namens Chad Falwright. Zurzeit wartet er ein paar Hundert Meter weiter im Verwaltungsgebäude des Gefängnisses auf den Moment, den er für die Krönung seiner Karriere hält. Er geht davon aus, dass man ihn um 23.30 Uhr zusammen mit der Familie Broone und dem örtlichen Sheriff zu einem Kleintransporter des Gefängnisses begleiten und zum Todestrakt fahren wird, wo dann alle in einen kleinen Raum mit einem großen, von einem Vorhang verhüllten Glasfenster geführt werden. Dort werden sie, so denkt Falwright, auf den Augenblick warten, wo Duke mit ein paar Injektionskanülen in den Armen auf die Bahre geschnallt wird und sich auf dramatische Weise der Vorhang öffnet.
Für einen Staatsanwalt gibt es nichts Befriedigenderes, als einer Hinrichtung beizuwohnen, für die er verantwortlich ist.
Falwright wird dieser befriedigende Moment allerdings verwehrt bleiben.
Er nimmt das Gespräch sofort entgegen. »Post hier«, melde ich mich. »Ich bin im Todestrakt und habe schlechte Neuigkeiten für Sie. Das 11. Bezirksgericht hat gerade einen Aufschub gewährt. Sieht ganz so aus, als müssten Sie mit eingezogenem Schwanz nach Verona zurückkriechen.«
»Was zum Teufel …?«, bringt er heraus.
»Sie haben richtig verstanden. Ihr Fehlurteil wird gerade zerlegt, und so nah wie jetzt werden Sie Dukes Hinrichtung nie wieder kommen. Ich muss allerdings zugeben, dass es ziemlich knapp war. Das 11. Bezirksgericht hat Zweifel daran, dass es ein faires Verfahren war, deshalb wird es an die erste Instanz zurückverwiesen. Es ist vorbei, Falwright. Tut mir leid, dass ich Ihnen den großen Moment verderbe.«
»Soll das ein Witz sein, Post?«
»Na klar ist das ein Witz. Hier im Todestrakt geht es immer sehr lustig zu. Sie hatten Ihren Spaß, als Sie sich den ganzen Tag lang mit den Reportern unterhalten haben, und jetzt habe ich eben meinen Spaß.« Würde ich sagen, dass ich diesen Kerl hasse, wäre das eine gigantische Untertreibung.
Ich beende das Gespräch und sehe Duke an, der immer noch sein Essen in sich hineinschaufelt. »Kann ich meine Mutter anrufen?«, bittet er mich mit vollem Mund.
»Nein. Im Todestrakt dürfen nur Anwälte mit dem Handy telefonieren. Aber sie wird es schon bald erfahren. Beeilen Sie sich.« Er spült das Steak mit Eistee hinunter und nimmt den Schokoladenkuchen in Angriff. Ich mache den Ton des Fernsehers mit der Fernbedienung lauter. Während Dukes Gabel über den Teller kratzt, stellt sich irgendwo auf dem Gefängnisgelände ein völlig außer Atem geratener Reporter in Positur und verkündet stotternd, dass ein Aufschub der Hinrichtung gewährt worden sei. Er sieht verwirrt aus, und um ihn herum bricht hektische Aktivität aus.
Nach ein paar Sekunden klopft es an der Tür, und der Gefängnisdirektor kommt herein. Er wirft einen Blick auf den Fernseher und sagt: »Ich nehme an, Sie haben es schon gehört?«
»Richtig. Tut mir leid, dass die Party abgesagt ist. Ihre Jungs können nach Hause gehen. Und bitte rufen Sie den Bus für mich.«
Duke wischt sich mit dem Hemdsärmel den Mund ab und beginnt zu lachen. »Sie sehen ziemlich enttäuscht aus«, sagt er zum Direktor.
»Nein, genau genommen bin ich erleichtert.« Es ist klar, dass der Direktor lügt. Auch er hat den ganzen Tag über mit Reportern geredet und das Rampenlicht genossen. Und plötzlich endet sein triumphaler Lauf über das Spielfeld, weil er kurz vor der Torlinie den Ball verliert.
»Ich bin dann weg«, verabschiede ich mich und gebe Duke die Hand.
»Danke, Post«, sagt er.
»Ich melde mich.« An der Tür drehe ich mich noch einmal zu dem Direktor um. »Bitte richten Sie dem Gouverneur schöne Grüße aus.«
Ich werde von einem Wärter aus dem Gebäude nach draußen geführt, wo mir kalte Nachtluft entgegenschlägt. Ein zweiter Wärter bringt mich zu einem nicht gekennzeichneten Kleintransporter des Gefängnisses, der ein paar Meter entfernt auf mich wartet. Ich steige ein und ziehe die Tür zu. »Haupttor«, sage ich zu dem Mann am Steuer.
Auf der Fahrt durch das weitläufige Gelände der Holman Correctional Facility überfallen mich schlagartig Müdigkeit und Hunger. Und Erleichterung. Ich schließe die Augen, atme tief durch und versuche, das Wunder zu begreifen, dass Duke den nächsten Tag erleben wird. Ich habe ihm das Leben gerettet. Aber wir werden ein zweites Wunder brauchen, um ihn aus dem Gefängnis zu holen.
Aus Gründen, die nur jenen Menschen bekannt sind, die diesen Ort leiten, waren alle Gefangenen in den letzten fünf Stunden in ihren Zellen eingesperrt, als bestünde die Gefahr, dass wütende Häftlinge auf die Idee kommen, sich wie beim Sturm auf die Bastille zusammenzurotten und den Todestrakt zu stürmen, um Duke zu retten. Der Einschluss ist mittlerweile beendet, die Aufregung vorbei. Das zusätzliche Wachpersonal, das angefordert worden war, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, befindet sich auf dem Heimweg, und ich will jetzt nur noch von hier weg. Ich habe mein Auto auf einem kleinen Parkplatz in der Nähe des Haupttors geparkt, wo die Fernsehcrews gerade dabei sind, zusammenzupacken und nach Hause zu fahren. Ich bedanke mich bei dem Fahrer, steige in meinen kleinen Ford-SUV und ergreife die Flucht. Weil ich telefonieren will, halte ich nach drei Kilometern auf dem Highway vor einem kleinen Supermarkt, der bereits geschlossen hat.
Mark Carter ist weiß, dreiunddreißig Jahre alt und lebt in einem kleinen, gemieteten Haus in Bayliss, sechzehn Kilometer von Verona entfernt. In meinen Akten befinden sich Fotos seines Hauses, seines Pick-ups und seiner aktuellen Partnerin, die bei ihm wohnt. Carter hat vor elf Jahren Emily Broone vergewaltigt und ermordet. Ich muss es nur noch beweisen.
Mit einem Wegwerfhandy rufe ich die Nummer seines Mobiltelefons an, die ich eigentlich nicht haben dürfte. Nachdem es fünfmal geklingelt hat, meldet er sich. »Hallo?«
»Spreche ich mit Mark Carter?«
»Wer will das wissen?«
»Sie kennen mich nicht, aber ich rufe aus dem Gefängnis an. Duke Russell hat gerade einen Aufschub bekommen, daher muss ich Ihnen leider mitteilen, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist. Sitzen Sie gerade vor dem Fernseher?«
»Wer sind Sie?«
»Ich bin mir sicher, dass Sie gerade mit Ihrer fetten Freundin zusammen auf Ihrem fetten Hintern vor dem Fernseher sitzen und inständig hoffen, dass Duke endlich für das Verbrechen hingerichtet wird, das Sie begangen haben. Sie sind ein Dreckskerl, Carter, und würden seelenruhig dabei zusehen, wie er für etwas stirbt, was Sie getan haben. Was sind Sie doch für ein Feigling.«
»Sagen Sie mir das ins Gesicht.«
»Oh, das werde ich, Carter, das werde ich – in einem Gerichtssaal. Ich werde die Beweise finden, und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis Duke aus dem Gefängnis kommt und Sie seinen Platz einnehmen. Ich werde Sie kriegen.«
Bevor er noch etwas sagen kann, beende ich das Gespräch.
2
Da Benzin geringfügig billiger ist als billige Motels, verbringe ich ganze Nächte damit, über leere Straßen zu fahren. Und jedes Mal wieder verspreche ich mir, dass ich später schlafen werde, als könnte ich demnächst in eine Art Winterstarre verfallen. Ich mache zwar häufig ein Nickerchen, aber ich schlafe nicht oft, ein Zustand, an dem sich so schnell nichts ändern wird. Ich habe mir eine schwere Last aufgebürdet: Unschuldige, die im Gefängnis verrotten, während draußen Vergewaltiger und Mörder frei herumlaufen.
Duke Russell wurde in einem verschlafenen Nest voller Hinterwäldler verurteilt. Die Hälfte der Geschworenen kann nur mit Mühe lesen, und ausnahmslos alle ließen sich von zwei aufgeblasenen Pseudosachverständigen in die Irre führen, die Chad Falwright in den Zeugenstand gerufen hatte. Der erste Gutachter war ein pensionierter Zahnarzt aus einer Kleinstadt in Wyoming, und auf welch verschlungenen Wegen er nach Verona, Alabama, gelangte, ist ein Kapitel für sich. Mit viel Autorität, einem teuren Anzug und einem beeindruckenden Wortschatz sagte er aus, die drei kleinen Wunden auf Emily Broones Armen seien von Dukes Zähnen verursacht worden. Dieser Clown bestreitet seinen Lebensunterhalt damit, landesweit als Sachverständiger auszusagen, immer für den Staatsanwalt und immer für ein hohes Honorar. In seinem kranken Hirn ist eine Vergewaltigung erst dann brutal genug, wenn es dem Vergewaltiger irgendwie gelingt, das Opfer so heftig zu beißen, dass er Zahnabdrücke hinterlässt.
Eine derart haltlose und lächerliche Theorie hätte im Kreuzverhör zerlegt werden müssen, aber Dukes Anwalt war entweder betrunken oder machte ein Nickerchen.
Der zweite Gutachter arbeitete im kriminaltechnischen Labor des Bundesstaates. Sein Spezialgebiet ist Haaranalyse. An Emilys Leiche wurden sieben Schamhaare gefunden, und dieser Typ redete den Geschworenen ein, dass sie von Duke stammen. Doch das ist falsch. Sie stammen vermutlich von Mark Carter, aber das wissen wir nicht. Noch nicht. Die Landeier, die für die Ermittlungen zuständig waren, hatten nur mäßiges Interesse daran, Carter als Verdächtigen zu behandeln, obwohl er der Letzte war, mit dem Emily in der Nacht, in der sie verschwand, gesehen wurde.
Die Analyse von Bissspuren und Haaren hat in fast allen modernen Rechtssystemen einen schlechten Ruf. Beide Sparten gehören zu jenem erbärmlichen und ständig variierenden Wissensgebiet, das Anwälte, die gegen Fehlurteile ankämpfen, verächtlich als Pseudowissenschaft bezeichnen. Nur Gott allein weiß, wie viele Unschuldige wegen unqualifizierten Gutachtern und ihren haltlosen Theorien langjährige Haftstrafen verbüßen müssen.
Jeder Verteidiger, der sein Geld wert ist, hätte die beiden Sachverständigen im Kreuzverhör auseinandergenommen, aber Dukes Anwalt war die dreitausend Dollar, die der Staat ihm gezahlt hat, nicht wert. Genau genommen war er überhaupt nichts wert. Er hatte nur wenig Erfahrung in Strafrecht, stank während des gesamten Verfahrens nach Alkohol, war grundsätzlich unvorbereitet, hielt seinen Mandanten für schuldig, bekam im Jahr nach dem Prozess dreimal eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, wurde aus der Anwaltskammer ausgeschlossen und starb schließlich an Leberzirrhose.
Und ich soll jetzt die Scherben aufsammeln und für Gerechtigkeit sorgen.
Allerdings hat mich niemand dazu abkommandiert, diesen Fall zu übernehmen. Ich habe mich wie immer freiwillig gemeldet.
Ich fahre auf der Interstate in Richtung Montgomery, das ich in zweieinhalb Stunden erreichen werde, und habe Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen. Wenn ich jetzt an einem Motel halten würde, könnte ich sowieso nicht schlafen. Ich bin noch viel zu aufgedreht von dem Wunder in letzter Minute, das ich gerade aus dem Hut gezaubert habe. Ich schicke dem Referendar in Atlanta eine SMS, in der ich mich bei ihm bedanke. Die nächste SMS geht an meine Chefin, die jetzt hoffentlich im Bett liegt.
Sie heißt Vicki Gourley und arbeitet im Büro unserer kleinen Stiftung, das im historischen Stadtzentrum von Savannah liegt. Sie hat Guardian Ministries vor zwölf Jahren mit eigenem Geld gegründet. Vicki ist gläubige Christin und leitet ihre Arbeit direkt aus den Evangelien ab. Jesus hat gesagt, dass man an die Gefangenen denken soll. Sie verbringt nicht viel Zeit mit Besuchen in Gefängnissen, arbeitet aber fünfzehn Stunden am Tag, um unschuldig einsitzende Häftlinge freizubekommen. Vor Jahren war sie Geschworene einer Jury, die einen jungen Mann des Mordes schuldig gesprochen und zum Tod verurteilt hatte. Zwei Jahre später stellte sich heraus, dass es ein Fehlurteil gewesen war. Der Staatsanwalt hatte entlastende Beweise zurückgehalten und einen Gefängnisspitzel zum Meineid angestiftet. Die Polizei hatte Beweise untergeschoben und die Geschworenen angelogen. Als der wirkliche Mörder anhand seiner DNA identifiziert wurde, verkaufte Vicki ihren Betrieb, der Teppiche und Parkettböden verlegt, an ihre Neffen und gründete dann mit dem Geld Guardian Ministries.
Ich war ihr erster Angestellter. Mittlerweile haben wir noch einen weiteren. Außerdem nehmen wir die Dienste eines freien Mitarbeiters namens François Tatum in Anspruch. Ein fünfundvierzig Jahre alter Schwarzer, dem als Teenager klar wurde, dass er sich das Leben im ländlichen Georgia vielleicht einfacher machte, wenn er sich nicht François, sondern Frankie nannte. Anscheinend hatte seine Mutter zumindest teilweise haitianisches Blut in den Adern, weshalb sie ihren Kindern französische Vornamen gab, die in ihrem entlegenen Winkel der englischsprachigen Welt jedoch alles andere als geläufig waren.
Frankie war der Erste, den ich aus dem Gefängnis geholt habe. Als ich ihn kennenlernte, verbüßte er in Georgia eine lebenslange Haftstrafe für einen Mord, den er nicht begangen hatte. Damals arbeitete ich als Priester der Episkopalkirche bei einer kleinen Gemeinde in Savannah. Wir leisteten Seelsorgearbeit im Gefängnis, und Frankie war einer der Häftlinge. Er war geradezu besessen von seiner Unschuld und sprach von nichts anderem. Er war intelligent, außerordentlich belesen und hatte sich seine enormen juristischen Fachkenntnisse selbst beigebracht. Nach zwei Besuchen hatte er mich überzeugt.
In der ersten Phase meiner juristischen Laufbahn habe ich Leute verteidigt, die sich keinen Anwalt leisten konnten. Ich hatte Hunderte Mandanten, und nach kurzer Zeit war ich an einem Punkt, an dem ich alle für schuldig hielt. Es kam mir nie in den Sinn, dass es Menschen gab, die zu Unrecht verurteilt worden waren. Mit Frankie änderte sich diese Einstellung. Ich stürzte mich in Ermittlungen zu seinem Fall, und bald war mir klar, dass es mir vielleicht gelingen würde, seine Unschuld zu beweisen. Dann traf ich Vicki, und sie bot mir einen Job an, mit dem ich noch weniger verdienen würde als mit meiner Arbeit als Seelsorger. Woran sich bis heute nichts geändert hat.
François Tatum wurde der erste Mandant von Guardian Ministries. Nach vierzehn Jahren im Gefängnis hatte seine Familie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Freunde gab es nicht mehr. Die bereits erwähnte Mutter hatte ihn und seine Geschwister vor der Haustür einer Tante abgeladen und ward nie wieder gesehen. Seinen Vater kennt er nicht. Als ich Frankie im Gefängnis begegnete, war ich sein erster Besucher in zwölf Jahren. Das klingt alles ganz furchtbar, aber es gab einen Silberstreifen am Horizont. Nach seiner Freilassung und Rehabilitierung bekam Frankie eine Menge Geld vom Staat Georgia und den lokalen Behörden, die ihn hinter Gitter gebracht hatten. Und da keine geldgierigen Familienangehörigen oder Freunde vorhanden waren, gelang es ihm, nach seiner Freilassung unterzutauchen wie ein Geist, der spurlos verschwindet. Er hat eine kleine Wohnung in Atlanta, ein Postfach in Chattanooga und verbringt den größten Teil seiner Zeit auf der Straße, wo er die Weite der Landschaft genießt. Sein Geld ist bei verschiedenen Banken in mehreren Südstaaten versteckt, damit es niemand findet. Beziehungen geht er aus dem Weg, weil er von allen tiefe Wunden davongetragen hat. Und weil er immer Angst hat, dass jemand versucht, ihm in die Tasche zu greifen.
Frankie vertraut mir und sonst niemandem. Als seine diversen Gerichtsverfahren beendet waren, wollte er mir ein großzügiges Honorar zahlen. Ich lehnte ab. Er hat sich jeden Cent des Geldes verdient, indem er das Gefängnis überlebt hat. Als ich bei Guardian anfing, habe ich ein Armutsgelübde abgelegt. Meine Mandanten überleben mit Mahlzeiten für zwei Dollar pro Tag, und an allen Ecken und Enden zu sparen ist das Mindeste, was ich tun kann.
Östlich von Montgomery halte ich an einer Lkw-Raststätte in der Nähe von Tuskegee. Es ist kurz vor sechs Uhr morgens und noch dunkel. Auf der Kiesfläche vor dem Gebäude parken dicht an dicht große Sattelschlepper, deren Motoren weiterlaufen, während die Fahrer schlafen oder frühstücken. Die Raststätte ist brechend voll, und als ich eintrete, schlägt mir der Duft von Speck und Würstchen entgegen. Im hinteren Teil winkt jemand. Frankie hat eine Sitznische für uns ergattert.
Da wir im ländlichen Alabama sind, begrüßen wir uns mit Händeschütteln und nicht mit einer kurzen Umarmung, die wir anderswo vielleicht in Erwägung ziehen würden. Zwei Männer, einer schwarz, der andere weiß, die sich in einer gut besuchten Raststätte in den Armen liegen, könnten ein oder zwei Blicke auf sich ziehen, was uns aber im Prinzip egal wäre. Frankie hat mehr Geld als sämtliche Gäste zusammen, und er ist immer noch so schlank und schnell wie zu seiner Zeit im Gefängnis. Aber er fängt keine Schlägerei an. Er wirkt so ruhig und selbstsicher, dass es gar nicht erst dazu kommt.
»Glückwunsch«, begrüßt er mich. »Das war ja ziemlich knapp.«
»Duke hatte schon mit seiner Henkersmahlzeit angefangen, als der Anruf kam. Dann musste er sehr schnell essen.«
»Aber du warst doch so zuversichtlich.«
»Hab nur so getan. Reine Routine als Anwalt. In Wirklichkeit hat sich mir fast der Magen umgedreht.«
»Da wir gerade davon sprechen: Du bist bestimmt am Verhungern.«
»Stimmt. Ich habe übrigens Carter angerufen, als ich aus dem Gefängnis raus war. Ich konnte nicht anders.«
Frankie runzelt leicht die Stirn. »Okay … Ich bin mir sicher, dass es einen Grund dafür gab.«
»Keinen guten. Ich war so sauer, dass ich mich nicht beherrschen konnte. Der Kerl sitzt da und zählt die Minuten, bis Duke hingerichtet wird. Kannst du dir das vorstellen? Sieht zu, wie ein Unschuldiger für das Verbrechen, das man selbst begangen hat, hingerichtet wird. Wir müssen ihn drankriegen, Frankie.«
»Das werden wir.«
Als eine Kellnerin zu uns an den Tisch kommt, bestelle ich Rührei und Kaffee. Frankie entscheidet sich für Pfannkuchen mit Würstchen.
Er weiß so viel über meine Fälle wie ich selbst. Er liest sämtliche Akten, Gesprächsnotizen, Gutachten und Verhandlungsprotokolle. Spaß haben ist für Frankie gleichbedeutend damit, in Orte wie Verona, Alabama, zu fahren, wo ihn niemand kennt, und Informationen auszugraben. Er ist furchtlos und unerschrocken, aber er geht kein Risiko ein, weil er sich nicht erwischen lassen will. Sein neues Leben gefällt ihm viel zu gut, und seine Freiheit hat vor allem deshalb eine so große Bedeutung für ihn, weil er lange ohne sie auskommen musste.
»Wir müssen uns irgendwie Carters DNA beschaffen«, sage ich.
»Ist klar. Ich arbeite dran. Boss, du brauchst mal eine Pause.«
»Erzähl mir was Neues. Und wie wir beide sehr genau wissen, kann ich mir seine DNA nicht mit illegalen Mitteln beschaffen.«
»Aber ich, oder?« Er lächelt und trinkt einen Schluck Kaffee. Die Kellnerin bringt mir meine Tasse.
»Vielleicht. Wir sollten später darüber reden. In den nächsten Wochen wird Carter wegen meines Anrufs ziemlich beunruhigt sein. Das wird ihm guttun. Irgendwann macht er einen Fehler, und dann schnappen wir ihn uns.«
»Wo fährst du jetzt hin?«
»Savannah. Ich bleibe ein paar Tage dort, dann muss ich nach Florida.«
»Florida? Seabrook?«
»Ja, Seabrook. Ich habe beschlossen, den Fall zu übernehmen.«
Frankies Gesicht verrät nie viel. Er blinzelt nicht oft, und seine Stimme klingt ruhig, fast schon monoton, als würde er jedes Wort auf die Waagschale legen. Um im Gefängnis zu überleben, brauchte er ein Pokergesicht. Außerdem gab es häufig Phasen, in denen er einsam war. »Bist du dir sicher?«, fragt er. Ihm ist anzusehen, dass er Zweifel an dem Fall in Seabrook hat.
»Der Mann ist unschuldig. Und er hat keinen Anwalt.«
Unser Essen kommt, und wir sind erst einmal mit Butter, Ahornsirup und Chilisauce beschäftigt. Der Fall in Seabrook liegt jetzt schon seit drei Jahren bei uns im Büro, während wir, die Mitarbeiter, darüber diskutieren, ob wir ihn übernehmen sollen oder nicht. In unserer Branche ist das nichts Ungewöhnliches. Es überrascht wenig, dass Guardian mit Post von Gefängnisinsassen aus fünfzig Bundesstaaten überschwemmt wird, die alle behaupten, unschuldig zu sein. Die überwiegende Mehrheit ist es nicht, deshalb prüfen wir alles ganz genau und sind sehr wählerisch. Wir nehmen nur die Fälle, bei denen wir uns weitgehend sicher sind, dass es ein Justizirrtum war. Trotzdem machen wir Fehler.
»Das da unten könnte ziemlich gefährlich sein«, sagt Frankie.
»Ich weiß. Wir reden schon lange über den Fall. In der Zwischenzeit zählt er die Tage, die er für jemand anderes im Knast sitzt.«
Frankie kaut auf einem Pfannkuchen herum und nickt leicht. Er ist immer noch nicht überzeugt.
»Frankie, haben wir zu einem guten Kampf jemals nein gesagt?«, frage ich.
»Vielleicht ist es dieses Mal besser zu verzichten. Du lehnst doch jeden Tag Fälle ab, oder? Der hier ist gefährlicher als andere. Es gibt genug potenzielle Mandanten für dich.«
»Du wirst doch nicht etwa zum Weichei?«
»Nein. Ich will nur nicht, dass dir etwas passiert. Mich sieht niemand, Boss. Ich lebe und arbeite im Schatten. Aber auf den Schriftsätzen steht dein Name. Wenn du an einem Ort wie Seabrook zu graben anfängst, wirst du vielleicht ein paar sehr unangenehmen Zeitgenossen auf die Füße treten.«
»Umso mehr ein Grund dafür, den Fall zu übernehmen«, erwidere ich lächelnd.
Als wir die Raststätte verlassen, ist die Sonne aufgegangen. Auf dem Parkplatz verabschieden wir uns mit einer kurzen Umarmung. Ich habe keine Ahnung, wohin er fahren wird, und das ist das Schöne an Frankie. Er wacht jeden Morgen als freier Mann auf, dankt Gott dafür, dass er Glück gehabt hat, steigt in seinen Pick-up aus der neuesten Modellreihe und folgt der Sonne.
Seine Freiheit gibt mir Kraft und treibt mich an. Wenn Guardian Ministries seinen Fall nicht übernommen hätte, würde er im Gefängnis verrotten.
3
Zwischen Opelika, Alabama, und Savannah gibt es keine direkte Route. Ich verlasse die Interstate und schlängle mich über zweispurige Straßen durch das Zentrum von Georgia, auf denen es im Lauf des Vormittags immer verkehrsreicher wird. Ich bin nicht zum ersten Mal in dieser Gegend. In den letzten zehn Jahren bin ich auf fast jedem Highway gefahren, der sich durch den »Todesgürtel« zieht, von North Carolina bis Texas. Einmal hätte ich fast einen Fall in Kalifornien übernommen, aber Vicki legte ihr Veto ein. Ich mag keine Flughäfen, und Guardian hätte es sich sowieso nicht leisten können, mich hin- und herfliegen zu lassen. Ich verbringe unzählige Stunden im Auto, mit viel schwarzem Kaffee und Hörbüchern. Dabei wechsle ich zwischen Phasen, in denen ich lange und gründlich nachdenke, und hektischen Gesprächen am Telefon.
In einer Kleinstadt komme ich am Gericht des Countys vorbei und sehe, wie drei junge Anwälte in ihren besten Anzügen in das Gebäude eilen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich einer von denen sein können.
Ich war dreißig Jahre alt, als ich meine Anwaltskarriere zum ersten Mal hingeworfen habe, und das aus gutem Grund.
Der Morgen begann mit der grauenhaften Nachricht, dass zwei sechzehnjährige weiße Jugendliche – ein Junge, ein Mädchen – mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden worden waren. Beiden Opfern hatte man die Genitalien verstümmelt. Offenbar hatten sie an einem abgelegenen Ort im County geparkt und waren dort von einer Gruppe schwarzer Jugendlicher überfallen worden, die ihr Auto stahlen. Der Wagen wurde wenige Stunden später gefunden. Ein Mitglied der Gang war geständig. Details der Tat sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Das Übliche in den Morgennachrichten von Memphis. Die Gewalttaten der letzten Nacht wurden abgestumpften Zuschauern präsentiert, die mit der großen Frage lebten: »Wie viel können wir noch ertragen?« Aber dieses Verbrechen war selbst für Memphis schockierend.
Brooke und ich verfolgten die Nachrichten im Bett, wie immer mit dem ersten Kaffee des Tages in der Hand. »Das könnte übel werden«, murmelte ich nach dem ersten Bericht.
»Das ist übel«, korrigierte sie mich.
»Du weißt, was ich meine.«
»Wirst du einen von ihnen bekommen?«
»Fang schon mal an zu beten«, erwiderte ich. Als ich unter der Dusche stand, war mir schlecht, und ich überlegte, ob ich ins Büro gehen sollte oder nicht. Ich hatte keinen Appetit und ließ das Frühstück sausen. Auf dem Weg zur Tür klingelte mein Handy. Mein Vorgesetzter sagte, ich solle mich beeilen. Ich verabschiedete mich mit einem Kuss von Brooke und sagte: »Drück mir die Daumen. Wird ein langer Tag.«
Die Pflichtverteidiger sind im Gebäude des Criminal Justice Complex im Stadtzentrum von Memphis untergebracht. Als ich um acht Uhr morgens unsere Abteilung betrat, war es dort so still wie in einer Leichenhalle. Ich hatte den Eindruck, als würden sich alle in ihren Büros verkriechen und jeglichen Blickkontakt vermeiden. Minuten später rief uns unser Vorgesetzter in den Konferenzraum. Ich war mit fünf anderen Anwälten für Schwerverbrechen zuständig, und da wir in Memphis arbeiteten, gab es jede Menge Mandanten für uns. Mit dreißig war ich der Jüngste, und als ich mich umsah, wusste ich, dass gleich mein Name fallen würde.
»Anscheinend sind sie zu fünft gewesen«, sagte mein Chef. »Inzwischen sind alle festgenommen worden. Alter zwischen fünfzehn und siebzehn. Zwei sind geständig. Es sieht danach aus, dass sie die beiden Opfer auf dem Rücksitz des Autos, das dem Jungen gehört, beim Sex überrascht haben. Vier der fünf Angeklagten sind Anwärter bei einer Gang, den Ravens, und um vollwertiges Mitglied zu werden, muss man ein weißes Mädchen vergewaltigen. Eines mit blonden Haaren. Crissy Spangler war blond. Der Anführer, ein gewisser Lamar Robinson, hat die Befehle gegeben. Der Junge, Will Foster, wurde an einen Baum gebunden und musste mit ansehen, wie sie das Mädchen nacheinander vergewaltigt haben. Als er keine Ruhe geben wollte, haben sie ihm die Genitalien verstümmelt und die Kehle durchgeschnitten. Wir bekommen noch Fotos von der Polizei.«
Wir standen stumm vor Entsetzen da, als uns klar wurde, was das zu bedeuten hatte. Mein Blick wanderte zu einem der Fenster. Mit dem Kopf voraus auf den Parkplatz zu springen kam mir wie das einzig Vernünftige vor.
»Sie haben Wills Auto gestohlen und, schlau wie sie sind, auf der South Third eine rote Ampel überfahren«, fuhr der Chef fort. »Die Polizei hat den Wagen, in dem drei von ihnen saßen, angehalten, Blutspuren entdeckt und alle festgenommen. Zwei haben angefangen zu reden und die Tat in allen Details beschrieben. Sie behaupten, dass es die anderen gewesen sind, aber ihr Geständnis belastet alle fünf. Die Obduktionen werden heute Vormittag durchgeführt. Selbstverständlich stecken wir bis über beide Ohren in dem Fall mit drin. Der erste Gerichtstermin ist für heute, vierzehn Uhr, angesetzt, und es wird mit Sicherheit ein Riesenzirkus werden. Überall sind Reporter, und Details sickern durch wie verrückt.«
Ich schob mich langsam in Richtung Fenster. »Post, Sie vertreten einen Fünfzehnjährigen namens Terrence Lattimore«, hörte ich meinen Chef rufen. »Soweit wir wissen, hat er noch kein Wort gesagt.«
Nachdem er die anderen Jugendlichen an meine Kollegen verteilt hatte, gab er Anweisungen: »Sie fahren sofort ins Gefängnis und suchen Ihre Mandanten auf. Informieren Sie die Polizei darüber, dass keine Verhöre stattfinden, wenn Sie nicht dabei sind. Die Jungs sind Gangmitglieder und werden vermutlich nicht sehr kooperativ sein, jedenfalls jetzt noch nicht.« Er sah uns, die Pechvögel, der Reihe nach an und sagte: »Tut mir leid.«
Eine Stunde später lief ich durch den Eingang des Gefängnisses, als eine Frau – vermutlich eine Reporterin – rief: »Vertreten Sie einen dieser Mörder?«
Ich tat so, als würde ich sie ignorieren, und ging weiter.
Terrence Lattimore wartete in einem kleinen Besucherraum auf mich. Er trug Hand- und Fußfesseln und war an einen Metallstuhl gekettet. Als wir allein waren, erklärte ich ihm, dass mir sein Fall zugewiesen worden sei und ich ihm einige Fragen stellen müsse, nur ein paar grundlegende Sachen für den Anfang. Seine Antwort waren ein Grinsen und ein wuterfüllter Blick. Er war zwar erst fünfzehn, aber ein ganz harter Junge, der schon alles gesehen hatte. Kampferprobt in allem, was mit Gangs, Drogen und Gewalt zu tun hatte. Er hasste mich und alle anderen Menschen mit weißer Haut. Er sagte, er habe keine Adresse, und riet mir, mich von seiner Familie fernzuhalten. Sein Vorstrafenregister enthielt zwei Schulverweise und vier Anklagen beim Jugendgericht, bei denen immer Gewalt mit im Spiel gewesen war.
Gegen Mittag war ich so weit, dass ich den Fall abgeben und mir einen anderen Job suchen wollte. Ich war nur deshalb drei Jahre zuvor Pflichtverteidiger geworden, weil ich keine Stelle bei einer Anwaltskanzlei finden konnte. Nach drei Jahren, in denen ich in die Abgründe unseres Strafjustizsystems geblickt hatte, stellte ich mir die schwierige Frage, warum ich eigentlich Jura studiert hatte. Ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Bei meiner Arbeit traf ich täglich auf Leute, mit denen ich außerhalb des Gerichtssaals jeglichen Kontakt vermieden hätte.
Mittagessen kam nicht infrage, weil wir uns sicher waren, dass wir keinen Bissen hinunterbringen würden. Die fünf von uns, die für diesen Fall ausgewählt worden waren, trafen sich mit dem Vorgesetzten und sahen sich die Fotos vom Tatort und die Obduktionsberichte an. Wenn ich etwas im Magen gehabt hätte, wäre es auf dem Fußboden gelandet.
Was zum Teufel machte ich da mit meinem Leben? Ich war Strafverteidiger, und die Frage »Wie kannst du jemanden vertreten, von dem du weißt, dass er schuldig ist?« hing mir zum Hals raus. Ich hatte immer eine Standardantwort parat, die ich im Studium gelernt hatte: »Jeder hat das Recht darauf, von einem Anwalt verteidigt zu werden. Das steht in der Verfassung.«
Aber ich glaubte nicht mehr daran. In Wahrheit gibt es Verbrechen, die so abscheulich und grausam sind, dass der Mörder entweder hingerichtet werden sollte, wenn man die Todesstrafe für richtig hält, oder lebenslänglich hinter Gitter kommen sollte, wenn man die Todesstrafe nicht für richtig hält. Als ich nach der Besprechung das Büro meines Chefs verließ, war ich mir nicht mehr sicher, was ich für richtig hielt.
Ich ging in mein winziges Büro, das aber wenigstens eine Tür hatte, die man abschließen konnte. Am Fenster stehend, starrte ich auf das Straßenpflaster unter mir und stellte mir vor, wie ich in die Tiefe sprang und zu irgendeinem exotischen Strand davonschwebte, wo das Leben großartig war und das einzige Problem, über das ich mir Sorgen machen musste, darin bestand, den nächsten kalten Drink zu beschaffen. Seltsamerweise kam Brooke in dem Traum nicht vor. Ich wachte auf, als das Telefon auf meinem Schreibtisch klingelte.
Allerdings hatte ich nicht geträumt, sondern Halluzinationen gehabt. Plötzlich lief alles wie in Zeitlupe ab, und ich bekam nur mit Mühe ein Hallo heraus. Die Stimme am anderen Ende gehörte zu einer Reporterin, die ein paar Fragen zu den Morden hatte. Sie glaubte tatsächlich, ich würde mit ihr über den Fall sprechen. Ich legte auf. Eine Stunde verging, und ich kann mich nicht erinnern, in dieser Zeit irgendetwas getan zu haben. Ich fühlte mich wie betäubt, mir war übel, und ich wollte einfach nur aus dem Gebäude rennen. Aber ich weiß noch, dass ich Brooke angerufen und ihr erzählt habe, dass ich einen von den fünfen erwischt hatte.
Der erste Gerichtstermin um vierzehn Uhr wurde von einem kleinen Saal in einen größeren verlegt, der aber immer noch nicht groß genug war. Aufgrund der hohen Kriminalitätsrate gab es in Memphis viele Polizisten, und an dem Nachmittag waren die meisten von ihnen im Gebäude. Sie postierten sich vor den Türen und durchsuchten jeden Reporter und jeden Zuschauer. Im Gerichtssaal stellten sie sich zu zweit nebeneinander am Mittelgang auf und bildeten ein Spalier an allen drei Wänden.
Will Fosters Cousin war bei der Feuerwehr von Memphis. Er kam mit einer Handvoll Kollegen, die aussahen, als würden sie jeden Moment zum Angriff übergehen. Ein paar Schwarze drückten sich in eine Ecke auf der anderen Seite des Saals, so weit von den Familien der Opfer entfernt wie möglich. Überall waren Reporter, allerdings ohne Kameras. Anwälte, die bei diesem Termin nichts zu tun hatten, liefen neugierig hin und her.
Ich betrat den Geschworenenraum durch den Lieferanteneingang und schob mich durch die Tür, um einen Blick auf das Gedränge zu werfen. Der Saal war brechend voll, die ungeheure Spannung fast mit Händen greifbar.
Der Richter kam, setzte sich und rief den Saal zur Ordnung. Dann wurden die fünf Angeklagten hereingeführt, alle in orangefarbenen Overalls und aneinandergekettet. Die Zuschauer starrten sie wie gebannt an. Die Gerichtszeichner griffen zu ihren Stiften. Einige Polizisten formierten sich in einer Reihe hinter den fünf Angeklagten und bildeten auf diese Weise einen Schutzschild. Die Jugendlichen standen vor der Richterbank und starrten auf ihre Füße. Hinten im Saal brüllte eine laute, kräftige Stimme: »Lasst sie frei, verdammt! Lasst sie frei!« Zwei Polizisten rannten zu dem Mann und sorgten dafür, dass er Ruhe gab.
Eine Frau schrie auf und brach in Tränen aus.
Ich stellte mich hinter Terrence Lattimore neben meine vier Kollegen. Dabei warf ich einen Blick auf die Leute, die in den ersten beiden Reihen saßen. Es waren offenbar Angehörige und Freunde der Opfer, und sie starrten mich mit unverhohlenem Hass an.
Mein Mandant hasste mich. Die Familie und die Freunde seiner Opfer hassten mich. Was zum Teufel hatte ich in diesem Gerichtssaal verloren?
Der Richter ließ den Hammer niedersausen und sagte: »Ich werde die Ordnung in diesem Gerichtssaal aufrechterhalten. Die Angeklagten erscheinen heute zum ersten Mal vor mir, und Zweck dieses Termins ist es, ihre Identität festzustellen und mich zu vergewissern, dass sie von einem Rechtsbeistand vertreten werden. Sonst nichts. Wer von Ihnen ist Lamar Robinson?«
Robinson hob den Kopf und murmelte etwas.
»Wie alt sind Sie, Mr. Robinson?«
»Siebzehn.«
»Mit Ihrer Vertretung wurde Julie Showalter vom Büro der Pflichtverteidiger beauftragt. Haben Sie sich mit ihr getroffen?«
Meine Kollegin trat einen Schritt vor und stellte sich zwischen Robinson und den neben ihm stehenden Angeklagten. Da alle aneinandergekettet waren, kamen die Anwälte nicht näher an sie heran. Hand- und Fußfesseln wurden im Gerichtssaal üblicherweise abgenommen, und die Tatsache, dass dies heute nicht geschah, sagte eine Menge über die Laune des Richters aus.
Robinson warf einen Blick auf Julie, die rechts neben ihm stand, und zuckte mit den Schultern.
»Mr. Robinson, möchten Sie von Ms. Showalter vertreten werden?«
»Kann ich einen schwarzen Anwalt haben?«, fragte er.
»Sie können jeden beauftragen, den Sie wollen. Haben Sie denn genug Geld für einen privaten Anwalt?«
»Vielleicht.«
»In Ordnung, das werden wir dann später bereden. Der Nächste, Terrence Lattimore.« Terrence starrte den Richter an, als würde er ihm die Kehle durchschneiden wollen.
»Mr. Lattimore, wie alt sind Sie?«
»Fünfzehn.«
»Haben Sie Geld für einen eigenen Anwalt?«
Kopfschütteln. Nein.
»Möchten Sie, dass Mr. Cullen Post vom Büro der Pflichtverteidiger Sie vertritt?«
Er zuckte mit den Schultern, es war ihm egal.
Der Richter sah mich an. »Mr. Post, haben Sie sich mit Ihrem Mandanten getroffen?«
Doch Mr. Post konnte nicht antworten. Ich machte den Mund auf, aber es kam kein Ton heraus. Ich trat einen Schritt zurück, den Blick unverwandt auf den Richter geheftet, der mich verblüfft ansah. »Mr. Post?«
Im Gerichtssaal war es vollkommen ruhig, doch in meinen Ohren klingelte es, ein schriller, durchdringender Ton, der keinen Sinn ergab. Meine Knie bestanden aus Gummi, ich bekam nur noch mühsam Luft. Ich machte noch einen Schritt nach hinten, dann drehte ich mich um und zwängte mich durch die Mauer aus Polizisten. Ich schaffte es bis zur Schranke, stieß das Schwingtor vor meinen Beinen auf und rannte durch den Mittelgang. Dabei rempelte ich einen Polizisten nach dem anderen an, aber keiner versuchte, mich aufzuhalten. Der Richter rief so etwas Ähnliches wie »Mr. Post, wo wollen Sie hin?«. Mr. Post wusste es nicht.
Ich taumelte durch die Tür, ließ den Saal hinter mir und rannte schnurstracks zur Herrentoilette, wo ich mich in einer der Kabinen einschloss, über die Kloschüssel beugte und mich übergab. Ich würgte und spuckte, bis ich nichts mehr im Magen hatte, dann ging ich zu einem der Waschbecken und spritzte mir Wasser ins Gesicht. Mir ist noch vage in Erinnerung, dass ich den Fahrstuhl genommen habe, aber ich hatte jegliches Gefühl für Zeit, Raum, Geräusche oder Bewegung verloren. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie ich aus dem Gebäude gekommen bin.
Plötzlich saß ich in meinem Wagen und nahm die Poplar Avenue in Richtung Osten, aus dem Stadtzentrum hinaus. Ohne es zu wollen, überfuhr ich eine rote Ampel und konnte gerade noch einen heftigen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verhindern. Hinter mir begannen wütende Autofahrer zu hupen. Irgendwann fiel mir auf, dass ich meinen Aktenkoffer im Gerichtssaal vergessen hatte, was ein breites Grinsen bei mir auslöste. Ich sah ihn nie wieder.
Die Eltern meiner Mutter lebten auf einer kleinen Farm sechzehn Kilometer westlich von Dyersburg, Tennessee, meiner Heimatstadt. Am späten Nachmittag kam ich dort an. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren und kann mich nicht daran erinnern, den Entschluss gefasst zu haben, nach Hause zu fahren. Meine Großeltern waren überrascht, mich zu sehen, wie sie später erzählten, aber bald wurde ihnen klar, dass ich Hilfe brauchte. Sie fragten mich aus, aber ich reagierte auf sämtliche Fragen nur mit einem leeren, starren Blick. Irgendwann steckten sie mich ins Bett und riefen Brooke an.
Am späten Abend verfrachteten mich ein paar Rettungssanitäter in einen Krankenwagen. Mit Brooke an meiner Seite fuhren wir drei Stunden zu einer psychiatrischen Klinik in der Nähe von Nashville. In Memphis waren keine Betten verfügbar, aber ich wollte sowieso nicht in die Stadt zurück. In den nächsten Tagen begann ich eine Therapie mit Medikamenten und langen Sitzungen bei Seelenklempnern und lernte allmählich, mit meinem Nervenzusammenbruch umzugehen. Nach einem Monat wurde ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Versicherungsgesellschaft nicht mehr für die Kosten aufkommen werde. Es war Zeit zu gehen, und ich war inzwischen so weit, dass ich die Klinik verlassen konnte.
Ich weigerte mich, in unsere Wohnung in Memphis zurückzukehren, und zog bei meinen Großeltern ein. Während dieser Zeit beschlossen Brooke und ich, unsere Beziehung zu beenden. Ungefähr nach der Hälfte unserer dreijährigen Ehe war uns beiden klar geworden, dass wir nicht den Rest unseres Lebens miteinander verbringen konnten und dass es viel Kummer und Leid geben würde, wenn wir es trotzdem versuchten. Zu der Zeit setzten wir uns nicht damit auseinander, und es gab nur selten Streit. Irgendwie fanden wir in jenen dunklen Tagen auf der Farm den Mut, offen darüber zu reden. Wir liebten uns immer noch, waren aber schon dabei, uns auseinanderzuleben. Zuerst vereinbarten wir eine einjährige Trennung auf Probe, aber das ließen wir bald sein. Ich habe Brooke nie vorgeworfen, dass sie mich wegen meines Zusammenbruchs verlassen hat. Ich wollte unsere Ehe beenden und sie auch. Wir sind mit gebrochenem Herzen auseinandergegangen, schworen aber, Freunde zu bleiben. Selbst das haben wir nicht geschafft.
Als Brooke mein Leben verließ, klopfte Gott an die Tür. Er kam in Gestalt von Father Bennie Drake, dem episkopalischen Priester meiner Heimatgemeinde in Dyersburg. Bennie war ungefähr vierzig, cool und hip und pflegte mitunter eine sehr anzügliche Ausdrucksweise. Er trug die meiste Zeit ausgewaschene Jeans, aber immer zusammen mit Priesterkragen und einem schwarzen Jackett, und wurde schnell zum Lichtblick in der Zeit meiner Genesung. Am Anfang kam er jede Woche einmal, doch bald wurden daraus fast tägliche Besuche, und ich fieberte unseren langen Gesprächen auf der Veranda geradezu entgegen. Ich vertraute ihm sofort und gestand, dass ich nicht wieder als Anwalt arbeiten wollte. Ich war erst dreißig und suchte nach einer anderen Möglichkeit, Menschen zu helfen. Ich wollte nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, Menschen auf Schadenersatz zu verklagen, Schuldige zu verteidigen oder unter dem Druck, den die Arbeit in einer Kanzlei mit sich brachte, zu malochen. Je besser ich Bennie kennenlernte, desto mehr wollte ich so sein wie er. Er sah etwas in mir und schlug mir vor, zumindest darüber nachzudenken, Priester zu werden. Wir verbrachten viel Zeit mit langen Gebeten und noch längeren Gesprächen, und allmählich begann ich, meine Berufung zu spüren.
Acht Monate nach meinem letzten Erscheinen vor Gericht zog ich nach Alexandria, Virginia, und trat in das dortige Priesterseminar ein, an dem ich die nächsten drei Jahre studierte. Um Geld zu verdienen, nahm ich einen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Großkanzlei in Washington, D.C., an, für zwanzig Stunden in der Woche. Ich hasste und verachtete meine Arbeit, aber es gelang mir, das zu verbergen. Jede Woche wurde ich daran erinnert, warum ich den Anwaltsberuf aufgegeben hatte.
Mit fünfunddreißig Jahren wurde ich zum Priester geweiht und bekam eine Stelle bei einer Episkopalgemeinde in der Drayton Street im historischen Stadtzentrum von Savannah. Der Vikar war ein wunderbarer Mann namens Luther Hodges, der schon seit Jahren Seelsorgearbeit in einem Gefängnis leistete. Sein Onkel war hinter Gittern gestorben, und er war fest entschlossen, jenen zu helfen, die man vergessen hatte. Drei Monate nachdem ich nach Savannah gezogen war, lernte ich Mr. François Tatum kennen, eine wahrhaft vergessene Seele.
Als ich Frankie zwei Jahre später aus dem Gefängnis holte, war das der aufregendste Moment meines Lebens. Ich hatte meine Berufung gefunden. Und durch göttliche Fügung hatte ich auch Vicki Gourley kennengelernt, eine Frau, die ihre eigene Mission hatte.
4
Guardian Ministries ist in einem alten Lagerhaus in Savannahs Broad Street untergebracht. Der Rest des riesigen Gebäudes wird von der Firma genutzt, die Vicki vor Jahren verkauft hat. Das Lagerhaus gehört ihr immer noch, und sie vermietet es an ihre Neffen, die weiterhin Teppiche und Parkettböden verlegen. Der größte Teil der Mieteinnahmen wird von Guardian geschluckt.
Es ist schon fast Mittag, als ich den Wagen parke und unsere Büroräume betrete. Ich erwarte keine begeisterte Begrüßung und bekomme sie auch nicht. Es gibt keine Empfangsdame und keinen Empfangsbereich für unsere Mandanten. Sie sitzen alle im Gefängnis. Wir haben keine Sekretärinnen, weil wir uns das nicht leisten können. Wir tippen unsere Briefe selbst. Wir heften Unterlagen ab, vereinbaren Termine, gehen ans Telefon, kochen Kaffee und tragen den Müll raus.
Über Mittag besucht Vicki fast immer ihre Mutter, die in einem Pflegeheim ein Stück die Straße hinunter lebt, und isst dort mit ihr. Ihr penibel aufgeräumtes Büro ist leer. Ich werfe einen Blick auf ihren Schreibtisch, auf dem kein einziges Blatt Papier schräg liegt. Auf einem Sideboard dahinter steht ein gerahmtes Farbfoto von Vicki und Boyd, ihrem verstorbenen Mann. Er hat die Firma gegründet, und als er jung starb, hat Vicki sie übernommen und wie eine Tyrannin geführt, bis das Rechtssystem sie so anwiderte, dass sie Guardian gründete.
Auf der anderen Seite des Korridors liegt das Büro von Mazy Ruffin, Leiterin unserer Prozessabteilung und Braintrust der Organisation. Sie sitzt auch nicht an ihrem Schreibtisch; vermutlich fährt sie gerade Kinder in der Gegend herum. Sie hat vier, und in der Regel findet man die Kleinen nachmittags irgendwo in den Räumen von Guardian auf dem Fußboden. Wenn die Kinderkrippe geöffnet ist, schließt Vicki leise ihre Tür. Ich auch, falls ich im Büro bin, was nur selten vorkommt. Als wir Mazy vor vier Jahren eingestellt haben, hatte sie zwei nicht verhandelbare Bedingungen. Die erste war die Erlaubnis, ihre Kinder mit ins Büro bringen zu dürfen, wenn es sein musste. Sie konnte es sich nicht leisten, die Kinder den ganzen Tag betreuen zu lassen. Die zweite war ihr Gehalt. Sie brauchte fünfundsechzigtausend Dollar im Jahr, um überleben zu können, keinen Penny weniger. Vicki und ich verdienten zusammengenommen weniger als diese Summe, aber wir ziehen auch keine Kinder groß und machen uns keine Gedanken um unser Gehalt. Wir haben beiden Bedingungen zugestimmt, und Mazy ist immer noch das bestbezahlte Mitglied unseres Teams.
Sie war ein Schnäppchen. Mazy ist in einer berüchtigten Sozialbausiedlung im Süden Atlantas aufgewachsen. Zeitweise war sie obdachlos, allerdings erzählt sie nicht viel darüber. Einem Lehrer an ihrer Highschool fiel auf, wie intelligent sie ist, und er förderte sie nach Kräften. Sie nahm das College und im Anschluss daran ein Jurastudium in Angriff, immer mit Vollstipendien und fast perfekten Noten. Jobangebote von Großkanzleien lehnte sie ab, stattdessen beschloss sie, Menschen zu helfen, die die gleiche Hautfarbe wie sie hatten, indem sie für die Bürgerrechtsorganisation NAACP Legal Defense Fund arbeitete. Diese Karriere war zu Ende, als ihre Ehe zerbrach. Ein Freund von mir erwähnte ihren Namen, als wir nach einem zweiten Anwalt suchten.
Die Domäne dieser beiden Alphaweibchen ist das Erdgeschoss. Wenn ich hier bin, gehe ich sofort nach oben in den ersten Stock, wo ich mich in einem kleinen, vollgestopften Zimmer verkrieche, das mir als Büro dient. Gegenüber liegt der Konferenzraum, allerdings gibt es bei Guardian nicht sehr viele Konferenzen. Manchmal benutzen wir ihn für beeidete Aussagen oder Besprechungen mit einem rehabilitierten Mandanten und seiner Familie.
Ich betrete den Konferenzraum und schalte das Licht ein. In der Mitte steht ein langer, ovaler Esstisch, den ich für hundert Dollar auf einem Flohmarkt gekauft habe, mit zehn nicht zueinander passenden Stühlen, die im Lauf der Jahre dazugekommen sind. Was dem Raum an Stil und Geschmack fehlt, macht er durch seinen Charakter mehr als wett. An einer Wand – unserer Wall of Fame – hängen acht große, gerahmte Porträts der Menschen, die wir aus dem Gefängnis geholt haben, angefangen mit Frankie. Ihre lächelnden Gesichter sind das Herz und die Seele unserer Organisation. Sie geben uns Kraft und spornen uns an, weiterzumachen, gegen das System zu kämpfen, für Freiheit und Gerechtigkeit einzutreten.
Nur acht. Tausende wie sie warten noch. Unsere Arbeit wird nie zu Ende sein, und auch wenn diese Tatsache entmutigend erscheinen mag, so ist sie doch eine große Motivation für uns.
An einer anderen Wand hängen fünf kleinere Fotos unserer aktuellen Mandanten, alle in Gefängniskleidung. Duke Russell in Alabama. Shasta Briley in North Carolina. Billy Rayburn in Tennessee. Curtis Wallace in Mississippi. Little Jimmy Flagler in Georgia. Drei Schwarze, zwei Weiße, eine Frau. Hautfarbe und Geschlecht haben keine Bedeutung für unsere Arbeit. Dazu kommt eine bunte Mischung gerahmter Zeitungsfotos, die jene glorreichen Momente zeigen, in denen wir unschuldige Mandanten aus dem Gefängnis begleiten. Auf den meisten davon bin ich zu sehen, zusammen mit anderen Anwälten, die uns geholfen haben. Mazy und Vicki sind auf einigen wenigen abgebildet. Das strahlende Lächeln der Menschen auf den Fotos wirkt ansteckend.
Ich gehe die Treppe hoch zu meinem Penthouse. Ich wohne in drei Zimmern im obersten Stockwerk, für die ich keine Miete bezahlen muss. Die Einrichtung werde ich nicht beschreiben. Die beiden Frauen in meinem Leben, Vicki und Mazy, wagen sich nicht einmal in die Nähe der Wohnung. Ich verbringe hier im Schnitt zehn Nächte im Monat, und es fällt sofort auf, dass ich alles vernachlässige. Meine Wohnung würde allerdings noch viel chaotischer aussehen, wenn ich die ganze Zeit hier wäre.
Ich dusche in meinem kleinen Bad, dann lasse ich mich aufs Bett fallen.
Nach zwei Stunden im Koma werde ich von Geräuschen aus dem Erdgeschoss geweckt. Ich ziehe mich an und wanke die Treppe hinunter. Mazy begrüßt mich mit einem strahlenden Lächeln und einer Umarmung. »Gut gemacht«, sagt sie immer wieder.
»Es war verdammt knapp. Duke war schon dabei, sein Steak zu essen, als der Anruf kam.«
»Hat er es aufgegessen?«
»Natürlich.«
Daniel, ihr vierjähriger Sohn, rennt auf mich zu und will mich auch umarmen. Er hat keine Ahnung, wo ich gestern Abend war oder was ich dort gemacht habe, er will einfach so von mir in den Arm genommen werden. Vicki hört uns reden und stürmt aus ihrem Büro. Noch mehr Umarmungen, noch mehr Glückwünsche.
Als Albert Hoover dann in North Carolina hingerichtet wurde, haben wir in Vickis Büro gesessen und geweint. Das hier ist entschieden besser.
»Ich mache uns einen Kaffee«, sagt Vicki.
Ihr Büro ist etwas größer als das von Mazy und nicht mit Spielzeug und Klapptischen mit Stapeln von Brettspielen und Malbüchern vollgestopft, deshalb benutzen wir es für eine kurze Lagebesprechung. Da ich während des Countdowns gestern Nacht mit beiden telefonisch in Kontakt war, kennen sie fast alle Details. Ich informiere sie über mein Treffen mit Frankie, und wir diskutieren den nächsten Schritt in Dukes Fall. Plötzlich haben wir keine Fristen mehr, kein Hinrichtungsdatum, keinen Countdown am Horizont, und der schlimmste Druck ist weg. Fälle mit Todeskandidaten ziehen sich über Jahre hin, es geht extrem langsam voran, bis von einem Tag auf den anderen ein Termin für die Hinrichtung angesetzt wird. Dann wird es auf einmal hektisch. Wir arbeiten rund um die Uhr, und wenn ein Aufschub gewährt wird, wissen wir, dass Monate, ja vielleicht Jahre bis zum nächsten Alarm vergehen werden. Aber wir lassen nicht nach und gönnen uns keine Ruhe, denn unsere Mandanten sind unschuldig und kämpfen darum, den Albtraum Gefängnis zu überleben.
Wir reden eine Weile über die anderen vier Fälle, bei denen es keinen Termindruck gibt.
Dann spreche ich ein heikles Thema an: »Was ist mit dem Budget, Vicki?«
Wie immer lächelt sie und sagt: »Wir sind pleite.«
»Ich muss telefonieren«, wirft Mazy ein. Sie steht auf, drückt mir einen Kuss auf die Stirn und verabschiedet sich mit den Worten: »Gute Arbeit, Post.«
Mazy spricht nicht gern über das Budget, und Vicki und ich respektieren das. Sie verlässt den Raum und geht in ihr Büro.
»Wir haben von der Cayhill-Stiftung einen Scheck über fünfzigtausend bekommen, was reichen dürfte, um für ein paar Monate die Rechnungen zu bezahlen«, informiert mich Vicki. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs brauchen wir etwa eine halbe Million Dollar im Jahr. Diese Summe bekommen wir, indem wir bei kleinen gemeinnützigen Organisationen und einigen Einzelpersonen anklopfen und sie um Geld bitten. Wenn ich mich dazu überwinden könnte, Fundraising zu betreiben, würde ich den halben Tag mit Telefonaten, Briefeschreiben und Vorträgen verbringen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Geldbetrag, der uns zur Verfügung steht, und der Anzahl von Unschuldigen, die wir aus dem Gefängnis holen können, aber ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, jemanden anzubetteln. Vicki und ich haben vor langer Zeit beschlossen, dass wir mit den Problemen eines großen Mitarbeiterstabs und dem ständigen Druck, Geld beschaffen zu müssen, nicht umgehen könnten. Eine kleine, schlanke Organisation ist uns lieber.
Einen Unschuldigen aus dem Gefängnis zu holen kann Jahre dauern und kostet mindestens zweihunderttausend Dollar. Wenn wir zusätzliches Geld brauchen, gelingt es uns immer irgendwie, die Summe aufzutreiben.
»Mach dir keine Sorgen«, sagt sie. »Wir dürften noch Zuschüsse bekommen, und ich bin gerade dabei, ein paar Spendern auf die Nerven zu gehen. Wir schaffen das. Wie immer.«
»Ich werde morgen ein paar Telefonate machen«, verspreche ich. Sosehr ich es auch hasse, ich zwinge mich dazu, jede Woche einige Stunden damit zu verbringen, Anwälte anzurufen, die unsere Arbeit unterstützen, und sie um Geld zu bitten. Außerdem habe ich ein kleines Netzwerk von Kirchengemeinden, die uns hin und wieder Spenden zukommen lassen.
»Ich vermute mal, dass du nach Seabrook fahren wirst«, meint Vicki.
»Stimmt. Ich habe mich entschieden. Der Fall liegt jetzt schon seit drei Jahren bei uns, und ich bin die Diskussionen leid. Wir sind alle der Meinung, dass er unschuldig ist. Er sitzt seit zweiundzwanzig Jahren im Gefängnis und hat keinen Anwalt. Niemand kümmert sich um seinen Fall. Das sollten wir jetzt tun.«
»Mazy und ich sind dabei.«