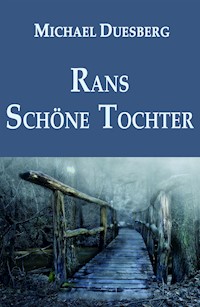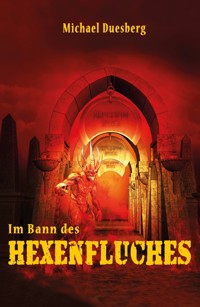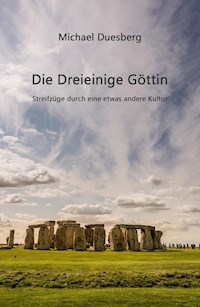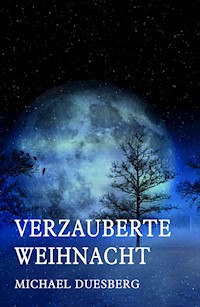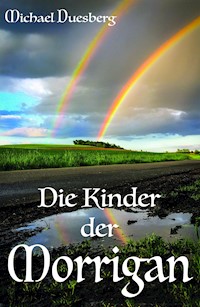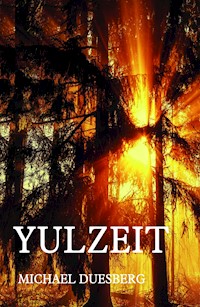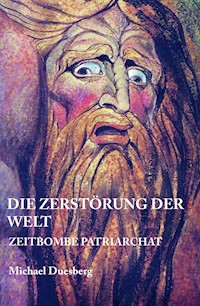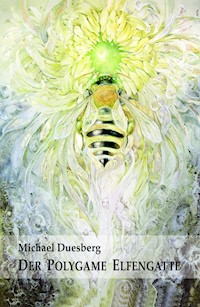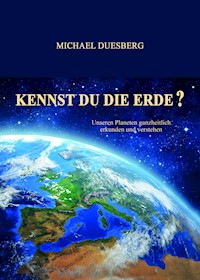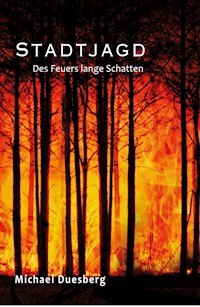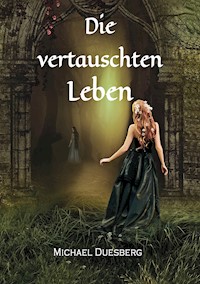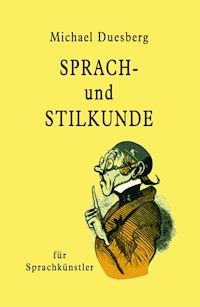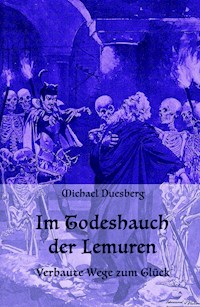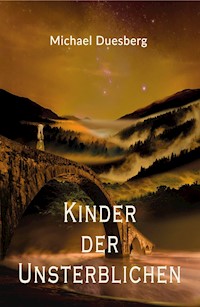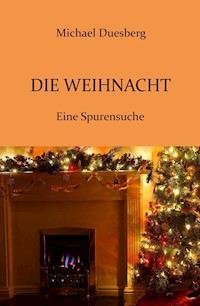
8,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Weihnachten - geheimnisvolle 13 Nächte und ein uraltes Fest. Märchen, Sagen, Sprüche und Lieder, die schon dem vorweihnachtlichen Julfest zugehörten. Und immer wieder die nicht mehr vertrauten Gestalten von Luzia, Frau Holle und Frau Perchta mit ihren heimlichen und unheimlichen Begleitern und dem spukhaften Gefolge der Natur- und Hausgeister. Ein Brückenschlag zwischen uralter Naturmagie und modernem Bewusstsein. Anregungen zur Durchdringung und Intensivierung heutiger Festgestaltung mit einem Anhang von Vorschlägen zum Feiern mit Kindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
© 2015 Michael Duesberg
Korrektorat/Satz/Umschlaggestaltung:
Angelika Fleckenstein; spotsrock.de
Umschlagbilder: pixabay.com
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN:
978-3-7323-3009-6 (Paperback)
978-3-7323-3010-2 (Hardcover)
978-3-7232-3011-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Natio-nalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; de-taillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
Michael Duesberg
Die Weihnacht
Eine Spurensuche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Weihnachten heute
Geschichtlicher Rückblick
Die Zeit zwischen den Jahren
Frau Holle und der Blinde
Das Abenteuer des Conle
Frau Holle
Holle
Frau Holle und der Bauer
Frau Holle tut…
Frau Holle am Hörselberg
Schneeflockenlied
Die Kindelwiese
Das Spinnweib im Hüggel bei Osnabrück
Die Spinnerin am Berge
Frau Holle und die Bäuerin
In den heiligen Nächten
Der Heimchenkönigin Überfahrt
Die Schwellen
Der graue Jäger
Dreizehn Nächte in Norge
Die Festvorbereitung
Das alte Erleben der Winterszeit
Das Doppelantlitz der Weihnacht
Der Wilde Jäger
Lied vom Schimmelreiter
Nikolaus
Luzia
Lucia aus Syrakus
Lucia – Legende aus Norrland
Stephan und Staffan
Staffan-Legende
Staffan var en stalledräng
Santa Lucia
Botschaft
Lucia und Staffan
Frau Holle – die Große Mutter
Perchta
Die Herrin der Tiere und ihre saligen Fräulein
Nerthus
Huldr
Die nordische Huldr-Saga
Die Große Mutter
Die drei Frauen und die Eine
Die dreieinige Große Mutter Erde
Waldminchen und die Altweibermühle
Die germanische Weihnacht – das Julfest
Jul / Yul
Mutterkult, Jul und Christentum
Besinnung
Literaturverzeichnis
Anhang
Die erste Weihnachtsfeier
Silvesterfeier
Silvesterfragen beim Flaschendrehen
Die zweite Weihnachtsfeier
Das Dreikönigslied
Dreikönigsfeier
Dreikönigslieder für Umzüge
Literaturverzeichnis des Anhangs
Einleitung
Weihnachten heute
Strömender Regen. Grau und kalt und unwirtlich. Einkäufer hasten unter Schirmen, Hüten und Kapuzen umher, um schnell noch ein paar Weihnachtsbesorgungen zu machen, ehe das große Gedränge in Gassen und Kaufläden beginnt. Die Hauptstraßen sind festlich geschmückt. Die Auslagen in den Geschäften verkünden die nahe Weihnacht: es ist der Vormittag des 24. Dezember. „Hoffentlich schneit es bald!“ – „Ja, denn so wie jetzt ist das ja wirklich nichts – total unweihnachtlich!“
Schnell noch ein Geschenk für Frieda …Was könnte ihr Freude be-reiten? Schwierig; sehen wir uns doch mal um: Tücher, Stoffe, Kleider, Gürtel; hat sie alles. Oder da: Holzwaren; Kästchen, Figuren – lauter unwichtiger Kram; aber schönes Holz! „Das da, rechts hinten, bitte! Wie bitte? Thuja? Toll! 60 Mark? Ja bitte, in Geschenkpapier“. Fehlen noch ein paar kleine Sachen für Erich und für Herrn R. – Oh je, schon wieder so spät!
Am Nachmittag wird der Baum geschmückt; eine seltene Tannenart mit Nadeln wie Dolchen. Jede Berührung ein Martyrium! Aber 80 Mark teuer! So, die Silberkugeln und Figürchen hängen jetzt dran. Noch den Stern auf die Spitze, dann die Kerzenhalter und das Lametta. –Jetzt den Gabentisch richten; und dann …; und dann …
Am frühen Abend ist Bescherung: Die Kerzen leuchten, das Silber glitzert schneeig, und hell tönen die Stimmen: „O du fröhliche“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“, von jedem Lied den ersten Vers. Die Stim-mung ist heiter und steigt noch. Geschenke werden ausgepackt: „Für Frieda!“ „Welch ein entzückendes Kästchen!“ – „Freut es dich?“ – Noch ein Lied: „O Tannenbaum“, speziell für die 80-Mark-Tanne! – „Früher ist man um Mitternacht in die Kirche gegangen“, sagt Groß-mutter. – Staunen. – Die Kerzen sind mittlerweile heruntergebrannt, das elektrische Licht strahlt wieder anheimelnd und vertraut. Noch eine sinnige Geschichte, die „seelisch auf Weihnachten einstimmt“, dann ist erst mal Ruhe.
Seelisch bewegt wird das Buch geschlossen; Taschentücher gleiten unauffällig über die Augen. Noch ein paar Plätzchen, bitte! Die Ge-schichte hat verdammt nachdenklich gemacht. „Fein, deine Spekulatius, …. mm!“ – Es ist schon spät; man verabschiedet sich voneinander. Nach und nach gehen alle zu Bett. „O Licht lösch aus…!“ Einen Augenblick lang ballen sich Bilder zusammen wie ferne Erinnerungen. Stimmungen steigen auf. Da hinein mischen sich die Freude auf morgen und der Ap-petit auf dieses oder jenes Spiel: ein Auto, ein Radio – die neuen Ge-schenke eben. Dann sinkt der Schläfer in den Abgrund…
Die Weihnacht? … Nun, das war sie. Aber war sie das wirklich?
Es sind nicht allein die Ketzer, die an dieser Art Weihnacht zweifeln oder auch verzweifeln. Und mancher Unbefangene spürt, dass wir mit unserer mitteleuropäischen Weihnacht tatsächlich an etwas vorbeige-hen, an einer lebendigen, erfüllten Weihnacht. Gab es eine solche denn jemals? Und wenn ja, wann? – Zur ersten Frage: Es gab sie! Davon sol-len im Folgenden Bruchstücke gesammelt werden. – Zur zweiten Frage: Solange die Weihnacht lebendig erlebt wurde, war sie auch erfüllt und lebendig. Das Erleben aber erlosch irgendwann.
Als Immanuel Kant (1724 – 1804) gegen den westlichen Empirismus und die Ideen der Aufklärung ankämpfte, versuchte er, die Religion vor den Angriffen dessen, was man damals „Wissen“ nannte, „in Sicher-heit“ zu bringen. Unter Wissen verstand man ein rationalistisches, reli-gionskritisches, wenn nicht gar religionsfeindliches Wissen, das sich von jeder Glaubensgrundlage abgelöst hatte. Daher verschanzte der tief gläubige Kant die Heiligtümer der Religion gleichsam in die von ihm errichtete Festung des Glaubens. Die Grundpfeiler der Religion, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, waren ihm zwar praktische Glaubens-grundlage, aber der theoretischen Vernunft seiner Ansicht nach uner-reichbar. Damit wurde erstmals philosophisch-gedanklich vollzogen, was sich auf anderer Ebene, auf dem Weg über die arabisch beeinflusste Wissenschaft, schon früher angekündigt hatte: „Von Gott und dem Jen-seits kann man nichts wissen; man kann allenfalls daran glauben“.
Dieses Postulat berücksichtigte nicht, dass es neben Wissen und Glauben auch noch eine andere Erkenntnis-Grundlage gibt, die des Er-lebens oder Erfahrens. Ist solches Erfahren erst einmal eingetreten, ver-drängt es mühelos Wissen und Glauben.
Um an Weihnachten zu lebendigen Erlebnissen zu kommen, müssen die Hintergründe der Weihnacht wieder vertraut werden. Das sind sie nicht. Viele Menschen kennen nur einen winzigen Ausschnitt vom Weihnachtsgeschehen, meistens den christlichen Teil, und den oft un-vollständig.
Im Folgenden werden von mehreren Seiten Schlaglichter auf unter-schiedliche Bereiche und Schichten der Weihnacht gerichtet werden. Die riesige Stoffmenge wurde energisch beschnitten. Dadurch traten zwangsläufig Lücken auf.
Geschichtlicher Rückblick
Die Weihnacht weist drei verschiedene geschichtliche Bereiche auf, deren Bilder und Bräuche wie archäologische Kulturschichten durch-sucht werden können:
1.) Das Christentum bildet die jüngste Schicht seit 354 n. Chr. Es übernahm aber zwangsläufig auch Bilder und Bräuche aus vorchristli-cher Zeit und assimilierte diese weitgehend.
2.) Das germanische Heidentum mit dem Yulfest ist die nächstältere Schicht. Doch auch diese beinhaltete schon älteres Kulturgut, das zum Teil verwandelt, zum Teil fast unverändert tradiert wurde.
3.) Das alte Sonnwendfest der Mittleren Steinzeit im Kult der Gro-ßen Mutter ist die älteste Schicht – ca. 10.000–2.000 Jahre vor der Zei-tenwende.
Aus allen drei Bereichen finden sich mehr oder weniger deutliche Spuren im Weihnachtsfest. Die immer schneller verblassenden Vorstel-lungsbilder, Bräuche, Sagen, Lieder und Gedichte, deren kulturge-schichtliches Durcheinander weder Christen noch Nichtchristen son-derlich erfreut, sind in der mitteleuropäischen Weihnacht in unter-schiedlicher Mischung enthalten – ein Kulturschatz, der durch die heu-tigen Verhältnisse vom Aussterben bedroht ist, der aber viele Anregun-gen für ein neues Erleben der Weihnacht böte!
Um 354 n. Chr. wurde das Weihnachtsfest von den Vätern der rö-misch-katholischen Kirche erstmals auf den 25. Dezember festgelegt. Das war der Tag der Wintersonnwende. Ein griechischer Kalender von 200 v. Chr. sagt über dieses Datum: „Geburtstag der Sonne, das Licht nimmt zu“. Demgegenüber ergaben mittelalterliche „Berech-nungen“, oder besser Spekulationen des Geburtstags Christi ganz an-dere Zeiten: den 20. Mai oder den 20. April. Der Kirchenvater Origenes sagte, die Christen feierten den Todestag Christi als „Natale“, als Geburtstag; einen speziellen Geburtstag Christi kenne er nicht. Die Kirche hatte also die Christgeburt auf den Tag der Wintersonnwende gelegt. Mit ihm begann auch das Yulfest.
Für den 24. /25. Dezember bezeugte der Historiker Beda um 735 n. Chr. für Altengland die Bezeichnung „módra niht“, das heißt „Nacht der Mutter“. Dieser Begriff ist uns auch aus anderen Ländern überlie-fert: So hieß der Weihnachtsabend in Skandinavien „Modernatten“, im Erzgebirge, Schleswig-Holstein und der Pfalz „Mutternacht“ und in Westböhmen „Nächte der Mütter“. Da aber der Begriff „módra niht“ (oder „modra neht“) älter ist als die Festlegung der christlichen Weih-nacht, bezieht er sich auch auf ein älteres Geschehen; das heißt, er weist auf eine ältere Mutter als die christliche Mutter Maria hin. Und die alte Bezeichnung „ze den wíhen nachten“ deutet auf eine Anzahl Nächte, die „Weihenächte“, nicht nur eine Nacht. Dies ist exakt, denn es sind deren dreizehn.
Die Zeit zwischen den Jahren
Älteren Vorstellungen zufolge unterscheiden wir zwei Jahresläufe: den des Mondes und den der Sonne. Sie sind unterschiedlich lang, weil der Mond mit seinen 29 1/2 Tagen pro „Monat“ bereits in (12 x 29 1/2 =) 354 Tagen ein Mondjahr vollendet, während das Sonnenjahr ca. 365 1/4 Tage umfasst. Die Differenz, elf ganze Tage und ein angebrochener – diese zwölf betroffenen Tage und ihre dreizehn Nächte wurden in alten Kalendern als die „13 Rauhnächte“, bzw. die „Zwölften“ aufge-führt.
Die „Rauh“- oder „Losnächte“ hatten es in sich! In altdeutschen Sa-gen werden die Wunder, aber auch das Spukgeschehen dieser Nächte beschrieben.
Zuvor eine Begriffsklärung: Im Folgenden wird des Öfteren das Wort „Anderswelt“ vorkommen. Es entstammt dem irischen, schotti-schen und walisischen Märchen- und Sagenschatz. Unter der Anderswelt wurde die Welt „hinter“ dem Schleier der Sinneswelt verstanden, jene Welt, die unsere eigene, die „Alltagswelt“ erst zustande bringt und am Leben erhält. Es ist die der Riesen, Trolle, Zwerge, Elfen, Feen, Meerfrauen und anderer Märchen- und Fabelwesen, aber auch die der 9 Engelreiche und der Verstorbenen und Ungeborenen.
Was geschah nun in den Rauhnächten? Alle möglichen, heimlichen und unheimlichen Gesellen und Gesellinnen, Geister und Geistchen der Anderswelt – bis hinab zum „Speicherpuck“, dem „bucklichten Männlein“, „Bibabutzemann“, „Klabauter“ und anderen eigentümli-chen Herrschaften – drangen ungefragt in unsere Alltagswelt ein, fuhr-werkten eine Weile darin herum und verschwanden wieder. Manche lu-den den Menschen sogar in ihre eigene Welt ein. Wer aber den goldenen Gastbecher der Anderswelt gereicht bekam, erlebte Merkwürdiges: wie sein Becher sich beim Trinken, statt leerer zu werden, weiter füllte. Und die Speisen an der Tafel der „Herrlichen“ nahmen immer nur zu statt ab, je mehr der Gast davon aß. Ströme, Flüsse und Bäche flossen dort hügelauf, den Quellen zu. Farben erklangen hörbar. Töne erschienen als überwältigende Erlebnisse und boten sich dem Auge als Tänzer oder Tänzerinnen dar. – Die Gesetze der normalen Zeitrechnung waren auf-gehoben. Ein wenig hiervon erfahren wir ja auch beim Einschlafen und Aufwachen, wenn Sekunden sich endlos zu dehnen vermögen und Stunden „sekundenschnell“ vorüber gleiten. – Wer aber jemals in der Anderswelt geweilt hatte, wurde seines Alltagslebens nicht mehr froh. Und oft entschied er sich, „fort zu gehen“. Dazu zwei Sagen:
Frau Holle und der Blinde1)
Einmal, an einem Weihnachtsnachmittag, kehrte ein blinder Buchbinder, von seinem Hund geführt von der Arbeit heim. Er hatte dabei eine weite Strecke durch einen großen Wald zu gehen und ein schlimmer Wind fuhr durch alle Wipfel. Nun wollte der Weg an diesem Tage schier kein Ende nehmen, es wurde immer einsamer und kälter um den blinden Mann und er fürchtete schließlich sein Hund habe sich verirrt.
Auf einmal legte das Tier sich nieder und sprach mit menschlichen Worten: „Weißt du, dass Frau Holle heute Nacht in den Wald kommt?“
„Hast du mit ihr zu reden?“ fragte der Blinde erstaunt.
„Nein, aber ich habe dich heute ein ganzes Jahr lang geführt“, sagte der Hund, „jetzt hab du einmal Geduld und gib mir, dass ich eine Stunde mit den Meinen spielen kann! Sie kommen alle in den Hollenwald!“
Da mußte der Mann, frierend an einen Stamm gelehnt, warten, bis sein Führer wiederkam. Er schalt erst noch, aber es war zu verstehen, dass auch solch ein Tier seine Freude haben will. Zwischen Weihnacht und Neujahr verstehen sie alle einan-der, verstehen sogar die Sprache der Menschen und es heißt, dass sie in den Tagen mehr wissen als unsereins, dafür, dass sie ein Jahr stumme Diener der Menschen waren.
Als der Blinde nun hoffte, dass ein gut Teil der Stunde vorüber sei, kam der Hund wieder vorbei. „Da musst noch Geduld haben“, sagte der Hund zu seinem Herrn, „es sind noch nicht alle da, wir sind zu früh gekommen.“
Der Mann mochte nichts erwidern, um dem Tier die Freude nicht zu verderben; wie er dabei aber horchend den Kopf zu ihm niederbeugte, geschah ihm, wie es allen Blinden bei Frau Holles Kommen geschieht, er konnte den Hund auf einmal wie einen Schatten sehen. Und als er den Kopf wieder hob, war ihm, als stünde rundum der Tannenwald wie eine Schar begrünter Kreuze da, und er erblickte oben in den Wipfeln den Mond, um den mit hellen Gliedern viele Nebel tanzten. Aber der Blinde sah noch mehr, er sah, wie ein ganzes Schiff mit Tannenbäumen und Lichtern vom Himmel näher schwebte und sich auf einer weißen Waldwiese, die vor ihm lag, niederließ.
Und der Mann, der viele Jahre ohne Augenlicht gewesen war, erblickte tausend Tiere, die von weither gekommen waren, um Frau Holle zu begrüßen, er erblickte die Elfen mit weißen Gliedern, die im Mondlicht tanzten. Und er lief über den Festplatz auf das Schiff zu und schrie vor Erstaunen: „Ich habe mein Augenlicht wieder, ich sehe dich, Frau Holle!“
Da schritt die schöne Frau selbst an ihm vorüber, und als sie ihn so rufen hörte, trat sie näher und fragte: „Bist du blind gewesen, armer Mann?“
„Ja“, rief der Buchbinder, „ja, ich bin blind gewesen und kann dich sehen, wie ist das herrlich!“
Aber die Frau warnte ihn: „Lieber Mann, hoffe nicht zu früh, es ist nur in den Zwölften, dass du zu sehen vermagst.“
„Ich bin aber so glücklich, dass ich sehen kann“, rief der Mann, „ach, kannst du mir denn nicht für immer mein Augenlicht wiedergeben?“ Es war ihm alles so herrlich rundum, voller Lichter und köstlichen Glanzes, voll schöner und tanzender Menschen, voll Wagen und freundlicher Tiere, voll ragender Bäume und leuchtender Blumen, die mitten im Schnee aufwuchsen. Den armen Mann dünkte, dass sein Leben immer und zu allen Stunden so prächtig sein würde wie in dieser. „Ach“, rief er, „hätte ich doch mein Augenlicht für immer –“, den schlimmen Alltag hatte er ganz vergessen, „kannst du mir nicht helfen, dass es so bleibt?“
Für immer kann ich dir nicht helfen“, antwortete sie traurig, „aber ich kann dich wählen lassen, ob du das Jahr hindurch alles Leben und Leid der Menschen erblicken, oder aber, ob du in den Zwölften zu uns kommen willst.“
Da weiß ich genau, was ich zu wünschen habe“, schrie der Mann aufgeregt, ihm schien das Jahr so viel länger als die kurze Spanne der Feiertage. „Da weiß ich gewiss, was ich erwähle: Gib mir das Jahr frei, Frau Holle, ein ganzes Jahr über möchte ich so offene Augen wie zu dieser Stunde haben.“
Da seufzten die Tiere, sie meinten vielleicht, der Fremde hätte sich anders ent-scheiden müssen. Aber Frau Holle strich ihm schon über die Augen: „So werde für deine Welt sehend, und blind für uns“, sagte sie. Und das Dunkel fiel auf die Lider des Mannes, weil er noch auf Frau Holles Wiese stand.
Und die schöne Königin rief seinen Hund, der kam gehorsam, führte den Mann in seine Stadt heim, und er war längs des Weges blind wie vorher. Aber als er zu den Menschen kam, erhellten sich seine Augen langsam, so wie es ihm die gütige Frau versprochen hatte. Und als das neue Jahr begann, lebte er mit klaren Augen, ein Genesener, unter den Seinen.
Es ist jedoch an dem, dass der Mann die Sehnsucht nach dem Frauhollenzug seit jener Nacht nicht mehr verlieren kann und dass er, wie alle Menschen, die lange blind waren, im Alltag alle Armut und Krankheit doppelt genug erkennt. Und er ist schwermütig und wortkarg geblieben und kann die Feier der Zwölften und den Zug der schönen überirdischen Frau, den er einmal gesehen hat, zu keiner Stunde vergessen.
(H. Fr. Blunk)
Das Abenteuer des Conle
Conle der Rotschopf, ein Sohn des Conn von den Hundert Schlachten, war mit seinem Vater eines Tags auf den Höhen von Uisnech, als er eine Frau in einem seltsamen Kleid sah. «Wo kommst du her, Weib?» fragte er. Und die Frau erwi-derte:
«Ich komme aus dem Land des Lebens, wo es weder Tod noch Sünde noch Mis-setat gibt. Wir feiern den ganzen Tag über, ohne dass man vorlegen oder nachschen-ken muss. Wir sind freundlich miteinander und kennen keinen Streit. Wir wohnen in einem großen Feenhügel, und nach diesem werden wir das Volk von den Feenhü-geln genannt.»
«Mit wem sprichst du da?» sagte Conn zu seinem Sohn, denn er sah die Frau nicht. Und das Weib erwiderte: «Er spricht mit einer schönen jungen Frau edler Herkunft, auf die wartet weder Tod noch Alter. Ich habe mich in Conle den Rot-schopf verliebt, und ich befehle ihm, zur Ebene der Freuden zu kommen, wo Boad-hagh für immer König ist, ein König in einem Land ohne Weinen und Klagen, seit-dem er dort herrscht. Komm mit mir, Conle Rotschopf mit dem schönen Nacken und den Augen wie eine Kerzenflamme. Eine goldene Krone über deinem gesunden Ge-sicht wird das Kennzeichen deiner Königsschaft sein. Wenn du mit mir kommst, wird sich dein Aussehen nicht verändern, du wirst immer jung und schön sein, bis zum Tag des Jüngsten Gerichts.»
Da sprach Conn zu seinem Druiden, Corann mit Namen, da doch alle die Frau, die Conle allein zu sehen vermochte, hatten reden hören:
«Hilf mir Corann, geübt im Singen und groß an Geschicklichkeit. Ich fühle mich überwältigt von einer Gewalt, wie ich ihr noch nie begegnet bin, seit man mich zum König machte, unsichtbare Gestalten überwältigen mich, schleppen mit Zauber mei-nen schönen Sohn fort. Von meiner Seite ist er gerissen durch den Zauber der Frauen.»
Da sang der Druide einen Zauber gegen die Stimme der Frau, so dass keiner sie mehr hören konnte, und auch Conle sah sie jetzt nicht mehr.
Als die Frau aber durch den mächtigen Gesang des Druiden vertrieben wurde, warf sie Conle einen Apfel zu. Und noch einen Monat nach diesem Vorfall war Conle ohne Essen und Trinken und verlangte nach keiner Speise, außer nach seinem Apfel. Wieviel er jedoch auch essen mochte, der Apfel wurde nicht weniger, vielmehr blieb er immer ein ganzer Apfel. Dann ergriff Conle Sehnsucht nach der Frau, die er gesehen hatte.
Eines Tages, als der Monat herum war, stand Conle neben seinem Vater in der Ebene von Archommin. Da sah er wieder die Frau kommen, und sie sagte zu ihm: «Auf einem Hochthron sitzt Conle unter den gewöhnlichen Sterblichen und lebt sei-nem Tod entgegen. Das unsterbliche Leben lädt dich ein. Wir rufen dich zu Tethras Volk, das dich jeden Tag bei den Versammlungen in deinem Heimatland erblickt.»
Als Conn wieder die Stimme dieses Weibes vernahm, sagte er zu seinen Gefolgs-leuten: «Ruft mir den Druiden! Ich höre, ihr ist heute wieder die Zunge gelöst.» Da sprach die Frau: «Conn von den Hundert Schlachten, verlass dich nicht auf deine Druiden, denn bald wird ein gerechter Mann kommen, mit großem Anhang und wird wunderbar Recht sprechen an unserer Küste. Bald wirst auch du unter seinem Gesetz stehen. Er wird den Zauber der Druiden lösen, und alles, was sie angesichts des Teufels, des Schwarzen Zaubers gelernt haben, wird ausgelöscht sein.»
Conn wunderte sich, dass Conle zu keinem sprach, als das Weib kam. «Hat dir, was das Weib sprach, das Herz durchbohrt?» fragte Conn. Und Conle antwor-tete: «Es ist nicht leicht für mich, denn ich liebe mein Volk, und doch hat das Verlangen nach jenem Weib mich ergriffen.»
Die Frau sprach: «Du kämpfst an gegen die Welle deiner Wünsche, die dich von ihnen fortträgt. In meinem gläsernen Boot fahren wir zum Feenhügel von Boadhagh, wenn wir bis dorthin gelangen. Es gibt ein anderes Land, und es wäre nicht übel, dieses Land zu erreichen. Die Sonne geht unter, sehe ich …das Land ist weit, und doch werden wir dort sein, ehe es Nacht geworden ist. In diesem Land empfindet jeder, der hinkommt, Freude. Es sind auch noch andere Wesen dort, außer Frauen und Mädchen.»
Dann rannte Conle davon von den Seinen und sprang in ihr gläsernes Boot. Sie sahen sie weit in der Ferne. Ihre Augen konnten ihnen nicht mehr folgen, so weit fort ruderten sie auf dem Meer. Nie hat man wieder etwas von Conle und diesem Weib gesehen.
(Unbekannter irischer Autor – 8. Jahrhundert)
Frau Holle
In der Zeit zwischen den Jahren zog Frau Holle im Lande herum, die Holde Frau mit den vielen Namen: Frau Perchta (oder Berchta, Berta, Baita), Frau Gode, Frau Harke, Herke oder Erke, Frau Frigg, Luzia, die Lutz oder die Lutzelfrau, um nur einige der bekannteren zu nennen. Obwohl stets dasselbe Wesen, trat die Hohe Frau nicht nur unter regional völlig verschiedenen Namen auf, sondern auch mit verschiedenem Alter, Aussehen und Verhalten.
Wer ist sie überhaupt, diese Frau Holle? – „Die bedeutendste volksmythologische Gestalt unserer Märchen, Sagen, Gedichte, Lieder und Bräuche“, sagen alte Brauchtumsbücher. Leider sind die genannten Kulturschätze nach zwei Weltkriegen kaum mehr bekannt, weil sie zerstört wurden wie die Häuser der Städte. Und was die Bomben im Krieg übrig ließen, zerstörte im folgenden Frieden desto sicherer das „Wirt-schaftswunder“ mit Film, Funk und Fernsehen, sowie in deren Gefolge neue „Kulturgüter“ à la Mickey Mouse oder Batman. Für eine Frau Holle fehlte da die geistige Atemluft. Mehr als das gleichnamige Mär-chen der Brüder Grimm ist heute über diese Gestalt kaum noch be-kannt. Dabei hat es im 19. Jahrhundert Dutzende von Märchen und Hunderte von regionalen Sagen über Frau Holle – Perchta – Luzia ge-geben.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sammelte der Dichter und Forscher Karl Paetow in Mitteldeutschland (vor allem Hessen) die dort noch vor-handenen Hollenmärchen und -Sagen und brachte sie als kleines Buch heraus, „Frau Holle – Volksmärchen und Sagen“2)