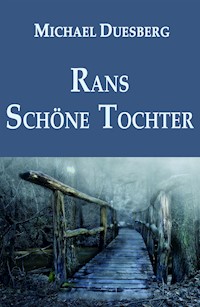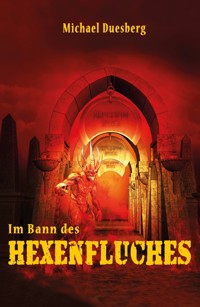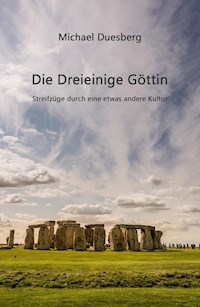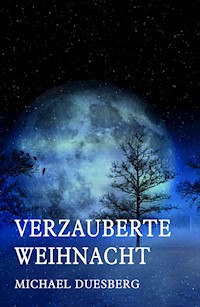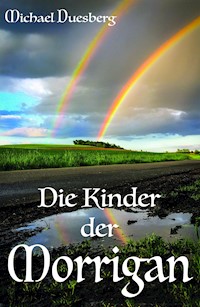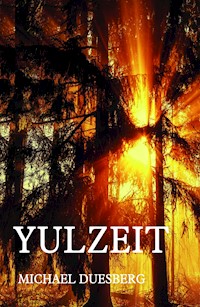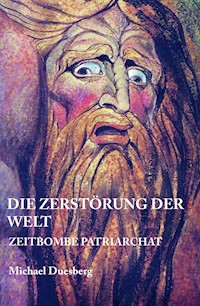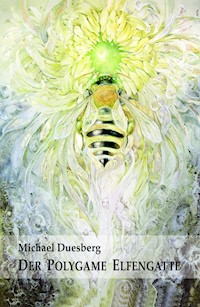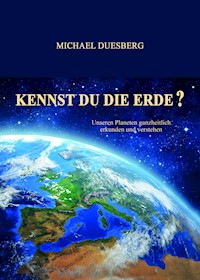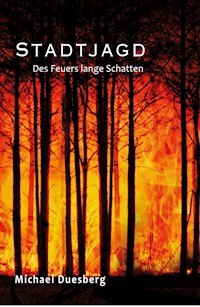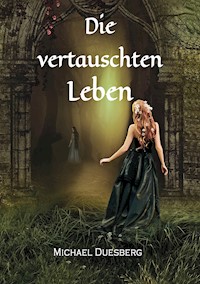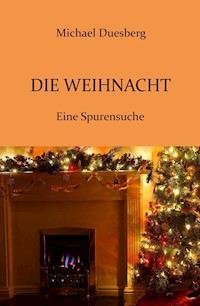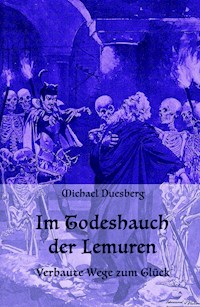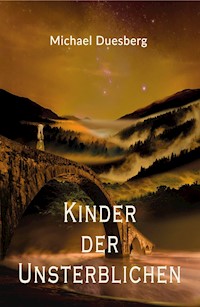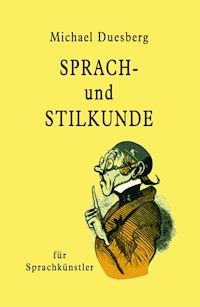
6,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine umfassende Wort- und Satzlehre zum Auffrischen verblassender Kenntnisse, nicht ohne reichlich eingestreute kleine 'Leckerbissen'; sodann eine ungewöhnliche Stilkunde, die sich an den menschlichen Temperamenten orientiert; ein vergnüglicher Rhetorik-Lehrgang und das Thema 'Aufsatz', beide üppig mit Beispielen ausstaffiert; zuletzt eine gründliche Stilkunde, und das Ganze auch noch lesbar und leicht nachzuvollziehen - wer könnte da widerstehen? Learning by reading.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
MICHAEL DUESBERG
SPRACH- und STILKUNDEfür SPRACHKÜNSTLER
SPRACH- und STILKUNDE
für
SPRACHKÜNSTLER
Michael Duesberg
REPETITORIUM SPRACHLEHRE
Impressum:
© 2018 Michael Duesberg
Umschlagbild: OpenClipart-Vectors | www.pixabay.com
Layout, Bildbearbeitung u. Umschlaggestaltung:
Angelika Fleckenstein; Spotsrock
ISBN
978-3-7469-7281-7 (Paperback)
978-3-7469-7282-4 (Hardcover)
978-3-7469-7283-1 (E-Book)
Druck und Verlag:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Du denkst, jeder, der eine Sprache gelernt hat, beherrscht sie dann auch, oder? Du hast Deine Muttersprache gelernt und dennoch sind vielleicht Dein Arbeitgeber, Deine Dozenten, Deine Lehrer oder andere für Dich wichtige Persönlichkeiten unzufrieden. Womöglich Du selbst auch? Woher kommt das? Weil Dein Können vielleicht gut, aber nicht optimal ist: Du KÖNNTEST ES IMMER NOCH BESSER! Natürlich fragst Du Dich dann, wie Du das anstellen sollst. Und genau das kannst Du hier erfahren.
Gesprochene Sprache oder deren Schriftform zu gestalten ist nichts anderes, als Ton oder ein anderes Medium zu formen und so lange umzugestalten, bis es Dir gefällt. Worauf Du auch immer beim Schreiben bisher geachtet hast: Du wirst nach der Lektüre dieses Buches mit einem anderen Ansatz an die Sprache herangehen und je nach Bedarf interessant, kenntnisreich, spannend, flüssig, vor allem aber SCHÖN schreiben können, denn das lässt sich lernen. Du bist skeptisch? Probiere es aus!
Vorwort
Das Baumaterial
A) Die Laute
B) Wörter. Die Wortlehre
1. Die Hauptwörter (Substantive oder Nomen)
1.1 Funktion
1.1.a) Konkreta
1.1.b) Abstrakta
1.2 Genus (Geschlecht)
1.3 Numerus (Zahl)
1.4 Kasus (Fall)
1.4.a) Der Nominativ
1.4.b) Der Genitiv
1.4.c) Der Dativ
1.4.d) Der Akkusativ
1.5 Deklination (Beugung)
2. Die Eigenschaftswörter (Adjektive)
2.1 Funktion
2.2 Gebrauch
2.3 Deklination (Beugung)
2.4 Komparation (Vergleichsform)
2.5 Unregelmäßigkeiten
3. Die Tuwörter (Verben)
3.1 Funktion
3.2 Einteilung
3.2.1 Die eigentlichen, selbstständigen Verben
3.2.1.a) transitive (zielende) Verben:
3.2.1.b) intransitive (nichtzielende) Verben:
3.2.1.c) reflexive (rückbezügliche) Verben:
3.2.2 Die Hilfsverben
3.2.2.a) Die Hilfsverben der Zeit
3.2.2.b) Die Hilfsverben der Aussageweise
3.3 Die Konjugation (Abwandlung)
3.3.1 Person und Zahl
3.3.2 Zeitformen (Tempora)
3.3.3 Zeitfolge (Consecutio temporum)
3.3.4 Zustandsformen des Verbs (Genera verbi)
3.3.4.a) Aktiv (Tatform)
3.3.4.b) Passiv (Leideform)
3.3.5 Aussageweisen (Modi)
3.3.5.a) Die Wirklichkeitsform (Indikativ)
3.3.5.b) Die Möglichkeitsform (Konjunktiv)
3.3.5.c) Befehlsform (Imperativ)
3.3.6 Formen ohne Personalendung (Infinitivformen)
3.3.6.a) Nennform (Infinitiv):
3.3.6.b) Mittelwort (Partizip)
3.3.7 Konjugationsarten
3.3.8 Zusammengesetzte Zeitwörter (Komposita)
4. Der Artikel
5. Die Zahlwörter (Numeralia)
6. Die Empfindungswörter (Interjektionen)
7. Die Umstandswörter (Adverbien)
7.1 Als Umstandswörter des Ortes (Lokaladverbien)
7.2 Als Umstandswörter der Zeit (Temporaladverbien)
7.3 Als Umstandswörter der Art und Weise (Modaladverbien)
7.4 Als Umstandswörter des Grundes (Kausaladverbien)
7.5 Die Relativadverbien
7.6 Die Interrogativadverbien
7.7 Die „Würzwörter“ (Abtönungspartikeln)
8. Die Verhältniswörter (Präpositionen)
8.1 Lokale Verhältniswörter (des Raumes)
8.2. Temporale Verhältniswörter (der Zeit)
8.3 Modale Verhältniswörter (der Art und Weise, der Umstände)
8.4 Kausale Verhältniswörter (des Grundes, der Ursachen)
9. Die Bindewörter (Konjunktionen)
9.1 Koordinierende Konjunktionen
9.1.1 Zusammenstellende Konjunktionen
9.1.2 Entgegenstellende Konjunktionen
9.1.3 Ausschließende Konjunktionen
9.1.4 Modale Konjunktionen
9.1.5 Kausale Konjunktionen
9.2.Subjunktionen
9.2.1 Lokale Subjunktionen
9.2.2 Temporale Subjunktionen
9.2.3 Modale Subjunktionen
9.2.4 Kausale Subjunktionen
Die Satzlehre
C) Die Sätze. Satzlehre (Syntax)
1. Die Satzarten
1.1 Aussagesätze (Erzählsätze)
1.2 Befehls-, Wunsch- und Ausrufesätze (Empfindungssätze)
1.3 Fragesätze
2. Die Satzglieder
2.1 Das Subjekt (S)
2.2 Das Prädikat (P)
2.3 Das Objekt (O)
2.4 Das Attribut (ATT)
2.4.1 Als Adjektivattribut:
2.4.2 Als Genitivattribut:
2.4.3 Als Adverbiales Attribut:
2.4.4 Als Präpositionales ATT:
2.4.5 Als I nfinitiv-ATT:
2.4.6 Als Apposition (Beisatz):
2.4.7 Als andere Attribut-Arten:
2.5 Das Adverbiale (ADV)
2.5.1 Die Lokaladverbien
2.5.2 Die Temporaladverbien
2.5.3 Die Modaladverbien
2.5.4 Die Kausaladverbien
3. Die Hauptsätze
3.1 Die Satzreihen (Satzverbindungen)
3.1.1 Unverbundene Satzreihen (Asyndetische Sätze)
3.1.2 Verbundene Satzreihen (Syndetische Sätze)
3.1.3.a) Kopulative (anreihende) Satzverbindungen
3.1.3.b) Disjunktive (ausschließende) Satzverbindungen
3.1.3.c) Adversative (entgegensetzende) Satzverbindungen
3.1.3.d) Kausale (begründende) Satzverbindungen
4. Die Nebensätze
4.1 Das Satzgefüge
4.2 Andere Einteilungen
Der Schreibstil
D) Der Schreibstil und die vier Temperamente
1. Erste Stilkunde an der Untertertia (8. Schuljahr) einer Waldorfschule
2. Die vier Temperamente
2.1 Der Phlegmatiker
2.2 Der Choleriker
2.3 Der Sanguiniker
2.4 Der Melancholiker
2.5 Temperamente-Schema
3. Die vier Stilrichtungen ertasten
4. Die vier Stilarten
4.1 Texte, cholerischer Stil
4.2 Texte, phlegmatischer Stil
4.3 Texte, melancholischer Stil
4.4 Texte, sanguinischer Stil
4.5 Zusammenfassung
Die Rhetorik
Rhetorik in unserer Sprache
Vorwort
E) Die Rhetorik
1. Figuren der Wiederholung
1.1 Die Doppelung
1.2 Die Anapher
1.3 Die Kette
1.4 Der Refrain
1.5 Die Verdeutlichung
1.6 Die Bekräftigung
1.7 Die Variation
1.8 Musikalische Figuren
2. Lexikalische Figuren (Tropen)
3. Syntaktische Figuren (Sätze)
4. Kompositorische Figuren (Kompositionen)
5. Dialektische Figuren (Gewichtung und Wertung der Argumente)
Der Aufsatz
F)Einige Aufsatzformen
Vorgehensweise
Der Bericht
Die Erzählung
Beispiele
Der Stil
Die Arbeit am Stil
Der Plot
Auf der Jagd nach dem Plot
Die Suche nach dem richtigen Aufbau
Wie erstelle ich einen Bauplan?
Alternative Handlungspläne
Die Schneeflockenmethode
Weitere Handlungsstrukturen
Das Baumaterial
Die Materialien des Sprach- oder Schreibkünstlers sind die Gedanken und die Sprache.
Letztere besteht aus:
den Lauten,den Wörtern undden Sätzen,
mit deren Hilfe Du Gedanken, Gefühle und Willensimpulse auszudrücken vermagst. Das kann in der Alltagssprache geschehen, aber auch in einer künstlerisch gehobenen Sprache, wie sie in der epischen oder lyrischen Dichtung Anwendung findet.
A) Die Laute
Die ganze Natur ist voller Laute: Wind, Wasser, Feuer, Steine, Tiere und Menschen, sie alle erzeugen Laute. In unserer Sprache können wir etwa 73 verschiedene Laute voneinander unterscheiden. Wir gliedern sie vereinfachend in die vier verschiedenen Laut-Kategorien:
Die Vokale (Selbstlaute), die Konsonanten (Mitlaute), die Diphtonge (Zwielaute) und die Umlaute.
Die Vokale (Selbstlaute) sind:
a e i o u
Die Konsonanten (Mitlaute) sind:
b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z.
Die Diphtonge (Zwielaute) sind:
ei eu au ui oi
Die Umlaute sind:
ä ö ü y
B) Wörter. Die Wortlehre
In der Wortlehre unterscheiden wir 3 × 3, also 9 Wortarten. Das klingt nach viel, erweist sich aber als sehr gut überschaubar, weil diese Wortarten drei verschiedene seelische Bereiche in uns Menschen ansprechen, nämlich Denken, Fühlen und Wollen. Die drei ersten und wohl am stärksten urbildlichen Wortarten sind:
Hauptwörter (Substantive oder Nomen)
Eigenschaftswörter (Adjektive)
Tuwörter (Verben)
1. Die Hauptwörter(Substantive oder Nomen)
Die Hauptwörter nehmen wir mit dem Haupte auf, daher kommt ihr Name, nicht weil sie die Hauptsache unter allen Wörtern wären. Hören wir ein Hauptwort, so bilden wir dasselbe in unserer Vorstellung, also in einem Bereich unseres Denkens nach.
Kleiner Test zum Beweis:
Schließe die Augen! Lass dir von jemandem langsam 10 verschiedene Hauptwörter aus deiner Lebensumgebung nennen, z. B. Baum, Dach, Hund, Zaun, Schwert, Hammer, Kohlkopf, Blume, Berg, Mond. Du wirst sie beim Hören innerlich vor dir SEHEN. Sie wirken auf deinen Kopf, Du merkst es daran, dass sie deine Vorstellung in Bewegung setzen.
2. Die Eigenschaftswörter (Adjektive)
Die Eigenschaftswörter können wir fühlen, spüren, empfinden. Sie wirken auf unser Fühlen.
Kleiner Test:
Schließe die Augen! Lass Dir von jemandem langsam 10 verschiedene, gut nachvollziehbare Eigenschaftswörter nennen. Z. B. schnell, weich, rau, süß, dumm, nett, schleimig, trocken, faulig, nass. Du wirst sie beim Hören innerlich erspüren, sie wirken auf dein Fühlen.
3. Die Tuwörter (Verben)
Die Tuwörter vollziehen wir innerlich tätig nach, oft sogar mit den Gliedmaßen reagierend; sie wirken auf unseren Willen.
Kleiner Test:
Wie reagierst Du auf die folgenden Tuwörter? hämmern, fliegen, sägen, schleichen, lachen, essen, hüpfen, sich verbeugen, klatschen, stampfen. Wenn Dir die Wirkung auf Dich selbst nicht sofort klar wird, so lies diese Wörter langsam einem Kindergartenkind vor und Du wirst etwas Lustiges erleben!
ERGEBNIS: Wenn Du nachempfinden kannst, dass diese Wortarten auf Dein Denken, Fühlen und Wollen, auf Kopf, Herz und Gliedmaßen zielen, so kannst Du sie jederzeit voneinander unterscheiden und leicht in die Erinnerung zurückrufen.
Nach demselben Muster ordnen sich auch die anderen 6 Wortarten unter Denken, Fühlen und Wollen ein:
Zum Denken, Begreifen, Verstehen gehören sowohl die Artikel (Geschlechtswörter) und Fürwörter (Pronomen), die das Hauptwort als brave Diener oder Stellvertreter begleiten, als auch die Zahlwörter (Numeralia), die auf dieselbe Weise mit dem Hauptwort verbunden sind.
Zum Fühlen, Spüren, Empfinden gehören sowohl die Ausrufwörter (Interjektionen), die gerade in ihrer urbildlichen Form (ah! ii! oh!) einer bestimmten seelischen Gestimmtheit entspringen, und die Umstandswörter (Adverbien), die in ihrer urbildlichen Form geradezu die „Eigenschaftswörter“ der Eigenschaftswörter (Wie stark ist sie? Sehr stark!), der Tuwörter (Wie singt er? Schön!) und der Umstandswörter (Wie laut kann er schreien? Sehr laut!) genannt werden könnten.
Zum Wollen gehören die Verhältniswörter (Präpositionen) und die Bindewörter (Konjunktionen), die, wie beim Wollen und Tun üblich, Bewegung in die Sache oder in den Satz bringen.
DENKEN
FÜHLEN
WOLLEN
Hauptwörter Substantive Nomen
Eigenschaftswörter Adjektive
Tuwörter Verben
Artikel und Fürwörter Pronomen
Ausrufwörter Interjektionen
Verhältniswörter Präpositionen
Zahlwörter Numeralia
Umstandswörter Adverbien
Bindewörter Konjunktionen
1. Die Hauptwörter (Substantive oder Nomen)
1.1 Funktion
Die Hauptwörter kann man in die konkreten und die abstrakten Nomen gliedern:
1.1.a) Konkreta
► Gattungsnamen: Haus, Spaten, Katze, Busch, Blume usw.
► Eigennamen: Fritz, Rhein, Belgien, Matterhorn, Titanic usw.
► Sammelnamen: Gebirge, Allee, Gewässer, Landschaft usw.
► Stoffnamen: Wasser, Metall, Stein, Plastik usw.
1.1.b) Abstrakta
► Eigenschaften: Schönheit, Güte, Begabung, Röte usw.
► Tätigkeiten: Geschrei, Schlag, Ruf, Sprung usw.
► Tugenden: Höflichkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft usw.
► Zeitabschnitte: Sommer, Stunde, Monat, Jahrhundert usw.
► Wissenschaften: Philosophie, Chemie, Erdkunde, Medizin usw.
► Seelisches: Gedanke, Phantasie, Wille, Glaube, Liebe usw.
Bei zusammengesetzten Nomina heißt der erste Teil Bestimmungswort, der zweite Grundwort:
► Mutter-sprache
► Vater-land
► Reise-ziel
► Massen-unterkunft
► Familien-ticket usw.
1.2 Genus (Geschlecht)
Siehe das Kapitel „Artikel“ S. 38
1.3 Numerus (Zahl)
Wir unterscheiden zwischen Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural): der Wagen – die Wagen, der Laden – die Läden, die Katze – die Katzen, die Mutter – die Mütter.
Daneben gibt es Nomina ohne Plural und solche ohne Singular. Nur im Singular stehen oft:
► Stoffe: Gold, Sand, Rauch, Butter, Honig, Asche, Mehl
► Sammelbegriffe: Obst, Vieh, Getier, Bewuchs
► Eigenschaften: Treue, Mut, Tapferkeit, Gehorsam, Güte
► Eigennamen: Donau, Alb, Stuttgart, Belgien
Allein im Plural stehen oft:
► Personengruppen: Leute, Eltern. Geschwister, Verwandte
► Zeitabschnitte: Ferien, Flitterwochen, die Tage (Menses)
► Geographische Begriffe: Alpen, Niederlande, Karpaten, Azoren
► Krankheiten: Blattern, Masern, Pocken, Röteln
► Sonstige: Kosten, Spesen, Tantiemen
Besonderheiten: Veränderte Bedeutung bei verschiedener Pluralform:
die Bank → die Bänke (zum Sitzen) die Banken (Geldhäuser) die Mutter → die Mütter (Frauen) → die Muttern (Schrauben) der Strauß → die Sträuße (Blumen) → die Strauße (Vögel) das Wort → die Wörter (einzelne) → die Worte (im Zusammenhang)
der Mann → die Männer (Plural) → die Mannen (Gefolgsleute)
Nomina mit Grundwort – mann:
Kaufmann → Kaufleute
Schutzmann → Schutzleute
Fachmann → Fachleute
Landsmann → Landsleute
Staatsmann → Staatsmänner
Schneemann → Schneemänner
Strohmann → Strohmänner
Ehemann → Ehemänner → Eheleute (Mann und Frau)
Steuermann → Steuermänner → Steuerleute
Ersatzmann → Ersatzmänner → Ersatzleute
Fremdwörter haben ihre eigenen Endungen:
Thema – Themen, Firma – Firmen, Datum – Daten, Atlas – Atlanten, Museum – Museen, Rhythmus – Rhythmen, Lexikon – Lexika, Material – Materialien
Viele Fremdwörter haben im Plural ein –s:
Salon, Sofa, Hotel, Saison, Party. Deutsche Wörter haben das in der Regel nicht. Ausnahmen sind einige Wörter niederdeutscher Herkunft: Wracks, Haffs, Knicks, Docks.
Umschreibende Plural-Formen:
Dank – Danksagungen, Glück – Glücksfälle, Schutz – Schutzmaßnahmen, Furcht – Befürchtungen, Rauch – Rauchschwaden, Lob – Lobsprüche, Rat – Ratschläge, Streit – Streitigkeiten, Unglück – Unglücksfälle, Schnee – Schneemassen.
1.4 Kasus (Fall)
Es gibt bei uns vier Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ.
1.4.a) Der Nominativ
Der 1. Fall heißt Nominativ und antwortet auf die Fragen WER? oder WAS?
z. B.: der Mann, die Frau, das Kind, das Wasser
1.4.b) Der Genitiv
Der 2. Fall heißt Genitiv und antwortet auf die Frage WESSEN?
z. B.: des Mannes, der Frau, des Kindes, des Wassers
1.4.c) Der Dativ
Der 3. Fall heißt Dativ und antwortet auf die Frage WEM?
z.B.: dem Manne, der Frau, dem Kinde, dem Wasser
1.4.d) Der Akkusativ
Der 4. Fall heißt Akkusativ und antwortet auf die Frage WEN? oder WAS?
z. B.: den Mann, die Frau, das Kind, das Wasser
1.5 Deklination (Beugung)
Fälle
MännlichStarke Deklination
Männlich Schwache Deklination
Singular
Singular
Singular
Nomnativ
der Baum
der Fahrer
der Mensch
Genitiv
des Baumes
des Fahrers
des Menschen
Dativ
dem Baum(e)
dem Fahrer
dem Menschen
Akkusativ
den Baum
den Fahrer
den Menschen
Plural
Plural
Plural
Nominativ
die Bäume
die Fahrer
die Menschen
Genitiv
der Bäume
der Fahrer
der Menschen
Dativ
den Bäumen
den Fahrern
den Menschen
Akkusativ
die Bäume
die Fahrer
die Menschen
Fälle
Weiblich StarkeDeklination
Weiblich Schwache Deklination
Singular
Singular
Singular
Nominativ
die Nacht
die Wurst
die Nase
Genitiv
der Nacht
der Wurst
der Nase
Dativ
der Nacht
der Wurst
der Nase
Akkusativ
die Nacht
die Wurst
die Nase
Plural
Plural
Plural
Nominativ
die Nächte
die Würste
die Nasen
Genitiv
der Nächte
der Würste
der Nasen
Dativ
den Nächten
den Würsten
den Nasen
Akkusativ
die Nächte
die Würste
die Nasen
Fälle
Sächlich StarkeDeklination
Sächlich Schwache Deklination
Singular
Singular
Singular
Nominativ
das Haar
das Lamm
das Auge
Genitiv
des Haares
des Lammes
des Auges
Dativ
dem Haar(e)
dem Lamm(e)
dem Auge
Akkusativ
das Haar
das Lamm
das Auge
Plural
Plural
Plural
Nominativ
die Haare
die Lämmer
die Augen
Genitiv
der Haare
der Lämmer
der Augen
Dativ
den Haaren
den Lämmern
den Augen
Akkusativ
die Haare
die Lämmer
die Augen
2. Die Eigenschaftswörter (Adjektive)
2.1 Funktion
Das Adjektiv benennt und charakterisiert Wesen und Dinge und stellt zwischen ihnen Vergleiche an.
Es bezeichnet Eigenschaften (Wesen, Dinge, Vorgänge, Zustände): z. B. ein fröhlicher Junge, süße Kirschen, schnelle Lieferungen, tiefes Blau
Und es bezeichnet Beziehungen (Herkunft, Ähnlichkeit, Orts- und Zeitverhältnisse): z. B. Schweizer Briefmarken, ungleiche Dreiecke, die hiesige Verwaltung, der morgige Tag
2.2 Gebrauch
Das Adjektiv kann in mehrfacher Weise gebraucht werden:
► attributiv (beifügend)wie z. B. die schmutzigen Stiefel, die roten Lippen, das traurige Kind, die schlimme Wunde
► prädikativ (aussagend)wie z. B. die Stiefel sind schmutzig, die Lippen sind rot, das Kind ist traurig, die Wunde ist schlimm
► nominalisiert (hauptwörtlich)die Schmutzigen, die Roten, das Traurige, das Schlimme, das Neue, der Größte, die Kleinere, den Bösesten
► adverbial (umstandswörtlich)der Wurm kroch langsam, der Neue überlegte gründlich, sie schrie laut, er schlug heftig zu
2.3 Deklination (Beugung)
Beim Hauptwort (1.4 Kasus, Fälle) sahen wir, dass es vier Fälle gibt, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Sie antworten auf die Fragen WER, WESSEN, WEM, WEN. Die Veränderungen, welche das Hauptwort im jeweiligen Fall durchmacht, verändern auch das zu ihm gehörige Eigenschaftswort:
► mein kleiner Bruder schreit,
► das ist das Spielzeug meines kleinen Bruders,
► ich kaufte meinem kleinen Bruder einen neuen Ballon,
► siehst du meinen kleinen Bruder?
► meine kleinen Brüder schreien,
► das ist das Spielzeug meiner kleinen Brüder,
► ich kaufte meinen kleinen Brüdern einen neuen Ballon,
► siehst du meine kleinen Brüder?
2.4 Komparation (Vergleichsform)
Eine der Aufgaben des Eigenschaftswortes sind die Vergleiche. Sie können drei verschiedene Stufen durchlaufen:
► positiv (Grundstufe)Fritz ist so groß wie ich. Ich bin nicht so dumm wie ihr. Sie war so schön wie der lichte Morgen.
► komparativ (Mehrstufe)Fritz ist größer als ich. Ich bin nicht dümmer als ihr. Sie war schöner als der lichte Morgen.
► superlativ (Höchststufe)Fritz ist der größte (nicht: der Größte!). Ich bin nicht der dümmste von uns. Sie ist die schönste von allen. Das war die beste Entscheidung! Das schmutzigste Zimmer ist deines.
2.5 Unregelmäßigkeiten
Unregelmäßig gesteigert werden folgende Eigenschaftswörter:
gut→ besser → am besten
viel → mehr → am meisten
nah → näher → am nächsten
hoch → höher → am höchsten
edel → edler → am edelsten
äußere → äußerste
innere → innerste
niedere → niederste
obere → oberste
untere → unterste
vordere → vorderste
hintere → hinterste
Gar nicht gesteigert werden: golden, bleiern, himmelblau, riesengroß u. a. Der Komparativ kann verstärkt werden durch: viel, weit, noch, bei weitem u. a. Der Superlativ kann verstärkt werden durch: aller-, weitaus, bei weitem, denkbar u. a.
3. Die Tuwörter (Verben)
3.1 Funktion
Das Verb ist nicht das wichtigste Wort im Satz, aber das beweglichste, lebendigste und kräftigste. Es bildet den Kern einer Aussage. Verben bezeichnen Tätigkeiten, Vorgänge und Zustände: der Specht hämmert, der Wind fuhr durch die kahlen Bäume, die Tannennadeln dufteten.
3.2 Einteilung
Dank seiner Beweglichkeit hat das Tuwort viele verschiedene Wesensseiten und Erscheinungsformen zu bieten. Wir sprechen von der „Pentatonik des Verbs“:
Die Pentatonik des Verbs
► Konjugation (Abwandlung): ich, du, er …
► Tempora (Zeitformen): Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft
► Genera Verbi (Zustandsformen): Aktiv und Passiv
► Modi (Aussageweisen): Indikativ und Konjunktiv
► Formen ohne Personalendung: Infinitiv und Partizipien
3.2.1 Die eigentlichen, selbstständigen Verben
3.2.1.a) transitive (zielende) Verben:
Beispiele: der Lehrer lobt den Schüler; der Polizist hält das Auto an; ich gehorche dir; er folgt mir; wir helfen ihm; sie gedachten seiner.
Die Tätigkeit geht von einem Wesen oder Ding aus und auf ein anderes über. Das letztere ist das Objekt.
3.2.1.b) intransitive (nichtzielende) Verben:
Beispiele: ich komme, du gehst, wir lachen, sie schlafen
3.2.1.c) reflexive (rückbezügliche) Verben:
Beispiele: ich beeile mich, er nimmt sich etwas vor, ich wehre mich dagegen, er vergaß sich völlig, er sputete sich
3.2.2 Die Hilfsverben
Sie dienen dazu, die Zeit- und Aussageverhältnisse der anderen Verben auszudrücken.
3.2.2.a) Die Hilfsverben der Zeit
Diese sind: sein, haben und werden. Mit ihrer Hilfe bilden wir die verschiedenen zusammengesetzten Zeitformen: ich habe geduscht, du bist gekommen, wir werden sehen.
3.2.2.b) Die Hilfsverben der Aussageweise
Diese sind: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, lassen. Sie können selbstständig und als Hilfsverb auftreten: Er möchte ein neues Fahrrad. – Ich möchte gern mitfahren. – Das hatte er nicht gewollt. – Er wollte nicht kommen.
Ähnlich werden verwendet: hören, sehen, helfen, lehren, brauchen, machen, heißen: ich hörte dich nicht kommen, ich sah ihn fallen, er half mir aufstehen, lehre mich schweigen, er hieß mich gehen.
3.3 Die Konjugation (Abwandlung)
3.3.1 Person und Zahl
Singular
Plural
1. Person: ich frage
1. Person: wir fragen
2. Person: du fragst/frägst
2. Person: ihr fragt
3. Person: er, sie, es fragt/frägt
3. Person: sie fragen
3.3.2 Zeitformen (Tempora)
Gegenwart
Gegenwart (Präsens)
Vollendete G. (Perfekt)
1. Person: ich frage
1. Person: ich habe gefragt
2. Person: du fragst
2. Person: du hast gefragt
3. Person: er, sie, es fragt
3. Person: er, sie, es hat gefragt
1. Person: wir fragen
1. Person: wir haben gefragt
2. Person: ihr fragt
2. Person: ihr habt gefragt
3. Person: sie fragen
3. Person: sie haben gefragt
Vergangenheit
Vergangenheit (Imperfekt, Präteritum)
Vollendete V. (Plusquamperfekt)
1. Person: ich fragte
1. Person: ich hatte gefragt
2. Person: du fragtest
2. Person: du hattest gefragt
3. Person: er, sie, es fragte
3. Person: er, sie, es hatte gefragt
1. Person: wir fragten
1. Person: wir hatten gefragt
2. Person: ihr fragtet
2. Person: ihr hattet gefragt
3. Person: sie fragten
3. Person: sie hatten gefragt
Zukunft
Zukunft (Futur)
Vollendete Z. (Futurum exactum)
1. Person: ich werde fragen
1. Person:ich werde gefragt haben
2. Person: du wirst fragen
2. Person:du wirst gefragt haben
3. Person: er, sie, es wird fragen
3. Person:er, sie, es wird gefragt haben
1. Person: wir werden fragen
1. Person:wir werden gefragt haben
2. Person: ihr werdet fragen
2. Person:ihr werdet gefragt haben
3. Person: sie werden fragen
3. Person:sie werden gefragt haben
3.3.3 Zeitfolge (Consecutio temporum)
Wir können ein und denselben Vorgang in der Gegenwart (Präsens) und in der Vergangenheit (Präteritum) ausdrücken. Treten dann die Zeitformen der Vollendung hinzu, also Perfekt und Plusquamperfekt, so gehören die folgenden unbedingt zusammen:
Präsens und Perfekt
Beispiele:
Ich verstehe sie besser (Präsens), nachdem ich ihren Brief gelesen habe (Perfekt).
Er ist schuldenfrei (Präsens), weil er das Geld zurückgezahlt hat (Perfekt).
Präteritum (Imperfekt) und Plusquamperfekt
Beispiele:
Ich verstand sie besser (Präteritum), nachdem ich ihren Brief gelesen hatte (Plusquamperfekt).
Er war schuldenfrei (Präteritum), weil er das Geld zurückgezahlt hatte (Plusquamperfekt).
Eine Ausnahme ergibt sich dann, wenn während der Erzählung im Präteritum die Handlung in besonderer Weise spannend gemacht oder dem Leser nahegebracht werden soll. Dann kann auch der folgende Wechsel auftreten:
Präteritum und Präsens
Beispiel:
Sie war so auf das Öffnen der Schublade konzentriert (Präteritum), dass sie gar nicht bemerkte (Präteritum), wie sich die Tür bewegt (Präsens), ein unförmiger Schatten ins Zimmer gleitet (Präsens) und von hinten auf sie zukommt (Präsens).
3.3.4 Zustandsformen des Verbs (Genera verbi)
Man unterscheidet zwei Verhaltensweisen des Verbs:
die Tatform (Aktiv) und die Leideform (Passiv).
3.3.4.a) Aktiv (Tatform)
Das Aktiv erhielt seinen Namen von jenen Sätzen, bei welchen die handelnde Person grammatikalisch tätig ist, also auch in Fällen körperlicher Untätigkeit, wo die Aktivität äußerlich fehlt:
Die Katze schläft, er leidet große Not, sie weint, er liegt da wie tot, er träumt von fernen Ländern.
3.3.4.b) Passiv (Leideform)
Im Passiv wird das Wesen oder Ding, mit dem etwas geschieht oder gemacht wird, zur Hauptsache:
Er wird bestraft, sie wird geehrt, wir werden gerufen.
Das Passiv kann in alle sechs Zeitformen versetzt werden. Da aber das Aktiv beim Erzählen lebendiger und kraftvoller wirkt, sollte das Passiv nur dort Anwendung finden, wo die erleidende Person im Mittelpunkt steht. Ebenso tritt es auf, wenn der Handelnde unbekannt ist: Gestern wurde bei uns eingebrochen. An Weihnachten wird wieder toll gefeiert.
3.3.5 Aussageweisen (Modi)
Bei den Aussageweisen handelt es sich um drei verschiedene Arten, wie das Verb auftreten kann:
► die Wirklichkeitsform (Indikativ),
► die Möglichkeitsform (Konjunktiv) und
► die Befehlsform (Imperativ).
3.3.5.a) Die Wirklichkeitsform (Indikativ)
Mit diesem Modus machen wir Aussagen über die Wirklichkeit. Der Sprecher oder Schreiber hält den geäußerten oder beschriebenen Sachverhalt für tatsächlich gegeben, zumindest für glaubwürdig: Alle bisherigen Satzbeispiele in unserer Grammatik standen in dieser Wirklichkeitsform.
3.3.5.b) Die Möglichkeitsform (Konjunktiv)
Dieser Modus wird angewandt bei Dingen, die nur möglich, wahrscheinlich, ausgedacht sind oder erzählt werden, also bei allem, wo die Gewissheit einer Aussage mehr oder weniger eingeschränkt ist. Wir unterscheiden Konjunktiv I und Konjunktiv II.
► Konjunktiv I
Der Konjunktiv I wird eingesetzt bei:Wünschen, Segenssprüchen, Flüchen, Aufforderungen und Anweisungen.
Beispiele:
Der Herr behüte dich … Es sei genug … Man nehme dreimal täglich eine Tablette … Er sagt, er komme gern … Ich hörte, er mache sich nichts aus solchen Feiern …
► Konjunktiv II
Der Konjunktiv II wird eingesetzt bei:Vorgestelltem, Ausgedachtem und Irrealem
Beispiele:Hätte er doch auf mich gehört … Das würde ich an deiner Stelle auch tun … Wäre er doch wie du … Ließe sie mich doch fahren … Könnte ich nur zu dir kommen…
– Höflichkeitsformeln
Beispiele:Wir würden uns freuen, wenn Sie zu uns kämen … Ich hätte gern Herrn S. persönlich gesprochen … Wären Sie so freundlich und … Hätten Sie die Güte und … Könnten Sie das Herrn M. bitte ausrichten …
– Irrealen Vergleichssätzen
Sie tat so, als ob sie taub wäre … Er versuchte den Eindruck zu erwecken, als wenn er dazu imstande wäre … Er benahm sich, als ob er alle Zeit der Welt hätte …
– Wenn-Sätzen, die unerfüllbar sind
Wenn ich Geld hätte, flöge ich in die Karibik …Das ließe ich nicht zu (wenn ich an deiner Stelle wäre) …Wenn ich du wäre …
– Einige Formen im Vergleich:
Indikativ Präsens
Konjunktiv I
I. Präteritum
Konjunktiv II
du kommst
du kommest
du kamst
du kämst
er geht
er gehe
er ging
er ginge
sie fällt
sie falle
sie fiel
sie fiele
ich bin
ich sei
ich war
ich wäre
du liegst
du liegest
du lagst
du lägest
es greift
es greife
es griff
es griffe
er kann
er könne
er konnte
er könnte
sie fehlt
sie fehle
sie fehlte
sie fehlte
sie zieht
sie ziehe
sie zog
sie zöge
Merke: „würde“ wird nur dann eingesetzt, wenn beim Konjunktiv Verwechslungen mit einer gleich klingenden Indikativ-Form auftreten könnten.
Mit den verschiedenen Konjunktiv-Formen lassen sich auch zeitähnliche Verhältnisse ausdrücken,
► Gegenwärtiges: Er bliebe gern.
► Vergangenes: Sie hätte mich nicht wiedererkannt.
► Zukünftiges: Er würde mich nicht wiedererkennen.
Merke: Bei indirekter Rede wird immer Konjunktiv I verwendet! Gibt es jedoch Verwechslungsmöglichkeiten mit Indikativ Präsens, so setzt man Konjunktiv II ein!
3.3.5.c) Befehlsform (Imperativ)
Der Imperativ drückt einen Befehl, eine Bitte oder eine Aufforderung aus:
Lies! Lest! Hilf! Helft! Stirb! Sterbt! Gib! Gebt! Iss! Esst! Handelt! Verzieht euch!
Übersicht über die Aussageweisen (Modi)
Wirklichkeitsform
Indikativ
6 Zeiten
Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I + II
Zustandsformen
Aktiv und Passiv
Möglichkeitsform
Konjunktiv
I und II
Befehlsform
Imperativ
3.3.6 Formen ohne Personalendung (Infinitivformen)
3.3.6.a) Nennform (Infinitiv):
gehen, essen, schlafen usw.
► Sie kann nach folgenden Verben stehen: wollen, dürfen, müssen, bleiben, gehen, helfen, lernen.Beispiele: er hieß mich schreiben, ich hörte sie kommen, er lehrte mich schweigen, wir sahen sie gehen.
► Sie kann als Nomen auftreten: Mir fällt das Atmen schwer. Beispiele: Lass das Schreien! Das Weinen hilft dir jetzt auch nicht mehr.
► Sie tritt mit „zu“ als erweiterter Infinitiv auf: Er scheute sich, ihm die volle Wahrheit zu sagen.Beispiele: Er erwog zu gehen. Er räumte ein zu übertreiben.
3.3.6.b) Mittelwort (Partizip)
► Das Mittelwort der Gegenwart (Partizip Präsens) wird auf dreierlei Art angewandt:
- adjektivischder singende Vogel, das lallende Kind, die kriechende Schnecke
- als Nomen undder Singende, der Lallende, die Kriechende
- adverbialer sitzt lesend im Zimmer, sie stand träumend da, wir saßen zitternd im Keller
► Das Mittelwort der Vergangenheit (Partizip Perfekt)wird auf zweierlei Art angewandt:
- adjektivischder geröstete Kaffee, das gestrandete Schiff, der verlorene Krieg
und
- als Nomen: der Genannte, das Geschrieben, der Verletzte
3.3.7 Konjugationsarten
(Siehe Seite 10!)
3.3.8 Zusammengesetzte Zeitwörter (Komposita)
Sie gliedern sich in drei Gruppen:
► echte Komposita,
► unechte Komposita und
► Komposita mit wechselnder Bedeutung.
Echte Komposita
Viele Verben können sich mit Silben oder Wörtern verbinden und erhalten dabei eine andere Bedeutung:
be-kommen, ver-kommen, unter-kommen, über-kommen, entkommen, vorwärts-kommen.
Das funktioniert auch mit setzen, folgen, stehen, fallen, gehen, fahren, legen, brauchen.
Die echten Komposita behalten beim Konjugieren die Vorsilbe vorn. Bei den unechten (siehe nächstes Kapitel!) rutscht sie nach hinten. Verb und Vorsilbe existieren da nur im Infinitiv.
Unechte Komposita
Hier werden beim Konjugieren Verb und Vorsilbe getrennt:
unterkommen → ich komme unter
stehenbleiben → ich bleibe stehen
anhängen → es hängt an
vorstellen → wir stellen vor
Komposita mit wechselnder Bedeutung
durchbrechen → er bricht durch → er durchbricht
umstellen → sie stellen um → sie umstellen
übersetzen → ich setze über → ich übersetze
so auch bei: durch-suchen, -streichen, -stehen, -setzen, -schneiden, -dringen
oder bei: um-fahren, -ziehen, -gehen, -kleiden, -pflanzen, -schreiben, -springen
oder: über-gehen, -ziehen, -werfen, -treten, -laufen oder: unter-schlagen, -stellen
4. Der Artikel
Die Artikel kennzeichnen am Hauptwort, ob es grammatikalisch männlich, weiblich oder sächlich ist.
„Grammatikalisch“, weil dies nicht unbedingt mit dem wirklichen Geschlecht der Wesen oder Sachen übereinstimmt. So sagen wir z. B. das Mädchen und das Weib, obwohl diese wohl kaum sächlich sind; oder der Hammer und die Axt, die nun eindeutig zu den Sachen gehören. Wie auch immer, der Artikel kann nur mit dem Hauptwort zusammen bestehen.
Bestimmte Artikel sind:
der die das
Unbestimmte Artikel sind:
ein eine ein
5. Die Zahlwörter (Numeralia)
Die Zahlwörter bezeichnen das Hauptwort näher. Sie geben ihre Anzahl oder Menge an.
Das haben sie zwar mit den Eigenschaftswörtern gemeinsam, doch die stärkere Beziehung der Zahlwörter besteht zu dem Artikel, und nicht von ungefähr ist eines der Zahlwörter identisch mit dem unbestimmten Artikel: Bei dem Satz Mike hat ein Haus können wir nur noch aus dem Zusammenhang oder, gesprochen, aus der Betonung erkennen, ob dieses ein zur einen oder zur anderen Wortart gehört:
Mike hat ein Haus bedeutet, dass er neben anderen Dingen auch ein Haus hat.
Mike hat ein Haus bedeutet, dass er nicht mehrere, sondern nur eines hat.
Die Zahlwörter können in zweierlei Form auftreten:
Als Grundzahlwörter (Kardinalia) finden wir eins, zwei, drei Dazu zählen auch:
- Wiederholungszahlen: einmal, zweimal, dreimal usw.
- Vervielfältigungszahlen: dreifach, vierfach, fünffach usw.
- Verteilungszahlen: je zwei, je drei, je vier usw. und
- Gattungszahlen: dreierlei, viererlei, fünferlei usw.
Als Ordnungszahlwörter (Ordinalia) finden wir (der, die, das) erste, zweite, dritte; erstens, zweitens, drittens usw.
Dazu zählen auch:
- Bruchzahlen: ein Viertel, Fünftel, Sechstel usw. und
- Einteilungszahlen: erstens, zweitens, drittens usw.
6. Die Empfindungswörter (Interjektionen)
Entsprechend den Eigenschaftswörtern, die wir fühlend wahrnehmen, wirken auch die Empfindungswörter (Interjektionen) und die Umstandswörter (Adverbien) auf unser Empfinden.
Die Herkunft der Empfindungswörter ergibt sich teils aus ihrem Namen, teils aus der Tatsache, dass sie gar nicht der Wortbildung bedürfen, sondern einem Empfinden oder Gefühl durch einen einzigen Laut Ausdruck geben können. Das mögen Babylaute, schlichte Ausrufe oder die gesamte Palette an Lauten oder Geräuschen sein, die in der Natur, bei den Elementen, bei Baum und Tier, ja sogar bei Maschinen oder Handwerksgerät entstehen. Herkömmliche Beispiele sind: ach! oh! hallo! peng! grrr! zack! he! doch würden auch schon Laute wie iii! ui! ei! genügen. Vom Satz werden sie entweder durch ein Ausrufezeichen oder Komma getrennt. Ihre Schreibweise, ist ziemlich frei.
Tschüss, bis morgen! Klirr, die Scheibe zersplitterte. Pfui! Wie hässlich!
Wir kennen Geräuschen wie z. B.: patsch! paff! plumps! quietsch! rumpel! pfff! knall! bumm! rums! zisch! usw.
und Tierlaute: miau! wau! iaa! piep! kläff! schnurr! kikeriki! kuckuck! quiek! grunz! usw.
ERGEBNIS: Interjektionen sind entweder Äußerungen einer Empfindung oder äußere Schall-Nachahmungen.
Die Empfindungswörter sind, was ihre Schreibweise angeht, relativ frei zu handhaben; auch der Entdeckung oder Erfindung neuer Wörter sind hier noch keine Grenzen gesetzt. Jeder spontane Ausruf oder Schmerzlaut ist ein Empfindungswort.
7. Die Umstandswörter (Adverbien)
Das Wesen der Umstandswörter (Adverbien) erschließt sich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie beim Tuwort (Verb) eine ähnliche Funktion erfüllen wie das Eigenschaftswort beim Hauptwort:
Sie beschreiben es näher; sie sind gewissermaßen die „Eigenschaftswörter der Verben“. Ferner Beschreiben sie alle Umstände, unter denen etwas geschieht; daher treten sie auch in vierfacher Gestalt auf:
7.1 Als Umstandswörter des Ortes (Lokaladverbien) ordnen sie das Geschehen einem bestimmten Ort zu. Erfragt werden sie mit
Wo?
Wohin?
Woher?
hier, da, dort, oben, unten, rechts, links, vorn, hinten, nirgends, fort, draußen usw.
7.2 Als Umstandswörter der Zeit (Temporaladverbien) fügen sie das Geschehen in eine bestimmte Zeit ein. Erfragt werden sie mit
Wann?
Wie lange?
Seit wann?
Wie oft?
jetzt, heute, morgen, gestern, neulich, bald, zuletzt, damals, dann, niemals, abends, inzwischen, demnächst, immer, oft, sofort, seither, manchmal, gelegentlich, selten usw.
7.3 Als Umstandswörter der Art und Weise (Modaladverbien)
beschreiben sie, auf welche Weise etwas geschieht. Erfragt werden sie mit
Wie?
Auf welche Weise?
Wie sehr?
vielleicht, umsonst, genug, genauso, fast, beinahe, ziemlich, mindestens, höchstens, sehr, gern, wohl, überhaupt, wahrscheinlich, hoffentlich, nicht, vergebens, nur usw.
7.4 Als Umstandswörter des Grundes (Kausaladverbien) geben sie den Grund, den Zweck, das Mittel oder die Bedingung an, unter denen etwas geschieht. Erfragt werden sie mit
Warum? Weshalb? (kausal, konsekutiv)
Wodurch? Womit? (instrumental)
Unter welcher Bedingung? (konditional)
Wozu? Wofür? (final)
darum, deshalb, dafür, also, doch, dennoch, sonst, notfalls, mithin, somit, nämlich, hierin, dadurch, folglich usw.
Später wurden aus den vier bestehenden Gruppen einige Adverbien herausgelöst und zu drei eigenen Kategorien gemacht. Sie zeigen allerdings noch deutlich ihre Herkunft:
7.5 Die Relativadverbien