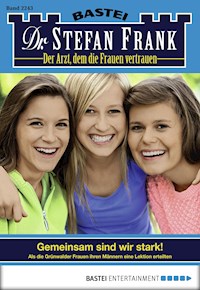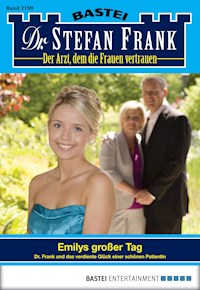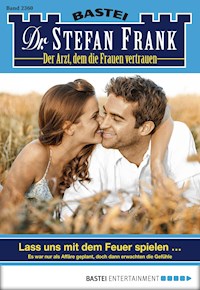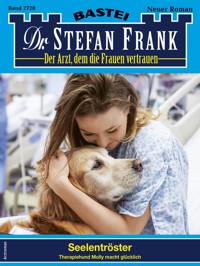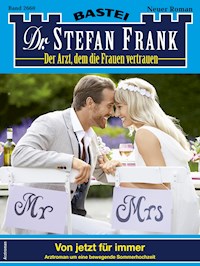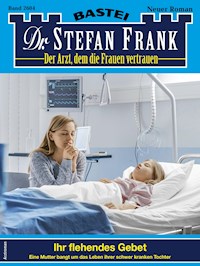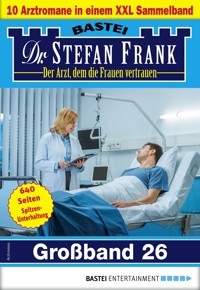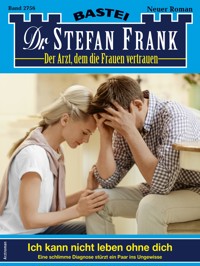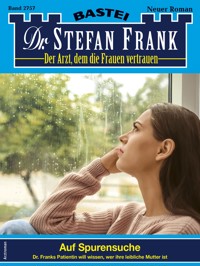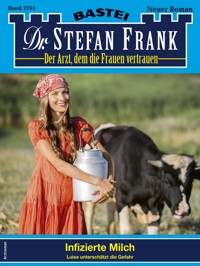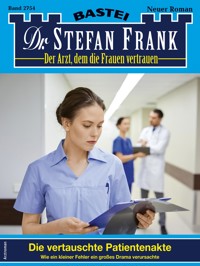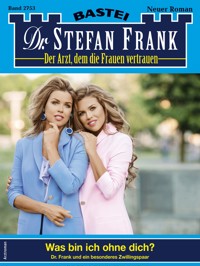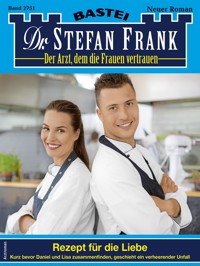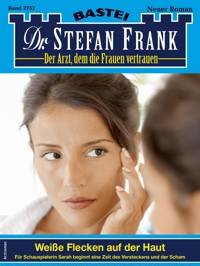2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Stefan Frank Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
3 spannende Arztromane lesen, nur 2 bezahlen!
Dr. Stefan Frank - dieser Name bürgt für Arztromane der Sonderklasse: authentischer Praxis-Alltag, dramatische Operationen, Menschenschicksale um Liebe, Leid und Hoffnung. Dabei ist Dr. Stefan Frank nicht nur praktizierender Arzt und Geburtshelfer, sondern vor allem ein sozial engagierter Mensch. Mit großem Einfühlungsvermögen stellt er die Interessen und Bedürfnisse seiner Patienten stets höher als seine eigenen Wünsche - und das schon seit Jahrzehnten!
Eine eigene TV-Serie, über 2000 veröffentlichte Romane und Taschenbücher in über 11 Sprachen und eine Gesamtauflage von weit über 85 Millionen verkauften Exemplaren sprechen für sich:
Dr. Stefan Frank - Hier sind Sie in guten Händen!
Dieser Sammelband enthält die Folgen 2200 bis 2202:
2200: Vielen Dank, Dr. Frank!
2201: Für dich werde ich mich ändern!
2202: Das Leben ist kein Märchen
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 250 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotiv von © shutterstock: Maria Symchych ISBN 978-3-7325-6873-4Stefan Frank
Dr. Stefan Frank Sammelband 1 - Arztroman
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Vielen Dank, Dr. Frank!
Vorschau
Vielen Dank, Dr. Frank!
Als die kleine Beate im Doktorhaus ihr Lachen wiederfand
Die junge Erzieherin Michaela ist entsetzt! Warum nur kann außer ihr niemand erkennen, was für ein liebenswertes Mädchen die fünfjährige Beate ist? Sicher, hin und wieder hat sie einen Wutausbruch, und es fällt ihr auch nicht leicht, andere Menschen an sich heranzulassen. Aber würde das nicht jedem so gehen, der als Kleinkind seine Eltern verloren hat und der seitdem von einem Waisenhaus ins andere abgeschoben wird?
Michaela weiß, Beate hat ein gutes Herz. Zum Beispiel kümmert das Mädchen sich rührend um den dreijährigen Paul, der ebenfalls ganz allein auf der Welt ist. Doch der Leiter des Kinderheims sieht das ganz anders: Beate soll umziehen, er kann ein schwieriges Kind wie sie nicht gebrauchen.
Verzweifelt klammern sich Beate und Paul aneinander, und Michaela kann es nicht fassen. Wie bringt ihr Chef es nur übers Herz, diese beiden einsamen Waisen voneinander zu trennen? Wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, wird Beate nie mehr froh …
„Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht!“, schrie das kleine Mädchen mit hochrotem Gesicht. „Ich will nicht, und du kannst mich nicht zwingen!“
Michaela Cordes zwang sich, einige Male tief durchzuatmen.
„Hör auf zu schreien, Beate“, sagte sie dann ruhig. „Ich bin nicht schwerhörig.“
Beate Kristen, fünf Jahre alt, stand leicht vorgebeugt vor ihr, wie ein Boxer, der bereit ist für den nächsten Angriff.
Michaela wusste, dass die Kleine durchaus imstande war, zu treten, zu schlagen und zu beißen – das hatte Beate bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Vorsichtshalber trat sie einen Schritt zurück.
„Hör auf“, wiederholte sie im selben Tonfall wie zuvor. „Deine Zimmerecke sieht aus wie ein Saustall, und du räumst da jetzt auf. Es ist eine Zumutung für die anderen Mädchen, wenn sie ständig über deine Sachen steigen müssen.“
„Ich will nicht!“, wiederholte Beate, aber es klang bereits ein wenig erschöpft. Trotzdem waren ihre kleinen Hände noch immer zu Fäusten geballt, und sie verharrte auch weiterhin in ihrer leicht vorgebeugten Haltung.
„Beate“, sagte Michaela mit ihrer sanftesten Stimme, „ich räume auch nicht gern auf, aber ich mache es, weil es manchmal notwendig ist – vor allem, wenn man mit anderen zusammenwohnt. Man kann nicht nur das tun, was einem gerade passt. Man muss manchmal auch Rücksicht auf andere nehmen.“
Unerwartet richtete Beate sich auf. Ihr Blick war voller Abwehr und Verachtung.
„Ich finde dich blöd“, sagte sie, drehte sich um und marschierte den Flur entlang auf ihr Zimmer zu, das sie sich mit drei anderen Mädchen teilte, von denen keins etwas mit ihr zu tun haben wollte.
Michaela seufzte. Im Grunde genommen gab es nur ein einziges anderes Kind hier im Heim, mit dem sich Beate vertrug: der dreijährige Paul Hemmerling. Er hatte Beate vom ersten Moment an geliebt – und sie ihn. Bei ihm hatte sie eine engelsgleiche Geduld. Sie nahm ihn vor anderen in Schutz, und sie tröstete ihn, wenn er weinte. Noch nie war sie Paul gegenüber ausfallend geworden, sogar ihre gefürchteten Wutausbrüche blieben aus, wenn er in der Nähe war.
„Räumt sie auf?“, fragte eine Stimme hinter Michaela.
Sie drehte sich zu ihrer Kollegin Linda Brauer um.
„Ich weiß es nicht.“ Michaela zuckte mit den Schultern. „Sie hat mir mitgeteilt, dass sie mich blöd findet, und ist gegangen.“
„Sie findet dich blöd?“, fragte Linda und lächelte.
Sie war Mitte dreißig, also etliche Jahre älter als Michaela, zudem war sie auch etliche Kilos schwerer.
Michaela trug die blonden Haare sehr kurz und hatte die zarte Figur einer Balletttänzerin. Ihre Augen waren von einem warmen Braun.
Linda hingegen sah mit ihren welligen braunen Haaren und der molligen Figur eher mütterlich aus. Wenn etwas nicht so lief, wie sie es sich vorstellte, konnte sie allerdings sehr energisch werden.
Michaela hatte viel von ihr gelernt, aber sie war nun einmal ein ganz anderer Typ. Sie gab nicht gern Befehle, sondern versuchte lieber, die Kinder zu überzeugen. Doch damit stieß sie, wie sie sehr wohl wusste, gelegentlich an ihre Grenzen.
„Du bist die Einzige“, fuhr Linda fort, „die überhaupt halbwegs mit ihr klarkommt. Ich muss gestehen, dass sie mich wahnsinnig macht, ich bringe einfach die Geduld nicht auf, mit der du dich auf sie einstellst.“
„Sie erinnert mich an mich selbst“, sagte Michaela.
„An dich? Ich weiß ja nicht, wie du mit fünf warst, aber aus heutiger Sicht habt ihr wirklich nichts gemeinsam.“
„Ich war auch jähzornig und konnte sehr unangenehm werden, wenn ich meinen Willen nicht bekommen habe“, gestand Michaela.
„Die Trotzphase haben wir alle durchgemacht, ich auch. Aber deshalb habe ich noch lange nicht das Gefühl, dass ich so war wie dieser kleine Teufelsbraten.“
„Ich mag sie jedenfalls.“ Michaela seufzte. „Obwohl sie mich oft genug zur Verzweiflung bringt.“
„Ich will ja nicht unken, aber ich glaube, ihre Tage in diesem Heim sind gezählt, wenn sich an ihrem Verhalten nicht bald etwas ändert.“
„Wieso glaubst du das?“, fragtet Michaela und sah ihre Kollegin erschrocken an.
Linda sah sich um, aber es war niemand zu sehen, der ihr Gespräch hätte belauschen können.
„Der Chef hat neulich eine Bemerkung in dieser Richtung gemacht“, verriet sie dann. „Er denkt offenbar darüber nach, sie in eine andere Einrichtung zu geben. Er findet, dass sie hier ein Störfaktor ist.“
„Aber sie braucht ein möglichst normales Umfeld, sonst wird sie für immer eine Außenseiterin bleiben.“ Michaela war blass geworden. „Sie hat ihre Eltern verloren, als sie gerade einmal vier Jahre alt war, und die Verwandten wollten sie nicht haben – etwas Schlimmeres kann einem Kind doch nicht passieren! Das Beste wäre natürlich, wir könnten sie endlich in einer Familie unterbringen, die sich liebevoll um sie kümmert. Aber darauf noch weiter zu hoffen, ist ja sinnlos.“
„Das kannst du laut sagen. Wie viele Pflegefamilien sind an ihr schon gescheitert?“
„Drei“, murmelte Michaela.
Daran, dass sich vielleicht sogar Eltern fanden, die bereit waren, Beate zu adoptieren, glaubte sie nicht mehr. Die Kleine schaffte es, sich in entscheidenden Momenten so ungünstig zu präsentieren, dass schon mehrere Interessenten erschrocken abgewunken hatten. Dabei gab es auch die liebenswerte, niedliche, charmante Beate, nur bekam die kaum jemand zu Gesicht.
„Vielleicht wird es besser, wenn sie in die Schule kommt und gefordert wird“, meinte sie hoffnungsvoll. „Sie ist ein kluges Kind.“
„Träum weiter, meine Süße. Sie wird randalieren, bis sie von der Schule fliegt.“
Michaela zog es vor, darauf nichts zu erwidern. Gut möglich, dass Linda recht hatte. Sie warf einen Blick auf die Uhr.
„Ich muss zur Klinik, Lu. Die haben gesagt, ich kann Timmy um fünf wieder abholen, wenn sie sich nicht noch einmal melden.“
„Okay, dann zisch ab.“ Linda zwinkerte ihr zu. „Soll ich in der Zwischenzeit mal nachsehen, ob Beate aufgeräumt hat?“
„Nein, bitte nicht. Lass ihr noch ein bisschen Zeit, sich abzuregen. Im Augenblick ist ja alles ruhig.“
„So lange es dauert“, murmelte Linda mit skeptischem Blick.
Als Michaela das Kinderheim verließ, sah sie, dass der Dienstwagen, den sich alle Mitarbeiter teilten, unterwegs war, und so ging sie zu Fuß. Das Heim lag in München-Schwabing, nicht weit vom Englischen Garten und der Waldner-Klinik entfernt.
Michaela war dort ständiger Gast. Mal hatte sich ein Kind verbrannt, mal war eins gestürzt oder hatte sich geschnitten. Aber natürlich kam es auch vor, dass einer ihrer Schützlinge ernsthaft erkrankte. Erst vor zwei Wochen war der siebenjährigen Clara in letzter Minute ein entzündeter Blinddarm entfernt worden.
„Etwas später“, hatten die Ärzte gesagt, „und er wäre geplatzt. Das kann auch heute noch lebensbedrohlich sein.“
Timmy jedenfalls hatte kochendheißen Tee auf seinen Arm bekommen, der arme Kerl. Zum Glück hatte Dr. Eva Körner, die Leiterin der Unfallambulanz in der Waldner-Klinik, ihr gleich versichert, dass man später nichts mehr davon sehen würde.
Michaela erreichte die Klinik nach wenigen Minuten. Sie ging direkt zur Notaufnahme. Dr. Körner hatte Timmy zur Vorsicht den Tag über da behalten wollen. Sie war gerade auf dem Stationsflur, als Michaela eintrat.
„Da sind Sie ja, Frau Cordes“, sagte sie freundlich.
„Wie geht’s Timmy, Frau Doktor?“
„Der kleine Mann hat sich tapfer gehalten. Wir haben ihm etwas gegen die Schmerzen gegeben, das hat ihn ziemlich müde gemacht, sodass er viel geschlafen hat. Die Wunde haben wir versorgt und verbunden.“
„Prima, haben Sie vielen Dank. Muss ich denn noch irgendwas beachten?“
„Das Wichtigste ist, dass sich nichts entzündet. Duschen oder baden sollte er deshalb im Augenblick besser nicht. Ich gebe Ihnen auch noch Medikamente mit, er wird weinerlich sein wegen der Schmerzen, schätze ich. Übermorgen kommen Sie bitte wieder, da machen wir ihm einen neuen Verband.“
„Laufen kann er aber, oder?“, fragte Michaela. „Ich bin zu Fuß gekommen.“
„Laufen kann er natürlich, aber lassen Sie ihm Zeit. Es kann sein, dass er von den Medikamenten ein wenig benommen ist. Übrigens hat er gerade Besuch. Herr Dr. Frank ist bei ihm und versucht, ihn zum Lachen zu bringen.“
„Das ist ja nett. Ich treffe Herrn Dr. Frank fast immer, wenn ich hier bin. Wenn man bedenkt, dass er in Grünwald praktiziert und wie weit das von Schwabing entfernt ist …“
„Das stimmt schon, aber er hat ja Belegbetten hier, und er findet, dass auch diejenigen seiner Patienten, die bei uns in der Klinik liegen, Anspruch auf einen täglichen Besuch ihres Hausarztes haben. Deshalb kommt er jeden Nachmittag nach seiner Sprechstunde, und deshalb sehen Sie ihn so oft“, erklärte Eva Körner. „Jetzt müssen Sie mich entschuldigen, Frau Cordes, meine Patienten brauchen mich. Sie wissen ja, wo Sie Timmy finden.“
Die Ärztin eilte den Gang hinunter, und Michaela betrat gleich darauf den Behandlungsraum, in dem Timmy lag. Der Kleine war blass, aber er sah ganz zufrieden aus, was sicherlich an dem Mann lag, der an seinem Bett saß und seine Hand hielt: Es war, wie Eva Körner gesagt hatte, Dr. Stefan Frank.
„Gerade haben wir von Ihnen gesprochen, Frau Cordes“, sagte er mit seinem sympathischen Lächeln, bei dem sich um seine Augen herum ein Kranz von feinen Fältchen bildete. „Timmy hatte ein bisschen Angst, dass Sie ihn vielleicht vergessen haben.“
„Timmy!“, sagte Michaela vorwurfsvoll. „Wie kommst du denn auf so eine dumme Idee?“
„Ich wollte heute Nacht nicht allein hier sein“, antwortete der Junge.
„Natürlich nicht. Frau Dr. Körner hat mir gesagt, dass du vielleicht ein wenig benommen von den Medikamenten bist, aber sie meinte, dass du laufen kannst. Ich bin nämlich zu Fuß gekommen, das Auto war nicht da.“
„Natürlich kann Timmy laufen“, erklärte Dr. Frank. „Das wäre ja gelacht, oder, Timmy? Schließlich ist dein Arm verletzt, nicht dein Bein.“
Es erwies sich dann aber, dass der Junge ziemlich unsicher auf den Beinen war, doch nachdem Michaela einige Male mit ihm das Zimmer durchquert hatte, ging es besser.
„Wir haben ja Zeit“, sagte sie. „Wir gehen langsam zurück, dann klappt das schon.“
„Ich könnte Sie fahren“, bot Stefan Frank an. „Das kostet mich zehn Minuten, nicht mehr. Kommen Sie, Timmy ist wirklich nicht fit.“
Und so wurden sie von Dr. Stefan Frank zurück zum Heim gefahren, was Timmy den Neid der anderen Kinder bescherte. Bei all der Aufmerksamkeit vergaß er seine Schmerzen fast.
Natürlich musste er den anderen Kindern ausführlich von seinem Tag in der Notaufnahme erzählen. Das machte er sehr gut, wenn man bedachte, dass er nicht allzu viel davon mitbekommen haben konnte. Aber er hatte schon immer eine rege Fantasie gehabt, und die half ihm jetzt, den Tag so auszuschmücken, dass es sich anhörte, als sei er überaus interessant gewesen.
Michaela warf unterdessen einen Blick in Beates Zimmer. Immerhin hatte sie angefangen aufzuräumen.
***
„Du bist spät dran heute“, stellte Dr. Ulrich Waldner fest, als sein Freund Stefan Frank an der Tür des Chefbüros auftauchte.
Ulrich Waldner war Chirurg, und er leitete die Waldner-Klinik. Seine Frau Ruth arbeitete ebenfalls in der Klinik, als Anästhesistin. Am liebsten stand er mit ihr zusammen im Operationssaal. Freilich operierte er seltener als früher, die Leitung der Klinik ließ ihm nicht mehr viel Zeit.
Mit Stefan Frank war er schon seit Studientagen befreundet, und auch ihre Zusammenarbeit dauerte nun schon lange. Sie vertrauten einander blind, und gemeinsam hatten sie schon so manche heikle Situation bewältigt.
„Ja, bin ich“, erwiderte Stefan, als er sich in einen von Ulrichs Besuchersesseln fallen ließ. „Ich bin heute zuerst in der Unfallambulanz vorbeigegangen, weil ich wusste, dass Eva Körner Dienst hat, und ich sie begrüßen wollte. Sie hat mir erzählt, dass wieder ein Kind aus dem Heim bei ihr war, und der Kleine sah so jämmerlich aus, dass ich mich erst einmal zu ihm gesetzt habe. Kinder, die Schmerzen haben und sich außerdem noch einsam fühlen, brechen mir einfach das Herz.“
„Du hast ihn also aufgeheitert?“
„Ich denke doch, ja. Er wollte meine Hand gar nicht mehr loslassen. Und er hatte Angst, dass die aus dem Heim ihn vergessen. Die Vorstellung, die Nacht hier in der Klinik zu verbringen, ohne einen vertrauten Menschen in der Nähe, hat ihn schlichtweg in Panik versetzt.“
„Wie alt?“
„Sieben. Da gibt man schon nicht mehr so gerne zu, dass man Angst hat. Aber du hättest sehen sollen, wie er gestrahlt hat, als Frau Cordes aufgetaucht ist, um ihn abzuholen. Na ja, ich habe die beiden dann zum Heim gefahren, der Junge war noch benommen von den Medikamenten.“
„Alexa wird nicht begeistert sein, wenn du so spät kommst.“
„Wir sehen uns heute gar nicht, sie hat sich mit einer Kollegin verabredet.“
Stefan Frank lächelte versonnen bei diesen Worten. Nach dem tragischen Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin Solveig Abel war er lange allein geblieben. Er hatte selbst nicht geglaubt, dass er sich noch einmal verlieben würde, aber dann war es doch passiert: Die Augenärztin Alexandra Schubert war in sein Leben gewirbelt und hatte es tüchtig durcheinandergebracht. Sie war um etwas jünger als er, Anfang vierzig, mit ihren hellbraunen Locken und den schönen dunklen Augen ausgesprochen hübsch – und vor allem sehr temperamentvoll.
Sie war als Partnerin in die Praxis einer älteren Kollegin in Grünwald eingestiegen und wohnte nur wenige Minuten von Stefans Haus in der Gartenstraße entfernt in einer schönen, hellen und gemütlichen Wohnung. Sie sahen sich, so oft es ging, die Wochenenden verbrachten sie fast immer zusammen.
„Wieso bleibst du dann nicht zum Abendessen? Ruth würde sich freuen, sie ist schon oben.“
Die Waldners bewohnten das Penthaus über der Klinik, sie hatten also den denkbar kürzesten Weg zur Arbeit: Sie mussten nur mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Ihre Wohnung war großzügig, dazu gehörte eine im Sommer gern genutzte Dachterrasse, außerdem hatte sie einen unverbaubaren Blick auf den Englischen Garten.
„Heute nicht, Uli“, erwiderte Stefan. „Danke für die Einladung, aber bei mir zu Hause ist einiges liegen geblieben, darum muss ich mich heute Abend kümmern. Und eigentlich wollte ich um diese Zeit längst wieder in Grünwald sein.“
„Also trinkst du nicht einmal einen Kaffee mit mir?“
„Nein, aber du darfst mir noch ein Wasser anbieten, danach mache ich mich auf den Weg.“
„Wir sollten uns aber bald wieder einmal zu viert treffen.“
„Das hat Alexa auch schon gesagt. Vielleicht am Wochenende, wenn nichts dazwischenkommt.“ Stefan trank das Wasser, das Ulrich ihm gereicht hatte, und stand auf. „Wir sehen uns morgen, Uli.“
Ulrich begleitete ihn zur Tür, wo sie sich mit einer Umarmung voneinander verabschiedeten.
***
„Wieso machst du so einen Mist?“, fragte Benjamin Weber den Vierzehnjährigen, der mit verstocktem Gesicht vor ihm saß. „Willst du unbedingt in den Knast zu deinen Brüdern?“ Er war so wütend, dass er den Jungen am liebsten am Kragen gepackt und geschüttelt hätte.
Mirko Krawitz war einer seiner Schützlinge. Obwohl er schon als Zwölfjähriger bei seinem ersten Autoklau ertappt worden war, hatte Benjamin gehofft, Mirko werde sein Leben noch auf die Reihe kriegen. Zum Glück war man mit zwölf ja noch nicht strafmündig, aber jetzt war Mirko vierzehn, da sah die Sache anders aus.
Und nun also das: Überfall auf einen Kiosk, gemeinsam mit seinem besten Freund Lukas Ernst. Auch Lukas war einer von Benjamins Schützlingen und – wenn das überhaupt möglich war – noch gefährdeter als Mirko. Es war zum Haareausraufen!
Benjamin war Sozialarbeiter, und er kannte Mirko seit einem halben Jahr. Schwierige Familienverhältnisse – der Vater hatte die Familie schon vor Jahren verlassen, die Mutter war mit den fünf Kindern vollkommen überfordert –, wenig Geld, zu enge Wohnung, keine Aussicht auf Besserung. Die beiden älteren Brüder saßen gerade Gefängnisstrafen ab, eine jüngere Schwester war weggelaufen und gerade erst wieder aufgefunden worden.
Mirko war auf dem besten Wege gewesen, seinen beiden älteren Brüdern zu folgen. Doch dann hatte er Benjamin kennengelernt, der versucht hatte, ihm klarzumachen, dass eine Karriere als Kleinkrimineller kein lohnendes Ziel war.
Mirkos Zwillingsschwester Alina war dafür das beste Beispiel: Sie hatte sich vorgenommen, Friseurin zu werden, und es war ihr gelungen, auf Anhieb eine Lehrstelle zu finden. Aber wie es jetzt aussah, war Mirko von dieser Zielstrebigkeit noch weit entfernt.
„Lass mich in Ruhe, Mann“, nuschelte Mirko.
„Ich lasse dich nicht in Ruhe. Ich will wissen, warum ihr das gemacht habt. Ich dachte, wenigstens du hättest begriffen, worum es geht.“
Mirko hob den Kopf und sah Benjamin endlich an.
„Um mein Leben, richtig?“
„Richtig.“
„Also lass mich mein Leben leben, und misch dich nicht ein. Mein Leben ist mein Leben. Ich kümmer mich ja auch nicht um deins, Alter.“
„Es ist mein Job, mich um dich zu kümmern“, stellte Benjamin fest. „Außerdem will ich nicht, dass du im Knast landest, und ich dachte eigentlich, du willst das auch nicht. Also sag mir bitte, warum ihr den Kiosk überfallen habt. Und dann auch noch ausgerechnet den Kiosk der Niebergs!“
Einen Moment lang so es so aus, als bekäme er noch einmal eine abweisende Antwort, doch Mirko überlegte es sich anders.
„Wegen der Kohle“, sagte er unwillig.
„Wegen der Kohle“, wiederholte Benjamin geduldig, obwohl er kurz vorm Platzen war. „Und was wolltet ihr damit, wenn ich fragen darf? Herr Nieberg ist kein reicher Mann, er hatte zweihundertundelf Euro in seiner Kasse. Für so eine Summe riskierst du es, in den Knast zu gehen?“
„Wir dachten ja, er hätte mehr“, erklärte Mirko widerstrebend.
Er war ein magerer Junge, der nicht stillsitzen konnte. Ständig waren seine Glieder in Bewegung, auch seine Augen flitzten hin und her, als könnte ihm, wenn er den Blick ruhig auf etwas richtete, etwas Wichtiges entgehen. Die dunklen Haare hatte er sich millimeterkurz abrasiert, und in seinem linken Ohr trug er einen billigen Ring.
„Was wolltet ihr damit?“, wiederholte Benjamin seine Frage.
Mirko grub die Zähne in seine Unterlippe. Plötzlich sah er so unglücklich aus, dass Benjamins Zorn verflog.
Was wusste er denn schon darüber, wie es in Mirko aussah? Konnte er sich überhaupt vorstellen, wie es war, ohne Eltern aufzuwachsen, die sich liebevoll und fürsorglich um ihre Kinder kümmerten? Was wusste er schon von einem Leben, in dem es ständig am Nötigsten fehlte? Von einem Leben, das sich in einer schäbigen, heruntergekommenen Wohnung in einem gesichtslosen Wohnblock abspielte, in dem das Treppenhaus stank und die Fahrstühle ständig defekt waren?
Er sah das alles, er war entsetzt darüber, aber wie es war, wenn man in ein solches Leben hineingeboren wurde, ohne große Aussicht, jemals herauszukommen, das wusste er nicht.
„Lukas hat ein Problem“, sagte Mirko endlich. „Er hat sich von den falschen Leuten Geld geliehen.“
„Was heißt das: von den falschen Leuten? Von wem?“
Mirko zögerte mit der Antwort.
„Von Wotan“, verriet er schließlich.
Wotan war bekannt im Viertel. Mit seinen fünfundzwanzig Jahren hatte er bereits mehrere Haftstrafen abgesessen. Er war bullig, sein Gesicht verschlagen, und vor allem hatte er keine Skrupel, zuzuschlagen. Seinen richtigen Namen kannte niemand, und warum er sich Wotan nannte, war ebenfalls unbekannt.
Er hatte ein paar Getreue um sich geschart, die bereit waren, seine Anordnungen zu befolgen, ohne sie zu hinterfragen. Wotan und seine Jungs waren weithin gefürchtet. Es ging das Gerücht, dass sie mit Drogen dealten.
„Ausgerechnet!“, stöhnte Benjamin.
„Ja, das habe ich auch gesagt.“
„Wieso leiht sich Lukas überhaupt Geld?“
„Na ja, die haben ihm Pillen gegeben, zum Probieren. Das fand er toll, danach hat er ihnen welche abgekauft“, murmelte Mirko. „Und dann noch mal, und dann konnte er das nicht gleich bezahlen …“
„Er nimmt jetzt auch noch Drogen?“, fragte Benjamin entsetzt. Er war wütend auf Lukas, aber zugleich machte er sich Vorwürfe, dass er nichts gemerkt hatte.
„Nein, er hat wieder aufgehört. Er hat jetzt verstanden, dass das Mist ist, ehrlich. Aber die Kohle musste er trotzdem aufbringen …“
„Wotan hat ihn also unter Druck gesetzt?“
„Ja, klar, die wollen das Geld zurückhaben, aber nicht nur die zweihundert Mäuse, sondern vierhundert, weil er nicht sofort zahlen konnte. Er wusste nicht, was er machen sollte, da haben wir …“
Er brach ab. Benjamin wusste ja Bescheid.
„Mann, Mann“, murmelte Benjamin. „Allein für so viel Blödheit müsste man euch einsperren. Habt ihr wirklich gedacht, ihr kommt damit davon?“
Mirko schluckte, erst jetzt merkte Benjamin, dass der Junge den Tränen nahe war.
„Ich hab das wirklich nur wegen Lukas gemacht“, beteuerte der Vierzehnjährige. „Dem ging dermaßen die Muffe, ich konnte ihn doch nicht hängenlassen. Und wo sollen wir vierhundert Mäuse herkriegen? Glaubst du, die schenkt uns jemand?“
„Du hättest mit mir reden können, statt so einen Mist zu machen.“
„Wollte ich ja, aber Lukas wollte das nicht“, murmelte Mirko. Er hob den Kopf, und zum ersten Mal irrte sein Blick nicht sofort wieder ab, als er Benjamin in die Augen sah. „Tut mir echt leid, Mann.“
„Bitte geht zu Herrn Nieberg, und erklärt ihm das. Der Mann war immer auf eurer Seite, das weißt du. Er hat es einfach nicht glauben wollen, dass ihr ihn bestohlen habt.“
„Ist gut.“ Mirko schluckte. „Was wird denn jetzt?“
„Das weiß ich noch nicht. Lass mich mal die Lage sondieren. Du bist ja leider schon bekannt bei der Polizei, aber ich kann darauf hinweisen, dass du dir jetzt länger nichts hast zuschulden kommen lassen. Lukas ja auch nicht, das ist wenigstens ein kleiner Pluspunkt.“ Benjamin unterbrach sich. „Was sagt denn Alina dazu?“
„Kannst du dir doch denken, oder?“, meinte Mirko und verzog das Gesicht.
„Ja, eigentlich schon. Und deine Mutter?“
„Sie hat angefangen zu weinen“, sagte Mirko. Seine Stimme klang verloren. „Sie denkt, dass ich kriminell werde, wie meine Brüder. Sie hat mich aufgegeben. Dabei …“
„Hast du ihr gesagt, dass du Lukas helfen wolltest?“
„Nein.“ Mirko schüttelte den Kopf. „Sie hätte mir sowieso nicht geglaubt.“
„Ich rede mit ihr“, sagte Benjamin. „Versprich mir, dass du dich das nächste Mal, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, zuerst an mich wendest.“
Mirko sah weiter vor sich hin, er antwortete nicht.
„Hey!“, sagte Benjamin. „Mach schon.“
„Ich versprech’s“, murmelte Mirko.
„Sieh mich bitte an dabei, damit ich sehe, ob es dir ernst ist.“
Mirko sah auf.
„Es ist mir ernst“, versicherte er. „Ehrlich, Ben.“
„Okay, dann gehe ich jetzt.“
„Ben?“
„Ja?“
„Wenn ich da heil rauskomme …“ Mirko nagte wieder an seiner Unterlippe. „Glaubst du, ich könnte es noch auf die Realschule schaffen?“
„Willst du das denn?“, fragte Benjamin überrascht. „Bisher hast du immer gesagt, du willst so schnell wie möglich von der Schule abgehen.“
„Mit einem Realschulabschluss hat man bessere Möglichkeiten.“
„Das ist doch meine Rede, seit wir uns kennen! Und jetzt auf einmal …“
„Ja“, sagte Mirko. „Also, sag schon.“
„Deine Noten sind nicht gerade berauschend, wenn ich dich daran erinnern darf.“
„Ich habe ja noch Zeit, sie zu verbessern.“
„Nicht mehr viel. Am besten fängst du gleich damit an. Vielleicht kannst du es dann schaffen.“
Mirko nickte.
„Danke“, sagte er mit leiser Stimme, als Benjamin ging.
***
„Nicht weinen, Paulchen“, sagte Beate leise.
Der kleine Paul lehnte sich an sie, und sie schlang beide Arme um ihn. Noch immer kullerten dicke Tränen über seine runden Wangen, aber seine Schluchzer wurden leiser.
Alex, der älter war als Paul und fast zwei Köpfe größer, hatte ihn nach dem Essen geschubst. Der Kleine war hingefallen und hatte sich wehgetan.
Beate hatte dafür gesorgt, dass Alex seine Tat bitter bereute, indem sie ihn heftig geboxt hatte. Das hatte für einen richtigen Tumult im Speisesaal gesorgt.
Jetzt tröstete sie Paul, der nicht nur weinte, weil er sich wehgetan hatte. Er weinte auch, weil er seine Mama vermisste, die an Krebs gestorben war. Seinen Papa hatte er nicht gekannt, aber seine Mama hatte er sehr lieb gehabt, und er konnte einfach nicht verstehen, warum sie nicht mehr bei ihm war.
Michaela erschien an der Tür.
„Paulchen muss ins Bett“, sagte sie.
Beate sah auf. Eben noch war sie ganz weich und fürsorglich gewesen, jetzt stellte sie schon wieder die Stacheln auf.
„Er ist traurig“, sagte sie. „Er kann noch nicht schlafen.“
Pauls Tränen flossen wieder.
„Ich will hier bleiben“, schluchzte er. „Ich will bei Beate bleiben.“
Die drei Mädchen, mit denen Beate das Zimmer teilte, kamen jetzt ebenfalls herein. Keine von ihnen verstand sich mit Beate, während sie Paul alle gern hatten. Sie sahen Michaela unschlüssig an und wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Maxi, Kim und Tina waren vier, fünf und sechs Jahre alt.
Michaela fällte rasch eine Entscheidung.
„Kommt mit“, sagte sie zu Beate und Paul. „Ihr könnt noch ein bisschen draußen sitzen, bis Paul sich beruhigt hat.“
„Wir wollen aber hier bleiben.“ Beate schob trotzig ihr Kinn vor, und ihre blauen Augen funkelten Michaela angriffslustig an.
„Du vielleicht. Paul möchte seine Ruhe haben und sich von dir trösten lassen, Beate. Also kommt jetzt mit.“
Beate schien abzuwägen, wie ihre Chancen standen, aus dieser Situation als Siegerin hervorzugehen, aber Paul nahm ihr die Entscheidung ab. Er stand auf, nahm ihre Hand und zog sie aus dem Zimmer.
Michaela atmete auf. Bloß kein Geschrei mehr heute Abend!
„Und ihr dürft noch eine halbe Stunde aufbleiben“, sagte sie zu den drei Mädchen. „Ich komme dann wieder.“
„Und Beate?“, fragte die sechsjährige Tina. „Darf die etwa noch länger aufbleiben?“
„Natürlich nicht, Tina.“
„Sie hat immer noch nicht richtig aufgeräumt“, beschwerte sich Kim. „Wir müssen immer aufräumen, aber sie darf alles liegen lassen.“
„Das darf sie nicht, sie hat ja schon angefangen, und den Rest räumt sie morgen auf“, erwiderte Michaela. „Bis nachher.“
Im Spielzimmer hielt Beate den kleinen Paul wieder liebevoll umarmt, er gab keinen Laut mehr von sich, wahrscheinlich schlief er schon halb.
Michaela beschloss, den beiden noch eine Viertelstunde Zeit zu lassen, dann würde sie Paul ins Bett bringen und Beate in ihr Zimmer schicken – falls sie sich schicken ließ.
***
Anton Nieberg saß mit seiner Frau Ellen beim Abendessen. Er war so in sich gekehrt, dass er ihre besorgten Blicke nicht bemerkte, außerdem schien ihm nicht einmal aufzufallen, dass sie ihm sein Lieblingsessen gemacht hatte: Frikadellen mit Bratkartoffeln und Salat.
„Sag mir doch, was los ist, bitte“, bat sie, als ihr die Stille zu drückend wurde. „Es macht mich verrückt, wenn du keinen Ton von dir gibst.“
Er sah fast erschrocken auf.
„Tut mir leid, Elli, ist mir gar nicht aufgefallen“ erklärte er und lächelte verlegen.
„Und dass du Frikadellen isst, hast du auch nicht gemerkt.“
Erstaunt sah er auf seinen Teller, dann legte er seine Gabel ab, um seiner Frau liebevoll die Hand zu drücken.
„Tut mir leid“, wiederholte er.
Er war ein kleiner, rundlicher Mann mit einem ebenfalls runden, gutmütigen Gesicht. Er war eigentlich schon Rentner, doch er hing an seinem Kiosk. Außerdem war seine Rente so schmal, dass jeder Euro, den er hinzuverdiente, ihnen das Leben erleichterte.
Ellen arbeitete halbtags in einer Bäckerei, außerdem half sie an bestimmten Tagen im Kiosk aus, damit ihr Mann auch einmal ein paar freie Stunden hatte. Sie führten ein ruhiges Leben, leisteten sich ab und zu eine kleine Reise und fanden, dass es ihnen gut ging.
„Also?“, fragte sie. „Was ist passiert?“
„Ich gebe den Kiosk auf“, antwortete er.
Jetzt war es Ellen, die die Gabel sinken ließ.
„Wie bitte?“, fragte sie.
Anders als ihr Mann war sie schlank, eine kleine bewegliche Frau mit einem ansteckend fröhlichen Lachen.
„Ja“, bestätigte er, „ich gebe ihn auf.“
„Habe ich da vielleicht auch ein Wörtchen mitzureden?“
„Nein“, antwortete er. „Hast du nicht.“
So sprach er normalerweise nicht mit ihr, also wiederholte sie ihre Frage.
„Was ist passiert?“
„Ich wollte es dir eigentlich nicht erzählen, aber du wirst es ja doch erfahren, wenn du morgen im Kiosk bist.“
„Nun rede schon, Anton!“
Er starrte vor sich auf den Tisch. Es fiel ihm schwer, ihr die Wahrheit zu sagen, so wie es ihm selbst immer noch schwerfiel, an diese Wahrheit zu glauben, obwohl es doch daran keinen Zweifel geben konnte.
„Ich bin überfallen worden“, sagte er schließlich.
Ellen wurde blass. Sie schob ihren Teller von sich, die Frikadellen waren vergessen.
„Im Kiosk?“, fragte sie.
„Ja. Zwei maskierte Jungs haben mich bedroht, sie wollten die Kasse haben. Sie hatten etwas in der Hand, das wie eine Pistole aussah, also habe ich ihnen alles gegeben, was da war. Etwas mehr als zweihundert Euro, die gesamten Tageseinnahmen.“
„Wann war das?“
„Na, vorhin. Das war der eigentliche Grund dafür, dass ich so spät gekommen bin. Ich dachte, ich sollte mich zuerst ein bisschen beruhigen, bevor ich es dir erzähle.“
„Du hättest es mir gleich sagen müssen, Anton.“
„Ja, du hast recht, entschuldige.“
„Hast du die Polizei gerufen?“
„Natürlich, sofort. Sie haben die Jungs auch sofort geschnappt, weil ich sie erkannt hatte.“
Ellens Aufregung steigerte sich.
„Du weißt, wer dich überfallen hat?“, rief sie ungläubig.
„Mirko und Lukas“, antwortete Anton widerstrebend. „Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Angelegenheit. Ich dachte immer, die beiden schaffen es, das sind im Grunde feine Jungs, die es nur etwas schwerer haben, den richtigen Weg zu finden. Außerdem …“
Er brach ab, weil er schlucken musste. Die Sache ging ihm näher, als er wahrhaben wollte.
„Außerdem dachte ich, dass sie mich mögen“, fügte er enttäuscht hinzu. „Nicht direkt, dass wir Freunde sind, aber …“
Erneut unterbrach er sich. Dieses Mal nahm er seine Rede nicht wieder auf.
„Mirko und Lukas“, wiederholte Ellen. „Hast du danach mit ihnen gesprochen?“
„Nein, ich weiß nur, dass sie bei der Polizei zuerst alles abgestritten haben, aber die haben sie getrennt verhört, und ruckzuck hatten sie sich in Widersprüche verwickelt. Außerdem hatte Lukas das Geld bei sich, fast auf den Cent genau die Summe, die in meiner Kasse war. Er ist dann zuerst eingeknickt und hat alles zugegeben, Mirko hat länger geleugnet.“
„Mirko ist der, den du besonders gern hast“, sagte Ellen leise.
„Ja“, bestätigte er und nickte trübsinnig. „Jedenfalls will ich den Kiosk schließen, bevor so etwas noch einmal passiert und du dann vielleicht diejenige bist, die eine Waffe auf sich gerichtet sieht.“
„War es eine echte Waffe?“
„Nein“, gab er zu. „Aber ich schwöre dir, dass das in so einem Moment keine Rolle spielt. Du hast einfach Angst und bist nicht imstande zu erkennen, ob das Ding, in dessen Öffnung du blickst, dich töten kann oder nicht. Ich habe die beiden ja auch nicht sofort erkannt, im ersten Augenblick war ich wie gelähmt.“
Anton schüttelte den Kopf.
„Lass uns nicht mehr darüber diskutieren, Elli“, bat er. „Ich habe für so etwas keine Nerven mehr, und ich will keine Angst um dich haben müssen.“
Langsam begann sie wieder zu essen. Auch Anton schnitt ein kleines Stück von seiner nur noch lauwarmen Frikadelle ab und schob es sich in den Mund.
„In all den Jahren ist nie etwas passiert“, sagte Ellen. „Ich glaube nicht daran, dass es ein richtiger Überfall war.“
„Wie bitte?“, rief er. „Nur weil wir die beiden Täter kennen? Ein Überfall bleibt es trotzdem.“
„Die beiden sind keine Räuber“, stellte sie energisch fest. „Sie müssen einen Grund gehabt haben.“
„Jeder Kriminelle hat Gründe für seine Tat“, brummte er mit zusammengekniffenen Augen. „Wenn es danach ginge …“
Es klingelte an der Tür.
„Erwartest du Besuch?“, fragte Ellen.
„Nein.“ Anton schüttelte den Kopf. „Ich will auch niemanden sehen. Wer immer es ist, bitte schick ihn oder sie weg.“
Sie nickte und stand auf. Er hörte sie die Tür öffnen, daraufhin leise Stimmen. Die Tür wurde wieder geschlossen, aber es waren nicht nur Ellens Schritte, die zur Küche zurückkehrten.
Ärgerlich hob er den Kopf. Hatte er sich nicht deutlich genug ausgedrückt?
Als er dann jedoch sah, wer Ellen folgte, vergaß er seinen Ärger. Mirko und Lukas konnten ihm kaum in die Augen sehen, als sie ihre Entschuldigungen stammelten. Er wechselte einen Blick mit Ellen und sah, dass sie ein Lächeln unterdrückte.
„Setzt euch“, sagte er barsch, „ihr seht ja, wir sind beim Essen. Aber ich will trotzdem hören, warum ihr das getan habt.“
Sie nahmen auf den äußersten Stuhlkanten Platz, und zuerst brachte keiner von ihnen ein Wort heraus. Es war Ellens ruhiger Freundlichkeit zu verdanken, dass sie schließlich doch mit ihrer Geschichte herausrückten.
Beschämt erkannte Anton, dass Ellen mit ihrer Vermutung recht gehabt hatte. Lukas war in Schwierigkeiten geraten – wenn auch durch grandiose Dummheit –, und Mirko hatte ihm helfen wollen und das in falsch verstandener Freundschaft auch getan. Statt mit seinem Sozialarbeiter zu reden, hatte er das getan, was in seiner Familie in solchen Fällen als probates Mittel galt.
Mirko hob den Kopf und sah Anton gerade in die Augen, was er nicht oft tat.
„Es war ein Notfall, Herr Nieberg“, sagte er mit flehendem Unterton. „Bitte, das war nicht gegen Sie gerichtet. Wir haben Ihren Kiosk ausgesucht, weil wir Sie kennen und wussten, Sie würden kein Theater machen, sondern uns alles geben, was in der Kasse ist.“
Diese Begründung dafür, warum die Wahl auf ihn gefallen war, fand Anton so absurd, dass er beinahe gelacht hätte. Aber er verstand schon, was Mirko eigentlich sagen wollte: Auf diese Weise war es gewissermaßen eine Familienangelegenheit geblieben.
„Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ich euch das Geld vielleicht auch so gegeben hätte?“, fragte er.
Jetzt sah ihn auch Lukas an. Beide Jungen schienen sich zu fragen, ob er gerade versuchte, sich über sie lustig zu machen.
„Wieso hätten Sie das tun sollen?“, wollte Lukas wissen.
„Vielleicht, weil ich euch mag?“, fragte Anton.
„Und weil wir nicht wollen, dass ihr solchen Leuten wie diesem Wotan in die Finger fallt“, setzte Ellen hinzu. „Ihr hättet uns einfach fragen können.“
„Aber …“, setzte Lukas an, verstummte jedoch gleich wieder.
Mirko übernahm es, zum Ausdruck zu bringen, was sein Freund und er dachten.
„Aber so gut kennen wir Sie doch gar nicht. Wir können Sie nicht einfach um Geld anhauen.“
„Wir kennen uns gut genug“, stellte Anton fest. „Jeder kann mal in Schwierigkeiten kommen, das passiert nicht nur Jugendlichen. Und wenn das so ist, dann braucht man Freunde. Ihr müsst wissen, wer eure Freunde sind, wenn ihr es schaffen wollt, ein besseres Leben zu führen als jetzt. Und das wollt ihr doch, oder?“
Beide Jungen nickten.
„Na, also“, sagte Anton.
„Wir ziehen die Anzeige zurück“, schlug Ellen vor.
Die Jungen sahen verwirrt aus.
„Geht das denn?“, wollten sie wissen.
Anton strahlte seine Frau an.
„Du bist unbezahlbar, Elli“, rief er. „Ich hätte selbst auf diese Idee kommen müssen. Ich werde sagen, dass das alles ein Irrtum war.“
„Aber wir haben doch schon gestanden“, sagte Mirko.
„Wir werden sagen, dass es ein Scherz war, der etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Lasst mich nur machen, ich regele das schon.“ Anton sah nicht länger niedergeschlagen aus, im Gegenteil. „Aber natürlich nur, wenn ihr mir schwört, dass ihr so etwas nie wieder macht.“
„Sowieso nicht“, sagte Mirko.
Lukas ließ den Kopf hängen.
„Ich auch nicht“, versprach er leise. „Aber ich muss das Geld für Wotan und seine Leute irgendwie aufbringen. Ich … ich habe Angst vor denen.“
„Die Polizei sollte sie verhaften und ins Gefängnis stecken!“, sagte Ellen erbost.
„Ich glaube, sie haben nicht genug Beweise“, murmelte Lukas.
Anton wechselte einen weiteren schnellen Blick mit seiner Frau.
„Du bekommst es von uns“, sagte er. „Und du wirst es bei uns im Kiosk abarbeiten, damit wir ab und zu mal ausschlafen können. Mirko wird dir helfen, denke ich. Samstags habt ihr keine Schule, das wäre also ein idealer Tag.“
„Ist das Ihr Ernst?“, fragte Mirko unsicher.
„Sie wollen mir das Geld geben, wo wir Sie doch überfallen haben?“, fragte Lukas. Er konnte es nicht fassen. „Und Sie wollen uns Ihre Kasse überlassen?“
„Hat jemand hier am Tisch eine bessere Idee?“
Niemand antwortete.
„Na also, Vorschlag einstimmig angenommen“, stellte Anton zufrieden fest.
***
„Diese Geschichte wird uns helfen, Wotan wegen Drogenhandels dranzukriegen“, sagte Kommissar Leo Vielberger, mit dem Benjamin am nächsten Morgen über Mirkos Fall sprach.
„Aber Sie müssen Mirko und Lukas schützen“, sagte Benjamin besorgt. „Vor Wotan haben alle Angst, und sein Arm reicht weit. Der hat seine Leute überall sitzen. Selbst wenn er hinter Gitter kommt: Es gibt immer einen, der auf freiem Fuß ist und Rache nehmen kann. Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich den beiden zu einer Aussage vor Gericht raten würde.“
„Wir werden sehr vorsichtig sein. Ich bin erst einmal froh, wenn wir nicht zwei Jugendliche drankriegen müssen, die vielleicht noch die Chance haben, auf den rechten Weg zurückzufinden. Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie Lukas Ernst seine Schulden bezahlt, vielleicht ergibt sich daraus unser weiteres Vorgehen. Der Überfall auf den Kiosk ist bisher nicht veröffentlicht worden, Wotan weiß also nicht, was wir mittlerweile wissen. Er denkt, er kriegt nur sein Geld …“
„Stattdessen fliegt er auf.“
„So ungefähr, ja. Bisher gab es ja immer nur Gerüchte über Wotans Geschäfte, jetzt haben wir zum ersten Mal eine Aussage, und die hilft uns enorm weiter.“
„Mir liegt viel an den Jungs“, sagte Benjamin. „Ich glaube, sie können es beide schaffen – zumindest habe ich die Hoffnung.“ Benjamin grinste verlegen. „Ich könnte allmählich mal wieder ein Erfolgserlebnis gebrauchen. Man stumpft sonst ab bei all dem Elend, das sich einem jeden Tag bietet.“
„Kenne ich“, sagte der Kommissar. Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. „Da muss ich mal kurz drangehen, einen Augenblick bitte.“