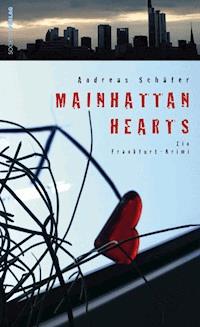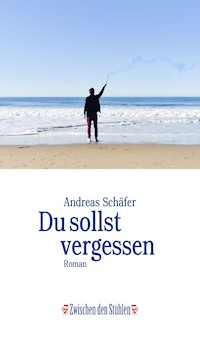
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Professor Udo Vorster stellt die Psychoanalyse auf den Kopf. Er predigt das ›Leben im Augenblick‹ und zieht gegen jede Form der Vergangenheitsbewältigung zu Felde. Der Wissenschaftler wird zum umjubelten Megastar. Er besitzt die seltene Gabe massenwirksam zu beeindrucken. Sein Publikum schenkt ihm nahezu bedingungslos Glauben kraft seiner natürlichen Autorität. Doch was ist von der Lehre des Professors zu halten? Ist er ein Hochstapler oder tatsächlich das begnadete Genie? Wie er die Spannung zwischen seiner Lehre und dem Echo darauf lenkt, gleicht dem Tanz eines Virtuosen auf einem Vulkan. Plötzlich wird Vorster mit einem brisanten Detail seiner Biografie konfrontiert. Seine Bewunderer rücken von ihm ab und allmählich scheint er die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Folgt nun der unaufhaltsame Abstieg oder schafft er ein Comeback?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Schäfer
Du sollst vergessen
Für meine Mutter,
die ich niemals vergessen werde
Andreas Schäfer
DU SOLLST VERGESSEN
Zwischen den Stühlen 6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Dezember 2022
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Titelbild: SnapwireSnaps (Pixabay)
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 310 9
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 796 1
Prolog: Ende statt Eröffnung
Als er bestattet war, trat einer ans Grab, achselzuckend. Vergesst ihn jetzt, sagte er laut genug, um gehört zu werden. Der von euch gegangen ist, hat schon vergessen.
Kapitel 1: Eine Patientin
Gründerbau – Jugendstil … Edit wusste nicht, wie sie die stattliche Villa einzuordnen hatte. Ein pompöser Bau allemal, auf riesigem Grundstück gelegen, geschichtsträchtig, der Boden von vielen dienstbaren Händen gepflegt. Der Professor war eine Kapazität, umstritten zwar, aber eben deswegen ständig in den Schlagzeilen. Jedenfalls schon eine Weile, sodass sie auf ihn aufmerksam geworden war. Ein renommierter Spezialist könnte ihr Sorgen nehmen, die Edits Identität gefährdeten. Ihr Bewusstsein reichte nicht zurück in die schreckliche Zeit, da waren Bruchstücke, Teilchen, die kein Mosaik ergaben.
Edit war gewillt, diesem Professor Vorster zu vertrauen. Das war viel, in ihrem Fall. Bedingungslos vertraute Edit niemandem mehr. Irgendetwas musste geschehen sein, in den frühen, zarten Mädchenjahren.
Die ältliche, vornehm gestylte Vorzimmerdame geleitete Edit in einen winzigen Raum. Großzügiger Ausblick auf ungekannte (märchenhafte?) Pflanzenarten, die zu anderer Jahreszeit farbenfroh aufblühen mochten; ob dahinter ein raffinierter Plan des Landschaftsarchitekten stand? Hatte in diesem herrschaftlichen Anwesen alles eine ihr geheime Funktion, einen Zweck, gerichtet auf die Genesung ihrer kranken Seele, unzugänglich nur der unbedarften, laienhaften Perspektive der Patientin?
Edit beschloss, einstweilen abzuwarten, was geschehen würde.
Noch immer ließ sich der Herr Professor nicht blicken. Edit ahnte, dass sie hier keinem anderen Patienten begegnen würde. Kein Psychoanalytiker, der auf sich hielt, bediente ein Massenpublikum. Diskretion war in den Kreisen dieser Koryphäen unabdingbar; jeder einzelne Patient bildete quasi den Mittelpunkt der (Forscher-) Welt. Professor Vorster galt zwar als Sonderling, der dabei war, seine Branche auf spektakuläre Weise aufzumischen, aber er war doch einer der ihren, Außenseiter innerhalb der Innung sozusagen. Jetzt öffnete sich eine Tür, die Edit gar nicht aufgefallen war. Den Mann, der ihr leicht zunickte, kannte sie nicht.
Keine Vergangenheit belastet die Begegnung. Edit blickt auf zu der Autorität, die sie nicht überragt. Der weitere Raum, der sich ihr nun eröffnet, hat in seiner Großzügigkeit etwas Indifferentes. Einen Augenblick spürt sie die Gefahr, sich darin zu verlieren. Aber der Mann ist ja da, der Mann, der für diesen Raum zu klein geraten ist. Eben deswegen gibt er Edit Halt. Sie wird sich nicht in dem Raum verlieren. Professor Vorster weiß um ihre Angst; die Wahl des Raumes erfolgte nicht zufällig. In seiner Statur wirkt der Professor unscheinbar; sie mag an ihn glauben, weil sie ihm nicht verfallen muss. Sie wird sein Aussehen später nicht mehr erinnern. Wie er das hinkriegt, hat etwas Magisches, das auszudrücken ihr nicht zufällt. Er macht eine einladende Bewegung in Richtung einer Couch, die sie offenbar nicht registriert. Hat Edit überhaupt etwas wahrgenommen in Vorsters Gegenwart?
Edit ist vermögend, was den Zugang erleichterte. Ihr Anliegen wurde bei der Kontaktaufnahme nicht thematisiert, der Professor legt Wert auf größtmögliche Unmittelbarkeit der Begegnung. Während eines Anbahnungstermins im Café Extrasatt befand seine Medienassistentin Edit für würdig, Patientin zu sein. Warum das ohne Erörterung ihres konkreten Falles entschieden wurde, hat Edit eigentlich nicht hinterfragt. Gelungenes Palaver auf einem schichtenspezifisch analogen Niveau könnte den Ausschlag zugunsten der Antragstellerin gegeben haben. Irgendwie fühlte sich Edit unterlegen, nicht weil die andere schöner, aber wohl fünf Jahre jünger wirkte als sie. Sie selbst war also keine Gefahr, sondern eine aparte Erscheinung. Edit wollte den Termin beim Professor und schaffte es dementsprechend, sich keine Blöße zu geben. Eine Frage nach innen fand nicht statt, sodass das Gespräch rhythmisch angenehm blieb. Die Assistentin benötigte keine finanzielle Sondierung, um Edits Glaubwürdigkeit festzustellen. Es fiel beiden Seiten leicht, die Unterhaltung mit Ertrag zu vergessen.
Edit spürt jetzt, im Angesicht Vorsters, eine gewisse Anspannung, die sie nicht belasten darf. Er soll ihr doch helfen, da darf sie nicht an seiner Kapazität, seinem Charisma scheitern. Dieser Mann schenkt ihr seine Aufmerksamkeit wie nebenher. Das Trauma, das sie ihr Leben lang begleitet hat, wird für ihn kaum relevanter Faktor sein. Edit sollte sich nicht in den nachgebenden plüschigen Couchkissen auflösen, während der Professor sie von seinem mächtigen Designersessel aus ignoriert. Die Zeit immerhin, die er seiner Patientin widmet, könnte sie mit Stolz erfüllen. Edit fragt sich, ob er sie überhaupt bereits gefragt hat. Einfach ungefragt losreden, fällt ihr nicht ein. Genau das mag dieser blicklose Hypnotiseur von ihr erwarten. Edit könnte nicht sagen, wie viel Zeit inzwischen verstrichen ist. Je länger das Schweigen währt, desto umfassender erscheint ihr die natürliche Autorität des Professors. Mochte er sie mit rein nonverbalen Mitteln ausleuchten? Edit fühlte ihr Unbewusstes verraten, ohne sich direkt mitgeteilt zu haben. Wenn er ihr am Ende helfen würde, war dies ein erstaunlich unbeschwerter Weg für sie.
Tatsächlich dämmerte es bereits, als Professor Vorster nun ohne Umschweife zur Sache kam. Er habe aus ihrem Verhalten zweifelsfrei schließen können, dass Edit ein Missbrauchsopfer sei. Der Magier nannte sie, konventionelle Gepflogenheiten vernachlässigend, wie selbstverständlich beim Vornamen. In diesem Augenblick hätte Edit dem Mann alles geglaubt. Sie dürfe ihm nun verraten, dass ihr Vater, längst verstorben, bei der Sache mit im Spiel sei, nicht er allein, jedoch vor allem er, weil er ihr Vater war. Die andere Person, an die sie sich fatalerweise erinnere, sei selbst nicht ungeschoren aus der Sache hervorgegangen. Also doch, entfährt es der Patientin, die das alles erlebt zu haben meint. Ich war mir nicht sicher, aber irgendetwas hat mich irritiert.
Papa ist da und David, der Junge, der mir Nachhilfestunden gab und manchmal das Spinett traktierte; Papa wollte nicht, dass er Musik machte, er sollte sich ganz aufs Rechnen verlegen. Ich weiß nicht mehr, wer nackt war, Papa, David, ich selbst? Ich sehe mich, wie ich ums Haus laufe, weinend, nervös, Mama ist nicht da, ich suche sie, aber da sind immer nur Papa und David. Papa lacht, David nicht, ich will beide nicht sehen, aber sie sind immer irgendwie da. Papa zeigt auf David und lacht. Warum lacht er, während David ganz betreten dreinschaut? Papa war sonst gar nicht lustig, immer ernst, verschlossen, arbeitsam, mich hat er nicht beachtet, wenn er Mama von seinen Fällen erzählte. David führte meine Hand, wenn wir Zählen übten, ich mochte ihn, aber es war unangenehm. Warum war Mama nie da, wenn Papa und David da waren? Es sind Fetzen, die ich sehe, im Traum und auch am Tag, aber ich kriege es nicht zusammen, wie es wirklich war …
Wie sollten Sie auch, stellt Vorster erstaunlich nüchtern fest. Vereinfachen, verdrehen, fabulieren – darüber haben sich Hirnforscher und Psychologen schon vor mir ausgelassen, das ist alles nicht neu. Sie haben etwas aufgeschnappt und glauben schließlich, Sie selbst hätten es erlebt. Ihre Erinnerung spielt Ihnen einen Streich, sie gaukelt Ihnen Erlebnisse vor, die Sie in einer Illustrierten gelesen haben, zeigt Ihnen Bilder fremder Menschen, die allmählich die Ihren werden, und Sie haben sie immer schon gekannt.
Papa und David hat es wirklich gegeben, David lebt wahrscheinlich noch.
Darum geht es nicht, sagt Vorster unberührt, und Edit fühlt sich sogleich blamiert. Die Irrtümer unseres Gedächtnisses hat sich die Psychoanalyse seit jeher zunutze gemacht, nicht nur die ansonsten verfeindeten Herren Freud und Jung waren versessen darauf, Methoden quasi wahrhaftigen Erinnerns zu entwerfen. Wenn es dann eher schlecht als recht gelang, dass ein fragwürdiger Proband irgendeine Leerstelle füllte, womit auch immer, war der Schaden gewaltig; was aus dem Schlund des Vergangenen herausgezogen wurde, raubte dem Probanden meist lebenslänglich die Balance. Die Psychoanalyse wurde zu ihrer eigenen Legende, indem vermeintliche Wohltaten der Erinnerungskultur – ich sage: Erinnerungsbarbarei! – konstruiert wurden. Angeblich gewann das Versuchskaninchen nach seiner seelischen Entblößung am Ende Identität und Würde zurück, sogar Glück wurde ihm verheißen, alles eitel Sonnenschein, nachdem man in der Finsternis herumgestochert hatte, Happy End wie im Roman inbegriffen, die eigenen Wunden überwunden, die der anderen zählten nicht.
Edit fand, dass sich der Professor in eine gewisse Rage redete.
Empirische Untersuchungen belegen, dass sich nach der Analyse in Wahrheit kaum jemand wieder in der Welt zurechtfand. Zerbrochene Existenzen reihten sich aneinander, das Leid der mittelbar Betroffenen will ich hier nicht reflektieren. Einen Moment lang musterte Vorster seine Patientin scheinbar widerwillig, Edit zuckte in ihren samtenen Kissen wie eine ertappte Sünderin zurück. Niemand verrät den diabolischen Charakter der Analyse, betonte der Professor gut gelaunt. Ihre wesentlichen Merkmale sind manipulativ, sie schüchtern ein, erzeugen Beklemmungen, zerlegen das Ich, zerstören das nervliche Bindegewebe der Kreatur. Die Illusion besteht darin, dass danach noch Kreativität möglich sei. Der Proband ist verloren, wenn er sich allzu gut erinnert hat. Würde man diesen Fakt ans Licht der Öffentlichkeit zerren, wären die Scharlatane binnen kürzester Frist arbeitslos.
Aber was soll dann werden, fragt Edit verzagt.
Die Frage ist falsch.
Sie meinen wohl nicht das Schicksal der Seelenklempner. Ihr Einwand ist redundant, spöttelt der Professor. Es darf eben nichts mehr werden mit der Erinnerung. Was, Gnädigste, folgt daraus, wenn sich ein Forschungszweig korrumpiert hat? Vorster ringt die Hände, die Geste wirkt feierlich. Erinnern sollte man sich lieber nicht mehr, nach allem, was gewesen ist. Ohne Rückbesinnung finden Sie Frieden, Freiheit, Schöpfergeist. Die Kindheit ist vergangen, Sie stehen mitten im Leben, sind attraktiv, wohlhabend, vielleicht auch intelligent. Sie müssen sich nur der Zukunft öffnen, dann ergeben sich ungeahnte Perspektiven für Sie, emanzipatorisch, Ihr Mann wird Sie auf Händen tragen, verehren, Ihre Unmittelbarkeit, Ihr Dasein im Augenblick wird alle begeistern, man wird Sie feiern als Diva ohne Allüren, Mittelpunkt so mancher Gesellschaft, das Geheimnis Ihres Erfolgs ganz einfach: dass Sie nicht länger verhemmt sind. Das Bewusstsein über ›früher‹ raubt Ihnen Ihre Persönlichkeit. Ihre Kindheit erhalten Sie niemals zurück, einzig ein nebulöses Abbild von Erlebnissen, die jedenfalls anders waren als jetzt von Ihnen wahrgenommen, begleitet Sie, sodass Sie auf fragilen Spuren wandeln, die nicht die ganze Wahrheit sind. Wollen Sie sich ernsthaft herunterziehen lassen von Trugbildern, Halbwahrheiten, der Gaukelei eines venezianischen Maskenballes, die Sie in eine surreale Schattenwelt versetzt, wollen Sie Zombie sein, während Ihre Lebensuhr läuft, die besten Jahre rückwärtsgewandt verlieren, es wäre ein Jammer, eine Schande, die Versündigung am eigenen Leben.
Aber so habe ich mich doch noch gar nicht gefunden, wirft Edit ein.
Sie existieren überhaupt nicht, solange Sie im Vergangenen herumstochern, schnarrt Vorster verächtlich. Ich sehe keinen Lebensentwurf, den Sie verfolgen, Sie richten sich ein als neunjährige Göre, der alle Welt Übles will, Opfer sein, Mitleid heischen, das ist Ihr erbärmlicher Kniff. Ein jämmerliches Leben, das ohne Ihr Zutun an Ihnen vorüberzieht.
Edit weint.
In unserer hinterwäldlerischen mitteleuropäischen Kultur – ich will die Bezeichnung Kultur lieber nicht kommentieren – wird das Erinnern prinzipiell höher geschätzt als das Vergessen. Ein kolossaler gesamtgesellschaftlicher Irrtum, der auf naiver Bewahrung überkommener Traditionen beruht. Daraus resultieren pathologische Deformationen des Ichs, das sich als solches nicht entwickeln kann, geschweige denn eine Identität herstellen, unverzichtbare Voraussetzungen des Lebendigseins bleiben bei uns, von wenigen Ausnahmen abgesehen, unerfüllt. An diesen Missständen, liebe Edit, muss ein Psychoanalytiker von heute verzweifeln. In den Staaten ist man ein winziges Stück weiter, setzt der Professor bedeutungsschwer hinzu, weil man dort unmittelbarer forscht, direkter, weil man sich nicht scheut, völlig neu anzufangen, ohne Vorbehalt, ohne Rückbezug auf Irrlehren, die hierzulande, einmal etabliert, Ewigkeitscharakter annehmen. Sie gelten einfach weiter, wenn sie längst widerlegt sind, als wären es unverrückbare Naturgesetze, die den Kern des alten Europas zusammenhalten. Freiheit des Gedächtnisses, dieses schlichte Postulat muss erst ein Neuroethiker aus Brooklyn ausrufen, damit es im deutschsprachigen Raum überhaupt Gehör findet.
Edit staunt.
Aber glauben Sie nur nicht, dass sich die Ansichten dieses Adam Kolber bei uns durchsetzen werden. Dazu benötigt es viel mehr. Die lange Pause, die er eintreten lässt, scheint Vorster zu genießen. Edit wagt kaum, zu atmen. Eine Frage würde sie bestimmt blamieren. Kolber ist ein Vorläufer, der Bruchstücke meiner systematischen Lehre zufällig formulierte. Ich nehme ihm das nicht übel, konstatiert der Professor wie wohlwollend. Denn offenkundig gibt es Erfahrungen, bei denen Vergessen besser sein kann als Erinnern. Ich gehe natürlich weiter als Kolber, ich sage Ihnen, liebe Edit, dass Vergessen in den meisten Fällen, allemal überwiegend, hilfreicher ist als Erinnern. Erst das Vergessen macht die Person. Diesen Satz, liebe Edit, sollten Sie nicht vergessen. Ich gebe mich nicht zufrieden mit den Pendelbewegungen, die dazu dienen, dass Psychologen einer grundsätzlichen Entscheidung zwischen Erinnern und Vergessen ausweichen. Sie wollen sich nicht festlegen, die Damen und Herren Kollegen, sie kochen ihre lauen, ungepfefferten Süppchen, einzig darauf bedacht, sich nicht die Zunge zu verbrennen.
Ist das nicht ungerecht? Edit erschrickt sofort über ihre Frage. Ungerecht von wem? Ungerecht für wen?
Der Professor verzichtet auf jeglichen vernichtenden Kommentar. Sie werden das nicht erinnern müssen, meint er beinahe vergnügt. Stellen Sie sich vor, meine Liebe, in Bedfordshire hat eine Dame ein Experiment durchgeführt und hinterher eine vermeintlich bahnbrechende Erkenntnis, die sie daraus gezogen haben will, veröffentlicht. Falsche und echte Erinnerungen enthalten beide komplexe Beschreibungen und Sinneseindrücke, sie sind nicht zu unterscheiden, verkündet diese Julia Shaw voller Stolz, und die Forschergilde liegt ihr zu Füßen. Die gute Frau sollte mir mal erzählen, was sie unter einer echten Erinnerung versteht. Die nämlich gibt es nicht, und somit erscheint mir ihr gesamtes Untersuchungsergebnis, das ich übrigens hundertprozentig teile, schonend ausgedrückt: als trivial. Welch aufwendiges Experiment für eine ganz banale Feststellung! Die haben ihre Forschungsmittel im Überfluss, schüttelt Vorster lautstark den Kopf. Ich will Sie nicht langweilen, meine Liebe, das alles braucht Sie nicht im Mindesten zu interessieren. Sie benötigen einzig Ihren eigenen Kosmos, und Ihrer Existenz als einer attraktiven, modernen Frau steht nichts im Wege. Schütteln Sie die Vergangenheit ab, sie gibt Ihnen nichts. Leben Sie, heute, morgen, allezeit, die Ihnen bleibt, die futuristische Gegenwart möge Ihnen Frieden, Freude, Freiheit schenken.
Es klingt fast pastoral. Der Professor hat sich erhoben, falls er nicht schon vorher durch den Raum geeilt ist. Edit folgert aus seinem Verhalten das Ende der Sitzung. Eine zentnerschwere Last wurde ihr genommen, nämlich die Bürde ihres gesamten vergangenen Lebens. Edit möchte dankbar sein, ihre Erleichterung zeigen. Lächelnd verabschiedet sie sich mit den Worten, dass ihr dann also damals gar nichts geschehen sei.
Darauf Vorster achselzuckend: Das habe ich so nicht gesagt.
Kapitel 2: Ein Flüchtling
Ich bin hier. Endlich Ruhe finden, alles hinter mir lassen, bei null anfangen, keine Vergangenheit, nicht hören, was geschehen ist, nicht reden, nichts berichten, nichts erzählen, keine Herkunft, keine Heimat, keine Stimme, keine Sprache, essen, trinken, schlafen, dann warten, bleiben – vor allem: nicht denken. In der Masse der anderen ist es leichter, weil man nicht wahrgenommen wird. Die Leere, die in mir ist, sieht keiner. Ich fühle mich fremd in der Masse, getrieben, sie bestimmen meine Schritte, ich mache nichts, ich bin erschöpft, während ich gehe, immer gleichmäßig, ich strauchele nicht, sie sind ja da. Ich schreite voran, ziellos, blicklos, kein Auge für den Nachbarn, der keiner ist, der fällt, an dessen Stelle ein anderer tritt, ich atme flach, sodass es keiner hört. Ich gehe, bis sie halten, irgendwann, irgendwo, die Masse ist ein Uhrwerk, ich schöpfe ihre Zeit, ich nehme sie, die nicht meine ist, ich bin hier.
Er hatte keinen Anhaltspunkt, wen er befragen sollte. Eigentlich war es ihm egal, er kannte niemanden in der Menge, das Exemplarische war kein äußerlicher Faktor, der Relevanz anzeigt. Offensichtlich hatten die eine entbehrungsreiche Reise hinter sich, Schrecken durchlitten, vielleicht in Lebensgefahr geschwebt, Hilfe war angesagt, Mitgefühl, das Elementare des Daseins musste gegeben werden, um den Tod zu verhindern. An Helfern mangelte es nicht, professionellen wie laienhaften, einer gesunden Mischung, die die gebeutelten, erbarmungswürdigen Menschen mit dem Nötigsten versorgte. Was genau das Nötigste war, erkannten diese Helfer besser als er. Nach seinen Eindrücken erschien ihm der heutige Tag für die Befragung verfrüht gewählt, er stand unnütz herum, unbeachtet, während Helfer und Opfer wie wild gestikulierten, mit Händen und Füßen Sprachbarrieren beiseiteschoben. Die würden schon zueinanderfinden, daran zweifelte Bernard nicht. Er hätte sich denken können, dass die Zahl der alleinreisenden jungen Männer auf dieser beschwerlichen Route bei Weitem überwog. Für die Befragung musste es nicht verkehrt sein, im Gegenteil. Diese Gruppierung bildete ganz bestimmt einen wesentlichen Teil des Problems, das er als Politologe ausgemacht hatte. Wie aber sollte er mit einem dieser jungen Kerle einigermaßen zielorientiert kommunizieren? Bernard ärgerte sich über die Blauäugigkeit, mit der er die Sache angeschoben hatte. Er war sich bewusst, dass ihm viele Kollegen nicht über den Weg trauten, offene Feindschaft an den Tag legten, wenn er mal wieder zu seiner Israelkritik ansetzte, Netanjahus expansive Siedlungspolitik als faschistoid brandmarkte und dann auch noch Beifall von der falschen Seite erhielt. Eingeladen wurde er meist von denen, die ihm suspekt waren; Zirkeln, die die Gräueltaten der Vergangenheit leugneten, relativierten oder jedenfalls nicht länger thematisieren wollten. Die Ausläufer des Historikerstreits aus den 1980er-Jahren hatten seltsame Blüten geschlagen; neuerdings kursierte die Auschwitz-Lüge gar als alternative Wahrheit im Netz. Verheerend war der primitive, peinliche Gehalt der Debatte, im Niveau unterirdisch, dabei gezielt amoralisiert, je dümmlicher die Positionen vorgetragen wurden, desto größeren Zulauf fanden sie. Er selbst konnte nichts sagen, was nicht sofort verzerrt, verformt, entstellt wurde. Mehrfach hatte Bernard überlegt, sich zurückzuziehen, resigniert angesichts dümmlicher, plumper, dreister Verdrehung historischer Tatsachen, hemmungslos vertreten von Demagogen mit akademischem Bildungsgrad, was ihn anwiderte. Diese Volksverhetzer glaubten gewiss nicht an den Inhalt ihrer Tiraden. Sie genossen, wie er meinte, den Rückhalt ihrer Meute. Machthunger trieb sie, Sehnsucht, als Tribunen gefeiert zu werden, ihre Vorbilder waren die größten Kriegsverbrecher der Menschheitsgeschichte, an deren Devotionalien sie sich ergötzten. Sie glaubten nicht an ihre eigene Auschwitz-Lüge, es war viel schlimmer, die Massentötungen in den Gaskammern waren ihnen schlicht egal, das Gemetzel an Millionen von Menschen gleichgültig, dem wohlfeilen Vergessen anheimgegeben. Keine verräterische Schamesröte überzog die Amoralisten, die jegliches Auschwitz-Sentiment heimlich oder auch unverhohlen verspottet hätten.
Es änderte nichts daran, dass Bernard die aktuelle israelische Regierungspolitik verurteilte. Für ihn war nach dem fatalen Attentat auf Rabin alles aus dem Ruder gelaufen. Der Attentäter hatte sein Ziel erreicht, wie ein Blick auf die dem Mord folgenden martialischen Jahrzehnte in Nahost offenlegte. Eben diese Phase war zum Hauptgegenstand der Analysen des Politologen geworden; er war entsetzt, auf die Konturen eines herrschenden und eines beherrschten Volkes zu stoßen. Natürlich war die geografische, die geostrategische Lage des kleinen, von diversen feindseligen arabischen Volksstämmen quasi umzingelten Staates extrem gefährlich; pazifistische Forderungen nach einer Auflösung der Armee wären weltfremd gewesen. Auch Bernards Meinung nach sollte niemand aus diesem Jahrhunderte lang nicht zuletzt im alten Europa geschundenen Volk noch einmal die andere Wange hinhalten, wenn er / sie beschmutzt oder beleidigt wurde. Die Balance zwischen erhöhter, besonderer Sensibilität und geforderter Normalität im Umgang mit Israel oder auch dem einzelnen jüdischen Bürger musste gewahrt, verteidigt bzw. überhaupt erst gefunden werden. Dafür, dass er solche Gedanken hegte, fühlte sich Bernard von jüdischer und muslimischer Seite gleichermaßen attackiert; sie standen ihm nicht zu. Seine Veröffentlichungen führten immer häufiger zu wüsten Beschimpfungen unter Kollegen, zumal unter solchen, die ihm früher verbunden gewesen waren. Am einfachsten wäre es wohl, ein völlig neues Forschungsfeld aufzumachen. Der Weg des geringsten Widerstandes kann weise sein. Bernard liebäugelte mit einer Veränderung dieser Art und hätte auch Ideen gehabt, die zu vertiefen es sich lohnte; er freute sich auf die erste unmittelbare Begegnung mit einer noch fremden, unvertrauten Materie, die sich ihm näherte und formen ließ, statt wesenlos zurückzuweichen. Viel später erst wäre der Zeitpunkt sich wiederholender Desillusionierung eingetreten, die ihn wie zwanghaft begleitete.
Was will dieser Mann von mir? Ich verstehe ihn nicht, ich will nicht mit ihm reden. Ich will unbehelligt sein, ich will leben, ich will hier leben. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Essen, trinken, schlafen, arbeiten, sprechen mit meiner Mutter daheim. Wann kann sie kommen, wann, wie, auf welchem Weg? Dieser Mann wird mir nicht helfen, ich spüre es. Er soll weggehen, ich bin hier.
Das Interview machte überhaupt keinen Sinn. Der Syrer, falls es denn einer war, hatte seine Englischkenntnisse offenbar vorgetäuscht, eine Kommunikation mit ihm war unmöglich, doch daran war nicht der erbarmungswürdige, heruntergekommene Zustand des jungen Mannes schuld. Es war sein abweisendes, feindseliges Verhalten, er verstand ja nicht, was man ihm sagte, egal welche Sprache man bemühte. Bernard wollte abbrechen, der Flüchtling zeigte kein Interesse, jegliche Neugier fehlte, keine Empathie für den Ort, in den er geflohen war, nichts Verbindendes ging von ihm aus, er wirkte schroff, selbstbezogen, wie abwesend. Der Politologe musste sich eingestehen, dass er fehl am Platze war, er kannte sich nicht aus in den elementaren Dingen des Lebens, da wussten andere besser Bescheid als er. Bernard fühlte sich linkisch und fürchtete, als nutzloser Stolperstein zum Ärgernis zu werden. Das wollte er unbedingt vermeiden und daher verschwinden. Er war bereits dabei, sich abzuwenden …
Woher jetzt plötzlich die junge Übersetzerin aus dem Boden gewachsen war, die sich lächelnd vor ihm aufbaute, wusste er nicht zu sagen, er hatte die langhaarige orientalische Schönheit vorher nicht gesehen. Sie war einfach da, ein Sprachwunder, anscheinend ohne jede Barriere, einnehmendes Wesen, gewinnende Art, Bernard dachte sofort an Scheherazade, die Sultanin und Erzählerin, die seine Mutter fasziniert hatte. Entscheidend waren ihre Arabischkenntnisse, maßgeblich ihr offener, vertrauenerweckender Zugang, der Bernard und den jungen Flüchtling auf Anhieb elektrisierte. Schon war man im Gespräch. Allerdings tauschten sich die beiden Männer, Bernard und Mohamed, ausschließlich mit Scheherazade aus, nahmen den jeweils anderen nicht zur Kenntnis. Dennoch herrschte fast so etwas wie Harmonie, erzeugt von Scheherazade, sodass sich Bernard aus der Reserve locken ließ und seinen Punkt auszubreiten begann.
Er erläuterte dem Flüchtling, genauer seiner Sultanin, weltmännisch die in der nationalen Historie begründeten sittlichen Verpflichtungen Deutschlands gegenüber Israel, die jeder Zugewanderte in seiner Eigenschaft als politisches Subjekt annehmen und bejahen müsse, wenn er hier heimisch werden wolle. Am Existenzrecht des Staates Israel sei von deutscher Seite aus nicht und niemals zu rütteln; der Forderung der prinzipiellen Akzeptanz Israels dürfe sich kein Zugewanderter innerlich verschließen, weil das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel sonst auf Dauer in eine Schieflage gerate, die zwanghaft zu einer neuerlichen staatlich gesellschaftlichen deutschen Schuld führe. Eine solch fatale Konsequenz fahrlässigen politischen Agierens, ausgelöst durch die Aufnahme Asylsuchender, sei den deutsch-israelischen Beziehungen nicht zuzumuten. Fast jovial fügte der Politologe einschränkend hinzu, die faktische Machtausübung und -ausdehnung, wie sie etwa Benjamin Netanjahu betreibe, müsse niemand im In- und Ausland gutheißen, er, Bernard selbst, sei ein vehementer Gegner des Siedlungsbaus, diese Kritik zu üben sei legitim, ja geradezu geboten für jedermann, auch als Beitrag zur Integration des Asylanten. Natürlich solle er ein verantwortliches freiheitliches demokratisches Subjekt werden, im Idealfall ein neuer Staatsbürger mit all seinen im Grundgesetz verankerten Rechten und Pflichten; nur seien eben bestimmte Voraussetzungen unabdingbar zu erfüllen, damit der Aufnahmeprozess keine unerfreuliche Wendung nehme und scheitern müsse.
Bernard hat seinen Vortrag bis hierhin selbstsicher und eifrig gehalten, er ist zufrieden mit der erzielten Wirkung des Arguments, man darf den Flüchtlingen nicht ohne einen gewissen staatsmännischen Stolz begegnen, wenn man sie erreichen, überzeugen will, bevor sie sich in antisemitischem Wahn verlieren. Eben das sollte unter allen Umständen verhindert werden. Jetzt erst stutzt er, irritiert über die Verwandlung, die sich während seines Monologs vollzogen hat und die er nicht versteht. Die langhaarige Übersetzerin trägt mittlerweile Kopftuch, sie lächelt nicht mehr, gewinnend schon gar nicht, keine Scheherazade, die ihre Umgebung träumen lässt, die sie verzückt, die unvereinbare Gegensätze versöhnt kraft ihrer Sprachgewalt und Anmut, kein ausgleichender Friedensengel zwischen Abendland und Morgenland, keine schiedsrichterliche Zauberfee, deren bloße Präsenz die Sorgen unserer Welt vergessen lässt – stattdessen eine zornbebende Muslima, die offenbar die Scharia nach Deutschland bringen will. Sie droht Bernard mit Anzeige wegen aufrührerischer ungesetzlicher politischer Infiltration, Vortäuschung einer amtlich beglaubigten Autorität, damit verbunden unautorisierter Gesinnungsschnüffelei zum Ziele der Unterminierung und Brechung des freien Willens des Ankömmlings. Als formaljuristisch gewiefte Agitatorin ist die Muslima unübertrefflich, sie hat Bernard spielend leicht durchschaut und den wunden Punkt seines Auftretens zutage gefördert, den Politologen als Volksverhetzer entlarvt, der ohne gesetzliche Handhabe unbescholtene Flüchtlinge unter Druck setze und verunsichere. Ihm müsse auf der Stelle das Handwerk gelegt, der Zugang zu Asylantenheimen aller Art verboten werden. Seine beflissene Netanjahu-Kritik nimmt die Muslima überhaupt nicht zur Kenntnis, sie prallt an ihr wie nicht geübt ab, als seine explizite Feindin sagt sie ihm auf den Kopf hin zu, er sei ein Jude, ein gottverdammter, lästerlicher Jude, Faschist und Ausbeuter, die muslimische Volksseele sei vor ihm zu schützen, er gehöre ausgemerzt, vernichtet, gesteinigt. Die Muslima unterstellt ihm, Jude zu sein, weil er den Herrenstaat Israel hofiere. Bernard, für einen Moment paralysiert, ohnmächtig erstarrt, sodann entsetzt, verunsichert wie nie zuvor, etwa auf seinen Kongressen und Veranstaltungen, sieht sich in plötzlicher Panik nach einer Rückzugsmöglichkeit um, er hält nicht für ausgeschlossen, dass die Lage eskaliert, die Muslima gleichgesinnte Flüchtlinge auf ihn hetzt, Lynchjustiz und Meuchelmord an ihm zelebriert, die Autorität dazu besitzt sie allemal, ein falsches Wort könnte seinen unmittelbaren Untergang einleiten. Vorhin hätte er beinahe seinen Vornamen genannt, rein zufällig kam es nicht dazu, wo er doch seine Scheherazade bewunderte, anhimmelte, vor ihrem Antlitz in Wonne zerfloss. Die Unterlassung könnte sein Leben gerettet haben, auf Simon, den nunmehr Verschwiegenen, hätte sich die Muslima einen gefährlich giftigen Reim gemacht.
Mohamed blickt den Politologen hasserfüllt an. Ein Wink nur der Muslima, und er würde sich auf ihn stürzen als ihr willfähriges Werkzeug. Die Muslima strahlt in diesem Moment unerschütterliche Ruhe aus, Gelassenheit, unnahbaren Charme, ihr Interesse an dem faschistischen Aufrührer ist erloschen. Sie hält die unsichtbaren Fäden fest in der Hand und damit die Macht des Augenblicks. Bernard ist Luft für sie, wie nicht mehr im Raum. Ein letztes Mal richtet er das Wort an sein Publikum, überflüssigerweise, weil ihm niemand Beachtung schenkt. Mohamed hat sich nach hinten begeben, die Übersetzerin ist wieder bei der Arbeit. Ich bin kein Moralist, vermeldet Bernard allen, die es nicht hören können und es nicht hören wollen.
Kapitel 3: Eine Schachpartie
Ob er in ihm einen Freund sah, hätte Bernard gern gewusst. Die Begegnung mit einem, der tatsächlich etwas zu sagen hatte, war beglückend; messerscharf seine Analysen, durchdringend sein Kennerblick, umfassend sein Repertoire, sodass ihn Bernard insgeheim mit universal gebildeten Persönlichkeiten vergangener Epochen verglich, mit Leonardo noch stärker als mit Johann Wolfgang, denn dieser kleine, untersetzte Mann hätte gewiss auch eine Mona Lisa zu beeindrucken vermocht. Es gab kaum etwas, das Bernard dem Udo, wie er ihn nennen durfte, nicht zutraute, und dabei scheute der smarte Professor niemals das Rampenlicht der Öffentlichkeit, in dem er sich vielmehr zu sonnen schien; er beherrschte die glamouröse Glitzerwelt, bewegte sich in Cannes, auf der Biennale, der Documenta oder auf Festivals im Metropolitan wie auf der heimischen Dachterrasse, wo jetzt wieder die Figuren für die abendliche Schachpartie bereitstanden. Sein Urteil, worüber auch immer, war keineswegs oberflächlich, jedoch kurz, bündig, zutreffend. Bernard fühlte sich von ihm regelmäßig durchschaut, ohne selbst das Objekt der Analyse gewesen zu sein; es war, als kenne Vorster Intimitäten seines Seelenlebens, die er ganz sicher nicht vor ihm ausgebreitet hatte. Den Vergleich mit Leonardo hätte sich der Professor natürlich verbeten, da ihm keine historische Persönlichkeit schmeichelte; die geistigen Lenker der Geschichte waren getreu seiner analytischen Theorie dem Vergessen anheimgegeben. Er meinte das in aller Verbindlichkeit schonungslos radikal. Bernard staunte darüber, dass Vorster es trotzdem seit einiger Zeit schaffte, Everybody’s Darling zu sein. Das war nicht immer so gewesen, wie der Politologe anders als sein Förderer nur zu gut erinnerte; heute jedoch stellte der Psychoanalytiker die letzten Gewissheiten in Zweifel, ohne unangenehm anzuecken, ohne berufene oder unberufene Feinde zu produzieren, ohne Hass zu säen, ohne zu polarisieren, offenbar ohne jemanden im Kern seiner Seele zu verletzen. Das war vielleicht seine größte Leistung: die Fähigkeit zu überzeugen, während er die Welt aus den Angeln hob. Niemand konnte Vorster ernsthaft böse sein, denn er nahm den Menschen die Bürde der Erinnerung. Sein Licht strahlte quasi auf die anderen zurück und gab ihnen Zuversicht. Nach dem jüngsten Treffen mit dem Professor hatte sogar Bernard mehr denn je an seine eigenen politologischen Thesen geglaubt; zugegebenermaßen hatte er Vorster hier ausnahmsweise ein Remis abgetrotzt, das seinem Ego zuträglich gewesen war.
Das Schachspiel mit dem überlegenen Kollegen (oder doch Freund?) fiel ihm nicht leicht; dabei bildete sich Bernard ein, die Eröffnungstheorie umfassender zu überblicken als der Professor. Auch im sogenannten Mittelspiel, in dem strategische Intuition und poetisches Stellungsgefühl gefragt waren, hielt er sich für durchaus ebenbürtig; was aber nützte eine noch so umsichtige Partieanlage und -gestaltung, wenn der andere wie in Trance über grandiose Endspieltechniken verfügte und eine verblüffende Schlusspointe aufs Brett zauberte. Um Vorster gewachsen zu sein, hätte Bernard die Partie bereits im Mittelteil entscheiden müssen; bei einem normalen Gegner der Kategorie des Internationalen Meisters wäre ihm das mitunter auch gelungen, nicht aber bei einer genuinen Autorität des Wissens, die ihre psychoanalytische Brillanz blindlings auf das Schachbrett übertrug. Er beneidete den Professor um seine Genialität; es hatte nicht den Anschein, dass der sich irgendetwas mit wirklicher Mühe, mit Anstrengung hatte aneignen müssen. Vorster zog wie magisch an, mit einer unauffälligen, unsichtbaren Geste, was sich Bernard im Schweiße seines Angesichts hart erarbeitete. Glücklicherweise vertraten die beiden unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen, sodass eine fachliche Rivalität rein thematisch nicht drohte. Eben dies bildete wohl die Voraussetzung, den Boden ihrer privaten Korrespondenz.
Die abendlichen Begegnungen fanden in Vorsters großzügiger Villa statt. Zumeist wurde Bernard auf der Dachterrasse empfangen, wenn es das Wetter zuließ, und er genoss dann den imposanten Blick auf die tiefer gelegene City. Dieser Ort blieb den Patienten des Professors verschlossen, bis auf eine einzige Ausnahme in all den Jahren, eine Frau, aus der der Professor ein striktes Geheimnis machte. Niemals wieder nach einer Sitzung hier oben über der Stadt war sie aufgetaucht, und es verstand sich von allein, dass sich jedwede Nachfrage verbot. Ein Phantom begleitete das Leben des Gurus, dessen Maxime vom Vergessen-Sollen somit eine unzulässige persönliche Erklärung fand, die sich Bernard immerhin zurechtlegte. Er dachte bildlich an Grace Kelly über den Dächern von Nizza, hätte diese Assoziation aber nicht zu äußern gewagt, die ihm die Gunst des Professors auf ewig verscherzt hätte. Vorster war konsequent genug, seine Privatsphäre auf die unmittelbare Gegenwart auszurichten, die einem Melodram reale wie fiktive Verknüpfungsressourcen nahm. Er raubte der Entwicklung einer Geschichte die Grundlage, indem er die märchenhafte Attitüde des Es-war-einmal auf dem Scheiterhaufen seines menschlichen Hygienegebots opferte.
Im Laufe der Sitzungen auf Vorsters Dachterrasse hatte sich bei Bernard ein latenter Oppositionsgeist gegen die Rituale des Meisters eingeschlichen, die diesem einen naturgegebenen Vorrang einräumten. Irgendwann hatte er eine Gegeneinladung ausgesprochen, wollte mit Vorster eine Schachpartie bei sich zu Hause spielen, ihm seine Mutter vorstellen, die sich über den ungeahnten Besuch gefreut und einen abwechslungsreichen Abend verlebt hätte. Ihr hätte er die charismatische Persönlichkeit des Professors allemal gegönnt. Vorster hatte das Ansinnen nicht abgelehnt, vielleicht hatte er ihm gedankt, Grüße an die Frau Mama bestellt, er war später jedoch nicht mehr auf diese Einlassung zurückgekommen, die zu erörtern wenig ergiebig gewesen wäre; er war darüber hinweggegangen, hatte die Nichtigkeit vergessen. Bernard tat es nicht nur um seine Mutter leid, er hatte sich Chancen ausgerechnet aufgrund des Heimvorteils, sich ausgemalt, wie er mit den weißen Steinen ein Damengambit zelebriert oder aber gegen eine indische Verteidigung sein geliebtes Positionsspiel am Damenflügel aufzieht, womit er den Stellungstyp erzwungen hätte, der ihm einst zu beachtlichen Weihen, ja einer großmeisterlichen Würdigung verholfen hatte. Stattdessen wurde ihm jetzt Burgunder gereicht, von der ältlichen Bediensteten zuvorkommend der Besuchersessel hinter den schwarzen Steinen gewiesen, während Vorster die Dachterrasse noch gar nicht betreten hat, er wisse ja, dass manche Patienten kein Ende fänden, die Zuwendung des Professors so dringend geboten wäre. Bernard verzichtete darauf hinzuweisen, dass allein Vorster Länge und Ausgang einer Besprechung bestimmte, dass keine Patientin (kein Patient) jemals ein Widerwort gefunden hätte, dass Vorster Herr über die Zeit des Gegenwärtigen war, dass er dem Augenblick befahl, kompromisslos in der Sache, unerbittlich und daher von allen geliebt. Insgeheim verfluchte der Politologe den Psychoanalytiker in diesem Moment; als die Bedienstete verschwunden war, hätte er Gelegenheit gehabt, sich die weißen Figuren anzueignen wegen des Anzugsvorteils, aber er hätte sich sofort von Vorster durchschaut und also verunsichert gefühlt.
Mit einem Glas in der Hand betrat der Hausherr die Bühne seiner Dachterrasse und winkte dem Freund schon von Weitem aufgeräumt zu. Du hast ja mal wieder für schönes Aufsehen gesorgt, Simon, lacht er vergnügt, musstest du deine Tiraden denn unbedingt in einem Asylantenheim reiten? Du bist Gesprächsthema der ganzen Stadt, ja landesweit ist man auf deinen Fall aufmerksam geworden, deine Popularität hätte ich auch gern erlangt. Aber sag einmal, wie um alles in der Welt willst du deine Felle retten, wo du den armen Flüchtling und die schutzbedürftige Muslima dermaßen widerborstig drangsaliert hast? Der Vorwurf der Nötigung wiegt schwer, und er steht unwidersprochen im Raum, mein Freund. Der Professor klopft Bernard gutmütig, beinahe väterlich über den Rücken. Dessen joviale, herablassende Art schätzt der Politologe nicht, Vorster nimmt ihn überhaupt nicht ernst, obwohl er weiß, wie wichtig Bernard seine umstrittene, gewagte, berüchtigte Forschungsposition ist. Natürlich war es ein grotesker, erbärmlicher Fehler, sich im Austausch mit einem analphabetischen Flüchtling und einer undurchschaubaren muslimischen Dolmetscherin dermaßen zu ereifern, dass er nun ein Verfahren wegen unerlaubter Beeinflussung am Hals hat. Wem bitteschön wollte Bernard in seiner strategischen Einfalt am Ende imponieren? Es ist ihm grandios gelungen, Muslime, Juden, Christen und womöglich sogar Atheisten gegen sich aufzubringen, und irgendwer hat den Politologen im Netz als Populisten beschimpft. Das wird Schule machen, wie Bernard ahnt, seine Dummheit ist kaum zu überbieten. Hätte nicht Vorster ihn mit dieser Sache in Ruhe lassen können? Fast hämisch vergleicht der ihn jetzt mit einem gemeinsamen Bekannten, über den die beiden ansonsten einander ironisch überbietend im Duett herziehen, wenn sie ihn weltfremd nennen, naiv, lebensuntauglich, genderideologisch, der Existenz des Alltags nicht gewachsen. Vorster eröffnet mit dem Königsbauern, während er Bernard an die Seite Tom Andes rückt. Der Israelnörgler und gleichzeitig vehemente Verfechter des Existenzrechts Israels findet sich neben dem Merkel-Kritiker wieder, der sich gegen die Deutungshoheit einer überragenden homogenen politisch legitimierten Generation einbildet, als einziger die tatsächliche Haltung der Kanzlerin durchschaut zu haben, in der er eine blutleere Machtpolitikerin erkennt, die kein anderes Ziel als ihre lebenslange Kanzlerschaft verfolge. Damit dringt er nicht durch, das will keiner hören, urteilt der Psychoanalytiker präzise, der auf Bernards Israelthese nicht näher einzugehen braucht. Der Vergleich Israel – Merkel ist erhoben und gegenwärtig, präsent. Bernard kann den Geist nicht wieder in die Flasche bannen, er würde ihn erzürnen. Der Psychoanalytiker nimmt es mit den Äpfeln und Birnen nicht so genau, er würde sie im Zweifel vergessen und hätte also zwingend recht. Bernards Antwort, mit dem Königsbauern dagegenzuhalten, war taktisch ungeschickt; der offene Charakter des Spiels behagt ihm nicht und kommt ihm rasch spanisch vor. Gnädigerweise schießt sich Vorster augenblicklich wieder direkt auf den unglückseligen Ande ein, sodass Bernard eine Ablenkung von seiner Person zu sehen wähnt; der schriftstellernde Journalist begehe den entscheidenden Lebensirrtum, indem er sich der Forderung des Vergessens seiner Sehnsucht verweigere. Wer diese Forderung wohl erhoben hat, wagt Bernard rebellisch zu denken, dabei ist ihm klar, dass der narzisstische Ande keinesfalls ähnlich existenziell an der Kanzlerin hängt wie er an Israel. Vorster doziert ungehemmt weiter. Jemand, vielmehr ein Mann, der behaupte, im körperlichen Unterlegenheitswunsch gegenüber der Frau bei sich angekommen zu sein, stilisiere sich zur hoffnungslosen Jammergestalt. Er, Vorster, brauche diesbezüglich weder auf die ewigen seligen Streithähne Freud und C. G. Jung zu verweisen, geschweige denn sie zu zitieren, noch Unterstützung bei zeitgenössischen Feministinnen zu suchen, deren rigide Ablehnung des Narren Ande belegt sei. Die habe der übrigens mit seiner kürzlich veröffentlichten Novelle aus der Fassung, in Zorn und Aufwallung gebracht. Der törichte Tom sei nicht lebensfähig, er sei nackt, allein, verloren. Wie Vorster sein unerbittliches, vernichtendes Urteil genüsslich fällt, reizt er Bernard zum Widerspruch, der aber die Sache Andes nicht vertritt. Der Politologe hat auf dem Königsflügel rochiert, bemüht eine Verteidigungsstrategie zu gestalten, die ihn indes nicht restlos überzeugt. Es ist alarmierend, dass er nicht wie früher den blamablen Ande bloßzustellen vermag. Ein solches Zeichen der Verbundenheit hätte der Grandseigneur schon von ihm erwartet. Jedoch Vorster ist auf seine emsige Zustimmung nicht angewiesen. Bernard fühlt sich an diesem Abend auf der Dachterrasse ebenso unbehaglich wie am Schachbrett. Die Damen sind bereits getauscht, die Partie nähert sich bedrohlich dem Endspiel. Er versucht es mit einem Überraschungsangriff und fragt, wenn auch schüchtern, nach der Gefühlswahrheit, die sich hinter der existenziellen Verzweiflung Tom Andes verbergen müsse. Wie solle einer aus seiner Haut heraus, der sich auf eine spezielle Weise erfahren habe. Ande sei ja nicht pervers im Sinne von pädophil, er stelle keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Er stellt eine Gefahr für sich selbst dar, er verfehlt die Facetten seiner Person, unterbricht der Psychoanalytiker harsch. Er weiß nicht, wer er ist, seine Männlichkeit ist ihm abhandengekommen, seit er von dieser Lavinia niedergerungen wurde. Ihren Übergriff stilisiert er theatralisch zu seinem Lebensschicksal, statt eine neue Erfahrung mit einer fremden Frau zu machen. Sein Unterlegenheitswunsch ist eine Fiktion, an die er sich klammert, um dem Leben, um der Gegenwart zu entrinnen. Er flieht das Leben, indem er sich weigert, den Übergriff zu vergessen. Ob die Frau ihn damals wirklich vergewaltigt hat, tut nichts zur Sache. Aber lebt er denn nicht im Einklang seines Gefühls, wirft Bernard im Flüsterton ein. Er ist ein wenig stolz auf seine unvermutete Beharrlichkeit.
Vorster lacht kurz auf. Deine Gefühlswahrheit, mein Freund, ist nur eine Illusion. Was du Gefühl nennst, trickst dich aus, um dir die Gegenwart zu rauben. Jetzt, in diesem Augenblick findet dein Leben statt. Du erfährst im Augenblick, dass du auf der Welt bist. Du erfährst im Augenblick, warum du auf der Welt bist. Du erfährst im Augenblick deine Existenz. Im nächsten Augenblick wirst du wie neugeboren sein. Das Früher hast du vergessen, wenn du den Augenblick erfährst.
Im Augenblick erfährt Bernard, dass die Schachpartie verloren ist. Die Damen waren ja schon abgeräumt, als sein Damenflügel jäh zusammenbrach. Den habe er wohl vergessen, verkündet der Hausherr schlicht.
Kapitel 4: Die Dame in Montevideo
Ein Ort in einem fremden Kontinent, vergleichsweise gelegen am Ende der Welt, gewährt den Blick auf eine weitere Dachterrasse und dazu auf eine schöne Frau, die den beiden Schachspielern nicht unbekannt ist. Mit Sicherheit hat die erwähnte Schachpartie längst stattgefunden oder aber wird zukünftig zu spielen sein, da sie offenbar nicht auf einen Silvestermorgen datiert werden kann. Der nicht mehr ganz jungen und eben deswegen hinreißenden Frau wird von einer uralten Indianerin gerade ein Frühstücksei serviert, wie gewünscht weich gekocht in nur drei Minuten, sie scheint zu genießen und doch mit den Gedanken woanders zu sein. Die Alte wirkt mürrisch und reagiert eher unwillig auf die Zumutung, dass sie in ein Gespräch ohne Ertrag, ohne formbare Materialität gezwungen wird, dem sich zu verweigern nicht schicklich wäre, denn sie steht in einem Dienstverhältnis gegenüber der Europäerin. Die Schöne bemüht sich darum eine Art Bilanz zu ziehen, sie wendet sich gestenreich an ihre Haushälterin, allerdings konsequent in einer Sprache, die diese nicht versteht; unzweifelhaft ist Ruth-Esther Mireille die fehlende Französischkenntnis der Indianerin bewusst, was auch ihre bewundernswert präzisen Dienstanweisungen in einem kaum überlieferten Inka-Dialekt verraten (ist es Quechua?), die von der Alten prompt erledigt werden. Mireille balanciert traumwandlerisch zwischen den beiden so unterschiedlichen Sprachen; wo sie über ihre sehr frühen Lebensabschnitte räsoniert, führt sie ein Selbstgespräch, gerichtet an die Adresse der Indianerin. Die Verärgerung der Bediensteten, die dem deutlich persönlichen Thema nichts abgewinnt, ist allzu verständlich; was sollte sie auf den Wortschwall ihrer Herrin erwidern? Die Zeit, der Mireille vielleicht sogar mit einem Anflug von Wehmut gedenkt, ist der Alten zu weit entfernt, und das nicht nur in räumlichem Sinne; das Vergangene gewinnt seine Berechtigung erst im Kontext der Riten und Gebräuche der eigenen Vorfahren, also der Inka; Machu Picchu, die Anden allgemein wären ihr näher als die höchste niedrige Erhebung Uruguays. Sie schätzt ihre Herrin, aber das sind alles Flausen, die nichts ändern, die das Leben nicht mit Sinn bereichern, die den Kopf verwirren, die Unordnung stiften, ablenken von der harten, elementaren Existenz, ohne die nichts wäre, was ist und wie es ist. Die untergegangenen Inka-Herrscher werden diese Dekadenz verachten und verdammen, Mireille in ihrem Reich keinen Platz gewähren, sie verstößt gegen unumstößliche Werte, indem sie Vergangenes reflektiert, das keinem tradierten Kanon entäußert wurde. Sie ist verloren, wenn sie kein Einsehen hat, und die Inka-Götter kennen keine Gnade. Sie kennen das Französische nicht und werden folgerichtig feindselig reagieren. Die Alte ist betrübt, denn sie weiß, dass sie Mireille nicht retten wird. Wehe, wer die Geister der Mächtigen erzürnt, und wenn es gänzlich fahrlässig geschieht.
Die Dame in Montevideo dürfte kaum interessieren, was hinter der sperrigen Stirn der Indianerin herumspukt; sie bildet sich ein, den Umgang mit ihr ohne Vorurteile zu pflegen, aber für ihresgleichen hält sie die Alte letztlich nicht. Am Ende hätten selbst die Inka, wäre es ihnen möglich gewesen und hätten sie Kenntnis gehabt, Pogrome gegen Juden veranlasst, Hass wie aus dem Nichts, keine historische Herleitung, kein religiöser symbolischer, motivischer Bezug, kein Sinn, auch nicht im Rahmen des Sinnlosen, aber Feindschaft, elementare Feindschaft, ausgetragen mit aller Grausamkeit, die dieser vergangenen Hochkultur innewohnte, die sie auszeichnete und ihre Nachbarn erzittern ließ, fremde Aussätzige wären in ihrer Obhut ohne Überlebenschance gewesen. Seltsam, wo sich die verworrenen, unsystematischen Gedanken der beiden so unterschiedlichen Frauen in ungeahnter Weise begegnen, ja kreuzen; wäre es ihnen bewusst, sie würden sich schämen, jede auf ihre Art. Solchen Empfindungen ist zumal Mireille zurzeit nicht unterworfen; seit ihrer Scheidung von Vorster springt sie im Grunde zwischen ihren früheren Lebensphasen und der brandaktuellen Gegenwart hin und her. Die Theorie des Vergessen-Sollens hat sie als Jüdin niemals an sich herangelassen, auch nicht während der heißesten Liebesnächte, die sie mit dem Psychoanalytiker in trauter Zweisamkeit verbrachte. Für eine Jüdin stellt sich die Frage des Vergessens im Angesicht von Auschwitz nicht. Der Professor verzichtete darauf, in dieser Richtung irgendwie nachzuhaken, wohl wissend, dass eine Ehe mit der Tennis-Weltranglistenspielerin aus den Top Ten ansonsten unmöglich gewesen wäre. Schon als Teenager hatte sich Mireille zu einer Moral der Ablehnung der Moralkeule bekannt, was ihr die Aufmerksamkeit und unverhohlene Bewunderung Bernards bescherte, dessen Begeisterung für die staatenlose Tennishoffnung nicht im Verborgenen blieb. Ihr spielerisches Talent war groß genug, um diesen Sport in Israel, wo Mireille niemals gelebt hatte, im öffentlichen Raum merklich aufzuwerten, manche Strategen verstiegen sich zur leicht übertriebenen Behauptung, sie habe das Tennis in seiner professionellen Version dort überhaupt erst salonfähig gemacht. Mireille war bereits ein Star, als die Zumutungen des Lebens sie erreichten. Sie liebte Vorster umso mehr, als Bernard offen um sie zu buhlen begann. Das Leben davor, unbehelligt von beiden Verehrern, war herrlich unkompliziert gewesen. Die Menschen hatten das kleine, dann größere Mädchen gefeiert, Juden wie Nicht-Juden, als Tennisstern am Firmament und als heranreifende aufgeweckte Persönlichkeit, der staatenlose Status verlieh ihr sogar einen Hauch Universalität. Verantwortlich für diese biografische Note war ihre sie alleinerziehende Mutter, die nach der Trennung vom Vater, einem exilierten ungarischen Diplomaten, die eigene französische Staatsbürgerschaft unangetastet ließ und bei den Behörden irgendwie durchsetzte, dass ihrem Töchterchen für später verschiedene Optionen offeriert wurden. Die exaltierte Nummer war gewiss nicht gesetzeskonform, aber Mama hatte so ihre Verbindungen. Wie nun daraus eine dauerhafte Staatenlosigkeit Mireilles nach Erlangen der Volljährigkeit erwachsen war, erschien der Allgemeinheit rätselhaft, wurde vergeblich hinterfragt, jedoch nicht zu einem Imageproblem der jungen Tennisspielerin. Mireille folgte auch Einladungen zu Turnierterminen in arabisch-muslimischen Ländern, die freilich spärlich bestückt waren und immer seltener wurden; die zunehmende Islamisierung führte dazu, dass an manchen Orten nur noch Herren-Grand Prix stattfanden. Die undurchschaubare, besorgniserregende kosmopolitische Entwicklung seit der Jahrtausendwende bekümmerte Mama, die in ihren späten Jahren längst überwunden geglaubte Existenzängste zurückkehren spürte; in welch zweifelhafte Welt hatte sie ihre Tochter hineingeboren. Mama starb einige Zeit nach den New Yorker Terroranschlägen, jedenfalls nach außen hin friedlich in ihrer Pariser Wohnung am Boulevard Haussmann, Mireille weilte da gerade bei einem Turnier in Nizza, also fast in der Nähe, aber eben nicht daheim. Sie verzichtete auf ihre Halbfinalteilnahme, eilte nach Hause, bekam erstmals im Leben arge Gewissensbisse und erlitt einen Karriereknick. Ihr immens ausgeprägtes Selbstbewusstsein reduzierte sich auf Normalmaß, immerhin schaffte sie es, sich jetzt nicht im Alkohol zu ertränken oder härteren Drogen zu verfallen. Die Voraussetzungen waren gegeben, um durchaus beeindruckt einen Udo Vorster wahrzunehmen und hernach, wenn auch weniger intensiv, einen Simon Bernard in seiner auffälligen Schwärmerei zu registrieren. Mireille wusste nicht, wie mit ihrer Trauer zu verfahren sei, als sie dem Guru des Vergessen-Sollens über den Weg lief; seine Theorie war verlockend und abstoßend zugleich. Für ihre Privatsphäre war es wünschenswert, wenn die Erinnerung langsam versiegte, wenn sie von Schuldgefühlen wegen ihrer Abwesenheit verschont wurde, genauer wenn diese Schuldgefühle endlich nachlassen, wenn sie sich gänzlich auflösen würden; wer anders als der Professor konnte diesbezüglich der ideale Mann sein. Vorster war konsequenter als jedermann, der ihr früher begegnet war. Das heikle Thema Auschwitz spielte, solange es um Mama ging, keine Rolle; während der späteren Ehe mochte es irgendwie ausgeblendet werden und bildete keinen Trennungsgrund. Ausgerechnet Bernard hingegen wurde überraschend zum Problem, als er, quasi nachträglich, den Tod seiner Mutter mitsamt seinen eigenen Versäumnissen derart beklagte, dass Mireille höchst unsanft an ihren Schuldkomplex erinnert wurde. Es brachte alles nichts und zeigte ihr, dass einzig Vorster, der Charismatiker, über den Dingen stand. Wie einfühlsam heilte er ihre Wunden, indem er alle Schuld von ihren gar nicht zerbrechlichen Schultern nahm. Es war wie Balsam für Mireille, wenn er das Hohelied vom Vergessen sang. Alles, was sich auf ihr ganz persönliches Leben bezog, überzeugte die Ex-Tennisspielerin vollends. Die ersten Jahre mit Vorster waren ein Segen für sie. An seiner Seite lernte sie den Verlust der Mutter verschmerzen und das jähe Karriereaus akzeptieren. Die junge Ehe kam ihr wie ein Erwachsenwerden nach jugendlichen Himmelsstürmen vor. Dabei hatte gerade Vorster sie aus dem Zustand frustrierender Ernüchterung befreit. Dankbarkeit, Bewunderung und Liebe bilden ein bezauberndes Gemisch. Zunächst glaubte Mireille, dieser beglückende Rausch könnte ein Leben lang halten. Sie hoffte es inständig und suchte das potenziell Trennende zwischen sich und dem Professor zu ignorieren. In seinem Sinne konnte man eine Anfechtung schlicht vergessen, statt ihr nachzugehen. Es gelang ihr einen über / mehrere / viele Jahre andauernden Moment, dann aber musste sie begreifen, dass wahr war, was sie zuvor verschwommen geahnt hatte. Vorster hatte eine Geliebte (wenn nicht mehrere), aus deren Existenz er durchaus kein Geheimnis machte. Mireille weigerte sich erneut, in eine Lebenskrise zu geraten, und ließ sich stattdessen mit dem sie enthusiastisch verehrenden Bernard ein, der sie mit Komplimenten überschüttete und sich als gelehriger Schmeichler entpuppte. Der Umgang mit ihm war vertrauenerweckend, nicht mühsam, sie hätte sich ihn durchaus als Bruder denken können. Also liebte sie ihn nicht, obwohl er ihr Geliebter wurde. Die Reaktion auf eine Erfahrung ist selten glücksstiftend. Irgendwann begann Mireille sich danach zu sehnen, was sie hatte vergessen sollen. Es war der Moment, als ihr beide Männer von Herzen fremd wurden. Bernard blieb für sie eine Episode, während er ihr lebenswichtige Bedeutung zuschrieb. Sie nahm es aus der Ferne wahr und konnte es nicht ändern. Ihre eigenen Grübeleien galten bis zu einem bestimmten Punkt ihrem Psychoanalytiker, der ihr niemals völlig gleichgültig geworden ist. Sie wurde aufmerksam auf die eine seiner Geliebten, sah in dieser Rosa bald nicht mehr eine Rivalin. Mireille war imstande nachzuvollziehen, dass Vorster der italienischstämmigen Uruguayerin verfiel. Sie teilte ja seine Gefühle für Rosa, wie sie etwas später merkte. Sie willigte zur Verblüffung des Professors ohne Federlesen in die Scheidung ein und kreuzte dann zur ein Raunen erzeugenden Überraschung auf der Hochzeit mit seiner zweiten Frau auf; sie wollte sich ein Bild von Rosa machen, die in ihr sogleich eine ältere, erfahrene Schwester erahnte. Mireille spürte, dass ihr schlichtes Einverständnis mit Rosa Vorster nicht behagte. Auf seiner zweiten Hochzeit war der Guru nicht der Mittelpunkt der Veranstaltung, ein Umstand, der ihn sichtlich irritierte. Mit der Heirat zeichnete sich das Ende oder jedenfalls die Krise der Beziehung ab; einem Udo Vorster durfte das nicht passieren. Als sich sein Ego, Geltungssucht, Eitelkeit meldeten, ließ ihn Rosa auf der Stelle sitzen und verschwand wochenlang nach Nirgendwo, angeblich zu ihren Eltern; das war auch die Version, die Mireille anvertraut wurde. Rosa gab bekannt, dass sie eine Auszeit benötige. Vorster war fassungslos. Rosa signalisierte ihm, dass sie im heimischen Uruguay keine Störung akzeptieren werde. War es Zufall, dass sich Mireille gleich nach der Scheidung im (fernen) Montevideo niedergelassen hatte? In der Heimat der anderen, noch nicht wissend, dass es diese zurück zum Rio de la Plata zog. Rosas Sympathie war ihr allemal sicher, ob die Kleine ihr indes entschieden zärtliche Gefühle schenkte, würde in der näheren Zukunft zu klären sein.
Die mürrische Miene der alten Indianerin spricht Bände. Die Reise nach Punta del Este, an die unendlich weitläufige Mündung des Rio de la Plata in den Atlantik, wo sie Rosa wiedersehen würde, gehört nach Ansicht der Haushälterin gewiss zu den elenden Flausen im Kopf ihrer Herrin, die den Untergang nur beschleunigen werden; glücklicherweise muss sie, die Alte, nicht daran teilhaben. Diese Italienerin ist bestenfalls eine Zugereiste ohne Stammbaum und damit nicht der Erregung wert. Die allzu nervöse Herrin möge aufbrechen und die Hausgötter, wie die Alte ihre eigenen Vorfahren nennt, nicht länger erzürnen.
Tatsächlich hat Mireille nach dem dritten Drei-Minuten-Ei die Waffen gestreckt und schickt sich an, die Dachterrasse zu verlassen. Zuvor allerdings erklärt sie der armen Haushälterin umständlich, dass es wirkliche Freiheit ohnehin nur im Exil gebe. Das alte, morbide Montevideo sei ihr als melancholischer Ort seelenverwandt; Mama, die hier niemals gewesen ist, hätte auf den Straßen und Plätzen ausgelassen Tango getanzt und ihren dritten romantischen Frühling erlebt. Mireille hat sich auf Anhieb in die Stadt, die streng genommen keine Metropole ist, verliebt; begierig sog sie die bewundernden Augen der Angler von der berüchtigten Mole auf, sodass von erwiderter Liebe auf den ersten Blick gesprochen werden darf. Der Rio-de-la-Plata-Slang ist immerhin nicht unangenehm, zwischen spanischen und italienischen Einwanderern werden keine bedrohlichen Unfreundlichkeiten getauscht, soweit Mireille das überhaupt zu beurteilen vermag. Vielleicht liegt ihre Begeisterung, ihr Überschwang auch an Rosa, deren Heimat die staatenlose Universalistin verräterisch aus der Reserve lockt. Was an Rosa klebt, überzeugt Mireille wie kaum etwas zuvor in ihrem Leben. Es gibt keine Erklärung dafür, und sie sucht auch nicht danach. Sie empfindet für Rosa bedingungslose Liebe. Die Heftigkeit ihrer Aufwallung ist geeignet, eine Katastrophe auszulösen. Das Orakel der Inka könnte recht behalten. Oder ist es ein uralter Fluch, der sich erfüllt an Mireille als Leidtragender? Abergläubische Strömungen werden die ehemalige Tennishoffnung nicht schockieren, deren Reise nach Punta del Este unbehelligt von ihrer Haushälterin erfolgt. Was ihr plausibel wäre, ist Abstammung als Merkmal einer Fixierung. Darüber herrschte in Fachkreisen Einigkeit, ehe der Professor die Bühne betrat. Eine unbeugsame, glorreiche wissenschaftliche Existenz, um von Rosa düpiert zu werden. Gibt es ein Vergessen in der Auszeit?
Mireille erinnert sich nicht, ob sie als kleines Mädchen einmal in Jerusalem gewesen ist. Warum sollte ihr Mama einen solchen frühkindlichen Besuch verschwiegen haben? Symbolcharakter, Überhöhung der zugemessenen Bedeutung könnten eine Rolle gespielt haben. Lücken in ihrem Bewusstsein haben sie früher nicht gestört; seit der gescheiterten Ehe mit Vorster jedoch faszinieren sie Grübeleien über ihr Leben. Sie will es jetzt wirklich wissen und fühlt sich Mama besonders nahe, wenn sie in der Vergangenheit herumstochert. Vorster hat nicht das Recht, ihr Mama zu rauben.
Mireille möchte als kleines Mädchen in Jerusalem gewesen sein. Es tut nichts zur Sache, dass inzwischen Zweifel an der Rekonstruierbarkeit der wahren Wegführung der Via Dolorosa überwiegen. Mama soll sie über die Via Dolorosa getragen haben, damit nichts im Leben Mireille anfechten kann.
Ihre Gedanken sind frei, ziellos. Mireille genießt die mögliche vergangene Reise mit Mama auf exzessive Weise. Jerusalem als Sehnsuchtsort darf an keinen politischen Realitäten scheitern. Darüber wäre alles gesagt. Über Mama wird niemals alles gesagt sein.
Der Abschied von der Haushälterin, die Mireille nach Lage der Dinge in einigen Tagen neuerlich mürrisch empfangen wird, fällt herzlich aus und dennoch nicht entspannt; der Verdacht, als führe die Indianerin irgendetwas gegen sie im Schilde, schwingt mit. Mireille legt Wert darauf, eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin zu sein, bestimmt keine Ausbeuterin; als Reaktion auf ihre Haltung fordert sie Loyalität und neigt auch nicht zum Misstrauen gegen ihre Bedienstete. Sie beschließt, nach ihrer Rückkehr die Alte über ihre persönliche Situation zu befragen, was einigermaßen aussichtslos erscheint; die stolze Inka-Erbin hat zu keiner Zeit belastende Fakten ihrer Identität preisgegeben und wird auch diesmal nichts über sich erzählen. Mireille kommt sich schrecklich dekadent globalisiert vor in der konkreten Auseinandersetzung mit dieser Naturwüchsigen, der sie beileibe nichts Übles will, deren Wohl ihr keineswegs gleichgültig ist; wenigstens das Alter der Alten müsste sie kennen, um ihrer Fürsorgepflicht zu genügen. Eile tut not, denn die Alte wird nicht ewig leben. Einen Rückfall in schlechtes Gewissen möchte Mireille nicht erleiden. Sie ertappt sich dabei, ihren Egoismus als Antriebsfeder eigenen Handelns zu erfahren.
Über Punta del Este hat sie gehört, dass der Ort an der Atlantikküste US-amerikanisches Gepräge aufweist. Eine Oase für Neureiche ohne Traditionsbewusstsein und Sentimentalitäten. Diverse ehemalige US-Präsidenten unterhalten hier angeblich ihren zweiten Wohnsitz. Wahrscheinlich ein Mekka für Steuerhinterzieher und Briefkastenfirmen, was nützlich gewesen sein könnte für die Finanzierung des Baues des auffallend modernen Airports von Montevideo. Mireille war dort zufällig am Tage der Eröffnung gelandet und wie ein Popstar gefeiert worden; ihr Tennisglanz lag hier bereits einige Jahre zurück. Eigentlich erstaunlich, dass in Punta del Este kein Grand Prix der zweiten Kategorie veranstaltet wurde; fehlende Sponsoren oder Publicity konnten kaum der Grund sein. Für ein romantisches Wiedersehen mit Rosa wäre ihr das gefühligere Montevideo mit seinem morbiden Charme lieber gewesen. Punta del Este, das hoffentlich nicht allzu steril wirkende Urlaubsresort, taugte, so Mireilles Befürchtung, lediglich als diffuses Freiheitssymbol. Vielleicht aber war weniger Aura nützlich, um die Erwartungen der Begegnung nicht zu überladen; Mireille schwebte eine spontane, unkomplizierte, herzerwärmende Begrüßung vor. Das überbordende Karussell ihrer Empfindungen durfte Rosa nicht erschlagen.
Positive Energie und Aufregung ließen sich nicht länger zügeln. Der Aufbruch stand unmittelbar bevor. Mireille ist für Rosa bereit.