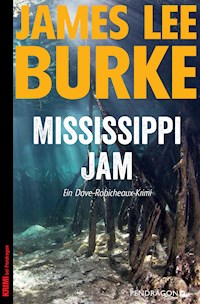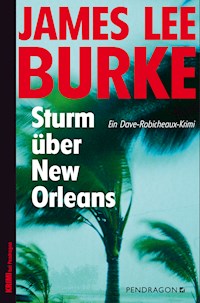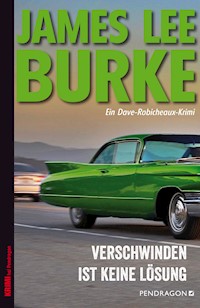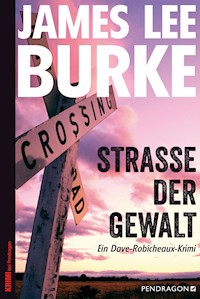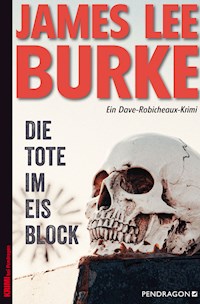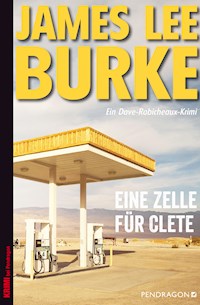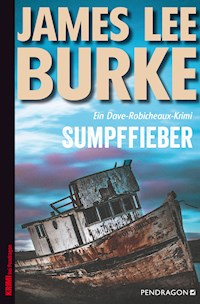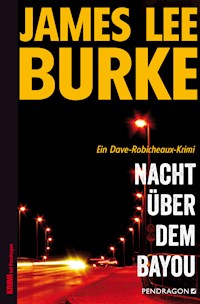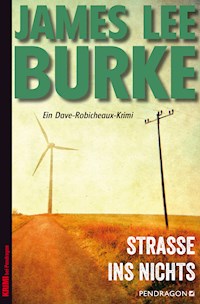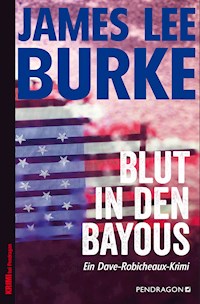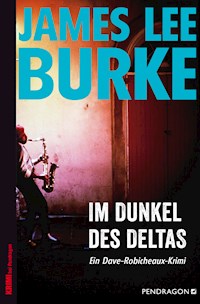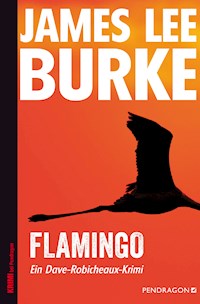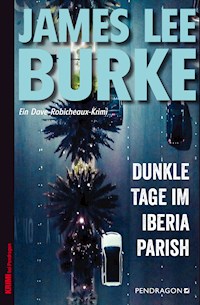
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Atmosphärisches Meisterwerk über die Abgründe der Menschheit! Als eine Frau namens Trish Klein in aufgewühltem Zustand in New Iberia auftaucht, stellt Dave Robicheaux fest, dass es sich dabei um die Tochter von Dallas Klein handelt - seinem Freund aus dem Vietnamkrieg, für dessen Tod er sich bis heute schuldig fühlt. Kaum angekommen, schließt Trish zweifelhafte Deals in Casinos ab. Der Verdacht kommt auf, dass sie in Wahrheit einen viel größeren Coup plant. Kann es sein, dass Trish den Mord an ihrem Vater rächen will? Und was hat sie mit dem angeblichen Selbstmord einer jungen Studentin zu tun? Um den Fall aufzuklären, muss Robicheaux sich endlich seinen Schuldgefühlen stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Dunkle Tage im Iberia Parish
Für unsere EnkelkinderJames Parker McDavid, Emma Marie Walsh,Jack Owen Walsh und James Lee Burke IV
Ich habe euch noch viel zu sagen,aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.Johannes 16, 12
1
In den frühen Achtzigerjahren, als Jim Beam pur und ein Bier zum Nachspülen noch mein Lebenselixier und meine Zuflucht waren, nahm ich an einem Austauschprogramm zwischen dem NOPD und einer Trainingsakademie für Polizeischüler im Dade County, Florida, teil. Ich arbeitete in der Mordkommission des Miami Police Department mit und unterrichtete nebenbei Strafrecht an einem College an der 27th Avenue N.W., unweit einer kleinen Stadt namens Opa Locka.
Mit seinen Gebäuden im orientalischen Stil wirkte Opa Locka wie eine Anhäufung von arabischen Moscheen. Am frühen Vormittag hing der Nebel vom Meer oder den Everglades, vermischt mit Staub und Kohlenmonoxid, wie schmutzige Wattebausche über den heruntergekommenen Minaretten und den rissigen Mauern der Gebäude. Abends waren die Straßen von Dampflampen beleuchtet, die im Nebel wie die Sicherheitslichter eines Gefängniskomplexes schimmerten. Das trockene Klatschen der Palmwedel erfüllte die verschmutzte Luft. In den Vorgärten sah man mehr Sand als Gras. Obwohl sich in den Häusern nicht viel Wertvolles befinden konnte, waren sie mit Gittern an den Fenstern und Stacheldraht auf den Zäunen gesichert. Junge Typen, die irgendeiner Gang angehörten, bretterten in ihren Spritfressern mit kaputten Auspufftöpfen über den Asphalt und zertrümmerten Schnapsflaschen auf dem Bürgersteig, ohne dass irgendjemand einschritt.
Für mich war es ein Ort, wo ich keine Vergleiche anstellen und keine Entscheidungen treffen musste, wo die Sonne jeden Morgen mit den Farbtönen eines Tequila Sunrise aufging. Wenn ich wieder mal bis zum frühen Morgen in Opa Locka abhing, gab es nicht viel zu überlegen: Meistens trank ich einfach weiter, bis ich im Delirium tremens versank. Vier bis fünf Nächte die Woche besoff ich mich systematisch in einer Bar, deren Gäste nichts voneinander wussten, deren Bekanntschaft in der Kneipe begann und endete. Die meisten tranken mit selbstzerstörerischer Resignation und hatten es längst aufgegeben, über ihr Leben nachzudenken, was ihnen vermutlich einen gewissen inneren Frieden ermöglichte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dort wusste, dass ich Polizeibeamter war – und falls doch, so war es ihnen völlig egal. Wenn ich heute zurückblicke, bin ich mir sicher, dass sie mich als einen der ihren anerkannt haben – einen Mann, der aus freiem Willen in Dantes neunten Höllenkreis hinabgestiegen ist, die Hand am Bierkrug, mit einem Whiskeyglas als U-Boot.
Einen Gast gab es jedoch, den ich als Freund bezeichnen würde: Dallas Klein, ein Kerl, der Ende 1971 einen Transporthubschrauber mitten durch feindliche Granaten und Gewehrfeuer flog, um die Jungs eines kleinen Aufklärungsteams zu bergen, die an der kambodschanischen Grenze festsaßen. Er kam dekoriert mit zwei Purple Hearts und einem Silver Star nach Hause, und mit einem nervösen Zucken im Gesicht, als würde vor seinem linken Auge eine Biene herumschwirren.
Er teilte meine Vorliebe für Pferderennen im Gulfstream Park, die Jai-Alai-Wettkampfhalle im Broward County, das Craps-Würfelspiel in einem Privatclub in Hollywood, Florida, eine Pokerrunde in Little Havana, die Hunde in Flagler Beach, die Trabrennen in Pompano Park, das Florida Derby in Hialeah, Kurztrips nach Jamaika und besonders den Moment, wenn in den schimmernden Spielautomaten die Münzen klimperten.
Dallas Klein war ein guter Junge, kein Säufer und kein bisschen verbittert, obwohl ihn seine Spielsucht bereits seine Braut und ein kleines Haus in Fort Lauderdale gekostet hatte. Er trug seine Verluste mit einem Lächeln, als wäre alles nicht so schlimm, solange er es mit Humor nahm. Samstags saß er meist bei einem frühen Lunch in der Bar, trank ein Glas Milch zu einem Hamburger und las den Morning Telegraph, gut gelaunt und freundlich wie immer, das rabenschwarze Haar kurz geschnitten. Um eins waren wir dann meistens beim Pferderennen, fest überzeugt, in die Zukunft schauen zu können. Die Geräuschkulisse der Menge nahm uns auf wundersame Weise jede Angst vor der eigenen Sterblichkeit, die uns bisweilen beschleichen mochte.
An einem sonnigen Nachmittag, als die Jacarandabäume und Bougainvilleen blühten, kam Dallas wieder einmal vergnügt pfeifend in die Bar geschlendert. Er hatte diese Woche drei NFL-Spiele richtig getippt und bei zwei Pferderennen den Ersten und Zweiten erraten. Zur Feier des Tages schmiss er eine Lokalrunde und lud mich zu Steak und Irish Potatoes ein.
Nach einer Weile kamen zwei Typen von der Sorte herein, mit der man nichts zu tun haben will. Der Größere winkte den Barkeeper heran, während der andere sich unter den Gästen an den Tischen umschaute und einen Moment brauchte, bis seine Augen sich an das schummrige Licht in der Bar gewöhnt hatten.
„Ich mach mich vom Acker, Dave. Ruf mich an“, sagte Dallas, legte Messer und Gabel auf den Teller und nahm seine Lederjacke von der Stuhllehne.
Im nächsten Moment verduftete er durch die Hintertür.
Er kam nur bis zu einem lavendelfarbenen Cadillac, wo ihn ein Riese erwartete, die Arme vor der Brust verschränkt. In der Sonnenbrille des Kerls waren die verzerrten Spiegelbilder von Minaretten und einer weißen Stuckwand zu sehen.
Die zwei Männer, die durch die Vordertür hereingekommen waren, folgten Dallas hinaus auf den Parkplatz. Ich zögerte einen Moment, dann wischte ich mir den Mund mit meiner Serviette ab und ging ebenfalls nach draußen.
Der Parkplatz war mit Bauschutt ausgelegt, in dem aus allen Ritzen Unkraut hervorwucherte. Unter dem strahlend blauen Himmel wiegten sich die Königspalmen entlang des Boulevards im Wind. Die mir unbekannten Männer hatten Dallas umringt – ein Manöver, bei dem jeder der drei genau wusste, was er zu tun hatte.
Der Fahrer des Caddys hatte den stämmigsten Hals, den ich je an einem Menschen gesehen hatte – so breit wie sein Gesicht. Mit der Krawatte und dem weißen Hemd erinnerte er ein bisschen an ein Schwein, das man in einen Anzug gesteckt hatte. Kaugummi kauend schaute er zu den windgepeitschten Palmen hoch, als ginge ihn das Ganze gar nichts an. Der Mann, der mit dem Barkeeper gesprochen hatte, war der Wortführer. Er trug Sportklamotten aus Polyester, dazu weiße Schuhe, und sah aus wie ein Schwindsüchtiger mit seinen eingesunkenen Schultern und dem faltigen Gesicht eines Kettenrauchers.
„Whitey soll also für deine 16 Riesen geradestehen?“, fragte er. „Das Geld gehört ihm nicht, verstehst du? Er zahlt selbst anderthalb Prozent Zinsen die Woche. Nein, Dallas, jetzt hörst du mir erst mal zu. Jeder weiß, was du für dein Land geleistet hast, aber wenn du jemandem 16 Riesen schuldest, kannst du den Kriegsheldenscheiß vergessen.“
Meine Aufmerksamkeit galt jedoch dem Kleinsten der drei. Er wirkte angespannt wie ein Meth-Junkie. Sein Mund erinnerte an ein horizontales Schlüsselloch, einen Mundwinkel hatte er nach oben gezogen, als wollte er lächeln. Er hörte angestrengt zu, als warte er nur noch auf grünes Licht, ein angespanntes Zucken in den Augen.
Der Schwindsüchtige legte Dallas die Hand auf die Schulter. „Was? Findest du etwa, wir sind zu hart zu dir? Willst du, dass Ernesto uns in die Glades fährt und wir uns dort weiter unterhalten? Whitey mag dich, Junge. Er hält verdammt viel von dir, nur darum behandelt er dich so rücksichtsvoll.“
„Haben die Gentlemen ein Problem mit meinem Freund Dallas?“, fragte ich in die Runde.
In der eintretenden Stille hörte ich die Palmwedel flattern. Ein Windstoß wirbelte Zeitungspapier an einem eisernen Tor vorbei.
„Nee, wir ham kein Problem“, entgegnete der Kleinste, und seine Schuhsohle knirschte auf dem groben Schutt, als er sich zu mir drehte. Seine Haare waren blondiert, er trug Plateauschuhe und einen dunkelblauen Anzug mit weit geöffneter Jacke, unter der das silberfarbene Hemd im Licht glitzerte, dazu ein seidenes Halstuch. In seinen grünen Augen brannte ein kaltes Feuer, das es ratsam erscheinen ließ, sich nicht mit ihm anzulegen.
„Dallas wird am Telefon verlangt“, sagte ich.
„Die sollen ihm eine Nachricht hinterlassen“, erwiderte der Kleine.
„Seine Mutter ist dran. Die ist stinksauer, wenn Dallas nicht ans Telefon geht.“
„Der Typ ist ein Cop“, meinte der Fahrer des Caddys, nahm die Sonnenbrille ab und kniff die Augen gegen die grelle Sonne zusammen.
Der Kleingewachsene und der Typ in Sportklamotten musterten mich einen Moment lang. „Sie sind ein Cop?“, fragte der Kleine und lächelte zum ersten Mal.
„Wer weiß“, erwiderte ich.
„Nette Kneipe ham Sie sich da ausgesucht“, meinte der Kerl.
„Und ob. Falls ihr euer Bier anschreiben lassen wollt, rede ich gern mit dem Barkeeper“, bot ich an.
Der Kleine lachte und ließ sich vom Fahrer ein Kaugummi geben. Dann trat er zu Dallas und flüsterte ihm etwas zu, das Dallas sehr blass werden ließ.
Nachdem die drei Männer in ihren Cadillac gestiegen und losgefahren waren, fragte ich Dallas, was der Typ zu ihm gesagt hatte.
„Ach, nichts. Er ist bloß ein Arschloch. Nicht so wichtig.“
„Wer ist Whitey?“, hakte ich nach.
„Whitey Bruxal. Er betreibt ein Wettbüro in einer Pizzeria in Hallendale.“
„Dem schuldest du 16 Riesen?“
„Das hab ich im Griff. Kein Problem.“
Zurück in der Bar, schob Dallas seinen Teller beiseite und bestellte sich einen Scotch mit Milch. Nach drei weiteren Drinks kehrte die Farbe in seine Wangen zurück. Er blies den Atem aus und stützte die Stirn auf eine Hand.
„Wow“, sagte er mehr zu sich selbst als zu mir.
„Was hat der Typ zu dir gesagt?“, fragte ich noch einmal.
„Eins-eins-fünf Coconut Palm Drive.“
„Was soll das heißen?“
„Ich habe eine Tochter, sechs Jahre alt. Sie wohnt bei ihrer Großmutter im Grove-Viertel. Das ist ihre Adresse“, erklärte Dallas. Er starrte mich an, als verstünde er selbst nicht so ganz, was das bedeutete.
Am nächsten Abend lud Dallas mich in seine Wohnung ein und grillte Hamburger auf dem kleinen Balkon. Unten an der Straße erstreckten sich endlose Reihen von eingeschossigen Wohnhäusern mit Teer- und Kiesdächern und Gärten, in deren Pools sich das Wasser im Wind kräuselte. Die Abendsonne stand in gedämpftem Rot über dem Horizont, verschleiert vom Rauch eines Schwelbrands in den Everglades. Dallas zeigte mir Fotos von seiner Tochter, die er in Orlando und vor einem Riesenrad auf Coney Island aufgenommen hatte. Auf einem Bild war sie in einem Schneeanzug zu sehen, mit Hasenohren an der Kapuze. Das kleine Mädchen hatte goldfarbenes Haar, blaue Augen und ein zauberhaftes Lächeln.
„Was ist mit ihrer Mom?“, wollte ich wissen.
„Sie ist mit einem Typen abgehauen, der mit seinem Schnellboot Koks von den Inseln befördert hat. Südlich von Pine Key sind sie mit 50 Knoten gegen eine Boje geknallt. Das muss man sich mal vorstellen. Der Typ hat in Vietnam einen Cobra-Hubschrauber geflogen. Meine Frau hat immer gesagt, dass sie auf Piloten steht.“ Er wendete die Burger auf dem Grill und konzentrierte sich einen Moment lang ganz darauf.
Ich wusste, was als Nächstes kommen würde.
„Heute früh haben sie mir eine Nachricht von Whitey unter der Tür durchgeschoben. Kann sein, dass ich mit meiner Tochter abhauen muss“, sagte Dallas.
Ich machte mir ein Bier auf und lehnte mich ans Balkongeländer. In der Ferne sah ich die Lichter der Autos, die einer Biegung der Autobahn folgten. Ich nahm einen Schluck Bier und schwieg.
„Ich hab uns einen Salat gemacht“, sagte Dallas. „Gibst du ihn in zwei Schüsseln?“
Eine Weile herrschte drückendes Schweigen. „Ich hab zwei Riesen auf einem Sparbuch – die könnte ich dir leihen“, schlug ich vor, hob die Flasche an die Lippen und wartete darauf, dass er seinen Stolz beiseiteschob und seinem Selbsterhaltungstrieb folgte, wie es jeder tat, wenn er in der Klemme saß.
„Nein, danke“, erwiderte er.
Ich ließ die Flasche sinken und sah ihn überrascht an.
„So was muss man richtig anpacken“, erklärte er. „Ich muss mir die Sache gut überlegen. Whitey ist kein übler Typ, er hat nur seine …“
„Was?“
„Seine eigenen Verpflichtungen. Miami ist eigentlich eine offene Stadt. Hier gibt’s keine Auftragsmorde und keinen, der alles kontrolliert. Trotzdem mischen die New Yorker Mafiafamilien bei allen Geschäften irgendwie mit. Verstehst du, was ich meine?“
„Nicht wirklich.“ Ich wollte gar nicht wissen, wie weit Dallas in die Unterwelt von Miami verstrickt war.
„Was für ein Leben, hmm?“
„Tja“, sagte ich. „Ich hätte meinen Hamburger gern blutig, wenn’s geht.“
„Lässt sich machen.“ Er drückte das Fett aus einem Patty und kniff die Augen gegen den Rauch und die Hitze zusammen.
Vor dem Essen ging ich rein und wusch mir die Hände. An einem Haken im Badezimmer hingen Dallas’ Arbeitsklamotten, noch in der Hülle aus der Reinigung. Über der Brusttasche war das Logo eines Geldtransportdienstes eingenäht.
Dallas änderte seine Pläne und blieb in Opa Locka. Einmal sah ich ihn an einer Straßenecke mit Ernesto sprechen, dem Kleiderschrank, der den lavendelfarbenen Cadillac fuhr. Sie stiegen zusammen in den Wagen ein und fuhren weg; Dallas’ Gesicht hatte um Jahre gealtert ausgesehen. Zweimal fragte ich ihn, ob er zum Pferderennen mitkommen wolle, doch er meinte, er sei erstens pleite und würde zweitens ein Zwölf-Schritte-Programm gramm für Spielsüchtige durchziehen. „Klar vermisse ich es, aber alles geht irgendwann zu Ende, oder?“
Der Frühling kam, und ich dachte kaum noch an Dallas und seine Probleme, zumal ich selbst genug an der Backe hatte. Mithilfe von Aspirin, Vitamin B und Mundspray kämpfte ich mich durch den Vormittag, doch meine Kollegen im Miami Police Department und die Polizeischüler am College wussten, was mit mir los war. Alle bekamen mit, dass ich ständig gereizt war, dass meine Hände zitterten und ich spätestens zu Mittag meinen ersten Wodka Collins brauchte. Das Mitleid und der Abscheu in den Augen der anderen verfolgten mich bis in den Schlaf.
Drei Wochen hielt ich ohne einen Drink durch. Frühmorgens ging ich am Hollywood Beach joggen, schnorchelte bei einem Korallenriff, wo es von Anemonenfischen wimmelte, ging ins Fitnessstudio und aß regelmäßig Fisch und grünen Salat in einem Restaurant am Strand. Bald war mein Körper so hart und braun wie ein alter Sattel.
An einem Freitagabend beschloss ich spontan, mein neues Sportjackett, die blank polierten Schuhe und eine frisch gebügelte Hose anzuziehen und die Jungs in der Bar in Opa Locka zu besuchen. Ich tat so, als könnte ich ein angerissenes Streichholz in einen Benzintank schmeißen, ohne dass es irgendwelche Folgen hätte.
An dem Abend begegnete ich zum zweiten Mal dem klein gewachsenen Kerl, der als Schuldeneintreiber für Whitey Bruxal tätig war. Er stand in der offenen Tür, schaute sich im Lokal um und zwang die Leute, ihm auszuweichen. Dann ging er zum Tresen und sprach mit dem Barkeeper; ich hörte ihn Dallas’ Namen sagen. Der Barmann schüttelte den Kopf und wusch weiter Bierkrüge in der Spüle ab. Der Schuldeneintreiber gab jedoch nicht so schnell auf. Er bestellte ein 7 Up mit Eis und schälte ein hart gekochtes Ei über einer Papierserviette. Geduldig wischte er sich die kleinen Schalenreste von den Fingern, ohne den Blick von der Tür zu wenden.
Halt dich da raus, warnte eine Stimme in meinem Kopf.
Ich ging auf die Toilette, kam zurück und setzte mich wieder an meinen Tisch. Der Eintreiber salzte sein Ei, biss hinein und kaute nachdenklich, während er durch die Eingangstür auf die Straße hinausblickte, die Schuhe in die Querstange des Barhockers eingehakt. Er trug stonewashed Jeans und ein durchscheinendes gelbes Hemd. Seinen Porkpie-Hut hatte er tief in die Stirn gezogen. Sein Rücken war oben breit und unten schmal zulaufend, als wäre er in verschiedenen Kampfkünsten bewandert, und seine Gesichtshaut leuchtete hart wie Keramik.
Ich trat zu ihm an die Theke und wartete, bis er sich mir zuwandte. „Wohnen Sie in der Gegend?“, fragte ich.
„Genau“, sagte er.
„Wie war noch gleich Ihr Name?“
„Elmer Fudd. Und Sie sind …?“
„Die Plateauschuhe sind echt stark. Viele Superfly-Typen tragen so was heute. Haben Sie den Film Superfly gesehen? Da geht’s um schwarze Drogendealer und Zuhälter und weiße Gangtypen, die sich für gemachte Leute halten.“
Der Mann wischte sich die Finger an seiner Serviette ab, zupfte sich am Ohrläppchen und gab dem Barkeeper ein Zeichen. „Geben Sie Smileyface hier einen Drink – was er möchte.“
„Wissen Sie, wenn man anderen irgendwelche komischen Namen gibt, hat das was Respektloses. Ich würde fast sagen, es ist unverschämt.“
„Unverschämt?“, erwiderte der Typ und nickte nachdrücklich.
„Ja. Man gibt dem anderen zu verstehen, dass man das Recht hat, zu sagen, was man will. Das ist eine schlechte Angewohnheit.“
Wieder nickte der Mann. „Tja, im Moment warte ich gerade auf jemanden – da hätte ich gern ein bisschen Ruhe. Seien Sie so gut und spucken Sie mir nicht in die Suppe, ja?“
„Würde mir nicht im Traum einfallen“, sagte ich. „Waren Sie eigentlich in Vietnam? Dallas war dort. Er ist ein guter Junge.“
Der Schuldeneintreiber stieg von seinem Hocker, kämmte sich die Haare und ließ seinen Blick über das schiefe Grinsen in meinem Gesicht gleiten, die Bierflecken auf meinem Hemd und den Ärmeln meiner neuen Jacke. Bestimmt fiel ihm auf, dass ich mich mit dem Unterarm auf dem Tresen aufstützen musste. „Ich hab mal einen kleinen Zwangsurlaub an einem Ort verbracht – den können Sie sich nicht in Ihren schlimmsten Albträumen vorstellen“, sagte er schließlich.
„Ja, ich hab schon gehört, dass es im Raiford-Knast ein bisschen ruppig zugeht.“
Er steckte den Kamm ein und betrachtete sich einen Moment lang im Spiegel hinter der Bar. Seine Wangen waren mit winzigen Narben übersät, wie von Stichen mit einer Messerspitze. Er drückte mir eine Rolle Pfefferminz in die Hand. „Können Sie behalten. Kleines Geschenk von Elmer Fudd. Sie können’s brauchen.“
Meine Zeit in dem Austauschprogramm lief im Juni ab, und ich wollte mit guten Erinnerungen an Südflorida nach New Orleans zurückkehren. Ich mietete ein Boot und angelte vor Key West im schönsten Wasser, das ich je gesehen hatte. Es war grün und klar wie Glas, dazwischen hier und dort ein indigoblauer Pool, wie eine Wolke aus Tinte auf dem Wasser. An einem brütend heißen Tag besuchte ich Fort Jefferson, das während des Bürgerkriegs und auch danach als Gefängnis gedient hatte. Mit dem Duft des Landwinds in der Nase, der von Kuba herüberwehte, schlief ich in einem kleinen Zelt nahe des Schelfs und schaute auf das Wasser hinaus, auf das rauchgrüne Leuchten irgendwelcher namenlosen Organismen. Nach und nach verdunkelte sich die Meeresoberfläche, und am Himmel erschienen zahllose Sterne, die schon Homer zu ewig gültigen Wahrheiten inspiriert hatten.
Doch wo ich auch hinging, immer lockte in irgendeiner von Palmen beschatteten Freiluftbar ein Frozen Daiquiri, eine eisgekühlte Dose Budweiser in der Kühlbox eines Anglers oder eine Flasche Cold Duck, die eine Frau zwischen ihre Schenkel klemmte und mit einem Zischen entkorkte.
Delirium tremens hin oder her – irgendwie spürte ich, dass ich nicht so sang- und klanglos weggehen konnte.
In meiner letzten Woche in Miami fuhr ich nach Opa Locka, um meine Rechnung in der Bar zu begleichen und allen, die hier waren, um der Mittagshitze zu entfliehen, einen Drink zu spendieren. In der Kneipe war es dunkel und kühl, während draußen die Sonne gnadenlos vom Himmel brannte. Ich kippte einen Brandy mit Soda, zählte das Wechselgeld nach und wollte schon gehen. Durchs Fenster sah ich Staub auf dem Bürgersteig aufwirbeln; ein Schwarzer mit schweißnassem Oberkörper bearbeitete den Asphalt mit einem Presslufthammer. Ich nahm noch einen Brandy mit Soda und sah mir die Liefer-Speisekarte des Lokals an. Nach einer Weile warf ich einen halben Dollar in die Jukebox, ging zurück zum Tresen und schaltete ein paar Gänge hoch: ein randvolles Glas Jim Beam und ein Bier zum Nachspülen.
Um halb vier war ich sturzbetrunken. Draußen hielt auf der anderen Straßenseite ein Geldtransporter vor der Bank, ein schimmerndes kastenförmiges Fahrzeug, dessen rot-weißer Anstrich in der Hitze zu pulsieren schien. Drei bewaffnete Wachmänner stiegen aus, öffneten die Hecktür, luden große, mit Schlössern gesicherte Taschen aus dem Wagen und stellten sie auf dem Bürgersteig ab. Einer der Sicherheitsmänner war Dallas Klein.
Ich ging hinaus, überquerte die Straße, meinen Drink in der Hand, und schirmte mit der anderen die Augen vor der glühenden Sonne ab.
„Wo hast du gesteckt, Kumpel?“, fragte ich. „Ich hab so lange für uns beide gebechert.“
Dallas stand im Schatten des Bankhauses, mit großen Schweißflecken in den Achseln seines grauen Hemds. „Ich bin im Dienst, Dave. Ich ruf dich an.“
„Wann hast du Feierabend?“
„Hau ab, Mann, ich hab zu tun.“
„Was hast du gesagt?“
„Das hier ist eine Sicherheitszone. Du kannst hier nicht rumstehen.“
„Du hast da was vergessen, Partner. Ich bin Polizist.“
„Hackedicht bist du. Jetzt hör auf, dich zum Narren zu machen, und geh zurück in die Bar.“
Ich drehte mich um und ging zurück zum Eingang, die Sonne wie heißes Wachs auf meiner Haut. Ich blickte über die Schulter zurück und sah, wie Dallas die mit Geld gefüllten Taschen in die Bank trug. Mein Gesicht fühlte sich zusammengekniffen an, die Haut wie tot, gefriergetrocknet trotz der Hitze.
„Stimmt irgendwas nicht, Dave?“, fragte der Barkeeper.
„Ja. Mein Glas ist leer“, entgegnete ich. „Einen doppelten Beam und ein Bier.“
Während er mir aus einer Bourbon-Flasche einschenkte, tupfte ich mir mit einer Serviette den Schweiß aus den Augen, während Dallas’ Beleidigung mir immer noch in den Ohren hallte. Ich schaute durchs Fenster hinaus, wo die Szene plötzlich surreale Züge annahm. Was immer ich mir von diesem Tag erwartet hatte – es war weit entfernt von dem, was da draußen vor sich ging. Wie aus dem Nichts tauchte ein weißer Van auf und hielt direkt hinter dem Geldtransporter. Vier Männer mit abgesägten Schrotflinten sprangen auf den Bürgersteig, alle in Arbeitsklamotten, Haare und Gesichter unter beigefarbenen Strümpfen verborgen.
„Ruf schnell 911 an!“, forderte ich den Barkeeper auf. „Sag denen, da ist ein bewaffneter Raubüberfall im Gang, und gib die Adresse an.“
Ich zog die .25er Automatik aus dem Knöchelholster. Als ich mich vom Barhocker schwang, schien eine Seite des Raumes unter meinem Fuß wegzukippen.
„Ich würde da nicht rausgehen“, warnte der Barkeeper.
„Ich bin ein Cop“, erwiderte ich.
Irgendwie hatte ich gehofft, dass mein entschlossenes Auftreten etwas an meinem momentanen Zustand ändern würde. Doch in den Augen des Barmanns sah ich eine traurige Gewissheit, an der noch so hochtrabende Worte nichts ändern konnten. Unsicheren Schrittes ging ich zur Tür und riss sie auf. Die Außenwelt brach mit einem Schwall heißer Luft und Kohlenmonoxid über mich herein. Die Straße, die ich vor mir sah, gehörte nicht mehr zu Südflorida. Für mich befand sie sich irgendwo in der Wüste, die von Aasvögeln, Kojoten und Schmeißfliegen bevölkert war. Es war der Ort, der uns alle erwartet und den wir in die hintersten Winkel unseres Unterbewusstseins verbannen. Die .25er in meiner Hand fühlte sich so klein und leicht wie eine Spielzeugpistole an.
Ich ging hinter einer der arabischen Säulen in Position und drückte die Pistole gegen den Stein, um meine Hand zu stabilisieren. „Polizei!“, rief ich. „Die Waffen weg und mit dem Gesicht nach unten auf den Boden!“
Doch die Männer, die den Geldtransporter ausraubten, beachteten mich kaum, schauten nur kurz in meine Richtung wie auf ein kleines Ärgernis, das man am besten ignorierte. Es war klar, dass das Timing des Überfalls misslungen war. Der Van war um Sekunden zu spät eingetroffen, sodass die Wachmänner noch Zeit hatten, die ersten Taschen in die Bank zu tragen. Die Sicherheitsleute des Geldtransporters knieten beim Bankhaus, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Die Täter mussten nur noch die Taschen einsammeln, die in Reichweite waren, aus Opa Locka verschwinden und den höchstwahrscheinlich gestohlenen Van irgendwo abstellen. Wenige Minuten später konnten sie in der Anonymität der Stadt untertauchen. Doch einen der Kerle hatte anscheinend die Gier gepackt. Er lud seine Schrotflinte durch und lief in die Bank, um die Taschen zu holen, die man bereits hineingetragen hatte.
Ein Bankangestellter war gerade dabei, die Tresortür zu schließen. Der Bewaffnete streckte ihn aus nächster Nähe mit einer Schrotladung nieder.
Der Schütze kam mit zwei blutbefleckten Taschen aus der Bank.
„Auf den Boden, hab ich gesagt! Los, ihr Scheißkerle!“, brüllte ich.
Einer der Täter jagte eine Schrotladung in die Säule und die Metalltür der Bar. Eine zweite Ladung schlug in ein Fenster ein. Dann nahmen sie mich alle zugleich unter Beschuss, wirbelten Staub und Steinbrocken auf.
Ich duckte mich hinter die Säule und rührte mich nicht von der Stelle, bis ich jemanden rufen hörte: „Los, los, los!“ Dann wurden die Türen des Vans zugeknallt.
Die sind weg, dachte ich. Doch es war noch nicht vorbei. Als der Van anfuhr, hörte ich einen der Täter vom Beifahrersitz aus etwas zu Dallas sagen. „Du bist ’ne Witzfigur“, rief der Kerl ihm zu.
Dann steckte er seine Schrotflinte durchs offene Fenster und schoss meinem Freund Dallas Klein den halben Kopf weg.
2
Der Raubüberfall und der Doppelmord wurden nie aufgeklärt. Ich erzählte dem FBI und den Behörden des Dade County alles, was ich über Dallas Kleins Beziehung zu Whitey Bruxal, dem Buchmacher, und seinen drei Schuldeneintreibern wusste, die Dallas wegen einer offenen Rechnung über 16 000 Dollar unter Druck gesetzt hatten. Doch es kam nichts dabei heraus. Die drei Eintreiber hatten wasserdichte Alibis, teure Anwälte und gaben sich ahnungslos. Whitey Bruxal reiste freiwillig aus New Jersey an und ließ sich dreimal befragen, ohne einen Rechtsbeistand in Anspruch zu nehmen. Ich musste erkennen, dass meine Aussage über Dallas’ Spielschulden für die Behörden ungefähr so glaubwürdig klang, als wäre sie von irgendeinem Säufer oder Junkie gekommen. Sie sagten es mir bloß nicht ins Gesicht.
Ich beendete meine kurze Mitarbeit bei den Behörden in Florida, ging zum ersten Mal zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker, die unter Kokospalmen am Strand von Fort Lauderdale stattfand, und flog noch am selben Tag nach New Orleans zurück.
Das alles liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Aus meiner Sicht hatte Dallas einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und am Ende alles verloren. Es war mir nicht gelungen, die Täter aufzuhalten, aber ich hatte es wenigstens versucht. Ich war nicht schuld an seinem Tod, sagte ich mir. Nach einigen Jahren beim New Orleans Police Department wurde ich gefeuert – vielleicht aus eigener Schuld, vielleicht auch nicht. Es war mir im Grunde auch egal. Immerhin war ich trocken, als ich nach New Iberia in Louisiana zurückkehrte, die kleine Stadt am Bayou Teche, in der ich geboren war. Dort fing ich noch einmal von vorne an. Jedes Baseballspiel fängt mit dem ersten Inning an, sagte ich mir. Und damit lag ich zur Abwechslung einmal richtig.
Heute bin ich Detective im Iberia Parish Sheriff’s Department und lebe von meinem bescheidenen Gehalt am Bayou Teche. Mit meiner Frau Molly, einer ehemaligen Nonne, bewohne ich ein kleines Haus im Schatten von Eichen, die mindestens 200 Jahre alt sind. Von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, habe ich es mit wenig spektakulären Fällen zu tun. Doch letztes Frühjahr, um die Zeit, als die Azaleen zu blühen begannen, kam mir an einem trägen Nachmittag etwas unter, dessen Tragweite erst später deutlich wurde – ein Fall wie viele, die irgendwann in einem Aktenschrank enden oder von denen man hofft, dass eine Bundesbehörde sich ihrer annimmt. Die Routineermittlung, die wir damals aufnahmen, erinnerte mich später an das leichte Beben, das durch einen Flugzeugrumpf geht, bevor Öl aus dem Triebwerk austritt und das Fenster verschmiert, durch das man auf die Wolken schaut.
An jenem Nachmittag kam ein Anruf von einer Fernfahrerraststätte herein. Eine Frau war während eines Reifenwechsels ins Casino gegangen und hatte zuerst einen 100-Dollar-Schein aus der Geldbörse gezogen, es sich dann aber anders überlegt und dem Angestellten einen Fünfziger gegeben.
„Sorry, ich hab nicht gesehen, dass ich es auch kleiner habe.“
„Der Hunderter ist kein Problem“, meinte der Angestellte.
„Nein, ist schon okay“, erwiderte die Frau.
Der Mann sah, dass die Kundin in ihrer Geldbörse zwei 100-Dollar-Scheine mit roten Farbspuren an den Rändern hatte.
Ich parkte den Streifenwagen vor der Raststätte und betrat das Casino durch eine Seitentür. An einem Pokerautomaten sah ich eine blonde Frau sitzen, die gerade einen 5-Dollar-Schein einschob. Bekleidet war sie mit Jeans und einem gelben Cowboyhemd. Sie trank einen Kaffee und betrachtete nachdenklich die Reihe der elektronischen Karten auf dem Bildschirm.
„Ich bin Detective Dave Robicheaux vom Iberia Parish Sheriff’s Department“, stellte ich mich vor.
„Hallo“, sagte sie und drehte sich zu mir um. Ihre Augen waren strahlend blau und ohne erkennbare Angst oder Misstrauen.
„Sie haben in Ihrer Brieftasche Geldscheine, die wir uns möglicherweise genauer ansehen müssen“, erklärte ich.
„Wie bitte?“
„Sie wollten dem Angestellten einen 100-Dollar-Schein geben. Könnte ich den bitte sehen?“
„Klar“, sagte sie lächelnd und nahm ihre Geldbörse aus der Handtasche. „Ich hab sogar zwei. Suchen Sie vielleicht nach gefälschten Banknoten oder so was?“
„Das müssen die Feds klären.“ Ich nahm ihr die Geldscheine aus der Hand. „Woher haben Sie die?“
„Von einem Casino in Biloxi“, sagte sie.
„Ich würde mir gern die Seriennummer notieren. Und könnte ich vielleicht Ihren Ausweis sehen?“
Sie gab mir ihren in Florida ausgestellten Führerschein. „Ich lebe heute in Lafayette. Ich kriege doch deswegen keinen Ärger, oder?“ Sie schaute zu mir auf mit ihren blauen Augen, die nichts zu verbergen schienen.
„Können Sie mir irgendein Dokument mit Ihrer Adresse in Lafayette zeigen? Ich bräuchte auch eine Telefonnummer, für den Fall, dass wir Sie erreichen müssen.“
„Was stimmt nicht mit diesen Scheinen?“, fragte sie.
„Manchmal wird zwischen Geldbündeln ein Sicherheitspäckchen versteckt, das im Fall eines Diebstahls explodiert und rote Farbe freisetzt, die die Scheine für die Bankräuber unbrauchbar macht.“
„Das heißt, dass diese Scheine vielleicht gestohlen wurden?“ Sie reichte mir eine Quittung über die Zahlung einer Kaution für eine Wohnung in Lafayette.
„Wahrscheinlich nicht. Die Farbe kann auch anders auf die Scheine gelangt sein. Sie heißen Trish Klein?“
„Ja. Ich bin erst vor Kurzem von Miami hergezogen.“
„Kennen Sie zufällig einen gewissen Dallas Klein?“
Sie sah mich mit großen Augen an, doch ihre Gedanken blieben mir verborgen. „Warum fragen Sie mich das?“
„Ich habe mal jemanden gekannt, der so hieß. Er war als Hubschrauberpilot in Vietnam und hat auch in Miami gelebt.“
„Das war mein Vater“, sagte sie.
Ich notierte mir ihre Adresse und Telefonnummer und gab ihr die Quittung zurück. „Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Ms. Klein. Ihr Dad war ein guter Mann“, sagte ich.
„Waren Sie mit ihm in Vietnam?“
„Ja.“ Ich schaute an ihrer Schulter vorbei auf den Pokerautomaten. „Sie haben vier Könige. Willkommen in Louisiana.“
Auf dem Weg zurück zur Dienststelle fragte ich mich, warum ich ihr nicht erzählt hatte, dass ich in Miami mit ihrem Vater befreundet gewesen war. Aber vielleicht waren diese alten Erinnerungen zu unangenehm, um sie wiederaufleben zu lassen. Die Frau hatte wahrscheinlich keine Ahnung, dass ihr Vater damals keinen anderen Ausweg gesehen hatte, als Beihilfe zu einem Raubüberfall zu leisten, falls es sich tatsächlich so zugetragen hatte. Warum sollte ich Dallas’ Tochter damit belasten?, fragte ich mich.
Vielleicht irrte ich mich aber, und sie wusste mehr, als sie zugeben wollte. Sie hatte einen Moment gezögert, bevor sie mir erzählt hatte, dass Dallas Klein ihr Vater war. Wie jeder Ermittler weiß, hat es immer etwas zu bedeuten, wenn Zeugen, Verdächtige oder unbeteiligte Personen zögern, bevor sie auf eine Frage antworten. Meist überlegen sie in so einem Fall, ob sie eine Information für sich behalten oder mit einer glatten Lüge reagieren sollen.
Als ich ins Department zurückkam, berichtete mir Wally, unser Mann in der Einsatzleitstelle, dass unten am Bayou, zwischen ein paar Häusern ein Stück flussaufwärts der Zuckerfabrik, jemand durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen war. Ich gab einem Detective im Raubdezernat die Seriennummern der verdächtigen Geldscheine und bat ihn, sie ans Finanzministerium weiterzuleiten. Dann versuchte ich das Bild aus meinen Gedanken zu verbannen, wie Dallas Klein auf dem Bürgersteig kniete, die Hände hinter dem Kopf verschränkt.
Unser Sheriff im Iberia Parish war Helen Soileau. Sie hatte ihre Laufbahn als Politesse beim NOPD begonnen, arbeitete später als Streifenpolizistin im Desire Project und in Gird Town und schließlich in der Drogenfahndung im French Quarter. Sie trug zumeist Jeans und hatte die Haltung und Statur eines athletischen Mannes, was ihr eine ganz eigene androgyne Schönheit verlieh. Ihr Gesicht konnte etwas Warmes und Sinnliches ausstrahlen, um Augenblicke später einen völlig anderen Ausdruck anzunehmen. Es kam vor, dass jemand, der sie auf einem Foto sah, sie auf einem anderen nicht wiedererkannte.
Ich bewunderte Helen – mehr noch, ich liebte diese Frau. Sie war grundehrlich und loyal, und sie kannte keine Angst. Wer ihr respektlos begegnete, tat das ein Mal und nie wieder.
Vor einigen Jahren hatte sie eine Bar besucht, die einem Mistkerl namens Jimmy Dean Styles gehörte, der später ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigen und ermorden sollte. Styles stand mit einer Flasche Schokomilch hinter dem Tresen und erzählte Helen beiläufig, dass er mitgehört habe, wie ein paar ihrer männlichen Kollegen sich bei McDonald’s an der East Main Street sich über sie lustig gemacht hätten. Er persönlich, fügte er hinzu, halte sie für „eine eiserne Lesbe, die sich von niemandem blöd kommen lässt“.
Dann setzte er mit einem boshaften Funkeln in den Augen die Schokomilchflasche an die Lippen.
Helen zückte ihren Schlagstock so schnell, dass er nicht einmal mehr zusammenzucken konnte, bevor Glas, Schokomilch und Blut in seinem Gesicht explodierten. Dann warf Helen ihre Visitenkarte auf den Tresen und sagte: „Schönen Tag noch. Rufen Sie mich an, wenn ich sonst noch was für Sie tun kann.“ So war Helen Soileau.
Ich klopfte an die Tür ihres Büros und öffnete sie. „Wally sagt, wir haben einen Mordfall bei der Zuckerfabrik?“
„Der Notruf kam erst vor einer Viertelstunde. Der Rechtsmediziner sollte schon dort sein. Wo warst du?“
„Bei der neuen Raststätte sind zwei Geldscheine mit Farbe dran aufgetaucht. Wer ist das Opfer?“
Sie schaute auf ihren Notizblock. „Yvonne Darbonne. Sie hat als Kellnerin im Victor’s gearbeitet. Kennst du sie?“
„Ja, ich glaube schon. Ihr Dad hatte mal eine Zuckerrohrfarm und hat später eine Bar am Bayou betrieben.“
„Okay, fahr schon mal den Wagen vor. Wir wollen mal sehen, womit wir’s zu tun haben“, sagte Helen.
Unser Weg führte durch die Innenstadt, über die Zugbrücke an der Burke Street und wieder zurück auf die andere Seite des Bayou. Dort folgten wir der Straße bis zu einer riesigen Zuckerfabrik, die einem fast den Blick auf den Himmel verstellte. Wenn die Mühlen auf Hochtouren liefen, sah man abends die Lichter und die weißen Dampfwolken kilometerweit. Fast fühlte man sich an mittelalterliche Darstellungen von Dantes Vision des Jenseits erinnert.
Zwischen der Zuckerfabrik und dem Bayou erstreckte sich eine Siedlung von alten Werkswohnhäusern. Im Winter wehte der Nordwind den Gestank und den Kohlenstaub der Fabrik direkt zu den Häusern. In den Vorgärten aus festgestampfter Erde waren Wäscheleinen gespannt, da und dort waren zerbrochene Fenster notdürftig mit Klebestreifen und Plastiktüten repariert. Als wir hinkamen, waren bereits zwei Chemiker der Spurensicherung, der Rechtsmediziner, drei Streifenwagen und ein Krankenwagen am Tatort.
„Wer hat die Tote gefunden?“, fragte ich Helen, als wir einen Regengraben überquerten und in der Auffahrt hielten.
„Eine Nachbarin hat den Schuss gehört. Sie hat ihn zuerst für einen Böller gehalten, dann hat sie aus dem Fenster geschaut und das Mädchen auf dem Boden liegen gesehen.“
„Hat sie sonst jemanden gesehen?“
„Angeblich hat sie ein Auto wegfahren gehört, aber gesehen hat sie niemanden.“
Der Vater des Mädchens, Cesaire Darbonne, war gerade eingetroffen. Trotz seiner knapp 70 Jahre war er ein schlanker, adretter Mann mit sorgfältig gescheiteltem stahlgrauem Haar und blassen türkisfarbenen Augen. Seine Haut war braun und glatt, ein Arm war mit weißen Narben übersät, die wie kleine, unregelmäßig geformte Herzen aussahen. Der Mann war völlig fertig.
Zwei Cops mussten ihn daran hindern, zu seiner Tochter zu laufen, die hinter dem Haus lag. Sie führten ihn zu einem Streifenwagen. Nachdem er sich auf den Beifahrersitz gesetzt hatte, blieben sie vor der offenen Tür stehen, damit er nicht wieder ausstieg. „Das is mein kleines Mädchen. Morgen hat sie Geburtstag. Wer kann meinem Mädchen so was antun? Sie is doch erst 18“, murmelte er.
Die Antwort auf seine Frage hätte ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Seine Tochter lag im Gras vor einer offenen Holzgarage, ihr Körper zu einem Fragezeichen gekrümmt. Sie trug einen beigefarbenen Rock, Tennisschuhe ohne Socken und ein T-Shirt mit einem geflügelten Pferd auf der Brust. Neben ihrer Hand lag ein blauschwarzer .22er Revolver mit Griffschalen aus Walnussholz. Die Eintrittswunde befand sich mitten in der Stirn. Eine Strähne ihres dunkelroten Haars hing quer über ihr Gesicht.
Ich ging neben ihr in die Hocke und hob den Revolver auf, indem ich einen Bleistift in den Abzugsbügel schob. Die Trommel schien mit Magnum-Patronen geladen zu sein, nur die Kammer vor dem Schlagbolzen war leer. Einen knappen Meter entfernt lag ein Handy im Gras. Helen reichte mir einen Ziplock-Beutel für Beweismittel. „Schmauchspuren?“, fragte sie.
„Jede Menge“, sagte ich.
Helen hockte sich zu mir, die Unterarme auf die Knie gestützt, das Gesicht gesenkt. „Hast du schon mal erlebt, dass eine Frau sich ins Gesicht schießt?“
„Nein, aber Selbstmörder sind nun mal in einer Extremsituation“, erwiderte ich.
Helen richtete sich auf und kaute an einem Grashalm. Die Sonne verschwand hinter einer Wolke, und der auffrischende Wind wehte den schweren Geruch des Bayou herauf. „Pack das Handy ein und bring es ins Labor. Wir müssen herausfinden, mit wem sie zuletzt gesprochen hat. Hat ihr Vater noch mehr Kinder?“
„Soweit ich weiß, war Yvonne ein Einzelkind“, sagte ich.
„Bist du bereit, mit ihm zu sprechen?“, fragte sie.
„Nicht wirklich.“ Ich erhob mich, und meine Knie knackten wie die eines Mannes, der viel zu alt war für die Aufgabe, die ihm bevorstand.
Helen und ich traten zu Mr. Darbonne, der immer noch im Streifenwagen saß. Seine Khakihose war makellos sauber, das Jeanshemd frisch gebügelt. Er schaute zu uns auf, als könnten wir ihm etwas sagen, das etwas an dem Schicksalsschlag zu ändern vermochte, der ihn wie ein Asteroid getroffen hatte. Ich sprach ihm unser Beileid aus, doch meine Worte schienen nicht zu ihm durchzudringen.
„Mit wem war Ihre Tochter heute zusammen, Mr. Darbonne?“, fragte ich ihn.
„Sie war auf der Uni, um sich zu informieren. Sie wollt’ diesen Sommer anfangen“, erklärte er, bis ihm klar wurde, dass das meine Frage nicht beantwortete. „Ich weiß nicht, wen sie getroffen hat.“
„Hatte sie einen Freund?“, wollte ich wissen.
„Ich glaube schon. Sie hat sich immer in der Stadt mit ihm getroffen. Hat mir aber nicht verraten, wer er war.“
„War sie in letzter Zeit irgendwie deprimiert oder verstört?“, fragte Helen.
„Nein, sie war eigentlich immer fröhlich. Ein braves Mädchen. Hat nich’ geraucht und nich’ getrunken. Hatte nie irgendwelchen Ärger. Ich war heute in Jeanerette auf Arbeitssuche. Wenn ich daheimgeblieben wär …“ Seine Augen wurden feucht.
„Hatte Ihre Tochter eine Pistole?“, hakte ich nach.
„Was hätt sie mit ’ner Pistole anfangen sollen? Sie hat Bücher gelesen, wollt’ Journalismus und Geschichte studieren. Sie hat ein Tagebuch geführt und ist oft ins Kino gegangen.“
Helen und ich schauten uns an. „Könnten Sie uns ihr Zimmer zeigen, Sir?“, fragte ich.
Die Holzböden im Haus waren frisch geschrubbt, die Möbel abgestaubt, die Küche sauber und aufgeräumt, das Geschirr abgewaschen, die Betten gemacht. Eine alte violette Couch stand dem kleinen Fernseher gegenüber. Auf den Armlehnen lagen Spitzendeckchen. Auf dem Flur zeigte ein an den Ecken vergilbtes Foto den Vater auf einem Jagdausflug, umgeben von Freunden mit Segeltuchjacken, Kappen und Gummistiefeln. Vor ihren Füßen waren tote Enten in einem großen Halbkreis angeordnet. Yvonnes Frisierkommode und Regale waren voll mit Stofftieren und abgegriffenen Taschenbüchern. Auch ein paar aus der Stadtbücherei entliehene Bücher waren dabei, darunter Silbermond und Kupfermünze von William Somerset Maugham und Der scharlachrote Buchstabe von Nathaniel Hawthorne.
„Wir würden uns gern ihr Tagebuch ansehen, Sir“, sagte ich. „Ich verspreche Ihnen, dass wir es zurückbringen.“
Er zögerte einen Moment lang. Dann wandte er sich von mir ab und schaute aus dem Fenster. Zwei Sanitäter hoben eine Trage in den Krankenwagen, auf der der Leichensack mit den sterblichen Überresten von Yvonne Darbonne festgeschnallt war. Der Mensch, als der sie heute früh aufgewacht war, war nicht mehr da. Cesaire Darbonne sprang auf und wollte zur Tür rennen.
„Tun Sie das nicht, Sir“, sagte Helen und trat ihm in den Weg. „Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Ihre Tochter mit Respekt behandelt wird.“
Er drehte sich um und fing an zu weinen. „Sie hat sich mit dem Jungen in der Stadt getroffen, weil sie sich für ihr Zuhause geschämt hat. Einmal ist sie spätabends vom Bowling zu Fuß nach Hause gegangen, die Autos sin’ mit 100 Sachen an ihr vorbeigepfiffen. Das Problem war, ich hab einfach keine Arbeit gefunden. 40 Jahre lang hab ich Zuckerrohr gepflanzt, aber jetzt ist es schwer.“
Bevor wir gingen, sprachen wir noch mit der Nachbarin, die gemeldet hatte, dass sie „Schüsse gehört“ habe. Sie war in den Fünfzigern und gehörte der recht vielfältigen Bevölkerungsgruppe an, die unter dem Begriff „Kreolen“ zusammengefasst wird. Ursprünglich verstand man darunter die Nachkommen von Europäern, heute bezeichnet man als Kreolen auch Menschen mit gemischten Wurzeln, die europäisch, indigen oder afrikanisch sein können. Die Frau namens Narcisse Ladrine gab an, nichts von der Tat gesehen zu haben – auch kein wegfahrendes Auto oder eine Person, die den Tatort verlassen hatte.
„Aber sie haben ein Auto wegfahren gehört?“, fragte ich nach.
„Ich bin mir nicht sicher.“ Sie trug ein bedrucktes Kleid, das ihren Körper wie ein Kartoffelsack umschloss und so ausgewaschen war, dass die Unterwäsche durchschimmerte.
„Denken Sie nach“, drängte ich. „Hat es nach einem Truck geklungen? War es laut? Vielleicht war der Auspuff rostig?“
„Wenn Sie einen Schuss hören, horchen Sie nicht auf irgendwelche anderen Geräusche.“
Da hatte sie wohl recht. „Haben Sie irgendwen auf der Straße gesehen?“, erwiderte ich.
„Ein Schwarzer war mit dem Fahrrad unterwegs und hat Flaschen und Dosen aus dem Graben geholt.“ Sie überlegte einen Augenblick. „Nee, das war viel früher. Als der Schuss fiel, hab ich niemanden gesehen.“
Wir gingen ein Stück die Straße hinauf und fragten beim Sicherheitsbüro der Zuckerfabrik nach. Auch dort hatte niemand etwas Auffälliges bemerkt. Die Sicherheitsleute hatten noch nicht einmal gewusst, dass sich hier ein Tötungsdelikt ereignet hatte.
Als wir zur Dienststelle zurückfuhren, prasselte ein heftiger Schauer auf den Streifenwagen ein und bedeckte die Straße binnen Minuten mit Hagelkörnern. Zurück im Büro, begann ich mit dem Papierkram, den ein solcher Todesfall mit sich brachte. Ich dachte überhaupt nicht mehr an die Sache mit den Farbflecken auf den 100-Dollar-Scheinen im Besitz von Trish Klein, der Tochter meines ermordeten Kumpels aus Miami. Kurz vor Feierabend kam Helen zur mir ins Büro. „Wir sind mit dieser Seriennummer einen Schritt weitergekommen“, berichtete sie. „Die Scheine stammen von einem Banküberfall in Mobile.“
Ich hatte mir insgeheim ein anderes Ergebnis erhofft. „Morgen werden ich noch einmal mit der Frau sprechen.“
„Das ist noch nicht alles“, fuhr Helen fort. „Die Geldscheine von dem Bankraub sind überall entlang der Golfküste in Casinos und bei Pferderennen aufgetaucht.“
„Trish Klein sagt, sie habe ihre Scheine von einem Casino in Biloxi.“
„Es gibt da noch ein interessantes Detail“, fügte Helen hinzu. „Die Spezialisten im Finanzministerium gehen davon aus, dass die Mafia diese Bank zur Geldwäsche benutzt hat. Die Schlaumeier wurden von Bankräubern abgezockt, die keine Ahnung hatten, was da lief. Was wissen wir über diese Trish Klein?“
Ich erzählte ihr von dem Mord an Dallas Klein, der sich vor vielen Jahren in Opa Locka, Florida, zugetragen hatte. Durch mein Fenster im ersten Stock beobachtete ich, wie der Regen auf die Familiengruften im St. Peter’s Cemetery niederprasselte.
„Warst du dabei, als er starb?“, fragte Helen.
„Ja, war ich.“ Meine Stimme klang ein wenig heiser.
„Okay, dann schließ unseren Anteil an der Sache ab und übergib sie den Feds. Ist das für dich in Ordnung?“
„Absolut.“
Um fünf Uhr fuhr ich nach Hause und parkte meinen Pick-up unter dem Carport des Hauses, in dem Molly und ich wohnen und das sich im sogenannten historischen Viertel von New Iberia befindet. Im Vergleich zu den Häusern im viktorianischen Stil und den Vorkriegsvillen, die das Bild an der East Main Street beherrschen, wirkt unser Heim bescheiden – dennoch ist es ein hübsches altes Haus, aus dem Holz von Eichen und Zypressen gebaut, lang gezogen und rechteckig wie ein Güterwagen, mit hohen Decken und Fenstern, einer kleinen Galerie, einem Blechdach und grünen Fensterläden, die wir schließen, wenn ein Hurrikan aufzieht.
Im Blumengarten blühen Azaleen, Lilien, Hibiskus, Philodendron und Rosen in der Sonne, sowie Kaladien und Hortensien im Schatten. Das Grundstück ist von Pecannussbäumen, Kiefern und immergrünen Eichen bedeckt, der hintere Teil fällt zum Teche hin ab, wo noch spätabends Frachtkähne und Schlepper mit grünen und roten Lichtern die Zugbrücke an der Burke Street passieren und nach Morgan City fahren. Frühmorgens hängt oft Nebel in den Bäumen und über dem Bayou, in dem man manchmal einen Alligator platschen hört, oder Enten, die sich im seichten Wasser tummeln.
Unser alter dreibeiniger Waschbär Tripod bewohnt eine Hütte hinter dem Haus. Sein Gefährte ist ein nicht kastrierter stämmiger Kater namens Snuggs. Seine angeknabberten Ohren und die Narben unter dem kurzen weißen Fell trägt er wie Ehrenzeichen. Hunde duldet er in unserem Garten nur, wenn auch Tripod nichts gegen sie einzuwenden hat.
Unsere Nachbarin, Miss Ellen Deschamps, ist eine 83-jährige Absolventin eines Mädchenpensionats in Mississippi, die jede streunende Katze füttert, die ihr über den Weg läuft. Sie hat etwas gegen Leute, die ihren Müll achtlos in die Landschaft kippen. Einmal hat sie einem Mann einen Sack Karotten über den Schädel gezogen, weil dieser den Aschenbecher seines Autos auf dem Winn-Dixie-Parkplatz entleert hatte. Unseren Waschbären betrachtet sie zwar als Eindringling, was sie jedoch nicht daran hindert, ihn ebenfalls zu füttern. Morgens sehe ich Miss Ellen durch den Bambus, der unsere Grundstücke voneinander trennt, wie sie sich um ihre Katzen kümmert oder im Garten arbeitet, die großen Taschen ihrer Schürze voll mit Werkzeug und Tierfutter. Allein diese alte Frau dabei zu beobachten, wie sie ihrer täglichen Arbeit nachgeht, versöhnt mich ein Stück weit mit der Welt.
Unser kleines Fleckchen an der East Main ist ein schöner Platz zum Leben, und die Frau, mit der ich ihn teile, ist einer der seltenen Menschen, die sich durch Mut, Zähheit und Leidenschaft auszeichnen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Vor unserer Heirat hatte sie als Schwester Molly Boyle für den Maryknoll-Missionsorden in Guatemala gearbeitet, wo die indigene Bevölkerung von der Armee massakriert worden war, um den linksgerichteten Rebellen eine Lektion zu erteilen. Später unterstützte sie die Zuckerrohrarbeiter im St. Mary Parish dabei, sich zu organisieren, und schuf Behausungen für die Armen. Bis sie schließlich ihren Orden verließ, einen alkoholgefährdeten Detective der Mordkommission heiratete, der in seiner Laufbahn wiederholt durch Gewaltausbrüche aufgefallen war, und sich mit ihm am Bayou Teche niederließ – zusammen mit Tripod, Snuggs und seiner Adoptivtochter Alafair, die am Reed College in Portland Psychologie und Englisch studierte.
„Was gibt’s Neues, Trooper?“, fragte sie, als ich zu ihr in die Küche kam.
Sie war gerade dabei, Salat zu waschen und zu zerkleinern. Ihr dunkelrotes Haar trug sie kurz geschnitten, Hals, Arme und Schultern waren von Sommersprossen gefleckt. Ihr Vater hatte als Sergeant in der Army gedient und später als Polizeibeamter in Port Arthur, Texas, gearbeitet. Sie sprach oft und mit großer Zuneigung von ihm, und ich vermutete, dass sie ihre geradlinige Art und ihre Vorliebe, mit den Händen anzupacken, von ihm hatte.
Ich streichelte ihr über den Hals und die Haarspitzen und drückte sanft ihre Schultern. Mollys Haare hatten den gleichen roten Farbton wie die des toten Mädchens bei der Zuckerfabrik, doch ich versuchte, das Bild der Schusswunde in der Stirn aus meinen Gedanken zu verdrängen. Molly drehte sich um und sah mich an. Es war manchmal nicht leicht, ihrem wachen, forschen Blick standzuhalten. „War irgendwas heute?“, wollte sie wissen.
„Ein Mädchen wurde tot bei der Zuckerfabrik gefunden. Yvonne Darbonne. Sie wollte gerade mit dem Studium anfangen.“
„Hast du sie gekannt?“
„Ihren Vater kenne ich. Er hat vor Jahren seine Farm verloren.“
„Wurde sie ermordet?“
„Es sieht nach Selbstmord aus, aber …“
„Was?“
„Nichts. Ich helf dir mit dem Essen“, sagte ich und nahm Schüsseln aus dem Schrank.
Als die Sonne unterging, hatte es aufgehört zu regnen, und ich schlenderte allein zum Bayou hinunter. Im Westen zeigte sich der Himmel im zarten Pink eines Flamingoflügels. Die Luft war schwer und feucht, doch sie roch sauber und frisch. Tropfen fielen von den Bäumen auf die Wasseroberfläche und bildeten kleine Ringe, die mit der Strömung davontrieben. Die friedliche Abendstimmung und das sanfte Tröpfeln vermochten jedoch das Bild von Yvonne Darbonne nicht aus meinen Gedanken zu vertreiben, wie sie tot auf dem Boden lag, die roten Haarsträhnen vor dem Gesicht vom Wind zerzaust.
Es gibt verschiedene Kategorien von Selbstmördern. Manche inszenieren eine Art Psychodrama als Hilferuf und gehen dabei einen Schritt zu weit. Die schwer Depressiven nehmen sich das Leben oft in einer verschlossenen Garage oder schlucken Tabletten mit Alkohol und lassen dazu eine bestimmte Musik laufen, zum Beispiel den Boléro von Ravel oder Clair de Lune von Debussy. Die Jumper‘, die ihrem Leben durch einen Sprung aus großer Höhe ein Ende setzen, warten manchmal auf Publikum, ehe sie zwischen den Sternen hinabsegeln. Manche Selbstmörder malen sich ganze Szenarien aus, wie jemand ihre Leiche findet und für den Rest seiner Tage von Schuldgefühlen und Trauer geplagt wird.
Jene jedoch, die eine Schusswaffe benutzen oder sich mit einer Rasierklinge die Pulsader aufschneiden, sind oft von einer unbezähmbaren Wut auf sich selbst getrieben. Frauen gehören nur selten zu denen, die eine Schusswaffe benutzen.
Waren Cesaire Darbonnes Angaben über seine Tochter zutreffend? Hatte sie wirklich nicht geraucht oder getrunken? War sie ein fröhliches Mädchen gewesen? Was konnte einen jungen, vielversprechenden Menschen dazu bringen, sich eine Kugel in die Stirn zu schießen? Oder konnte es sein, dass sie nicht allein am Tatort gewesen war?
Am nächsten Tag trottete Koko Hebert, unser Rechtsmediziner, in mein Büro. Selten hatte ich einen Menschen gesehen, der etwas so Trauriges und Trübsinniges ausstrahlte wie er. Sein Körper hatte die Form einer Pyramide mit abgerundeten Kanten. Er stank nach Zigarettenrauch und Bierschweiß, und manchmal hatte er einen noch schlimmeren Geruch an sich, der mich an ein Leichenschauhaus in Vietnam erinnerte, nachdem der Strom ausgefallen war.
Kokos Zynismus und seine Verbitterung waren mehr als offensichtlich. Sein Sohn war im Irak gefallen, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sein schroffes, wenig einnehmendes Auftreten so etwas wie ein versteckter Hilferuf sein mochte.
Draußen vor meinem Fenster war das Gras grün und die Sonne schien, doch wenn Koko seinen Hintern auf einen Stuhl vor meinem Schreibtisch platzierte, wirkte es wie eine Sonnenfinsternis. Er nahm einen langen Zug von seiner Zigarette und warf die Stirn in Falten, als wäre das Inhalieren krebserregender Substanzen eine Sache von metaphysischer Tiefe.
„Hier drin wird eigentlich nicht geraucht“, sagte ich.
Er nahm sich eine Kaffeetasse von meinem Schreibtisch und drückte seine Zigarette darin aus. „Willst du die Obduktionsergebnisse dieses Mädchens oder willst du mir bloß sagen, dass du selbst keine schlechten Gewohnheiten hast?“, fragte er.
„Es freut mich, dass du vorbeigekommen bist.“
„Klar. Hast du schon einen Anruf vom Labor gekriegt?“
„Nö.“
„Wir haben ihre Hände genau untersucht. Sie hat selbst abgedrückt. Es war Selbstmord.“
„Bist du sicher?“
„Hast du irgendwelche Zweifel an der Atomabsorptionsspektroskopie?“
„Lass mich eins klarstellen, Koko. Ich weiß deine Arbeit zu schätzen – aber auf deine schnippischen Bemerkungen kann ich verzichten.“
In der eintretenden Stille hörte ich die Klimaanlage summen. „Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Wir haben an beiden Händen Pulverspuren gefunden. Sie hat die Pistole auf ihre Stirn gerichtet und abgedrückt. Es war Selbstmord. Punkt. Aus. Ende.“
„Ihr Vater sagt, sie hat nicht getrunken und keine Drogen genommen. Sie wollte gerade mit dem Studium anfangen. Wie kann es sein, dass ein junger Mensch sich in so einer Situation eine Kugel in den Kopf schießt? Dass sie tot im eigenen Garten liegt, mit einem Revolver, den ihr Vater nie zuvor gesehen hat?“
„Vielleicht hab ich mir ja den falschen toxikologischen Befund angesehen – aber der mit Yvonne Darbonnes Namen drauf besagt, dass sie jede Menge Alkohol, Gras und Ecstasy intus hatte. Als ich sie aufgeschnitten hab, kam es mir vor, als würde ich in eine Punschschüssel greifen. Sie hatte außerdem erst vor Kurzem Sex mit mehreren Partnern. Allem Anschein nach ohne Anwendung von Gewalt. Es gab zwar einen blauen Fleck auf dem Oberschenkel, aber das ist bei so vielen Partnern wohl kein Wunder. Ich schätze, sie war zugedröhnt und hat es dann so richtig krachen lassen.“
„Was gibt dir das eigentlich, Koko?“
„Was meinst du?“
„Andere Leute zu beleidigen und zu provozieren.“
Koko kratzte sich an der Innenseite des Schenkels, als würde ein Mückenstich ihm ein unerträgliches Jucken verursachen. „Gibt es eigentlich irgendwelche Sitzungen, wo man so was lernen kann? Dieses Psychogeschwätz, meine ich.“
Ich ließ den Atem entweichen und rieb mir die Schläfen. „Was gibt es sonst noch?“, fragte ich.
„Das ist alles. Sie war betrunken und bekifft und hat mit ein paar Typen gevögelt, die keinen Gummi benutzt haben. Und da fragst du dich, warum sich so jemand umbringt?“
Kurz nachdem Koko mein Büro verlassen hatte, rief mich Mack Bertrand, unser forensischer Chemiker, aus dem kriminaltechnischen Labor an. Mack war ein anständiger, freundlicher, Pfeife rauchender Familienvater und einer der besten Spurensicherungsexperten, die mir je begegnet waren. „Wir haben die Pistole im Fall Darbonne untersucht“, berichtete er. „Sie wurde 1999 in einem Studentenheim an der Ole Miss gestohlen.“
„Gibt es noch andere Fingerabdrücke außer denen der Toten?“
„Die Waffe ist erst kürzlich gereinigt und geölt worden. Es waren zwar Reste von Abdrücken dran, aber nicht genug, um sie durch das System laufen zu lassen. Hilft dir das weiter, Dave?“
„Wahrscheinlich nicht wirklich.“
„Es war Selbstmord, Partner. Sie hat mit dem Daumen abgedrückt. Ihre Fingerabdrücke waren auf der Rückseite des Griffs. Sie muss die Pistole umgedreht und sich eine Kugel mitten in die Stirn geschossen haben.“
„Hast du dir ihr Handy angesehen?“
„Ja. Sie hat hauptsächlich mit Freundinnen von der New Iberia Highschool telefoniert. Nichts Ungewöhnliches. Bis auf …“
„Ja?“
„Sie hat diese Woche zweimal im Haus von Bello Lujan angerufen.“
In Gedanken sah ich einen sonnengebräunten Mann in einer weißen Reithose, mit gekräuselten schwarzen Haaren auf den Armen. Das war der Bello von heute, doch ich hatte ihn schon viel früher gekannt, als er noch ein ganz anderes Leben geführt hatte. „Warum kann sie einen solchen Typen angerufen haben?“, sinnierte ich.
„Sein Sohn studiert an der University of Louisiana. Vielleicht hat er die Tote näher gekannt.“ Mack stockte einen Moment. „Dave?“
„Yeah?“
„Das Mädchen hat sich das Leben genommen. Daran kann nichts und niemand etwas ändern. Bello ist ein Scheißkerl, der es nicht wert ist, dass du dich mit ihm abgibst. Lass die Finger von ihm.“
„Solche Worte bin ich von dir gar nicht gewohnt, Mack.“
„Ich weiß, aber für Bello Lujan ist das noch stark untertrieben.“
Es kommt manchmal vor, dass jemand einen schweren Verkehrsunfall verursacht, indem er so langsam fährt, dass sich hinter ihm Fahrende gezwungen sehen, bei einer Steigung oder in einer Kurve zu überholen. Oder indem er bei Gelb eine Kreuzung überquert und ein abbiegendes Fahrzeug blockiert, das daraufhin von einem anderen Auto gerammt wird. Der Verursacher eines solchen Unfalls fährt oft weiter, ohne in den Rückspiegel zu schauen, und wird meist nicht zur Verantwortung gezogen. Ich fragte mich, ob der Fall Yvonne Darbonne sich mit einem solchen Verkehrsunfall vergleichen ließ.
Ich schaute auf meine Armbanduhr. Es war 11:05 Uhr – höchste Zeit, der Sache mit den rot verfärbten Geldscheinen nachzugehen, die Dallas Kleins Tochter, wie sie sagte, in einem Casino bekommen hatte. Außerdem hatte ich einen tödlichen Unfall mit Fahrerflucht zu untersuchen, dazu noch drei ungeklärte Fälle von Personen, die vor zehn Jahren spurlos verschwunden waren, sowie eine Schießerei zwischen verfeindeten Gangs, bei der zwei Drogendealer mit Kugeln aus einer .25er Automatik vollgepumpt worden waren.
Was man heutzutage in einer amerikanischen Kleinstadt halt so alles erleben konnte.
Yvonne Darbonnes Tagebuch lag auf meinem Schreibtisch. Der himmelblaue Einband war in einer Ecke mit Sonnenblumen bedruckt. Der erste Eintrag war drei Monate alt. Er lautete:
War mit ihm im City Park, hab die Enten und Fuchshörnchen mit Brot gefüttert. Er hat mir seine Windjacke um die Schultern gelegt, als es kühler wurde. Seine Wangen waren rot wie Äpfel.
Sie hatte ungefähr 30 Seiten geschrieben, aber nur wenige Namen erwähnt – und wenn, dann nur Vornamen. Die letzten Einträge waren voller Freude und romantischer Gefühle; es gab nicht den kleinsten Hinweis auf irgendwelche inneren Konflikte. Im Gegenteil, ihre Handschrift und Wortwahl sowie ihr allgemeines Verständnis der Welt ließen auf einen grundvernünftigen, reifen Menschen schließen. Erneut schaute ich auf meine Uhr, dann auf die Akten, die sich auf meinem Schreibtisch stapelten, und den übrigen Papierkram, den ich zu bearbeiten hatte. Yvonne Darbonnes Tod würde als Selbstmord zu den Akten gelegt werden. Meine Ermittlungen waren damit abgeschlossen, sagte ich mir. Ich legte das Tagebuch in eine Schublade und machte mich auf den Weg nach Lafayette, um mit Trish Klein zu sprechen.
3
Ihr Apartment lag in einer von Eichen beschatteten Wohnsiedlung nahe dem Girard Park. Der Wohnkomplex war aus weißem Backstein gebaut und mit schmiedeeisernen Balkongeländern versehen. Die Mauer, die den Poolbereich umgrenzte, war mit blühenden Bougainvilleen geschmückt. Der Swimmingpool war beheizt; obwohl die Sonne hoch am Himmel stand, stieg von der von Eichen beschatteten Wasseroberfläche Dampf auf. Keinen halben Kilometer entfernt war man im Lafayette Oil Center wahrscheinlich besorgt wegen drohender Gewinneinbußen und Bildern von schwarzen Rauchwolken, die aus brennenden irakischen Pipelines zum Wüstenhimmel stiegen, doch in diesem ruhigen Wohnkomplex schien die Welt im Jahr 1955 stehen geblieben zu sein. Die moosbehängten Bäume und das milde, freundliche Wetter vermittelten einem das Gefühl, dass es ein Leben jenseits aller Probleme der modernen Welt gab.
Trishs Apartment lag im Erdgeschoss des Gebäudes. Ich drückte auf die Klingel und konnte das Summen hinter der Tür hören. Ich hatte absichtlich nicht vorher angerufen, um die Frau unvorbereitet anzutreffen. Als sie die Tür öffnete, sah ich drei junge Männer und eine Frau im Wohnzimmer sitzen. „Oh, Mr. Robicheaux“, sagte Trish, kam heraus und zog die Tür hinter sich zu. „Hätten Sie angerufen, dann wäre ich nach New Iberia gekommen.“
„Ich hatte in Lafayette was zu erledigen. Haben eigentlich schon Agenten vom FBI mit Ihnen gesprochen?“
„FBI? Nein“, erwiderte sie. „Geht es immer noch um diese 100-Dollar-Scheine?“
„Sie stammen allem Anschein nach aus der Beute eines Banküberfalls in Mobile.“
Ich wartete auf irgendeine Regung in ihrem Gesicht, doch ihre blauen Augen blieben unverwandt auf mich gerichtet, abgesehen davon, dass sie ein-, zweimal blinzelte. „Heißt das, mein Geld wird beschlagnahmt?“
„Darüber müssen Sie mit den Feds sprechen.“
Sie kniff die Lippen zusammen. „Wenn das FBI dafür zuständig ist – warum sind Sie dann hier?“
„Für die Verbreitung von gestohlenem Geld sind wir genauso zuständig wie die Feds. Außerdem war ich mit Ihrem Vater befreundet.“
„Verstehe. Dann ist er der eigentliche Grund, dass Sie sich damit beschäftigen?“
„Wer sind Ihre Gäste?“, fragte ich, ohne auf ihre Frage einzugehen, und deutete mit dem Kopf zur Tür.
„Ein paar Leute, die mir helfen wollen, eine Farm zu gründen.“
„Können wir nicht reingehen? Ich würde sie gern kennenlernen.“
„Glauben Sie eigentlich, dass ich diese Geldscheine gestohlen habe?“
„Nein, natürlich nicht. Sie sind Dallas’ Tochter“, erwiderte ich.
Einen Moment lang musterte sie mich prüfend, die Hand auf dem Türknauf. „Ja, kommen Sie rein. Vielleicht können wir die Sache dann ein für alle Mal klären.“
Ihre Freunde waren ein eigenwilliges Grüppchen. Sie waren Ende 20 oder Anfang 30, und jeder schien eine Rolle zu verkörpern, die mehr auf Wunschdenken als Realität beruhte. Sie stellten sich so zwanglos vor, als würden wir uns in einer Kneipe kennenlernen, wo Nachnamen nicht weiter wichtig waren und man einander ganz offen und zwanglos gegenübertrat. Doch im Gegensatz zu den meisten Leuten, die einem in Kneipen begegneten, hatten Trish Kleins Freunde etwas Unschuldiges an sich, das fast schon komisch anmutete.
Ein klein gewachsener, o-beiniger Kerl namens Tommy, mit einer röhrenförmigen Nase und einem kleinen Mund, stellte sich als Jockey vor, obwohl er breitere Hüften hatte, als es bei einem Jockey üblich war, und einige Kilo zu viel auf die Waage brachte.
Ein sonnengebräunter Mann namens Miguel in einem makellosen weißen Unterhemd und mit einer Tätowierung der Jungfrau Maria auf der rechten Schulter, behauptete, Boxer zu sein. Tatsächlich hatte er eine Narbe am Auge, und das Lid hing schwer herunter. Seine dicken Oberarme ließen auch vermuten, dass er regelmäßig an der Boxbirne trainierte, doch für einen Profi waren seine Handgelenke zu dünn und seine Hände zu klein.