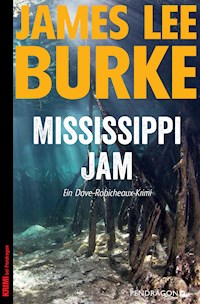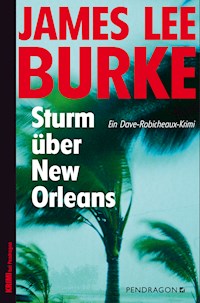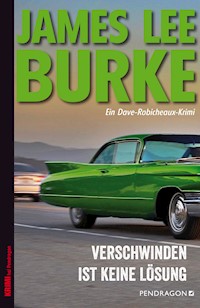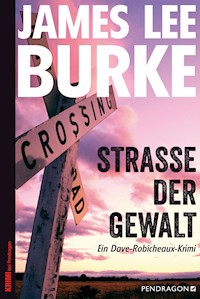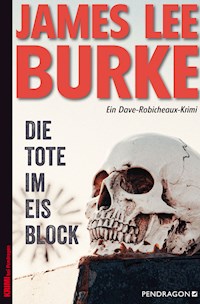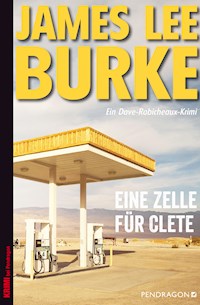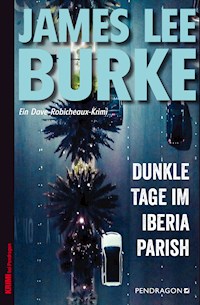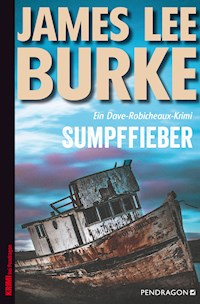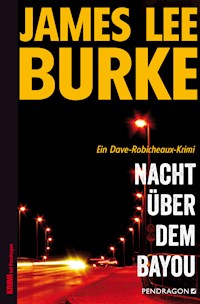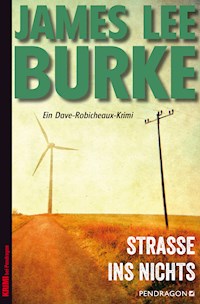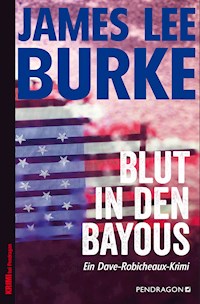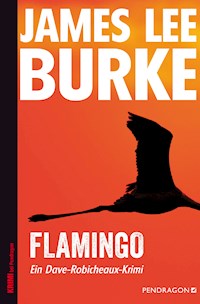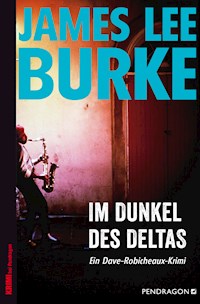
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Seit über hundert Jahren lebt die schwarze Farmerfamilie Fontenot auf einer Plantage in der Nähe von New Orleans. Doch jetzt will man sie von dem gepachteten Stück Land vertreiben. Detective Dave Robicheaux kümmert sich darum und stößt auf die zwielichtigen Machenschaften des Giacano-Clans. Schnell verstrickt er sich selbst in das wirre Geflecht der undurchsichtigen Verbindungen. Erste Anhaltspunkte findet er in einem Notizbuch, das ihm Sonny Boy Marsallus, ein Dealer und Spieler zwischen den Fronten, auf der Flucht vor dem Clan anvertraut. Bald fließt das erste Blut …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Im Dunkel des Deltas
Für Rollie und Loretta McIntosh
JAMES LEE BURKE
Im Dunkel des Deltas
Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 8
Aus dem Amerikanischen von Georg Schmidt
Ich befahl mich dem Gott der Unterdrückten an,senkte das Haupt auf meine gefesselten Händeund weinte bitterlich.
Aus Zwölf Jahre als Sklave,ein autobiographischer Berichtvon Solomon Northup
1
Die Familie Giacano hatte sich bereits zu Zeiten der Prohibition sämtliche schwarzen Geschäfte in den Bezirken Orleans und Jefferson unter den Nagel gerissen. Freibrief und Genehmigung dafür kamen natürlich von der Kommission in Chicago, und kein anderer Familienclan traute sich jemals, in ihr Revier einzudringen. Seither waren Prostitution, Hehlerei, Geldwäsche, Glücksspiel, Kreditwucher, Arbeitsvermittlung, Drogenhandel und sogar das Wildern in Südlouisiana ihre ureigene Domäne. Kein Straßengangster, Betrüger, Einbrecher, kein Dieb, Lockvogel oder Zuhälter stellte das jemals in Frage, es sei denn, er wollte sich eine Aufnahme davon anhören, was Tommy Figorelli (auch bekannt als Tommy Fig, Tommy Fingers, Tommy Five) zum Aufheulen der Elektrosäge zu sagen hatte, kurz bevor er gefriergetrocknet und in Einzelteilen an den hölzernen Ventilatorblättern in seiner eigenen Metzgerei aufgehängt wurde.
Deshalb war Sonny Boy Marsallus, der in der Sozialsiedlung in Iberville aufgewachsen war, als dort noch lauter Weiße wohnten, in den siebziger und achtziger Jahren eine Art Wunder gewesen. Er beteiligte sich nicht am Geschäft, ließ sich weder auf Zuhälterei noch auf Drogen- oder Waffenhandel ein, und er sagte dem fetten Alten, Didoni Giacano persönlich, dass er zu den Weight Watchers gehen oder sich für die Rettung der Wale einsetzen sollte. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er an einem gleißend blauen Spätnachmittag im Frühling, als die Palmwedel im Wind rasselten und die Straßenbahn klingelnd auf dem Mittelstreifen vorbeifuhr, knapp unterhalb des alten Jung-Hotels draußen auf dem Gehsteig stand, die Haut makellos wie Milch, die bronze-roten Haare leicht eingeölt und seitlich nach hinten gekämmt, und wie immer irgendein Spiel laufen hatte – Craps oder Bourré um hohe Einsätze, wenn er nicht draußen auf der Rennbahn irgendwelche schmutzigen Gelder aus Jersey wusch, einschlägig bekannte Rückfalltäter, die kein von Amts wegen zugelassener Kopfgeldjäger mit der Kneifzange angefasst hätte, auf Kaution rauspaukte oder zinslos Geld an Mädels verlieh, die aussteigen wollten.
Genau genommen lebte Sonny den Ehrenkodex vor, den der Mob für sich in Anspruch nahm.
Aber zu viele Mädels stiegen mit Sonnys Geld in den nächsten Greyhound und verließen New Orleans, als dass ihn die Giacanos weiter gewähren lassen konnten. Seinerzeit ging Sonny außer Landes, nach Süden, wo er den Auftakt des großen Theaters, das die Reagan-Regierung in El Salvador und Guatemala veranstaltete, aus erster Hand miterlebte. Clete Purcel, mein alter Partner bei der Mordkommission im First District, hatte da unten mit ihm zu tun gehabt, als er seinerseits wegen Mordes auf der Flucht war, aber er wollte nie darüber reden, was sie dort getrieben hatten oder woher die seltsamen Gerüchte stammten, die über Sonny im Umlauf waren: dass er vor lauter Muta, Pulche und psychedelischen Pilzen verrückt geworden wäre, sich linken Terroristen angeschlossen, eine Zeit lang in einem Dreckloch in Nicaragua im Knast gesessen hätte, mit guatemaltekischen Flüchtlingen in Südmexiko arbeitete oder in einem Kloster in Jalisco sei. Nichts davon passte zu dem Halbseidenen von der Canal Street, der Narben an den Augenbrauen hatte und mit klingender Münze beschwingt durch die Welt schritt.
Deshalb war ich überrascht, als ich hörte, dass er zurück in der Stadt war, wieder mitmischte und seine Geschäfte im Pearl einfädelte, wo die alte, grün gestrichene eiserne Straßenbahn von der St. Charles Avenue in die bonbonbunte, von windzerzausten Palmen bestandene Glitzerwelt an der Canal Street einbog. Als ich ihn zwei Querstraßen weiter in einem im Neonlicht flimmernden Tropenanzug und einem lavendelfarbenen Hemd vor einem Spielsalon herumhängen sah, wirkte er wie eh und je, so als wäre er nie unter südlicher Sonne gewesen, hätte sich niemals mit einem M60 oder schwerem Marschgepäck durch den Dschungel geschleppt, wo man sich abends die Blutegel mit Zigaretten aus der Haut brannte und tunlichst nicht an den strengen Geruch dachte, der aus den fauligen Socken aufstieg.
Schwarze Poolspieler lehnten an den Parkuhren und lungerten vor den Läden herum, Musik dröhnte aus den Ghettoblastern.
Er schnippte mit den Fingern, klatschte in die Hände und zwinkerte mir zu. „Wie läuft’s denn so, Streak?“, fragte er.
„Nichts los, Sonny. Hast du immer noch nicht genug von Kriegsschauplätzen?“
„Meinst du die Stadt? So übel ist die gar nicht.“
„Ist sie doch.“
„Komm, trink ein Bier, iss ein paar Austern mit mir.“
Er sprach mit näselndem Akzent, wie die meisten aus einfachen Verhältnissen stammenden Menschen in New Orleans, deren Englisch von den Ende des 19. Jahrhunderts eingewanderten Iren und Italienern beeinflusst war. Er lächelte mich an, stieß dann einen Schwall Luft aus dem Mund und schaute kurz die Straße auf und ab. Dann heftete er den Blick wieder auf mich, immer noch lächelnd – ein Mann, der seinem eigenen Rhythmus folgte.
„Huch“, sagte er und tippte sich mit dem ausgestreckten Zeigefinger an die Stirn. „Hab ich vergessen. Ich hab ja gehört, dass du jetzt zu Meetings gehst. Hey, ich steh auf Eistee. Komm schon, Streak.“
„Warum nicht?“, sagte ich.
Wir standen an der Bar im Pearl und aßen rohe Austern, die salzig und kalt waren und an deren Schalen Eissplitter hafteten. Zum Zahlen zog er eine mit einem dicken Gummiring umwickelte Geldrolle aus lauter Fünfzigern aus der Hosentasche. Unterkiefer und Hals waren frisch rasiert und schimmerten regelrecht.
„Hast du’s nicht mal mit Houston oder Miami versuchen wollen?“, fragte ich.
„Wenn anständige Menschen sterben, ziehen sie nach New Orleans.“
Doch das betont elegante Auftreten und die gute Laune waren nicht überzeugend. Sonny wirkte irgendwie angegriffen, leicht gehetzt, vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt von der eigenen Energie, war allzu wachsam, schaute sich ständig um und beobachtete die Tür.
„Erwartest du jemanden?“, fragte ich.
„Du weißt doch, was Sache ist.“
„Nein.“
„Sweet Pea Chaisson“, sagte er.
„Aha.“
Er sah meinen Blick.
„Was denn, überrascht dich das?“
„Er ist ein bodenloser Scheißkerl, Sonny.“
„Ja, so kann man’s vermutlich ausdrücken.“
Ich bedauerte bereits, dass ich mich auf einen kurzen Abstecher in den schönen Schein von Sonny Boys Seifenblasenwelt eingelassen hatte.
„Hey, geh noch nicht“, sagte er.
„Ich muss zurück nach New Iberia.“
„Sweet Pea braucht bloß Sicherheiten. Der Typ ist längst nicht so schlimm wie sein Ruf.“
„Erzähl das seinen Mädchen.“
„Du bist ein Cop, Dave. Ihr erfahrt doch die Sachen immer erst hinterher.“
„Bis zum nächsten Mal, Sonny.“
Sein Blick war auf das Fenster zur Straße gerichtet. Er legte mir die Hand auf den Unterarm und schaute dem Barmann zu, der einen großen Krug Bier zapfte. „Geh jetzt nicht raus“, sagte er.
Ich schaute zur Glasfront. Zwei Frauen gingen vorbei, redeten aufeinander ein. Ein Mann mit Hut und Regenmantel stand an der Bordsteinkante, so als warte er auf ein Taxi. Ein kleiner, stämmiger Mann in einem Sportsakko stellte sich zu ihm. Beide schauten auf die Straße.
Sonny Boy biss einen Niednagel ab und spuckte ihn aus.
„Sweet Peas Abgesandte?“, fragte ich.
„Ein bisschen ernster. Komm mit aufs Klo“, sagte er.
„Ich bin Polizist, Sonny. Keine faulen Sachen. Wenn du Zoff hast, rufen wir die hiesigen Cops.“
„Spar dir die Sprüche für Dick Tracy. Hast du deine Knarre dabei?“
„Was denkst du denn?“
Er ging in den hinteren Teil des Restaurants. Ich wartete einen Moment, legte meine Sonnenbrille auf die Bar, damit jeder wusste, dass ich zurückkommen würde, und folgte ihm dann. Er verriegelte die Toilettentür, hängte seine Jacke daran auf und schlüpfte aus seinem Hemd. Seine Haut sah aus wie Alabaster mit harten roten Kanten entlang der Knochen. Eine blaue Madonna in einem Lichtkranz aus nadelspitzen orangen Strahlen war auf seine rechte Schulter tätowiert.
„Schaust du auf mein Tattoo?“, fragte er und grinste.
„Eigentlich nicht.“
„Oh, die Narben?“
Ich zuckte mit den Achseln.
„Zwei ehemalige Spezialisten von Somoza haben mich zu ’ner Sensibilisierungssitzung eingeladen“, sagte er.
Die Narben waren lila, dick wie Strohhalme und zogen sich kreuz und quer über Rippen und Brustkorb.
Er fummelte an einem schwarzen Notizbuch herum, das er mit Klebeband am Kreuz befestigt hatte. Mit einem Schmatzton löste es sich. Er hielt es in der Hand, so dass die Klebestreifen herunterhingen, als sei es ein herausgeschnittener Tumor.
„Heb das für mich auf.“
„Behalt es selber“, sagte ich.
„Eine Frau bewahrt eine Kopie für mich auf. Du magst doch Poesie, Bekenntnisliteratur, lauter solchen Kram. Wenn mir nichts passiert, wirfst du es in die Post.“
„Was hast du vor, Sonny?“
„Die Welt ist klein geworden. Heutzutage hocken Menschen in Grashütten und gucken CNN. Da kann man auch gleich da bleiben, wo einem das Essen schmeckt.“
„Du bist ein intelligenter Kerl. Du musst nicht den Prügel knaben für die Giacanos spielen.“
„Schau im Kalender nach, wenn du heimkommst. In den siebziger Jahren waren die Spaghettis drauf und dran, den Bach runterzugehen.“
„Steht deine Adresse drin?“
„Klar. Wirst du’s lesen?“
„Wahrscheinlich nicht. Aber ich heb’s eine Woche lang für dich auf.“
„Gar nicht neugierig?“, fragte er, während er sein Hemd wieder anzog. Auf der blassen Haut wirkte sein Mund rot wie bei einer Frau, und seine Augen funkelten hellgrün, als er lächelte.
„Ne.“
„Solltest du aber sein“, sagte er. Er schlüpfte in seine Jacke. „Du weißt doch, was ein Barracoon ist, oder?“
„Eine Baracke zur Verwahrung von Sklaven?“
„Jean Lafitte hatte gleich außerhalb von New Iberia eine. Beim Spanish Lake. Wetten, dass du das nicht gewusst hast.“ Er stieß mir den Finger in den Bauch.
„Schön, dass ich’s erfahren habe.“
„Ich geh durch die Küche raus. Die Jungs da draußen tun dir nichts.“
„Ich glaube, du bist nicht ganz bei Trost, Sonny. So einfach wimmelst du einen Polizisten nicht ab.“
„Die Jungs da draußen stellen ihre Fragen viersprachig, Dave. Der mit dem Hals wie ein Feuerhydrant zum Beispiel, der hat früher für Idi Amin die Drecksarbeit im Keller gemacht. Der möchte zu gern mit mir plaudern.“
„Warum?“
„Ich hab seinen Bruder abgeknallt. Genieß den Frühlingsabend, Streak. Schön, wieder daheim zu sein.“
Er schloss die Tür auf und verschwand durch den Hinterausgang des Restaurants.
Als ich zur Bar zurückkehrte, sah ich, dass sowohl der Mann mit dem Hut als auch sein gedrungener Begleiter durch die Glasfront hereinschauten. Ihre Augen erinnerten mich an Schrotkugeln. Scheiß drauf, dachte ich und ging zur Tür. Doch im gleichen Augenblick drängte sich eine Schar japanischer Touristen ins Restaurant, und als ich mich durchgezwängt hatte, war der Gehsteig draußen leer und verlassen, bis auf einen älteren Mann mit einer Handkarre, der Schnitt blumen verkaufte.
Der Abendhimmel war hellblau, von rosa gekräuselten Wolken durchzogen, und vom See her ging ein leichter Wind, mild und salzhaltig, nach Kaffee und Rosen duftend, mit einem trockenen, versengten Ozongeruch durchsetzt, wenn die Oberleitung der Straßenbahn knisternd Funken warf.
Als ich zu meinem Pick-up zurückging, sah ich das Wetterleuchten draußen auf dem Lake Pontchartrain, die zuckenden Blitze in der dunklen Wolkenwand, die plötzlich aus dem Golf aufgezogen war.
Eine Stunde später peitschten mir auf der Fahrt durch den Atchafalaya-Sumpf dichte Regenschwaden entgegen. Sonny Boys Notizbuch vibrierte im Motorengedröhn auf dem Armaturenbrett.
2
Am nächsten Morgen legte ich es ungelesen in meinen Aktenschrank im Iberia Parish Sheriff’s Department und trank, während ich meine Post aufmachte, eine Tasse Kaffee. Ich fand eine telefonische Nachricht von Sonny Boy Marsallus, aber er hatte eine Nummer aus St. Martinville hinterlassen, nicht aus New Orleans. Ich wählte sie, doch es meldete sich niemand.
Ich schaute aus dem Fenster, genoss das strahlende Morgenlicht und den Anblick der hoch aufragenden Palmen vor den windzerfetzten Wolken am Himmel. Du bist nicht für ihn zuständig, sagte ich mir, misch dich nicht in seinen Ärger ein. Sonny war vermutlich von Geburt an nicht in Einklang mit der Welt gewesen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis ihn jemand über die Klinge springen ließ.
Letzten Endes nahm ich mir aber doch die Akte über Sweet Pea Chaisson vor, die auf die eine oder andere Art immer auf den neuesten Stand gebracht wurde, vermutlich, weil er einer von uns war und offenbar unbedingt in die Gegend von Breaux Bridge, St. Martinville und New Iberia zurückkommen und sich Ärger einhandeln wollte.
Ich habe nie ganz begriffen, warum Verhaltenspsychologen so viel Zeit und Steuermittel für die Untersuchung von Soziopathen und hoffnungslosen Rückfalltätern aufwenden, denn für uns war bei diesen Forschungen bislang noch nicht das Geringste herausgesprungen, und die Täter wurden davon auch um keinen Deut besser. Ich habe mir oft überlegt, ob es nicht nützlicher wäre, wenn man einfach eine Handvoll Akten über Leute wie Sweet Pea herauszieht, ihnen eine leitende Stellung in der Mitte der Gesellschaft gibt, zusieht, wie das den Leuten schmeckt, und sich dann drastischere Maßnahmen überlegt, eine Sträflingskolonie auf den Aleuten zum Beispiel.
Er war in einem Güterwaggon der Southern Pacific geboren und ausgesetzt und von einer Mulattin großgezogen worden, die an der Straße nach Breaux Bridge eine Zydeco-Bar mit angeschlossenem Bordell betrieb, das sogenannte House of Joy. Sein Gesicht sah aus wie eine auf dem Kopf stehende Träne – Augen, die wie Schlitze in Brotteig wirkten, weiße Brauen, strähnige Haare, die wie Suppennudeln herunterhingen, eine Stupsnase und dazu ein viel zu kleiner Mund, der ständig geiferte.
Seine Abstammung war ein Rätsel. Die Haut war biskuitfarben und nahezu haarlos, dazu ein ausladender Bauch, wie ein mit Wasser gefüllter Ballon, pummelige Arme und teigige Hände, so als sei er nie dem Babyspeck entwachsen. Doch sein Äußeres täuschte. Mit 17 Jahren hatte Sweet Pea ein Schwein, das die Gemüsebeete seiner Mutter verwüstet hatte, mit bloßen Händen eingefangen, das quiekende Tier zum nächsten Highway geschleppt und kopfüber gegen den Kühlergrill eines Sattelzuges geworfen. 19-mal wegen Zuhälterei festgenommen. Zweimal verurteilt. Insgesamt 18 Monate im Bezirksgefängnis abgesessen. Jemand hatte auf Sweet Pea Acht gegeben, und ich bezweifelte, dass es eine höhere Macht war.
Dann entdeckte ich in meiner Post eine rosa Hausmitteilung, die ich zunächst übersehen hatte. Rat mal, wer wieder im Warteraum sitzt? hatte Wally, unser Dispatcher, in seiner kindlichen Handschrift draufgekritzelt. Der Laufzettel war um 7: 55 Uhr ausgestellt.
Herr im Himmel.
Bertha Fontenots Haut war wirklich schwarz, so tiefschwarz, dass die Narben an ihren Händen, die sie sich beim Austernaufbrechen in den Restaurants von New Iberia und Lafayette zugezogen hatte, wie rosa Würmer wirkten, die sich an ihrem Fleisch nährten. Fettwülste wabbelten um ihre Arme, und ihr Hintern quoll links und rechts wie zwei Kissen über den Metallstuhl, auf dem sie saß. Das runde Hütchen und das lila Kostüm waren viel zu klein für sie, und ihr Rock war hoch über die weißen Strümpfe hinaufgerutscht, so dass man die knotigen Krampfadern an ihren Schenkeln sehen konnte.
Sie hatte ein weißes Papiertuch über ihren Schoß gebreitet, von dem sie mit den Fingern geröstete Schweineschwartenstücke aß.
„Ham Sie sich endlich ’n paar Minuten von Ihrm Stuhl losreißen können?“, sagte sie mit vollem Mund.
„Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass Sie da sind.“
„Können Sie mir mit Moleen Bertrand weiterhelfen?“
„Das ist eine zivilrechtliche Sache, Bertie.“
„Das ham Sie schon mal gesagt.“
„Daran hat sich auch nichts geändert.“
„Das hätt mir auch jeder weiße Schrottanwalt erzähln können.“
„Vielen Dank.“
Zwei Polizisten in Uniform, die am Wasserspender standen, grinsten mir zu.
„Warum kommen Sie nicht mit in mein Büro und trinken einen Kaffee?“, fragte ich.
Sie keuchte, als ich ihr aufhalf, wischte dann die Krümel von ihrem Kleid, klemmte sich die große lackierte Strohtasche mit den Plastikblumen an der Seite unter den Arm und folgte mir in das Büro. Ich schloss die Tür hinter uns und wartete, bis sie sich gesetzt hatte.
„Eins müssen Sie verstehen, Bertie. Ich bin für Straftaten zuständig. Wenn Sie Schwierigkeiten wegen eines Rechtsanspruchs auf Ihr Land haben, brauchen Sie einen Anwalt, der Sie in einem sogenannten zivilrechtlichen Verfahren vertritt.“
„Moleen Bertrand is doch Anwalt. Glauben Sie, ein andrer Anwalt legt sich wegen ’n paar Schwarzen mit dem an?“
„Ich habe einen Freund, dessen Sozietät sich mit Rechtsansprüchen befasst. Ich werde ihn bitten, dass er für Sie in den Gerichtsakten nachforscht.“
„Das nutzt doch nix. Das Stück Land, auf dem wir sechs schwarzen Familien leben, is in Arpents. Das taucht in den Vermessungsunterlagen beim Gericht nicht auf. Beim Gericht is heutzutage alles in Acres.“
„Das spielt doch keine Rolle. Wenn es Ihr Land ist, haben Sie einen Anspruch darauf.“
„Was meinen Sie mit wenn ? Moleen Bertrands Großvater hat uns das Land von 95 Jahren geschenkt. Jeder hat das gewusst.“
„Anscheinend nicht.“
„Und was wolln Sie dagegen tun?“
„Ich rede mit Moleen.“
„Warum reden Sie nicht gleich mit Ihrm Papierkorb?“
„Geben Sie mir Ihre Telefonnummer.“
„Sie müssen im Laden anrufen. Sie wissen doch, warum Moleen Bertrand das Land will, oder nicht?“
„Nein.“
„Da is’n Haufen Gold vergraben.“
„Das ist doch Unsinn, Bertie.“
„Warum will er dann unsre kleinen Häuser platt walzen?“
„Ich frag ihn danach.“
„Wann?“
„Heute noch. Ist das früh genug?“
„Mal sehn, was bei rauskommt.“
Mein Telefon klingelte, und ich nutzte den Anruf, den ich auf Warteschleife schaltete, als Vorwand, verabschiedete mich von ihr und brachte sie zur Tür. Doch als ich sie steif und würdevoll zu ihrem Auto auf dem Parkplatz laufen sah, fragte ich mich, ob nicht auch ich in die alte weiße Masche verfallen war, eine Art unwirsches Wohlwollen im Umgang mit Farbigen, so als seien sie irgendwie nicht fähig zu begreifen, welche Mühe wir uns ihretwegen gaben.
Zwei Tage später wurde ein Autofahrer um fünf Uhr morgens auf dem Highway nach St. Martinville von einem Streifenwagen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Auf dem Rücksitz und dem Boden des Wagens befanden sich ein Fernseher, eine tragbare Stereoanlage, ein Karton mit Damenschuhen, Schnapsflaschen, Konservendosen und ein Koffer voller Damenkleidung und Handtaschen.
„Hat man Sie etwa zum Transenball eingeladen?“, fragte der Streifenpolizist.
„Ich helf meiner Freundin beim Umzug“, erwiderte der Fahrer.
„Sie haben doch nicht etwa getrunken, oder?“
„Nein, Sir.“
„Sie wirken ein bisschen nervös.“
„Sie haben ’ne Knarre in der Hand.“
„Ich glaub nicht, dass es daran liegt. Was duftet denn hier so? Ist das etwa ein ganz starker Tobak? Würden Sie bitte mal aussteigen?“
Der Deputy hatte die Autonummer bereits überprüfen lassen. Der Wagen gehörte einer Frau namens Della Landry, die an der Bezirksgrenze zwischen St. Martin und Iberia wohnte. Der Fahrer hieß Roland Broussard. Er hatte ein Pflaster auf der Stirn, als er gegen Mittag von Detec tive Helen Soileau in unseren Vernehmungsraum gebracht wurde.
Er trug dunkle Jeans, Laufschuhe und ein grünes Krankenhaushemd. Die schwarzen Haare waren dicht und lockig, die Nägel bis aufs Fleisch abgekaut, sein Gesicht war unrasiert. Ein säuerlicher Geruch stieg aus seinen Achselhöhlen auf. Wortlos schauten wir ihn an.
Das Zimmer hatte keine Fenster und enthielt lediglich einen Holztisch und drei Stühle. Er öffnete und schloss die Hände auf der Tischplatte und scharrte unruhig mit den Füßen unter dem Stuhl herum. Ich nahm seinen linken Unterarm und drehte ihn um.
„Wie oft fixen Sie, Roland?“, fragte ich.
„Ich bin beim Blutspenden gewesen.“
„Aha.“
„Haben Sie ein Aspirin?“ Er blickte zu Helen Soileau. Sie hatte ein breites Gesicht, dessen Ausdruck man unter keinen Umständen missverstehen sollte. Ihre blonden Haare sahen aus wie eine gelackte Perücke, ihr Körper wie ein Kartoffelsack. Sie trug eine blaue Hose und ein gestärktes, kurzärmliges weißes Hemd, hatte ihre Dienstmarke über der linken Brust angeheftet und die Handschellen hinten an ihrem Pistolengurt hängen.
„Wo ist Ihr Hemd?“, fragte ich.
„Das war voller Blut. Von mir.“
„Im Bericht steht, Sie haben versucht zu fliehen“, sagte Helen.
„Schaun Sie, ich hab um einen Anwalt gebeten. Ansonsten muss ich nix sagen, stimmt’s?“
„Das stimmt“, sagte ich. „Aber Sie haben uns bereits gestanden, dass Sie den Wagen geklaut haben. Also können wir Sie deshalb auch vernehmen, nicht wahr?“
„Ja, ich hab ihn geklaut. Was wollt ihr denn sonst noch? Is ja ’n dolles Ding, Scheiße noch mal.“
„Würden Sie bitte auf Ihre Ausdrucksweise achten“, sagte ich.
„Was is’n das hier, ’n Irrenhaus? Da macht sich ’n Clown draußen auf der Straße über mich lustig, dann prügelt er mich windelweich, und hinterher soll ich auch noch auf meine Scheißausdrucksweise aufpassen.“
„Hat die Besitzerin des Wagens etwa ihre ganze Habe eingeladen und Ihnen dann die Schlüssel gegeben, damit Sie ihn nicht kurzschließen müssen? Das ist eine sehr seltsame Geschichte, Roland“, sagte ich.
„Er hat genau so in der Auffahrt gestanden. Ich weiß, worauf Sie hinaus … Warum glotzt die mich ständig an?“
„Ich weiß es nicht.“
„Ich hab das Auto genommen. Ich hab auch Dope drin geraucht. Ansonsten sag ich nix mehr … Hey, hörn Sie mal, stimmt mit der irgendwas nicht?“ Er hielt den Finger dicht an seine Brust, als er auf Helen deutete.
„Wollen Sie es sich nicht ein bisschen leichter machen, Roland? Jetzt ist noch Zeit dazu“, sagte ich.
Bevor er antworten konnte, ergriff Helen mit beiden Händen den oberen Rand des Papierkorbs, holte aus und schmetterte ihn seitlich an seinen Kopf. Er stürzte zu Boden, riss den Mund auf und bekam glasige Augen. Dann schlug sie erneut zu, wieder mit voller Kraft, und traf ihn am Hinterkopf, ehe ich ihre Arme packen konnte. Ihre Muskeln waren steinhart.
Sie schüttelte meine Hände ab und schleuderte den Abfallkorb auf ihn, so dass sich der gesamte Inhalt, Zigarettenkippen, Asche und Bonbonpapiere, über seine Schultern ergoss.
„Du kleiner Pisser“, sagte sie. „Meinst du etwa, zwei Detectives der Mordkommission verschwenden wegen eines Autodiebstahls ihre Zeit mit einem Furz wie dir? Schau mich an, wenn ich mit dir rede!“
„Helen …“ sagte ich leise.
„Geh raus und lass uns allein“, sagte sie.
„Nix da“, sagte ich und half Roland Broussard wieder auf den Stuhl.
„Entschuldigen Sie sich bei Detective Soileau, Roland.“
„Für was?“
„Weil Sie den Klugscheißer markiert haben. Uns für dumm verkaufen wollten.“
„Entschuldigung.“
„Helen …“ Ich schaute sie an.
„Ich geh kurz aufs Klo. Bin in fünf Minuten wieder da“, sagte sie.
„Spielen Sie jetzt den Guten?“, fragte er, nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte.
„Das ist keine Show, mein Bester. Ich komme mit Helen nicht klar. Schaffen nur wenige. Sie hat in drei Jahren zwei Beschuldigte umgelegt.“
Er ging auf Blickkontakt mit mir.
„Die Lage sieht folgendermaßen aus“, sagte ich. „Ich glaube, dass Sie in das Doppelhaus der Frau eingestiegen sind und ihren Wagen gestohlen haben, aber mit allem anderen nichts zu tun hatten. Ich glaube das jedenfalls. Das heißt aber nicht, dass man Sie wegen dem, was da drin passiert ist, nicht drankriegt. Kapieren Sie, worauf ich hinauswill?“
Er kniff sich mit den Fingern in die Schläfen, so als winde sich ein rostiges Stück Draht durch seinen Kopf.
„Also?“ Auffordernd öffnete ich die Hände.
„Niemand war daheim, als ich durchs Fenster eingestiegen bin. Ich hab die Bude ausgeräumt und alles in ihr Auto geladen. Dann hat sie irgend ’ne andere Braut vor dem Haus abgesetzt, und ich hab mich im Gebüsch versteckt. Was mach ich jetzt? überleg ich mir. Wenn ich das Auto anlass, merkt sie, dass ich’s klauen will. Wenn ich warte und sie schaltet das Licht ein, merkt sie, dass die Bude ausgeräumt is. Dann kommen aus dem Nichts zwei Typen angerauscht, gehn ganz schnell den Gehweg rauf und schubsen sie rein. Was die mit der gemacht ham, daran erinner ich mich nicht gern. Ich hab die Augen zugemacht, das is die Wahrheit. Sie hat gewimmert, und ich hab gewollt, dass es aufhört. Ich verscheißer Sie nicht, Mann. Was hätt ich denn machen sollen?“
„Um Hilfe rufen.“
„Ich bin fix und fertig gewesen, schwer auf Meth. Wenn man nicht dabei gewesen is, sagt sich das so leicht, dass man was hätte machen sollen. Schaun Sie, wie immer Sie auch heißen, ich bin zweimal eingefahren, aber ich hab noch nie jemand was getan. Diese Typen, die ham sie regelrecht in Stücke gerissen. Ich hab Schiss gehabt, ich hab so was noch nie erlebt.“
„Wie haben sie ausgesehen, Roland?“
„Geben Sie mir ’ne Zigarette.“
„Ich rauche nicht.“
„Ihre Gesichter hab ich nicht gesehn. Wollt ich nicht. Warum ham ihr bloß die Nachbarn nicht geholfen?“
„Die waren nicht zu Hause.“
„Sie hat mir leidgetan. Ich wünschte, ich hätt irgendwas unternommen.“
„Detective Soileau wird Ihre Aussage aufnehmen, Roland. Ich werde vermutlich auch noch mal mit Ihnen reden.“
„Woher wissen Sie, dass ich’s nicht gewesen bin?“
„Der Gerichtsmediziner sagt, man hat ihr im Badezimmer das Genick gebrochen. Das ist der einzige Raum, in dem Sie keine Dreckspur hinterlassen haben.“
Auf dem Weg nach draußen begegnete ich Helen. Sie hatte die Augen starr und steif auf das besorgte Gesicht von Roland Broussard gerichtet.
„Er ist geständig“, sagte ich.
Die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Genauso gut hätte ich mit dem Abfluss des Wasserspenders reden können.
Moleen Bertrand wohnte in einem riesigen, von weißen Säulen getragenen Haus am Bayou Teche, unmittelbar östlich des Stadtparks. Wenn man von der verglasten hinteren Veranda aus über den sanft abfallenden Rasen hinwegschaute, konnte man zwischen den großzügig gesetzten immergrünen Eichen hindurch die braunen Fluten des Bayou vorbeiströmen sehen, das Schilfdickicht auf der anderen Seite, die über und über mit Trompeten- und Passionsblumen umrankten Gartenlauben seiner Nachbarn und schließlich die starren, klobigen Umrisse der alten Zugbrücke und des Wärterhäuschens an der Burke Street.
Es war März und schon ziemlich warm, doch Moleen Bertrand trug ein langärmliges rot-weiß gestreiftes Hemd mit rubinbesetzten Manschettenknöpfen und hochgeschlagenem weißem Kragen. Er war über eins achtzig groß und wirkte nicht unbedingt wie ein Weichling, aber zugleich war er seltsam körperlos, ohne jede Muskelkraft und Ausstrahlung, so als habe er als Heranwachsender einfach jegliche anstrengende Arbeit und sportliche Betätigung bewusst gemieden.
Er hatte von Geburt an ein behütetes Leben in Reichtum und Wohlstand genossen – Privatschulen, Mitgliedschaft im einzigen Country Club der Stadt und Weihnachtsferien an Orten, die unsereins nur aus Büchern kannte –, aber niemand konnte ihm vorwerfen, dass er aus dem, was ihm mit auf den Weg gegeben worden war, nichts gemacht hätte. Er hatte es in Springhill zu akademischen Ehren gebracht und war gegen Ende des Vietnamkriegs Major bei der Air Force gewesen. Er gab an der Tulane University die Law Review heraus und wurde nach nicht einmal fünf Jahren Sozius in der Anwaltskanzlei, bei der er arbeitete. Außerdem war er ein meisterhafter Tontaubenschütze. Zahlreiche Politiker, die für ihre Freigebigkeit beim Stimmenfang berühmt waren, hatten um seine Gunst gebuhlt, weil sie sich durch ihn und seinen Namen Zulauf versprachen. Sie wurde ihnen nicht gewährt. Aber er stieß niemanden vor den Kopf und galt auch nicht als unfreundlich.
Wir spazierten unter den Bäumen auf seinem Grundstück entlang. Er trank einen Schluck Eistee, wirkte ruhig und gelassen, während er zu einem Motorboot schaute, das mit einem Wasserskifahrer im Schlepptau in einem Schwall gelber Gischt über den Bayou bretterte.
„Bertie kann jederzeit zu mir in die Kanzlei kommen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, Dave“, sagte er. Seine kurzen graumelierten Haare waren feucht, frisch gekämmt und rasiermesserscharf gescheitelt, so dass die rosige Kopfhaut durchschimmerte.
„Sie sagt, Ihr Großvater hätte ihrer Familie das Land geschenkt.“
„Tatsache ist, dass wir nie Pacht von ihnen verlangt haben. Das legt sie dahingehend aus, dass ihr das Land gehört.“
„Wollen Sie es verkaufen?“
„Ist nur eine Frage der Zeit, bis es jemand erschließt.“
„Diese schwarzen Familien leben da schon seit langer Zeit, Moleen.“
„Mir brauchen Sie nichts zu erzählen.“ Einen Moment lang wirkte er unwirsch, dann fasste er sich wieder. „Schauen Sie, in Wirklichkeit sieht das folgendermaßen aus, und ich will mich damit keineswegs beklagen: Dort wohnen sechs oder sieben Negerfamilien, für die wir seit 50 Jahren sorgen. Ich meine damit, dass wir die Arzt- und Zahnarztrechnungen für sie bezahlen, das Schulgeld, ihnen ein Draufgeld zum zehnten Juni geben und ihre Leute aus dem Gefängnis auslösen. Bertie vergisst so etwas gern.“
„Sie hat irgendwas davon erzählt, dass auf dem Grundstück Gold vergraben sein soll.“
„Herr im Himmel. Ich will Ihnen ja nicht zu nahetreten, aber haben Sie nichts Besseres zu tun?“
„Sie hat auf mich aufgepasst, als ich klein war. Ich kann sie nicht einfach aus meinem Büro rausschmeißen.“
Er lächelte und legte mir die Hand auf die Schulter. Seine Nägel waren makellos, die Finger weich, so als berühre einen eine Frau. „Schicken Sie sie bei mir vorbei“, sagte er.
„Was soll dieses Gerede von wegen Gold?“
„Wer weiß? Ich habe immer gehört, dass Jean Lafitte seine Schätze angeblich auf der anderen Seite des Bayou vergraben haben soll, da drüben bei den beiden großen Zypressen.“ Aus dem Lächeln wurde ein fragender Blick. „Warum schauen Sie so finster?“
„Sie sind schon der zweite, der in den letzten Tagen den Namen Lafitte erwähnt.“
„Hm“, sagte er und stieß die Luft aus der Nase.
„Vielen Dank, dass Sie die Zeit erübrigt haben, Moleen.“
„Gern geschehen.“
Ich ging zu meinem Pick-up, der auf der kiesbestreuten Zufahrt neben dem Bootshaus stand. Ich rieb mir den Nacken, so als sei mir eben noch etwas eingefallen, das ich fast vergessen hätte.
„Entschuldigen Sie, aber haben Sie nicht mal Berties Neffen verteidigt?“
„Das stimmt.“
„Luke heißt er, und Sie haben ihn aus der Todeszelle rausgehauen.“
„Genauso war’s.“
Ich nickte und winkte ihm noch einmal zu.
Er hatte erwähnt, dass seine Familie seit jeher Schwarze aus dem Gefängnis herausholte, aber kein Wort darüber verloren, dass er jemanden in einer dramatischen Aktion wenige Stunden vor der Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl gerettet hatte.
Warum nicht?
Vielleicht aus bloßer Bescheidenheit, sagte ich mir.
Als ich in der Auffahrt zurücksetzte, goss er lässig seinen Eistee in den oben in einem Ameisenhaufen steckenden Trichter.
Ich fuhr auf dem St.-Martinville-Highway hinaus zu dem limonengrünen, ein Stück von der Straße zurückgesetzten und hinter einer Reihe Pinien stehenden Doppelhaus, dorthin, wo Della Landry Qualen hatte erdulden müssen, die sich die meisten von uns nicht einmal in ihren schlimmsten Alpträumen vorstellen mögen. Die Mörder hatten das Haus buchstäblich auf den Kopf gestellt. Matratzen, Kissen und Polstermöbel waren aufgeschlitzt, Geschirr und Bücher von den Regalen gefegt, sämtliche Schubladen auf dem Boden ausgekippt, Putz und Wandverkleidung mit einem Brecheisen oder Zimmermannshammer herausgerissen. Selbst die Abdeckung auf dem Wasserkasten der Toilette war zerschlagen.
Der Inhalt der Badezimmerschränke, egal wie intim, war quer über den Boden verstreut und von schweren Schuhen auf den Kunstfliesen zermalmt worden. Die gläserne Schiebetür der über der Badewanne angebrachten Duschkabine war aus dem Rahmen gerissen. Auf der anderen Seite der Wanne befand sich ein trockener roter Streifen, der von einem mit Farbe getränkten Pinsel hätte stammen können.
Wenn die Spur eines Mordopfers in die halbseidene Welt der Aufreißlokale und Zuhälter, der kleinen Betrüger und Straßendealer zurückverfolgt werden kann, dauert die Suche nach dem Täter für gewöhnlich nicht lange. Aber Della Landry war Sozialarbeiterin gewesen, hatte erst vor drei Jahren an der Louisiana State University ihren Abschluss in Politologie gemacht. Sie stammte aus einer gutbürgerlichen Familie in Slidell, hatte regelmäßig die katholische Kirche in St. Martinville besucht und Religionsunterricht für die Kinder von Wanderarbeitern gegeben.
Sie hatte einen Freund in New Orleans, der manchmal übers Wochenende bei ihr blieb, aber niemand wusste, wie er hieß, und allem Anschein nach gab es auch nichts Bemerkenswertes über diese Beziehung zu berichten.
Was könnte sie getan, besessen oder in den Händen gehabt haben? Was hatte die Täter angelockt, die sie in jungen Jahren so jäh aus dem Leben gerissen hatten?
Die Killer könnten einen Fehler gemacht haben, dachte ich, sich die falsche Person ausgesucht haben, an die falsche Adresse geraten sein. Warum nicht? Polizisten passierte das auch.
Aber die Doppelhaushälfte war zuvor an ein Ehepaar vermietet gewesen, das einen Gemischtwarenladen hatte. Nebenan wohnten Rentner. Ansonsten lebten hier, in dieser beinahe ländlichen Gegend, überwiegend Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, die nie genug Geld haben würden, um sich ein eigenes Haus zu kaufen.
Ein kleiner Bücherständer aus Metalldraht lag umgekippt neben dem Fernseher. Die auf dem Teppichboden verstreuten Bände deuteten lediglich auf ein allgemeines Interesse am Lesen hin, ohne dass etwas Ausgefallenes darunter gewesen wäre. Doch inmitten der aufgeschlagenen und ausgerissenen Seiten war eine kleine Zeitung mit dem Titel The Catholic Worker, auf der sich ein Schuhabdruck befand.
Ich sah das Telefon, das aus der Steckdose in der Wand gerissen worden war, aber aus irgendeinem Grund fiel mir zuerst der Zettel mit der Nummer auf, der unten auf dem Apparat klebte.
Ich schob den Stecker wieder in die Dose und wählte die Dienststelle an.
„Wally, könntest du in mein Büro gehen und einen Blick auf die rosa Telefonbenachrichtigung werfen, die in der Ecke meiner Schreibunterlage klemmt?“
„Klar. Hey, ich bin froh, dass du anrufst. Der Sheriff hat dich gesucht.“
„Immer der Reihe nach, ja?“
„Bleib dran.“
Er stellte mich auf Warteschleife, nahm dann den Hörer an meinem Schreibtisch ab.
„Bin bereit, Dave.“
Ich bat ihn, mir die Telefonnummer auf der Benachrichtigung vorzulesen. Als er sie durchgegeben hatte, sagte er: „Das ist die Nummer, die Sonny Marsallus hinterlassen hat.“
„Es ist auch die Nummer von dem Telefon, von dem aus ich gerade anrufe. Della Landrys Apparat.“
„Was läuft da eigentlich? Will Sonny seinen Scheiß etwa bei uns in Iberia durchziehen?“
„Ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.“
„Hör mal, der Sheriff will, dass du raus zum Spanish Lake fährst. Sweet Pea Chaisson und eine Fuhre von seinen Bräuten machen vor dem Gemischtwarenladen einen Riesenaufstand.“
„Schick einen Streifenwagen raus.“
„Es geht nicht um ein Verkehrsdelikt.“ Er prustete laut und keuchend los, als ob er sich an seinem Zigarrenrauch verschluckt habe. „Sweet Pea hat die Leiche von seiner Mutter im Kofferraum, und angeblich ragt sie hinten aus seiner Karre raus. Sieh zu, was du tun kannst, Dave.“
3
Nach etwa acht Kilometern sah ich vom alten Lafayette-Highway aus, der am Spanish Lake vorbeiführte, die blinkenden Lichter der Einsatzfahrzeuge bei dem Gemischtwarenladen, vor dem sich der Verkehr in beiden Richtungen staute, weil die Leute abbremsten und die uniformierten Polizisten und Sanitäter angafften, die ihrerseits offenbar nicht wussten, was sie von der Angelegenheit halten sollten. Ich fuhr auf der Bankette weiter und stieß auf den Parkplatz, wo Sweet Pea und fünf seiner Nutten – drei Weiße, eine Schwarze und eine Asiatin – mit schweißglänzenden Gesichtern zwischen etlichen kreuz und quer herumliegenden schmutzigen Schaufeln in einem rosa Cadillac-Cabriolet saßen, aus dessen Lederpolstern die Hitze aufstieg. Eine Horde Kinder versuchte zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch zu gaffen, die sich um den Kofferraum scharten.
Der Sarg war übergroß, so breit wie ein querliegender Axtgriff, bestand aus Holz und Tuch, war mit den Überresten von Seidenblumen und Engeln geschmückt und hatte ein quadratisches Sichtfenster im Deckel. Die Seitenwände waren verfault, die Bretter wurden von Plastikmüllsäcken und Klebeband zusammengehalten. Sweet Pea hatte eine Sperrholzplatte unter den Boden geklemmt, damit er nicht auseinanderbrach und in lauter Einzelteilen auf der Straße landete, aber das Kopfteil des Sarges ragte über die Stoßstange hinaus. Das Glasfenster war mitten durchgebrochen, und darunter konnte man die wächsernen, eingefallenen Gesichter zweier Leichen und ein Gewirr aus verfilzten Haaren erkennen, die bis an die Seitenwände gewuchert waren.
Ein uniformierter Deputy mit Sonnenbrille grinste mich an.
„Sweet Pea sagt, er macht einen Sonderpreis für die Braut in der Kiste.“
„Was geht hier vor?“, fragte ich.
„Hat Ihnen Wally nicht Bescheid gesagt?“
„Nein, der war ebenfalls zu Späßen aufgelegt.“
Der Deputy hörte auf zu lächeln. „Er sagt, er schafft seine Angehörigen zu einem anderen Friedhof.“
Ich ging zur Fahrertür. Sweet Pea blinzelte mich gegen die tiefstehende Sonne an. Er hatte die seltsamsten Augen, die ich je bei einem Menschen gesehen habe. Es waren schmale, unter einer schweren Hautfalte liegende Schlitze, die wie die Augen eines kleinen Vogels wirkten.
„Ich glaub es nicht“, sagte ich.
„Glauben Sie’s ruhig“, sagte die Frau neben ihm abschätzig. Ihre rosa Shorts waren mit Erde verkrustet. Sie zog das Oberteil ihrer Bluse hoch und roch daran.
„Ihr meint wohl, es ist Mardi Gras?“, fragte ich.
„Hab ich etwa nicht das Recht, meine Adoptivmutter umzubetten?“, fragte Sweet Pea. Seine schütteren Haare klebten an der Kopfhaut.
„Wer ist mit ihr im Sarg?“
Sein Mund bildete ein feuchtes, stummes O, so als denke er nach. Dann sagte er: „Ihr erster Mann. Die sind unzertrennlich gewesen.“
„Können wir aussteigen und uns was zu essen holen?“, fragte die Frau neben ihm.
„Bleibt lieber noch einen Moment, wo ihr seid“, sagte ich.
„Robicheaux, können wir nicht vernünftig miteinander reden? Es is heiß. Meine Mädels fühlen sich nicht wohl.“
„Reden Sie mich nicht mit Familiennamen an.“
„Entschuldigung, aber Sie verstehen nicht, worum es geht. Meine Adoptivmutter war auf der Bertrand Plantage begraben, weil sie dort nämlich aufgewachsen is. Ich hab gehört, dass sie verkauft werden soll, will aber nicht, dass irgendein Schwanzlutscher herkommt und Zement auf das Grab meiner Mutter kippt. Deshalb schaff ich sie nach Breaux Bridge. Dafür brauch ich keine Genehmigung.“
Er schaute mir in die Augen und bemerkte meinen Blick.
„Ich kapier’s nicht. War ich unhöflich, hab ich Sie mit irgendwas beleidigt?“, fragte er.
„Sie sind ein Zuhälter. Sie haben hier in der Gegend nicht viele Freunde.“
Er schlug mit den Handballen leicht auf das Lenkrad, lächelte vor sich hin. Schwere Schweißtropfen standen in seinen weißen Augenbrauen. Er putzte sich mit dem kleinen Finger das Ohr aus. „Müssen wir auf den Gerichtsmediziner warten?“, fragte er.
„Ganz genau.“
„Ich will nicht, dass mir jemand die Sitze einsaut. Die Mädels haben drüben am Grab zwei Kästen Bier getrunken.“
„Kommen Sie mit in mein Büro“, sagte ich.
„Wie bitte?“, fragte er.
„Steigen Sie aus.“
Er ging mit mir in den Schatten auf der windabgewandten Seite des Ladens. Er trug eine weiße Hose, braune Schuhe, einen braunen Gürtel und ein kastanienfarbenes Hemd, das bis über die Brust aufgeknöpft war. Die Zähne in seinem winzigen Mund wirkten klein und spitz.
„Warum die harte Tour?“, fragte er.
„Ich kann Sie nicht leiden.“
„Das is Ihr Problem.“
„Haben Sie Stress mit Sonny Boy Marsallus?“
„Nein. Warum sollte ich?“
„Weil Sie glauben, dass er sich in Ihre Geschäfte einmischt.“
„Stehn Sie bei Marsallus auf der Gehaltsliste?“
„Letzte Nacht wurde eine Frau totgeschlagen, Sweet Pea. Wie fänden Sie es, wenn Sie die Nacht im Bau zubringen und uns morgen früh ein paar Fragen beantworten?“
„Diese Braut, war das Sonnys Schlampe oder was? Warum halten Sie mir das vor?“
„Vor neun Jahren war ich dabei, als man ein Mädchen aus dem Industrial Canal gezogen hat. Sie war mit Benzin übergossen und angezündet worden. Ich habe gehört, dass Sie sich so bei den Giacanos eingekratzt haben.“
Er zog einen Zahnstocher aus der Brusttasche seines Hemds und steckte ihn in den Mund. Versonnen schüttelte er den Kopf.
„Hier in der Gegend ändert sich nie was. Sagen Sie mal, wollen Sie ’n Snowball?“, sagte er.
„Sie sind ein schlauer Kerl, Sweet Pea.“ Ich löste die Handschellen von meinem Gürtel und drehte ihn zu der Bimssteinmauer um.
Er blieb ruhig stehen, als ich sie um beide Handgelenke schnappen ließ, hatte das Kinn hochgereckt und lächelte vor sich hin.
„Wie lautet die Anschuldigung?“, fragte er.
„Unerlaubte Beförderung von Müll. Ist nicht beleidigend gemeint.“
„Moment mal“, sagte er. Er beugte die Knie, grunzte und ließ leise Luft ab. „Junge, das tut gut. Besten Dank, Partner.“
An diesem Abend kochten Bootsie, meine Frau, und ich auf dem Küchenherd in einem großen schwarzen Topf Flusskrebse, die wir mit unserer Adoptivtochter Alafair am Picknicktisch im Hof abpulten und aßen. Mein Vater, ein Trapper und Ölbohrer, hatte unser Haus während der Depression aus Zypressen und Eichen gebaut, sämtliche Bretter und Balken von Hand zurechtgehauen, gebohrt und ineinandergefügt, und durch das Regenwasser und den Rauch der Stoppelfeuer auf den abgeernteten Zuckerrohrfeldern war das Holz dunkel und hart geworden. Heutzutage dürfte selbst ein schwerer Schlag mit dem Schmiedehammer an der Außenwand abprallen. Vor dem Haus führte ein mit Bäumen bestandener Abhang hinab zum Bayou mit meinem Bootsanleger und dem Köderladen, den ich mit einem alten Schwarzen namens Batist betrieb, und auf der anderen Seite des Bayou war der Sumpf, ein Dickicht aus Gummibäumen, Weiden und toten Zypressen, die sich in der untergehenden Sonne blutrot färbten.
Alafair war jetzt fast 14, hatte nur mehr wenig mit dem kleinen salvadorianischen Mädchen gemein, dessen Gliedmaßen sich so zart und zerbrechlich wie Vogelknochen angefühlt hatten, als ich sie draußen im Golf aus einem untergegangenen Flugzeug gezogen hatte. Und sie war auch nicht mehr das rundliche, stramme, typisch amerikanische Kind, das Indianergeschichten über Curious Custer und Baby Squanto las, eine Donald-Duck-Kappe mit einem quakenden Schnabel als Schirm, ein Baby-Orca-T-Shirt und rot-weiße Tennisschuhe trug, auf deren gummierten Spitzen jeweils LINKS und RECHTS eingeprägt war. Es kam mir so vor, als hätte sie eines Tages einfach eine Grenze überschritten, denn mit einem Mal war der Babyspeck weg, und ihre Brust und Hüften hatten weibliche Formen angenommen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, und es versetzt mir nach wie vor einen Stich, wie sie ihren Vater eines Morgens bat, sie nicht mehr „kleiner Kerl“ oder „Baby Squanto“ zu nennen.
Früher hatte sie eine Ponyfrisur gehabt, aber jetzt trug sie die dichten, von einem leichten Kastanienton durchsetzten Haare schulterlang. Sie riss einen Krebsschwanz ab, saugte das Fett aus dem Kopf und pulte mit dem Daumennagel das Fleisch aus der Schale.
„Was war das für ein Buch, das du draußen auf der Veranda gelesen hast, Dave?“, fragte sie.
„Eine Art Tagebuch.“
„Von wem?“
„Einem gewissen Sonny Boy.“
„Heißt so etwa ein erwachsener Mann?“, fragte sie.
„Marsallus?“, fragte Bootsie. Sie hörte auf zu essen. Ihre Haare waren honigblond, und sie hatte sie hochgebürstet und rund um ihren Kopf festgesteckt. „Was hast du denn mit ihm und seinesgleichen zu tun?“
„Ich bin ihm an der Canal über den Weg gelaufen.“
„Der ist wieder in New Orleans? Ist er etwa lebensmüde?“
„Wenn ja, hat jemand anders dafür büßen müssen.“
Ich sah ihren fragenden Blick.
„Die Frau, die drüben an der Grenze nach St. Martin umgebracht worden ist“, sagte ich. „Ich glaube, sie war Sonnys Freundin.“
Sie biss sich leicht auf die Unterlippe. „Er versucht dich in irgendwas reinzuziehen, nicht wahr?“
„Vielleicht.“
„Nicht vielleicht. Ich kenn ihn länger als du, Dave. Er ist manipulativ.“
„Ich glaube, ich bin nie aus ihm schlau geworden. Los, wir fahren in die Stadt und gehen ein Eis essen“, sagte ich.
„Lass dich von Sonny nicht einspannen“, sagte sie.
Ich wollte Bootsies Wissen um den Mob in New Orleans nicht in Frage stellen. Nach der Hochzeit mit ihrem früheren Mann hatte sie herausgefunden, dass er die Bücher für die Familie Giacano führte und 50 Prozent an einer Automatenfirma von ihnen besaß. Als er und seine Geliebte auf dem Parkplatz der Rennbahn in Hialeah erschossen wurden, hatte sie außerdem feststellen müssen, dass er ihr Haus an der Camp Street beliehen hatte, das sie schuldenfrei und unbelastet in die Ehe eingebracht hatte.
Außerdem wollte ich in Alafairs Anwesenheit nicht mit Bootsie über den Inhalt von Sonnys Notizbuch sprechen. Vieles davon verstand ich nicht – Namen, die mir nichts sagten, Verweise auf Verbindungsebenen, Anspielungen auf Waffenlager und Drogenschmuggler, die das amerikanische Küstenradar unterflogen. Genau genommen kamen mir die Themen und Ortsnamen überholt vor, wie zehn Jahre alter Kram, mit dem sich auf dem Höhepunkt der Ära Reagan allerlei Untersuchungsausschüsse des Kongresses befasst hatten.
Aber bei vielen Eintragungen handelte es sich um hautnahe Schilderungen von Ereignissen, die weder ideologisch verbrämt waren noch nachträgliche Überlegungen über Recht und Unrecht wiedergaben.
Im Gefängnis ist es kühl und dunkel, und es riecht nach Stein und abgestandenem Wasser. Der Mann in der Ecke sagt, er sei aus Texas, aber er spricht kein Wort Englisch. Er hat mit einer Gabel die Absätze seiner Stiefel abmontiert und den Wachen 70 amerikanische Dollar gegeben. Durch die Gitter kann ich die Helikopter sehen, die tief über den Baumwipfeln auf die Ortschaft am Berghang zufliegen und eine Rakete nach der anderen abfeuern. Ich glaube, die Wachen werden den Mann in der Ecke morgen früh erschießen. Ständig erzählt er jedem, der ihm zuhört, dass er nur ein Marijuanista wäre …
Etwa zwei Kilometer von der Stelle entfernt, wo wir unsere Munition abgeholt haben, fanden wir in einem Sumpf sechs Zuckerrohrschneider, denen man die Daumen mit Draht auf dem Rücken zusammengebunden hatte. Sie hatten keinerlei Verbindung zu uns. Sie hatten niederknien müssen und waren mit Macheten hingerichtet worden. Wir rückten ab, als die Angehörigen aus dem Dorf kamen …
Die Ruhr … Wasser, das einem wie ein nasses Rasiermesser durch den Körper fährt … letzte Nacht glühendes Fieber, während der Regen auf die Bäume prasselte … Ich werde morgens von Gewehrfeuer auf der anderen Seite der Indianerpyramide geweckt, die grau und grün und dunstverhangen ist. Meine Decke wimmelt von Spinnen …
„Worüber denkst du nach?“, fragte Bootsie auf der Rückfahrt von der Eisdiele.
„Du hast recht, was Sonny angeht. Er ist der geborene Schieber.“
„Ja?“
„Ich hab bloß noch nie einen Zocker gekannt, der sich das Leben absichtlich zur Hölle auf Erden macht.“
Ich sah, wie sie mir im Zwielicht einen sonderbaren Blick zuwarf.
Am nächsten Morgen ging ich nicht gleich in die Dienststelle. Stattdessen fuhr ich am Spanish Lake vorbei zu der kleinen Gemeinde Cade, die hauptsächlich aus unbefestigten Straßen, den alten Bahngleisen der Southern Pacific und den windschiefen, ungestrichenen Bretterhütten der Schwarzen bestand, hinter denen sich die endlosen, zur Zuckerrohrplantage der Familie Bertrand gehörenden Lände reien erstreckten.
Heute Morgen hatte es geregnet, und zwischen dem jungen Zuckerrohr, das hellgrün auf den Feldern stand, schritten weiße Reiher auf und ab und pickten Insekten aus dem Boden. Ich fuhr auf einem Feldweg an Bertha Fontenots verwittertem Zypressenhaus vorbei, das ein oranges Blechdach hatte und hinter dem ein kleines Toilettenhäuschen stand. An der Südwand wucherten üppige Bananenstauden, und aus allerlei Kaffeekannen und verrosteten Eimern auf ihrer Veranda wuchsen blühende Petunien und Springkraut. Ich fuhr an einem weiteren Haus vorbei, das ausnahmsweise gestrichen war, und hielt an einem Hain aus Gummibäumen, dem inoffiziellen Friedhof der schwarzen Familien, die schon vor dem Bürgerkrieg auf der Plantage gearbeitet hatten.
Die Gräber waren kaum mehr als flache Mulden zwischen wehendem Laub, die vereinzelten, mit ungelenken Buchstaben und Ziffern beschrifteten Holzkreuze und aus Brettern gezimmerten Gedenktafeln umgestürzt und unter den Rädern der Traktoren und Zuckerrohrfuhrwerke geborsten. Mit Ausnahme einer offenen Grube, an deren Boden, halb unter der nachrieselnden Erde begraben, die zerbrochene steinerne Deckplatte lag.
Doch selbst im tiefen Schatten konnte ich den Namen Chaisson erkennen, der in den Stein gemeißelt war.
„Kann ich Ihnen bei was helfen?“, fragte ein Schwarzer hinter mir. Er war groß, hatte ein schmales Gesicht, Augen wie Blaufischschuppen, kurzrasierte Haare, und seine Haut schimmerte in einem matten Goldton, wie altes Sattelleder. Er trug ein rosa Golfhemd mit Grasflecken, ausgeblichene Jeans und Turnschuhe ohne Socken.
„Ham Sie Mr. Moleen gefragt, ob Sie sein Anwesen betreten dürfen?“, fragte er.
„Ich bin Detective Robicheaux vom Büro des Sheriffs“, sagte ich und klappte das Etui mit meiner Dienstmarke auf. Er nickte, ohne etwas zu erwidern, sichtlich darum bemüht, sich keinerlei Gefühlsregung anmerken zu lassen. „Sind Sie nicht Berties Neffe?“
„Ja, klar, das stimmt.“
„Sie heißen Luke, Sie führen den Tanzschuppen südlich vom Highway.“
„Zeitweise. Er gehört mir aber nicht. Sie wissen ja allerhand.“ Sein Blick wurde verhangen, als er lächelte. Hinter ihm sah ich eine junge Schwarze, die uns von der Veranda aus beobachtete. Sie trug weiße Shorts und eine geblümte Bluse, und ihre Haut hatte den gleichen goldenen Schimmer wie seine. Sie ging am Stock, aber an ihren Beinen konnte ich keinerlei Gebrechen erkennen.
„Was glauben Sie, wie viele Leute in diesem Hain begraben sind?“, fragte ich.
„Hier in der Gegend wird schon lang keiner mehr begraben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es jemals der Fall war.“
„Stammt das Loch da etwa von einem Gürteltier?“
„Miss Chaisson und ihr Mann warn da begraben. Aber das is der einzige Gedenkstein, den ich hier je gesehn hab.“
„Vielleicht handelt es sich bei diesen Mulden um lauter Indianergräber. Was meinen Sie?“
„Ich bin in der Stadt aufgewachsen, Sir. Mit so was kenn ich mich nich aus.“
„Sie brauchen mich nicht mit Sir anzureden.“
Er nickte wieder, die Augen ins Leere gerichtet.
„Gehört Ihnen das Haus, Partner?“, fragte ich.
„Tante Bertie sagt, es gehört ihr seit dem Tod ihrer Mutter. Sie lässt mich und meine Schwester hier wohnen.“
„Sie sagt, es gehört ihr, was?“
„Mr. Moleen sagt was andres.“
„Wem glauben Sie?“, fragte ich und lächelte.
„Das, was die Leute beim Gericht sagen. Wollen Sie noch irgendwas, Sir? Ich muss wieder an die Arbeit.“
„Danke für Ihre Mühe.“
Das einfallende Licht warf helle Tupfen auf seine Haut, als er sich entfernte, das Gesicht dem Wind zugewandt, der über das Zuckerrohrfeld wehte. War ich schon zu lange Polizist? fragte ich mich. War es schon so weit gekommen, dass ich jemanden einfach deshalb nicht mochte, weil er eingesessen hatte?
Nein, es lag an der Verschlossenheit, der Feindseligkeit, die nicht zu greifen war, dem Rückzug auf die eigene Rassenzugehörigkeit, die man einsetzte wie die Schneide einer Axt.
Aber was durften wir anderes erwarten? dachte ich. Wir waren gute Lehrer gewesen.
Ich war fünf Minuten in meinem Büro, als Helen Soileau mit einem Aktenordner in der Hand durch die Tür kam, sich auf die Kante meines Schreibtischs hockte und mich mit ihren weit auseinanderstehenden, reglosen blassen Augen anschaute.
„Was ist los?“, fragte ich.
„Rat mal, wer Sweet Pea Chaisson auf Kaution rausgeholt hat?“
Ich zog die Augenbrauen hoch.
„Jason Darbonne, drüben aus Lafayette. Seit wann vertritt der denn Zuhälter?“
„Darbonne würde seine eigene Mutter vor einen Hundeschlitten spannen, wenn der Preis stimmt.“
„Hör dir das an. Der Mann vom Gesundheitsamt wollte Sweet Pea den Sarg nicht nach Breaux Bridge transportieren lassen, also hat er sich jemand besorgt, der ihn für zehn Piepen in ’nem Müllaster hingeschafft hat.“
„Was ist in dem Aktenordner?“
„Wolltest du diesen Pisser noch mal vernehmen? Zu schade. Die FBIler haben ihn heut Morgen abgeholt … He, hab ich mir doch gedacht, dass dir das in den Eiern ziept.“
„Helen, könntest du mal ein bisschen drüber nachdenken, wie du manchmal mit Menschen sprichst?“
„Um mich geht’s hier nicht. Es geht um den nichtsnutzigen schwarzen Blindfisch im Knast, der unsern Mann an das FBI übergeben hat.“
„Was will das FBI denn von einem kleinen Einbrecher?“
„Hier ist der Papierkram“, sagte sie und warf den Aktenordner auf meinen Schreibtisch. „Wenn du rüber in den Knast gehst, dann sag dem trantütigen Scheißer, er soll nicht ständig an anderer Leute Schwänze denken und uns wenigstens anrufen, bevor er eine laufende Ermittlung versaut.“
„Ich mein’s ernst, Helen … Warum machst du’s den Leuten nicht ein bisschen … Lassen wir’s … Ich kümmer mich drum.“
Nachdem sie mein Büro verlassen hatte, ging ich ins Bezirksgefängnis und suchte den Beschließer auf. Er war ein drei Zentner schwerer Bisexueller, der eine Brille mit Gläsern so dick wie Colaflaschen trug und den Hals voller Muttermale hatte.
„Ich hab ihn nicht entlassen. Das war die Nachtwache“, sagte er.
„Die Papiere sind Mist, Kelso.“
„Beleidige mir nicht die Nachtwache. Der is nicht umsonst nach der achten Klasse abgegangen.“
„Du hast einen merkwürdigen Sinn für Humor. Roland Broussard war Zeuge bei einem Mord.“
„Dann red doch mit den FBIlern. Vielleicht haben sie ihn deswegen abgeholt. Außerdem haben sie ihn bloß vorübergehend mitgenommen.“
„Wo steht das? Die Handschrift sieht aus, als wär ein besoffenes Huhn über das Blatt gelaufen.“
„Willst du sonst noch was?“, fragte er und holte ein in Wachspapier gewickeltes Sandwich aus seiner Schreibtischschublade.
„Ja, dass der Häftling wieder in unseren Gewahrsam kommt.“
Er nickte, biss in das Sandwich und schlug die Zeitung auf seiner Schreibunterlage auf.
„Ich versprech’s dir, Mann, und du wirst’s auch zuerst erfahren“, sagte er und war bereits in den Sportteil vertieft.
4
Wenn man eine Zeit lang Polizist ist, ist man gewissen Versuchungen ausgesetzt. Es fängt, wie bei allen Verlockungen, klein an und wächst sich allmählich aus, bis man feststellt, dass man irgendwo unwiderruflich vom rechten Weg abgekommen ist, und eines Morgens in einem moralischen Niemandsland aufwacht, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie man da hingelangt ist.
Ich rede hier nicht von Bestechlichkeit, auch nicht davon, dass man Dope aus der Asservatenkammer mitgehen und sich von Dealern mit Stoff versorgen lässt. Diesen Versuchungen erliegt man nicht von Berufs wegen, sondern aus persönlichen Gründen.
Der große Kuhhandel, den man eingeht, betrifft vielmehr die Mitmenschlichkeit. Die Machtbefugnis eines Polizisten ist gewaltig, zumindest in den unteren Schichten der Gesellschaft, in denen man sich die meiste Zeit aufhält. Als junger Berufsanfänger ist man Menschenfreund, hat feste moralische Vorsätze, doch nach und nach kommt man sich verraten vor von denen, die man beschützen und denen man dienen soll. Man ist in ihrem Stadtteil nicht gern gesehen, wird regelmäßig angelogen, bis aufs Blut gereizt, der Streifenwagen wird mit Molotowcocktails beworfen. Der schmierigste Kopfgeldjäger kann sich unbeschadet in Wohnviertel wagen, in denen man selbst hinterrücks beschossen wird.
Langsam beginnt man zu glauben, dass manche aus unserer Gesellschaft nicht dem gleichen Genpool angehören. Man hält sie insgeheim für Untermenschen, für moralisch verkommen oder bestenfalls für schräge Gestalten, die man hinter Gitter steckt und wie komische Zirkustiere behandelt.
Danach trifft man vielleicht als Erster an einem Tatort ein, an dem ein anderer Polizist gerade einen flüchtigen Verdächtigen erschossen hat. Es ist eine heiße Sommernacht, die Luft flirrt vor Insekten, und man weiß genau Bescheid, will es aber nicht wahrhaben. Ein schlichter Einbruch, ein aufgeschlitztes Fliegengitter auf der Rückseite des Hauses, der Tote ist ein völlig vertrottelter Verlierer, den jeder Cop weit und breit kennt. Die beiden Einschusswunden liegen keine zehn Zentimeter auseinander.
„Wollte er abhauen?“, sagt man zu dem anderen Cop, der fickrig wie nur sonst was ist.
„Da hast du verdammt recht. Und dann ist er stehen geblieben und hat sich umgedreht. Schau, er hat ’ne Knarre gehabt.“
Die Waffe liegt im Gras. Sie ist blauschwarz, der Griff mit Isolierband umwickelt. Der Mond scheint kaum, die Nacht so dunkel, dass man sich fragt, wie jemand diese Waffe in der Hand eines schwarzen Tatverdächtigen sehen konnte.
„Ich zähl auf dich, Kleiner“, sagt der andere Cop. „Sag den Leuten einfach, was du gesehen hast. Da ist die Scheißknarre. Stimmt’s? Das ist kein Pilz.“
Und schon überschreitet man eine Grenze.
Nimm’s nicht schwer, sagt einem später ein Sergeant und Saufkumpan. Ist doch bloß ein weiterer Verlierer weniger. Die meisten von der Sorte eignen sich doch nicht mal zum Seife machen.
Dann passiert etwas, das einen daran erinnert, dass wir alle dem gleichen Stamm entsprungen sind.
Man stelle sich einen Mann vor, der in einen Kofferraum eingeschlossen ist, die Hände auf den Rücken gefesselt, die Nase läuft wegen des Staubs und des durchdringenden Ölgeruchs vom Reservereifen. Die Bremslichter des Wagens gehen an, und einen kurzen Moment wird es hell im Kofferraum. Dann biegt der Wagen auf einen Feldweg ab, und Steine prasseln wie Schrotkugeln von unten an die Kotflügel. Aber plötzlich tut sich etwas, und der gefesselte Mann kann sein Glück zunächst kaum fassen – der Wagen schlägt in eine Bodenrinne, die Kofferraumverriegelung springt auf, verhakt sich aber wieder, ohne dass der Deckel hochklappt und vom Fahrer im Rückspiegel gesehen werden kann.
Die Luft, die durch den Spalt hereindringt, riecht nach Regen, nassen Bäumen und Blumen, der Mann hört, wie draußen Hunderte von Fröschen miteinander um die Wette quaken. Er richtet sich auf, drückt die Sohlen seiner Tennisschuhe an den Deckel und hebelt die Halterung aus dem Schloss, wälzt sich dann aus dem Kofferraum heraus, prallt auf die Stoßstange, landet mitten auf der Straße und kullert wie ein verlorener Reifen. Er landet auf der Brust und keucht auf, so als sei er tief gefallen. Steine zerschürfen ihm das Gesicht und reißen silberdollargroße Wunden in seine Ellenbogen.
30 Meter weiter bleibt der Wagen, dessen Kofferraumdeckel sperrangelweit offen steht, mit quietschenden Bremsen stehen. Und der Gefesselte schlägt sich durch das Röhricht neben der Straße und gerät in einen Sumpf, verheddert sich mit den Beinen in den Ranken abgestorbener Wasserhyazinthen und versinkt im Schlick, der sich wie weicher Zement um seine Füße legt.
Vor sich sieht er die überfluteten Zypressen und Weiden, die grüne Algenschicht auf dem Wasser, die dunklen Schatten, die ihn umfangen und verbergen könnten wie ein Mantel. Die Wasserhyazinthen legen sich wie ein Drahtgeflecht um seine Beine, er stolpert, fällt auf ein Knie. Eine braune Schlammwolke wallt um ihn auf. Er torkelt wieder weiter, zerrt an der Wäscheleine, mit der seine Handgelenke gefesselt sind, hört nur noch sein hämmerndes Herz.
Die Verfolger sind jetzt unmittelbar hinter ihm, sein Rücken juckt, als werde ihm die Haut mit Zangen abgezogen. Dann hört er einen Schrei und fragt sich, ob er von ihm stammt oder von einer Nutria draußen auf dem See.
Sie geben nur einen Schuss ab. Die Kugel trifft ihn dicht über der Niere und durchbohrt ihn wie ein Speer aus Eis. Als er die Augen wieder aufschlägt, liegt er rücklings im weichen Geäst der umgestürzten Weiden, die sich an einer Sandbank verfangen haben, und seine Beine hängen im Wasser. Der Pistolenschuss hallt ihm noch immer in den Ohren. Der Mann, von dem nur die Silhouette zu sehen ist, watet auf ihn zu und raucht eine Zigarette.
Nicht noch mal, will Roland Broussard sagen. Ich bin auf Meth. Das is der einzige Grund, weshalb ich dort gewesen bin. Ich bin ein Niemand, Mann. Das hier is nicht nötig.
Der Mann, von dem nur die Silhouette zu sehen ist, tritt vielleicht einen Schritt zur Seite, damit Rolands Gesicht im Mondlicht liegt. Dann jagt er eine weitere Kugel aus seiner .357er Magnum genau durch Rolands Augenbraue.
Mit schweren Schritten geht er zum Ufer zurück, wo sein Begleiter auf ihn gewartet hat, als sehe er sich zum wiederholten Mal einen altbekannten Film an.
5
Clete, dessen taubenblauer Porkpie-Hut schief in der Stirn saß, hörte zu und ließ den Blick gelegentlich in den Flur schweifen, während ich erzählte. Er trug makellose weiße Tennisshorts und ein mit Sittichen bedrucktes Hemd. An seinem Nacken und den mächtigen Oberarmen schälte sich die sonnenverbrannte Haut.
„Jemand kidnappen, der bereits in Haft sitzt, ist ziemlich frech. Was meinst du, wer die Typen waren?“, fragte er und wandte den Blick von zwei uniformierten Deputies auf der anderen Seite der Glasscheibe ab.
„Jungs, die sich mit den Formalitäten auskennen, zumindest gut genug, um einen Nachtbeschließer zu überzeugen, dass sie vom FBI sind.“
„Die Schmalzlocken?“
„Kann sein.“
„Ist aber normalerweise nicht ihr Stil. Die kommen den Bundesbehörden nicht gern ins Gehege.“ Wieder warf er einen Blick durch die Trennscheibe auf den Flur. „Wieso komm ich mir vor, als ob ich irgendein Zootier bin?“
„Reine Einbildung“, sagte ich mit ausdrucksloser Miene.
„Bestimmt.“ Dann zwinkerte er und richtete den Finger auf einen Deputy. Der Deputy blickte auf ein paar Papiere, die er in der Hand hatte.
„Lass es gut sein, Clete.“
„Wieso hast du mich hierhergebeten?“
„Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, angeln zu gehen.“
Er lächelte. Sein Gesicht war rosig, und die funkelnden grünen Augen verrieten einen ureigenen Sinn für Humor. Durch die eine Augenbraue und quer über den Nasenrücken verlief eine Narbe, die er sich als kleiner Junge im Irish Channel durch einen Schlag mit einem Bleirohr eingehandelt hatte.
„Dave, ich weiß, was mein alter Partner bei der Mordkommission denkt, bevor’s ihm selber klar ist.“
„Ich habe zwei ungeklärte Mordfälle. Eines der Opfer war möglicherweise Sonny Boy Marsallus’ Freundin.“
„Marsallus, hm?“, sagte er, und seine Miene wurde ernst.
„Ich wollte ihn von der Polizei in New Orleans aufgreifen lassen, aber er ist von der Bildfläche verschwunden.“
Er trommelte mit den Fingern auf die Armlehne des Stuhls. „Lass ihn außen vor“, sagte er.
„Was hat er unten in den Tropen getrieben?“, fragte ich.
„Allerhand durchgemacht.“
Helen Soileau kam herein, ohne anzuklopfen, und ließ den Tatortbericht auf meinen Schreibtisch fallen.
„Willst du einen Blick drauf werfen und ihn abzeichnen?“, fragte sie. Sie musterte Clete von oben bis unten.
„Kennt ihr einander?“, fragte ich.
„Nur vom Hörensagen. Hat er nicht mal für Sally Dio gearbeitet?“, sagte sie.
Clete steckte sich einen Kaugummi in den Mund und schaute mich an.
„Ich nehm mir den Bericht in ein paar Minuten vor, Helen“, sagte ich.
„Auf der Zigarettenkippe konnten wir keinen Fingerabdruck sichern, aber die Abgüsse von den Fuß- und Reifenspuren sehen gut aus“, sagte sie. „Übrigens, die .357er Kugeln waren Dumdum-Geschosse.“
„Danke“, sagte ich.
Clete drehte sich auf dem Stuhl herum und sah ihr nach, als sie wieder hinausging.
„Wer is’n die Muschileckerin?“, fragte er.
„Komm schon, Clete.“
„Ein Blick auf die Braut, und du gehst freiwillig ins Kloster.“
Es war Viertel vor fünf.
„Willst du nicht schon mal deinen Wagen holen? Wir treffen uns dann vor dem Eingang“, sagte ich.