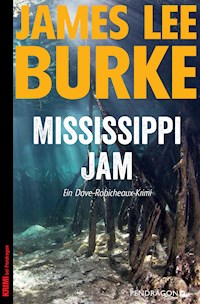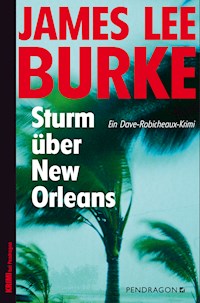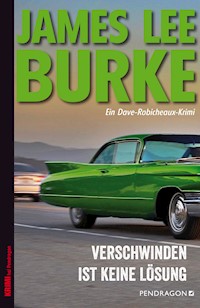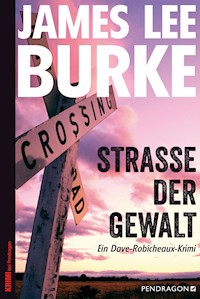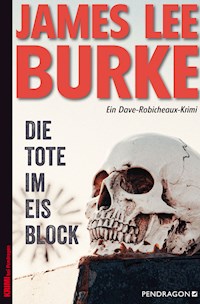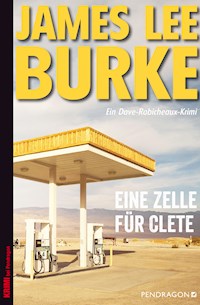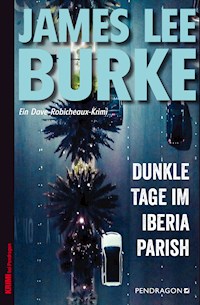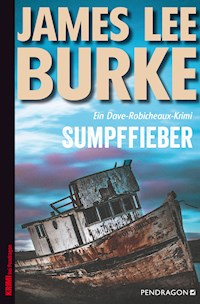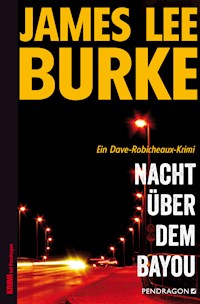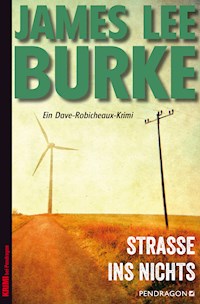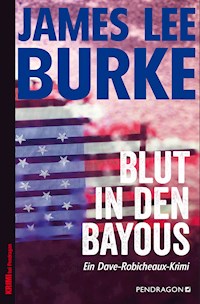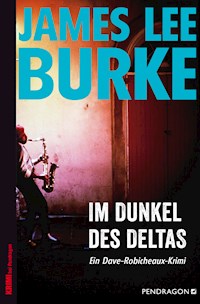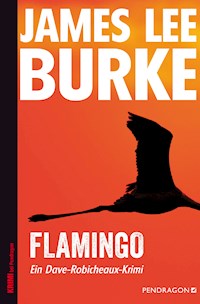Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt mit einem Schuss durch ein Fenster im Haus des Öl-Magnaten Weldon Sonnier. Dave Robicheaux wird mit den Ermittlungen beauftragt. Sofort ist er heillos verstrickt im engen Beziehungsgeflecht einer der angesehensten Familien Louisianas. Doch der Clan mauert. Wie soll er in diesem gefährlichen Sumpf aus familiärer Gewalt, jahrzehntealter Schuld und Mafiaverbindungen den Überblick behalten? Unterstützt von seinem Partner Clete Purcel versucht er Licht ins Dunkel zu bringen. Allerdings muss er nicht nur gegen Verbrecher kämpfen, auch die Dämonen seiner eigenen Vergangenheit machen ihm zu schaffen. Gelingt es Dave, dem Druck standzuhalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Weißes Leuchten
Für Farrel und Patty Lemoineund meinen alten Gitarrenpartner Murphy Dowouis
JAMES LEE BURKE
Weißes Leuchten
Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 5
Aus dem Amerikanischen von Oliver Huzly
1
Ich kannte die Sonnier-Familie schon mein ganzes Leben lang. Drei Sonniers hatten gemeinsam mit mir die katholische Grundschule in New Iberia besucht, einer war mit mir in Vietnam gewesen, und kurz war ich sogar mal mit Drew, dem Nesthäkchen, gegangen, bevor ich in den Krieg zog. Durch Drew wurde mir klar, dass die Sonniers einer ganz bestimmten Sorte von Menschen angehörten: Man mag sie nur aus der Entfernung, aber nicht wegen dem, was sie sind, sondern wegen dem, was sie verkörpern – eine Art vererbten oder familiär vermittelten Konstruktionsfehler, als wäre bei ihnen der Kitt vergessen worden, der uns als Menschen zusammenhält.
Die Geschichte der Sonnier-Kinder war so eine, von der man instinktiv wusste, dass man nicht mehr wissen wollte, genauso wie man sich spät nachts in der Bar Leidensgeschichten einer verzweifelten und geplagten Seele eigentlich gar nicht anhören mag. Als Polizist habe ich die Erfahrung gemacht, dass Pädophile in der Lage sind, sehr lange ihrem Treiben nachzugehen und dabei ein geordnetes Leben zu führen und Dutzende, sogar Hunderte von Kindern zu missbrauchen, weil man dem eigenen instinktiven Gespür für die Symptome beim Täter nicht trauen mag. In unserem Kopf entstehen schreckliche, ekelhafte Bilder, und so hoffen wir wider besseres Wissen, dass das Problem in Wirklichkeit nur in unserer subjektiven Wahrnehmung liegt.
Die systematische körperliche Misshandlung von Kindern gehört in dieselbe Kategorie. Niemand will sich damit auseinandersetzen. In meinem ganzen Leben kann ich mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo ein Erwachsener jemals in der Öffentlichkeit eingegriffen hätte, wenn ein anderer Erwachsener ein Kind schlecht behandelte. Den Staatsanwälten graut davor, jemanden wegen Kindesmisshandlung vor Gericht zu bringen, weil ihre einzigen Zeugen für gewöhnlich Kinder sind, die schon der bloße Gedanke, gegen die eigenen Eltern aussagen zu müssen, in Angst und Schrecken versetzt. Und die bittere Ironie dabei ist, wenn der Staatsanwalt Erfolg hat, wird das Opfer danach in die Obhut des Staates übergeben und wächst bei Pflegeeltern oder in einem Waisenhaus auf, das kaum mehr ist als eine Verwahranstalt für Menschenwesen.
Als Kind sah ich die Brandmale, die die Sonnier-Kinder an Armen und Beinen trugen. Sie stammten von Zigaretten. Die verschorften Wunden sahen aus wie geringelte, graue Würmer. Irgendwann glaubte ich, die Sonniers würden in einem Haus aufwachsen, das eher ein Ofen war als ein Heim.
An einem wunderschönen Frühlingstag rief der Dispatcher, der Diensthabende der Telefonzentrale im Sheriffsbüro des Iberia Parish, wo ich als Detective arbeitete, mich zu Hause an und teilte mir mit, jemand habe bei Weldon Sonnier durchs Esszimmerfenster geschossen und ich könne Zeit sparen, wenn ich direkt dort hinfahren würde und nicht erst vorher ins Büro käme.
Ich saß gerade am Frühstückstisch, durchs offene Fenster roch ich den schweren, üppigen Duft der Hortensien im Blumenbeet und das Regenwasser der letzten Nacht, das von den Pecanbäumen und Eichen im Garten tropfte. Es war ein wirklich schöner Morgen, das frühe Sonnenlicht hing wie weicher, wattiger Rauch in den Ästen der Bäume.
„Bist du noch dran, Dave?“, fragte der Dispatcher.
„Sag dem Sheriff, er soll jemand anders hinschicken“, antwortete ich.
„Hast du was gegen Weldon?“
„Nein. Aber ich hab was gegen manche Dinge, die sich vermutlich in Weldons Kopf abspielen.“
„Okay, ich sag’s dem Alten.“
„Ach was, vergiss es“, sagte ich. „Wird ’ne Viertelstunde dauern, dann mach ich mich auf den Weg. Was wisst ihr noch?“
„Das ist alles. Seine Frau hat’s gemeldet. Er nicht. Typisch Weldon, stimmt’s?“ Er lachte.
Angeblich hatte Weldon mehr als 200 000 Dollar für die Renovierung der alten Familienvilla draußen am Bayou Teche ausgegeben, die noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg stammte. Das Haus war aus verwitterten, weiß gestrichenen Ziegeln erbaut und besaß eine breite Terrasse mit Säulenvorbau. Im zweiten Stock zog sich eine Veranda ums ganze Haus herum. An den Fenstern gab es grüne Läden mit Lamellen, an den beiden Enden des Daches identische Ziegelschornsteine, und überall verschnörkelte, ornamentale Eisenverzierungen, die von historischen Bauten im French Quarter von New Orleans stammten. Die lange Auffahrt von der Straße zum Haus wurde vom Geäst moosbewachsener Eichen überdacht wie von einem Baldachin, doch ansonsten war Weldon Sonnier nicht der Typ, der für barocken Schmuck unnötig Land brachliegen ließ. Der ganze Grund vor dem Haus und sogar unten am Bayou, wo früher die Hütten der Sklaven gestanden hatten, war an Farmer verpachtet, die dort Zuckerrohr anbauten.
Ich hatte es immer als Ironie des Schicksals empfunden, dass Weldon so viel von dem Geld, das er mit Öl verdient hatte, dafür ausgab, um in einer klassischen Südstaatenvilla leben zu können, wo er selbst doch in einem typischen Akadier-Farmhaus aufgewachsen war, einem über 150 Jahre alten, stattlichen Gebäude aus Zypressenholz, das man einst in mühevoller Handarbeit und ohne Nägel errichtet hatte. New Iberias Denkmalschützer waren buchstäblich in Tränen ausgebrochen, als Weldon in einer schäbigen Hinterwäldlerkneipe eine Handvoll angetrunkener Schwarzer anheuerte, ihnen Brecheisen und Äxte in die Hand drückte und schließlich auf einem Zaun sitzend, gemächlich eine Zigarre schmauchend und an einem Glas mit Cold Duck nippend, dabei zusah, wie sie das alte Sonnier-Haus zu einem Haufen Bretter zerlegten, die er später allesamt für 200 Dollar an einen Schreiner verkaufte.
Als ich mit meinem Pick-up die Einfahrt hochfuhr und unter einer großen Eiche vor der Säulenterrasse parkte, warteten bereits zwei uniformierte Deputys in ihrem Wagen auf mich. Die Vordertüren standen weit offen, damit sie in den Genuss der milden Brise kamen, die über den schattigen Rasen wehte. Der Fahrer namens Garrett, der früher in Houston Polizist gewesen war, ein stämmig gebauter Mann mit dickem blonden Schnurrbart und einer Gesichtsfarbe, die nach frischem Sonnenbrand aussah, schnippte seine Zigarette in hohem Bogen in die Rosen und stieg aus, um mir entgegenzugehen. Er trug eine Pilotensonnenbrille, und an seinem rechten Unterarm prangte die Tätowierung eines grünen Drachen. Er war noch ziemlich neu, ich kannte ihn kaum, aber ich hatte gehört, dass er in Houston seinen Abschied eingereicht hatte, nachdem er im Verlauf einer Internal-Affairs-Untersuchung vom Dienst suspendiert worden war.
„Was habt ihr?“, fragte ich.
„Nicht viel“, sagte er. „Mr. Sonnier meint, es ist wahrscheinlich ein Unfall gewesen. Irgendwelche Jungs auf der Hasenjagd oder so.“
„Und was sagt Mrs. Sonnier?“
„Die sitzt im Frühstückszimmer und stopft sich mit Beruhigungsmitteln voll.“
„Aber was sagt sie dazu?“
„Nichts, Detective.“
„Nennen Sie mich ruhig Dave. Denken Sie auch, dass das nur so ’n paar Jungs waren?“
„Werfen Sie doch mal einen Blick auf das Riesenloch in der Wohnzimmerwand, und sagen Sie mir dann, was Sie denken.“
Er biss sich auf die Lippen, weil das etwas schroff herausgekommen war. Ich bewegte mich in Richtung Haustür.
„Dave, warten Sie noch kurz“, sagte er. Er nahm die Brille ab und kniff sich in den Nasenrücken. „In der Zeit, als Sie im Urlaub waren, hat uns die Frau zweimal angerufen, weil jemand ums Haus herumstrich. Wir sind gekommen, konnten aber niemanden finden, deshalb hab ich’s nicht ernst genommen. Ich dachte, sie ist vielleicht ein bisschen … überspannt.“
„Das kann man wohl sagen. Sie ist tablettensüchtig.“
„Damals hat sie ausgesagt, sie hätte einen Typ mit einem Narbengesicht gesehen, der durch ihr Fenster gestarrt hat. Sie meinte, es hätte ausgesehen wie rote Knetmasse oder so was. Aber der Boden war ganz nass, und Fußspuren hab ich keine gefunden. Aber vielleicht hat sie ja tatsächlich was gesehen. Wahrscheinlich hätte ich der Sache ein bisschen gründlicher nachgehen sollen.“
„Machen Sie sich da mal keine Gedanken. Ich übernehme das jetzt. Warum fahrt ihr zwei nicht vorne zum Café und gönnt euch eine Erfrischung?“
„Ist sie nicht die Schwester von diesem Nazi- oder Klan-Politiker in New Orleans?“
„Allerdings. Weldon hat ein Faible dafür, sich die Richtigen auszusuchen.“ Ich konnte es mir nicht verkneifen: „Sie wissen doch, wer Weldons Bruder ist, oder?“
„Nein.“
„Lyle Sonnier.“
„Dieser Fernsehprediger aus Baton Rouge? Sie machen Witze. Mann, ich wette, der Typ könnte Scheiße als Rosen verkaufen, ohne dass seine Hände nach was anderem als Seife duften.“
„Willkommen in Süd-Louisiana, Kollege.“
Weldon öffnete die Tür und gab mir die Hand. Eine große, rechteckige Hand, dicke Schwielen zogen sich über Handballen und Zeigefinger. Selbst mit einem Grinsen wirkte Weldons Gesicht energisch, der Blick wie eine Schrotladung, sein Kiefer kantig und hart. Das braungraue Haar war so kurz geschnitten, dass man über den großen Ohren die Kopfhaut durchschimmern sah, und er schien immer die Backenzähne zusammenzubeißen, weil sich das knotige Gewebe hinter dem Kiefergelenk spannte. Er trug Hausschuhe, verwaschene Jeans ohne Gürtel und ein mit Farbflecken verunziertes T-Shirt, das über seinen mächtigen Bizeps und dem brettflachen Bauch spannte. Er war noch unrasiert, in der Hand hielt er eine Tasse Kaffee. Er behandelte mich zuvorkommend – Weldon war stets höflich –, sah dabei aber immer wieder auf seine Uhr.
„Mehr kann ich dir wirklich nicht erzählen, Dave“, sagte er, als wir im Türbogen zum Esszimmer standen. „Ich stand hier vor den Glastüren und hab mir angesehen, wie die Sonne über dem Bayou aufgeht, und auf einmal: paff, ging’s durch die Scheibe und dann in die Wand da hinten.“ Er grinste.
„Hat dir sicher einen mächtigen Schrecken eingejagt“, sagte ich.
„Das kann ich dir sagen.“
„Klar. Du siehst ja auch ganz aufgelöst aus, Weldon. Und warum hat deine Frau angerufen und nicht du?“
„Die macht sich doch immer Sorgen.“
„Und du selber nicht?“
„Jetzt pass mal auf, Dave, ich hab da vorher schon zwei junge Schwarze gesehen. Die haben ein Kaninchen aus dem Zuckerrohrfeld gejagt, und dann seh ich noch, wie sie auf ein paar Spottdrosseln schießen, die drüben am Bayou auf einem Baum hocken. Ich glaub, die hausen in einer dieser alten Niggerhütten da unten an der Straße. Warum nimmst du dir die nicht mal zur Brust?“
Er sah auf die Zeiger der Mahagonistanduhr am anderen Ende des Esszimmers und stellte dann seine Armbanduhr nach.
„Aber die schwarzen Kids hatten keine Schrotflinte, oder?“, fragte ich.
„Nein, ich glaub nicht.“
„Hatten sie eine .22er?“
„Weiß ich nicht, Dave.“
„Aber genau das hätten sie wahrscheinlich gehabt, wenn sie’s auf Kaninchen oder Spottdrosseln abgesehen haben, oder? Zumindest, wenn sie keine Schrotflinte hatten.“
„Mag sein.“
Ich sah mir das Loch in der Scheibe genauer an. Es war ziemlich weit oben in der Tür. Ich nahm meinen Füller, der fast so dick wie mein kleiner Finger ist, aus der Tasche und steckte das eine Ende des Füllers durch das Loch. Dann ging ich durchs Esszimmer und machte das Gleiche mit dem Loch in der Wand. Hinter der Wand war ein solider Holzpfeiler, und der Füller verschwand gut fünf Zentimeter tief im Loch, bevor er auf etwas Festes stieß.
„Meinst du wirklich, das stammt von einer Kugel Kaliber .22?“, fragte ich.
„Vielleicht war’s ein Querschläger“, antwortete er.
Ich trat wieder zu den Glastüren, öffnete sie zur Terrasse, die mit großen Steinplatten bepflastert war, und blickte hinaus über den leicht abschüssigen blaugrünen Rasen bis zum Bayou. Zwischen den Zypressen und Eichen an der Uferböschung sah man einen Bootssteg und ein verwittertes Bootshaus. Zwischen dem schlammigen Ufer und dem Rasen befand sich noch eine niedrige rote Ziegelmauer, die Weldon errichtet hatte, damit sein Land nicht nach und nach in den Bayou Teche gespült wurde.
„Ich find’s eigentlich ziemlich dumm, was du da tust, Weldon“, sagte ich, immer noch auf die Ziegelmauer und die Bäume am Ufer blickend, deren Silhouetten sich gegen das Sonnenlicht auf der braunen Oberfläche des Bayou abzeichneten.
„Wie bitte?“, fragte er.
„Wer hat einen Grund, dir was anzutun?“
„Keine Menschenseele.“ Er lächelte. „Wenigstens nicht, soviel ich weiß.“
„Ich will dir ja nicht zu nahetreten, aber schließlich ist Bobby Earl dein Schwager.“
„Und?“
„Eine umstrittene Figur. Ein CBS-Reporter hat ihn mal den ‚Robert Redford des Rassismus‘ genannt.“
„Ja, das fand Bobby auch nicht schlecht.“
„Mir ist zu Ohren gekommen, du hättest Bobby im Copeland’s an der Krawatte über den Tisch gezogen und sie anschließend mit einem Steakmesser durchgesäbelt.“
„Na ja, eigentlich war’s ja Mason’s, drüben an der Magazine Street.“
„Aha. Und wie hat ihm das geschmeckt, in einem Lokal vor allen Leuten so vorgeführt zu werden?“
„Er hat’s mit Fassung getragen. Bobby ist kein übler Kerl. Hin und wieder muss man ihm halt den Kopf zurechtrücken.“
„Und was ist mit seinen Anhängern – Typen vom Ku Klux Klan, Nazis, Mitglieder der Aryan Nation? Findest du die auch nicht so übel?“
„Ich nehm Bobby nicht so ernst.“
„Viele tun’s aber.“
„Das ist deren Problem. Bobby hat ’n großen Schwanz und dazu ’n Spatzenhirn. Wenn die Presse die Finger von ihm ließe, würde er von Tür zu Tür Versicherungen verkaufen.“
„Mir ist da noch was über dich zu Ohren gekommen, Weldon, und das ist vielleicht ernster zu nehmen.“
„Dave, ohne dass ich dir zu nahetreten will. Es tut mir ehrlich leid, dass du hier rauskommen musstest. Es tut mir auch ehrlich leid, dass meine Frau die ganze Zeit bis über beide Kiemen zugeknallt ist und Gummivisagen im Fenster sieht. Ich weiß zu schätzen, dass du hier deinen Job tust, aber ich weiß wirklich nicht, wer mein Fenster auf dem Gewissen hat. Das ist die volle Wahrheit, und jetzt muss ich zur Arbeit.“
„Ich hab gehört, du bist pleite.“
„Na und? So läuft’s nun mal, wenn man als Unabhängiger im Ölgeschäft ist. Da gehst du immer volles Risiko.“
„Bist du jemandem Geld schuldig?“
Wieder spannten sich die Knorpel hinter seinem Kiefer.
„Ich finde, jetzt gehst du ein bisschen zu weit, Dave.“
„Ach ja?“
„Allerdings.“
„Tut mir leid, das zu hören.“
„Als ich meine erste Bohrung gemacht hab, da hatte ich nur meine Muskeln und rostigen Müll vom Schrottplatz. Und keiner hat auch nur einen Finger gerührt, um mir zu helfen. Kein Kredit, nix auf Anschreiben, nur ich und vier Schwarze und ein Bohrmeister aus Texas, der gesoffen hat wie ein Tier, und eine Menge verdammt harte Arbeit.“ Er zeigte mit dem Finger auf mich. „Und das hab ich zwanzig Jahre so durchgehalten, Kumpel. Ich mach vor keinem den Buckel krumm, damit er mir Geld borgt, und wo ich schon mal dabei bin, sag ich dir noch was. Wenn sich jemand mit mir anlegt und mit dem Gewehr ein Loch in mein Haus schießt, dann sorg ich selber dafür, dass die Sache bereinigt wird.“
„Das will ich mal besser nicht hoffen. Ich würd’s äußerst ungern sehen, wenn du Ärger bekommst, Weldon. Und jetzt würde ich gerne mit deiner Frau sprechen, wenn’s möglich ist.“
Er steckte sich die Zigarette in den Mund, zündete sie an und ließ das schwere Metallfeuerzeug ungerührt auf die blankpolierte Holzplatte des Esstisches fallen.
„Klar, kein Problem“, sagte er. „Aber sei ein bisschen vorsichtig. Sie verträgt ihre Medikamente wohl nicht so gut. Die sind schlecht für ihren Blutdruck.“
Seine Ehefrau war ein blasse, feinknochige Frau mit aschblondem Haar, durch deren milchweiße Haut sich eine Unzahl blauer Äderchen zog. Sie trug einen rosa Hausmantel aus Seide, hatte sich das Haar nach hinten gebürstet und frisches Make-up aufgelegt. Eigentlich hätte sie hübsch sein müssen, aber in ihren blauen Augen lag immer ein leicht verwirrter Ausdruck, als höre sie um sich herum immer das Schlagen unsichtbarer Türen. Das Frühstückszimmer war unter einem Kuppeldach und voll verglast. Sonnenlicht durchflutete den Raum voller Hängefarnpflanzen und Philodendren, der einen großartigen Ausblick auf den Bayou, die Eichen, das Bambusgehölz und die am Spalier explodierenden violetten Glyzinien bot. Aber ihr Gesicht schien nichts davon zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Augen waren unnatürlich geweitet, die Pupillen auf Stecknadelkopfgröße geschrumpft, und ihre Haut war so straff, dass man hätte meinen können, jemand verdrehe ihr hinten am Kopf das Haar. Ich fragte mich, wie das wohl gewesen war, in dem Haus aufzuwachsen, das einen Mann wie Bobby Earl hervorgebracht hatte.
Ihr Taufname war Bama. Ihr weicher Akzent, mehr Mississippi als Louisiana, schmeichelte dem Ohr, doch dahinter hörte man ein leichtes Zittern, wie ein Tremolo, so als ob ein Nervenende bloß läge und in ihr flatterte.
Sie sagte, sie sei im Bett gewesen, als sie den Schuss und das Klirren der Scheibe gehört hatte. Aber gesehen habe sie nichts.
„Und was ist mit diesem Mann, der um Ihr Haus geschlichen ist, Mrs. Sonnier? Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?“ Ich lächelte sie an.
„Natürlich nicht.“
„Sie haben ihn vorher noch nie gesehen?“
„Nein. Er sah furchtbar aus.“
Ich verfolgte, wie Weldon die Augen zur Decke hob, sich dann abwandte und wieder hinaus auf den Bayou blickte.
„Was meinen Sie damit?“, fragte ich.
„Er sah aus wie ein Brandopfer“, sagte sie. „Die Ohren waren nur noch kleine Stummel. Das Gesicht war wie eine rote Gummimasse, wie diese großen Flicken, mit denen man Reifen repariert.“
Weldon drehte sich wieder zu mir.
„Also wirklich, Dave. Das habt ihr doch alles schon in euren Akten, oder?“, fragte er. „Das macht doch keinen Sinn, das alles jetzt noch mal durchzukauen.“
„Vielleicht nicht, Weldon“, sagte ich, klappte mein kleines Notizbuch zu und steckte es wieder ein. „Mrs. Sonnier, hier haben Sie für alle Fälle meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie sich plötzlich doch noch an etwas anderes erinnern oder wenn ich Ihnen sonst irgendwie behilflich sein kann.“
Weldon rieb die eine Hand am Handrücken der anderen und gab sich alle Mühe, kein finsteres Gesicht zu ziehen.
„Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mir gern noch den hinteren Teil des Grundstücks anschauen“, sagte ich.
„Nur zu“, sagte er.
Das Gras war noch feucht vom Morgentau, üppig und prall wie ein nasser Schwamm, als ich zwischen den Eichen hinunter zum Bayou lief. Neben der Ruine einer alten grauen Scheune, deren Dach längst den Geist aufgegeben hatte und an deren einer Wand noch ein uraltes Blechwerbeschild für das Allheilmittel Hadacol hing, lag eine sonnige Lichtung, wo jemand einen kleinen Obstgarten mit Erdbeeren und Wassermelonen angelegt hatte. Ich ging den Ziegeldamm entlang und ließ meinen Blick über das schlammige Ufer streifen, das sich von dort bis zum Bayou erstreckte. Auf dem feuchten Untergrund sah man überall die Spuren von Sumpfbibern und Waschbären und die feinen Abdrücke, die die verschiedenen Reiher und andere Sumpfvögel hinterlassen hatten. Dann entdeckte ich nicht weit von den Zypressenplanken, die zu Weldons Anlegesteg und Bootshaus führten, unten an der Ziegelmauer ein Wirrwarr menschlicher Fußabdrücke.
Ich stützte die Handflächen auf die kühlen Ziegel und untersuchte das Ufer genauer. Den Spuren nach war jemand von den Zypressenplanken zur Mauer und dann wieder zurückgegangen, und jemand mit größeren Füßen war anschließend über die ursprünglichen Spuren getreten. Auf der Ziegelmauer selbst waren ein paar Schlammspritzer, und im Gras, direkt neben meinem Fuß, lag der Stummel einer Zigarette. Eine Lucky Strike. Ich nahm einen verschließbaren Klarsichtbeutel aus der Tasche und verstaute die Kippe sorgfältig darin.
Ich wollte schon wieder zurück zum Haus, als auf einmal ein Windstoß die Eichenäste über meinem Kopf bewegte. Das Muster, das Sonne und Schatten auf den Boden warfen, bewegte sich kurz wie ein Netz, an dem jemand zieht, und ich sah im Schlamm etwas metallisch aufblinken. Ich stieg über den Damm und fand die leere Hülse einer Patrone vom Kaliber .308. Ich pickte sie mit der Füllerspitze aus dem Schlamm und ließ sie zu dem Zigarettenstummel in den Plastikbeutel fallen.
Dann ging ich seitlich um das Haus herum, bis ich wieder zur Einfahrt und zu meinem Pick-up kam. Weldon wartete auf mich. Ich hielt den Plastikbeutel kurz hoch, damit er ihn sehen konnte.
„Da siehst du mal, mit was für einem Kaliber dein Hasenjäger auf Pirsch war“, sagte ich. „Und er hat die leere Hülse ausgeworfen, Weldon. Das heißt, wenn er kein halbautomatisches Gewehr hatte, wollte er’s vermutlich gleich noch mal versuchen.“
„Pass auf, wie wär’s, wenn du dich von jetzt an nur noch an mich hältst und Bama da rauslässt? Das ist zu viel für sie.“
Ich holte tief Luft und ließ meinen Blick zur Sonne schweifen, die durch die Eichen hindurch auf den Asphalt schien.
„Ich glaube, deine Frau hat schwere Probleme. Vielleicht wär’s an der Zeit, sich drum zu kümmern“, sagte ich.
Ich sah, wie sich sein Hals rot verfärbte. Er räusperte sich.
„Jetzt mischst du dich in Dinge ein, die nicht mehr zu deinem Job gehören“, sagte er.
„Mag sein. Aber sie ist eine nette Frau, und ich glaube, sie braucht Hilfe.“
Er biss auf seiner Unterlippe herum, legte die Hände an die Hüften, starrte hinunter auf seine Füße und stocherte mit dem Schuh ein Muster in den Schotter, wie ein Baseballtrainer, der über den nächsten Spielzug nachdenkt.
„In New Iberia und St. Martinville gibt es verschiedene Therapiegruppen, du weißt schon, Zwölf-Schritte-Programm. Das sind gute Leute“, sagte ich.
Er nickte, ohne den Kopf zu heben.
„Da ist noch was, das ich dich fragen muss“, sagte ich. „Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch damals in Vietnam von einem Flugzeugträger aus Aufklärungsflüge gemacht, oder? Du musst ziemlich gut gewesen sein.“
„Gib mir einen Schimpansen, drei Bananen und ’ne halbe Stunde Zeit, dann geb ich dir einen Piloten.“
„Und ich hab auch gehört, dass du für Air America geflogen bist.“
„Und?“
„Nicht grade der übliche Lebenslauf. Du bist nicht zufällig immer noch in irgendeinen CIA-Mist verwickelt, oder?“
Er klopfte mit dem Finger auf seine Wange wie auf eine Trommel.
„CIA … das steht doch für Christen, Iren und Alkoholiker? Nein, ich bin bloß ’n blöder Cajun, hab mit Religion nicht viel am Hut und mit der Sauferei erst recht nicht. Ich schätze, den Schuh kann ich mir nicht anziehen, Dave.“
„Ach so. Na, wenn du’s leid bist, kannst du mich ja im Büro oder zu Hause mal anrufen.“
„Was leid bin?“
„Hier den Affen zu machen und Leute zu verscheißern, die nur versuchen, dir zu helfen. Wir sehn uns, Weldon.“
Ich ging, ließ ihn einfach da in der Einfahrt stehen, ein schwaches Grinsen im Gesicht, sein Kiefer wie aus Stein gemeißelt. Die großen, quadratischen Hände hingen schlaff und offen an beiden Seiten herunter.
Wieder im Büro, fragte ich den Dispatcher nach Garrett, dem neuen Mann.
„Er ist nach St. Martinville gefahren, um einen Gefangenen abzuholen. Soll ich ihn über Funk rufen?“, fragte er.
„Sag ihm nur, er soll bei mir vorbeischauen, wenn er kann. Ist nichts Dringendes.“ Ich bemühte mich um einen völlig neutralen Gesichtsausdruck. „Sag mal, wie war das in Houston? Weshalb hatte er Ärger mit Internal Affairs?“
„Eigentlich war’s sein Partner, der den Ärger hatte. Vielleicht hast du in der Zeitung was drüber gelesen. Garrett blieb im Wagen sitzen, während sein Partner einen jungen Mexikaner unter die Brücke am Buffalo Bayou schleifte und russisches Roulette mit ihm spielte. Nur, dass er sich verkalkuliert und dem Jungen den Kopf weggeschossen hat. Ziemliche Schweinerei. Garrett war sauer, weil sie auch gegen ihn ermittelt haben, und da hat er sich mit einem Captain angelegt und kurzerhand seinen Abschied eingereicht. Schade, denn im Nachhinein kamen sie zu dem Schluss, dass ihm nichts vorzuwerfen war. Ich schätze also, für ihn ist das hier so ’ne Art Neuanfang. War da irgendwas, draußen bei den Sonniers?“
„Nein, ich will nur meinen Bericht mit ihm abgleichen.“
„Hey, in deinem Fach wartet eine interessante Telefonnachricht.“
Ich hob die Augenbrauen und wartete.
„Lyle Sonnier“, sagte er mit breitem Grinsen.
Auf dem Weg zu meinem Büroplatz holte ich den kleinen Stapel von Tagesbefehlen, Memos und Nachrichten aus meinem Fach. Ich setzte mich damit an den Tisch, legte alles vor mir auf die Schreibtischunterlage und ging langsam jeden einzelnen Zettel durch. Ich wusste nicht genau, warum ich nichts mit Lyle zu tun haben wollte. Vielleicht hatte ich den Anflug eines schlechten Gewissens, weil ich nicht ganz aufrichtig gewesen war. Heute Morgen war ich dazu bereit gewesen, mit Garrett über Lyle zu scherzen, obwohl ich wusste, dass in Wahrheit nichts Komisches an ihm war. Wenn man spät in der Nacht die Programme im Kabelfernsehen durchorgelte und ihn so sah, in seinem metallic-grauen Seidenanzug mit der goldenen Krawatte, das wellige Haar zu einer gewaltigen kuchenförmigen Tolle hochfrisiert, mit laut erhobener, melodramatischer Stimme und wild fuchtelnden Armen vor einem verzückten Publikum, das vorwiegend aus Schwarzen und Angehörigen der weißen Unterschicht bestand, konnte man ihn einfach als einen weiteren falschen Prediger oder fundamentalistischen Fanatiker abtun, wie ihn der ländliche Süden in jeder Generation wieder mit unfehlbarer Sicherheit hervorbringt.
Nur, dass ich Lyle anders kannte. Damals war er 18 gewesen und hatte in meinem Zug bei der Infanterie die Vorhut gemacht, wann immer irgendwelche dunklen Löcher in der Erde zu erkunden waren. Tunnelratten nannte man diese Jungs, die mit nacktem Oberkörper in die Erdlöcher krochen, in der einen Hand eine Taschenlampe, in der anderen eine .45er Automatik, als Rettungsleine ein Seil um den Knöchel. Ich erinnerte mich noch gut an den Tag, als er sich in ein Loch gezwängt hatte, so schmal, dass es ihm dabei fast die Hose auszog. Als sich das Seil langsam abrollte und mit ihm im Inneren des Hügels verschwand, hörten wir auf einmal ein dumpfes Rumpeln unter der Erde, und eine rote Wolke korditgeschwängerten Staubs stieg aus dem Loch. Als wir ihn am Knöchel wieder herauszogen, hatte er die Arme immer noch starr ausgestreckt. Blutspritzer zogen sich ihm wie ein Spinnennetz über Haar und Gesicht, und zwei Finger seiner rechten Hand fehlten, als hätte sie jemand mit einem Rasiermesser abgehackt.
Die Leute von New Iberia, die Lyle kannten, sprachen für gewöhnlich von ihm als einen Schwindler der alten Schule, der sich die Ängste und Dummheit seiner Anhänger zunutze machte. Andere, die ihn ebenfalls kannten, hielten ihn für einen amüsanten Halbirren, der sich das Hirn wohl mit Drogen verbrutzelt hatte. Was genau davon letztlich zutraf, wusste ich nicht, aber irgendwie drängte sich mir immer der Verdacht auf, dass in dem Sekundenbruchteil zwischen dem Augenblick, als er mit der vorgestreckten Taschenlampe oder der Pistole den Draht berührte, der die Mine auslöste, und dem nächsten, als in seinem Kopf nur noch ein weißes Leuchten und ein ohrenbetäubendes Dröhnen herrschte und sich seine Gesichtshaut anfühlte, als wäre sie mit brennendem Fett bestrichen, irgendetwas mit ihm geschehen war. Vielleicht dachte er, er blicke tatsächlich mittels eines dritten Auges in den Abgrund aller ungreifbaren Ängste, den Strudel der Mysterien, und begreife, dass alles, was ihn zu diesem einen Moment geführt hatte, nur ein schlechter Witz war.
Ich blickte auf seine Nummer in Baton Rouge, die da auf dem Notizzettel geschrieben stand, dann drehte ich den Zettel wieder und wieder in meinen Fingern. Nein, Lyle Sonnier war durchaus ernst zu nehmen, dachte ich schließlich. Ich griff zum Telefon und begann die Nummer zu wählen, als ich auf einmal merkte, dass Garrett, der ehemalige Houstoner Cop, im Eingang meines Büroabteils stand. Er blickte etwas scheel, als ich den Kopf zu ihm hob.
„Oh, hallo, danke, dass Sie vorbeischauen“, sagte ich.
„Keine Ursache. Was liegt an?“
„Nicht viel.“ Ich trommelte beiläufig mit den Fingern auf der Schreibtischunterlage, dann zog ich eine Schublade auf und schloss sie wieder. „Sie haben nicht zufällig was zu rauchen da?“
„Klar doch“, sagte er und nahm eine Schachtel Zigaretten aus der Hemdtasche. Er klopfte eine heraus und bot sie mir an.
„Lucky Strikes sind mir zu stark“, sagte ich. „Aber trotzdem danke. Wie wär’s, wenn wir zwei einen kleinen Spaziergang machen?“
„Äh, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Worum geht’s, Dave?“
„Kommen Sie, ich spendier Ihnen ein Eis. Ich will nur ein paar Sachen mit Ihnen noch mal durchgehen.“ Ich lächelte ihn an.
Draußen war es hell und warm, und die Rasensprenger warfen einen dunstigen kleinen Regenbogen auf die Wiese. Die grünen Palmen zeichneten sich scharf gegen den knallblauen Himmel ab, und unten an der Ecke, neben einer riesigen alten Eiche, deren Wurzeln den Randstein regelrecht geknackt und auf dem Bürgersteig einen richtigen kleinen Hügel aufgeworfen hatten, stand ein Schwarzer mit einer weißen Kellnerjacke, der aus einem kleinen Handwägelchen mit Sonnenschirm Snowballs, kleingehacktes Eis mit Sirup, verkaufte.
Ich kaufte zwei mit Pfefferminzsirup, gab eins davon Garrett, und dann setzten wir uns nebeneinander auf eine eiserne Bank im Schatten. Sein Revolverholster und der Gürtel daran knarrten wie ein Sattel. Er setzte die Sonnenbrille auf, blickte von mir weg und zupfte an der einen Seite seines Schnurrbarts herum.
„Der Dispatcher hat mir von Ihrem Ärger mit Internal Affairs in Houston erzählt“, sagte ich. „Klingt so, als hätte man Ihnen übel mitgespielt.“
„Ich kann nicht klagen. Mir gefällt’s hier. Ich mag das Essen und auch die Leute.“
„Aber für Ihre berufliche Laufbahn bedeutet es ja wohl doch einen ziemlichen Rückschritt“, sagte ich.
„Wie gesagt, ich beklage mich nicht.“
Ich knabberte ein bisschen an meinem Eis und blickte unverwandt nach vorne.
„Ich will mal Klartext reden, Kumpel“, sagte ich. „Sie sind neu hier und vermutlich ein bisschen ehrgeizig. Alles schön und gut. Aber da draußen bei den Sonniers, da haben Sie Mist gebaut und Sachen getan, die Sie nicht hätten tun sollen.“
Er räusperte sich und wollte etwas erwidern, unterließ es aber dann.
„Ich seh das doch richtig, oder? Sie sind über den Ziegeldamm geklettert und haben sich am Ufer umgesehen? Und Sie haben eine Kippe ins Gras geworfen?“
„Ja, Sir.“
„Haben Sie dabei irgendwas gefunden?“
„Nein, Sir.“
„Sind Sie sicher?“ Ich sah sein Profil scharf an. Seine Kehle war rot angelaufen.
„Ich bin mir sicher.“
„In Ordnung. Vergessen wir das Ganze. Ist ja nichts passiert. Aber das nächste Mal beschränken Sie sich darauf, den Tatort zu sichern oder auf den zuständigen Ermittler zu warten.“
Er nickte und starrte vor sich hin, versunken in irgendwelche Gedanken, die hinter seiner Sonnenbrille verborgen blieben. Dann fragte er: „Kommt das in meine Personalakte?“
„Nein. Aber darum geht’s nicht, Kumpel. Sind wir uns einig, worum es geht?“
„Ja, Sir.“
„Gut. Wir sehen uns nachher noch im Büro. Ich muss jetzt einen Anruf erledigen.“
Aber Tatsache war, dass ich einfach nicht länger mit ihm reden wollte. Ich hatte so das Gefühl, dass Deputy Garrett sich nicht gerne etwas sagen ließ.
Ich wählte die Nummer von Lyle Sonnier in Baton Rouge und erfuhr von einer Sekretärin, dass er heute nicht in der Stadt sei. Ich gab die leere Patronenhülse unserem Fingerabdruckspezialisten, was ich mir eigentlich auch hätte sparen können, da einen Fingerabdrücke selten weiterbringen, wenn man nicht die Abdrücke eines bestimmten Verdächtigen in den Akten hat. Dann las ich die kurzen Berichte über den Mann, den Bama Sonnier gemeldet hatte, aber das fügte kein einziges weiteres Detail zu den Ereignissen draußen bei den Sonniers hinzu. Am liebsten hätte ich die Sache abgehakt und Weldon seinem falschen Stolz und seinen ganz persönlichen Dämonen, wie immer die auch beschaffen sein mochten, überlassen. Es war vergeudete Zeit, wenn man jemandem helfen wollte, der keinerlei Einmischung in sein Leben duldete. Aber dann musste ich daran denken, was aus mir geworden wäre, wenn andere Menschen mir gegenüber genauso gedacht und gehandelt hätten. Ich wäre tot oder in einer Irrenanstalt oder vollauf damit beschäftigt, schon am frühen Morgen genug Münzen und zerknitterte Eindollarscheine für einen doppelten Jim Beam zusammenzuklauben, dazu noch einen eiskalten Krug Jax-Bier, alles in der vergeblichen Hoffnung, dieser bernsteinfarbene Hitzeschock würde irgendwie die ganzen Schlangen und Tausendfüßler, die sich in meinem Inneren wanden, zu Asche verglühen. Nur dann konnte ich nämlich sicher sein, dass die rote Sonne, die hoch über den Eichen auf dem Parkplatz brütete, nicht mehr bedrohlich war, dass der Tag frei sein würde von ständig mutierenden Gestalten und körperlosen Stimmen, die wie kleine Holzsplitter in meinen Kopf stachen, und dass ich um zehn Uhr morgens nicht schon so stark zitterte, dass ich ein Glas Whiskey nicht mal mehr mit beiden Händen halten konnte.
Um zwölf Uhr fuhr ich zum Essen nach Hause. Die unbefestigte Straße entlang des Bayou war gesäumt von Eichen, die einst Sklaven gepflanzt hatten. Die Sonne blitzte wie ein Heliograf durch die moosbewachsenen Äste über mir. Überall am Rande des Bayou standen die Hyazinthen dicht in voller Blüte, die Blätter voller kleiner Wassertröpfchen, die im Schatten wie Quecksilber schimmerten. Draußen in der Sonne, wo das Wasser braun und brütend heiß vor sich hindümpelte, schwebten Libellen völlig reglos in der Luft, und schwer gepanzerte Kaimanfische tummelten sich in der Strömung mit der Geschmeidigkeit von Schlangen.
Bei der Bootsrampe neben dem Pier und dem Köderladen, der mir gehörte und um den sich meine Frau Bootsie und ein älterer Schwarzer namens Batist in meiner Abwesenheit kümmerten, waren etwa ein Dutzend Personenwagen und Pick-ups geparkt. Ich winkte Batist zu, der gerade auf den runden Tischen, ehemaligen Telefonkabeltrommeln, unter der Schatten spendenden Leinenmarkise Fleisch vom Grill servierte. Dann bog ich in die unbefestigte Auffahrt zu meinem Haus und parkte unter den Pecanbäumen vor dem weitläufigen Gebäude aus Zypressen- und Eichenholz, das mein Vater eigenhändig während der großen Depression gebaut hatte. Abgestorbenes Laub und vermodernde Schalen von Pecannüssen bedeckten den Boden, und die Pecanbäume türmten sich so dicht vor dem Himmel auf, dass die Veranda vor dem Haus fast den ganzen Tag lang im Schatten lag. Selbst im Hochsommer musste ich nachts nur den Deckenventilator einschalten, und sofort wurde es im Haus so kühl, dass wir uns zudecken mussten.
Meine Adoptivtochter Alafair besaß ein Haustier, einen dreibeinigen Waschbären, den wir Tripod getauft hatten. Wir hatten ihn an eine Kette gelegt, die wiederum an einem langen Draht befestigt war, der zwischen zwei Eichen gespannt war. So konnte er im ganzen Garten herumlaufen. Immer wenn ein Auto über die Auffahrt kam, raste Tripod aus unerfindlichem Grund wie ein Irrer an seinem Draht hin und her, bis er sich hoffnungslos an einem Baumstumpf verfangen hatte. Dann versuchte er an der Rinde des Stammes hochzukraxeln, was für gewöhnlich damit endete, dass er mit gewaltigem Krach auf den Kaninchenställen landete und sich dabei fast erdrosselte.
Ich machte den Motor aus, ging über das Laub, das weich unter meinen Füßen federte, hob ihn hoch und entwirrte seine Kette. Er war ein prächtiges Exemplar seiner Gattung, mit weißen Haarspitzen, dickem Bauch und ausladendem Hintern, üppigem, gestreiftem Schwanz, einer adretten schwarzen Maske und Schnurrhaaren in einem Salz-und-Pfeffer-Ton. Ich öffnete einen der Kaninchenställe, wo ich Maisbrot und Hundekuchen für ihn aufbewahrte, und füllte seinen Napf, der neben der Wasserschale stand, in der er alles wusch, was er fraß.
Als ich mich umdrehte, stand Bootsie auf der Veranda und sah mir lächelnd zu. Sie trug weiße Shorts, Holzsandalen, ein verwaschenes rosafarbenes Bauernhemd und hatte sich ein rotes Taschentuch in ihr honigfarbenes Haar gebunden. Im Schatten der Veranda verlieh die Sonnenbräune ihren Armen und Beinen einen richtigen Schimmer. Sie hatte immer noch die Figur eines Mädchens, der Rücken gerade und muskulös, die Hüften weich und wiegend beim Gehen. Nachts, wenn sie tief schlief, legte ich manchmal meine Hand auf ihren Rücken, nur um die Spannung in ihren Muskeln zu fühlen, den Druck ihrer Lungen gegen meine Handfläche, als ob ich mich versichern wollte, dass das Feuer, die Energie, das pulsierende Blut und der Herzschlag unter ihrer sonnengebräunten Haut wirklich waren und von Bestand und nicht trügerisch, dass sie am nächsten Morgen nicht steif vor Schmerz erwachen würde, ihr Bindegewebe fest in den Klauen der Krankheit, die in ihren Adern schwamm.
Sie stützte sich mit einem Arm an einen Pfeiler der Veranda, blinzelte mir zu und fragte: „Comment la vie, Hübscher?“
„Und wie steht’s bei dir, Schöne?“, fragte ich.
„Ich hab étoufée für dich gemacht.“
„Wunderbar.“
„Hat Lyle Sonnier dich im Büro erreicht?“
„Nein. Hat er hier angerufen?“
„Ja, und er hat gesagt, dass er dir was Wichtiges mitzuteilen hat.“
Ich drückte sie mit einem Arm und gab ihr einen Kuss auf den Hals, als wir ins Haus gingen. Ihr volles Haar fiel in weichen Locken, und sie trug es in einem Fassonschnitt, der hinten am Hals spitz zulief und sich schön anfühlte, wie die frisch gestutzte Mähne eines Ponys.
„Hast du eine Ahnung, warum er dich anruft?“, fragte sie.
„Heute Morgen hat jemand auf Weldon Sonnier geschossen.“
„Weldon? Wer würde so was tun?“
„Da bin ich überfragt. Ich glaube, Weldon weiß etwas, aber er macht den Mund nicht auf. Je älter Weldon wird, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass er Beton in seinem Schädel hat.“
„Hat er Ärger mit irgendwelchen Leuten?“
„Du kennst Weldon doch. Für den gibt’s keine halben Sachen. Ich erinnere mich noch daran, wie er dabei erwischt wurde, als er in St. Martinville Lebensmittel in einem Billardsalon geklaut hat. Der Barkeeper hat ihn am Ohr aus der Küche gezogen und ihm das Ohr verdreht, bis er vor allen im Raum gekreischt hat. Zehn Minuten später kommt Weldon, noch mit Tränen in den Augen, wieder rein, greift sich ein paar Billardkugeln vom Tisch und zerschmeißt jedes einzelne Fenster in dem Laden.“
„Das ist ja eine traurige Geschichte“, sagte sie.
„Na ja, sie waren traurige Kinder, oder?“ Ich setzte mich vor die dampfende Schale mit Crawfish-étoufée. Die Soße schimmerte butterig und war mit klein gehackten grünen Zwiebeln bestreut. Die weißen Fenstervorhänge mit den winzigen rosa Blumen blähten sich in der sanften Brise, die durch die Eichen und Pecanbäume im Garten hereinwehte. „Komm, lass uns essen und nicht mehr an die Probleme anderer Leute denken.“
Sie trat zu mir und strich mir mit den Fingern durchs Haar. Dann streichelte sie meinen Hals und meine Wange. Ich legte meinen Arm um ihren weichen Körper und zog sie an mich.
„Aber genau das ist es doch, was du tust – dir Gedanken um die Probleme anderer Menschen machen, oder?“, fragte sie.
„Hinter der ganzen Fassade ist Weldon ein anständiger Kerl. Ich glaube, dass da jemand den Auftrag gegeben hat, ihn zu ermorden. Und ich glaube auch, dass Weldon dabei den Kürzeren ziehen wird, wenn er nicht endlich seinen Stolz runterschluckt.“
„Meinst du etwa, Weldon hat sich mit der Mafia eingelassen?“
„Ich hab gehört, dass er für Air America geflogen ist, nachdem er die Marine verließ. Das war eine Fluglinie der CIA in Vietnam. Ich nehme an, wenn man da mal dazugehört, gehört man sein Leben lang dazu.“ Ich klapperte mit dem Löffel außen an der étoufée-Schale. „Vielleicht hat es aber auch was mit Bobby Earl zu tun. Ein Typ wie der, der vergisst es nie, wenn ihn jemand an der Krawatte durch den Salat zieht.“
„Ha, unser Detective lächelt übers ganze Gesicht.“
„Das wären prächtige Bilder für die Abendnachrichten gewesen.“
Sie beugte sich über mich, drückte meinen Kopf an ihren Busen und küsste mein Haar. Dann nahm sie mir gegenüber Platz und machte sich daran, einen Krebs zu schälen.
„Hast du nach dem Essen was vor?“, fragte sie.
„Hast du was Bestimmtes im Auge?“
„Man kann nie wissen.“ Sie sah auf, ein Lächeln in den Augen.
Ich bin einer der wenigen mir bekannten Menschen, die zweimal im Leben eine neue Chance bekommen haben. Nachdem ich Jahre mit Suff und Selbstzerstörung verschwendet hatte, fand ich schließlich wieder zurück zu Nüchternheit und damit auch Selbstachtung, dank einer höheren Macht, wie man das bei den Anonymen Alkoholikern nennt. Und dann, nach dem Mord an meiner Frau Annie, trat völlig unerwartet Bootsie Mouton wieder in mein Leben, als wäre die Zeit stehen geblieben, als wäre plötzlich wieder der Sommer von 1957, in dem wir uns bei einem Tanzfest draußen am Spanish Lake kennengelernt hatten.
Ich werde nie vergessen, wie ich sie das erste Mal küsste. Es war in der Abenddämmerung unter den großen Eichen am Bayou Teche in St. Martinville, der Himmel lavendelfarben und rosa und am Horizont durchzogen von leuchtenden Feuerstreifen. Sie blickte hoch in mein Gesicht wie eine aufgehende Blume, und als unsere Lippen sich berührten, drückte sie sich an mich, und ich spürte die Wärme ihres sonnengebräunten Körpers und begriff mit einem Schlag, dass ich keine Ahnung gehabt hatte, was ein Kuss sein konnte. Sie öffnete und schloss ihren Mund, erst ganz langsam, dann immer weiter, drehte den Kopf, hob das Kinn, und ihre Lippen waren trocken und weich, ihr Gesicht voll Vertrauen und Gelassenheit und Liebe. Als sie ihren Kopf an meinen lehnte, konnte ich kaum schlucken, und die Leuchtkäfer zogen hinter sich Netze von rotem Licht durch das schwarzgrüne Gewirr der Eichenäste über unseren Köpfen, und das ohrenbetäubende Gezirpe der Zikaden erfüllte den Himmel von Horizont zu Horizont.
Ich aß nicht mehr weiter und trat hinter ihren Stuhl, beugte mich zu ihr und küsste sie auf den Mund.
„Was für Gedanken tummeln sich nur seit heute Morgen in deinem Kopf ?“, fragte sie.
„Du bist die Beste, Boots“, sagte ich.
Sie sah zu mir auf, ihre Augen gütig und weich, und ich berührte mit den Fingern ihr Haar und ihre Wange.
Dann sah sie in Richtung der Straße aus dem Fenster.
„Wer ist denn das?“, fragte sie. Ein silbern lackierter Cadillac mit Fernseh- und CB-Funk-Antennen und beinahe schwarz getönten Scheiben bog von der unbefestigten Straße am Bayou in meine Auffahrt und parkte unter den Pecanbäumen neben meinem Pick-up.
Der Fahrer machte den Motor aus, stieg aus und trat in den Hof. Er trug einen glänzend anthrazitgrauen Anzug, ein blaues Hemd mit Manschettenknöpfen, eine rotblau gestreifte Krawatte und eine eng anliegende schwarze Sonnenbrille. Die nahm er jetzt vorsichtig mit der rechten Hand ab, die anstatt der beiden untersten Finger nur noch eine halbmondförmige glatte Stelle aufwies. Er sperrte die Augen weit auf, um sich an die verändernden Lichtverhältnisse zu gewöhnen, und ging durch das Laub und die Pecanschalen auf die Veranda zu. Seine schwarzen Schuhe waren so blank poliert, dass sie genauso gut aus Plastik sein konnten.
„Ist das …“, begann Bootsie.
„Ja, das ist Lyle Sonnier. Er hätte nicht hierherkommen sollen.“
„Vielleicht hat er’s im Büro probiert, und die haben ihm gesagt, dass du zu Hause bist.“
„Spielt keine Rolle. Er hätte einen Termin mit mir im Büro abmachen müssen.“
„Ich wusste nicht, dass du so schlecht auf ihn zu sprechen bist.“
„Er lebt davon, arme und ungebildete Menschen auszunutzen, die es nicht besser wissen, Boots. Er hat die Hungersnot in Äthiopien dafür verwendet, Spenden für seine Fernsehshow aufzutreiben. Schau dir nur seinen Wagen an.“
„Psst, er ist schon auf der Veranda“, flüsterte sie.
„Ich werde draußen mit ihm reden. Es gibt keinen Grund, ihn ins Haus zu bitten. Okay, Boots?“
Sie zuckte mit den Achseln und sagte: „Wie du meinst. Ich finde, du bist ein bisschen zu hart.“
Lyle grinste durch die Fliegentür, als er mich kommen sah. Er hatte dieselbe dunkle Cajunhaut wie die anderen Sonniers, aber Lyle war immer der Dünne gewesen, mit schmalen Schultern und Hüften, der geborene Langstreckenläufer oder Billardhai und unterm Strich einer der furchtlosesten Soldaten, mit denen ich in Vietnam gekämpft hatte. Nur, dass Vietnam und die kleinen Männer mit ihrer pyjamaartigen Kleidung, die sich in Erdlöchern und kleinen Höhlen versteckten, 25 Jahre zurücklagen.
„Wie steht’s, Lieut?“, fragte er.
„Wie geht’s dir, Lyle?“, fragte ich und schüttelte draußen auf der Veranda seine verstümmelte Hand. Sie war leicht und dünn und fühlte sich in meinem Griff irgendwie unnatürlich an. „Ich muss noch die Kaninchen und das Pferd meiner Tochter füttern, bevor ich wieder zur Arbeit gehe. Macht’s dir was aus, mich zu begleiten? Wir können uns dabei unterhalten.“
„Kein Problem. Bootsie ist nicht da?“ Er warf einen Blick zur Fliegentür. Seine rechte Gesichtshälfte war gesprenkelt von Schrapnellnarben, die wie eine Kette aus fleischfarbenen Plastiktränen aussahen.
„Sie kommt gleich raus. Worum geht’s, Lyle?“ Ich ging zu den Kaninchenställen unter den Bäumen, damit er mir folgen musste.
Eine ganze Zeit lang sagte er gar nichts. Stattdessen stand er im Schatten und kämmte seine pomadisierte braune Tolle und blickte hinaus zu meinem Bootssteg und dem Zypressenstumpf auf der anderen Seite des Bayou. Dann steckte er den Kamm in die Hemdtasche.
„Du magst mich nicht, stimmt’s?“, fragte er.
Ich öffnete die Maschendrahttür eines Kaninchenstalls und machte mich daran, den Futternapf mit Luzerne-Kügelchen zu füllen.
„Vielleicht mag ich nur nicht, was du so tust, Lyle“, sagte ich.
„Ich entschuldige mich nicht dafür.“
„Das hab ich auch gar nicht von dir verlangt.“
„Ich habe die Gabe, Menschen zu heilen, mein Sohn.“
Ich sah auf die Uhr, öffnete den nächsten Verschlag und gab ihm keine Antwort.
„Das ist keine Prahlerei“, sagte er. „Es ist eine Gabe. Ich habe nichts dafür getan. Aber diese Kraft, die kommt durch meine Schulter, durch meinen Arm, direkt durch diese verkrüppelte Hand, und von da geht sie weiter in ihre Körper. Ich kann sie fühlen, diese Kraft. Sie wächst in meinem Arm, gerade so, als würde ich einen Eimer Wasser am Henkel halten, und dann ist sie wieder weg, übergegangen von mir auf andere Menschen, und mein Arm ist auf einmal so leicht, als ob da gar nichts im Ärmel stecken würde. Das magst du jetzt glauben oder nicht, mein Sohn. Aber es ist Gottes Wahrheit. Und ich sag dir noch was. Du hast da im Haus eine kranke Frau.“
Ich stellte die Tüte mit den Luzernesprossen ab, legte den Riegel am Verschlag vor und drehte mich zu ihm, sodass ich ihm voll ins Gesicht sah.
„Zwei Dinge, Lyle. Nenn mich nicht noch mal ‚mein Sohn‘, und tu nicht so, als wüsstest du irgendwas über die Probleme in unserer Familie.“
Er kratzte den Rücken der verkrüppelten Hand und blickte hoch zum Haus. Dann saugte er versonnen an seinen Backenzähnen und sagte: „Wollte dich nicht kränken. Lag nicht in meiner Absicht. O nein, Sir.“
„Also, wie kann ich dir jetzt helfen?“
„Es ist genau umgekehrt. Du bist draußen bei Weldon gewesen, aber der hat kein Wort über die Lippen gebracht, stimmt’s?“
„Was ist mit Weldon?“
„Jemand hat auf ihn geschossen. Nachdem Bama die Polizei benachrichtigt hatte, hat sie mich angerufen. Dave, Weldon wird dir nicht helfen. Das kann er nicht. Er hat Angst.“
„Angst wovor?“
„Wovor die meisten Menschen Angst haben, wenn sie Angst haben – der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.“
„Weldon macht auf mich nicht den Eindruck, als ließe er sich so leicht ins Bockshorn jagen.“
„Du hast unseren alten Herrn nicht gekannt.“
„Was meinst du damit, Lyle?“
„Der Mann mit dem verbrannten Gesicht, den Bama durchs Fenster gesehen hat. Ich hab ihn nämlich auch gesehen. Bei der Sendung letzten Sonntag saß er in der dritten Reihe. Ich hätte fast das Kabel vom Mikrofon gerissen, als ich ihn genauer ansah und das Gesicht unter all den Narben erkannte. Es war so, wie wenn man das Negativ eines Fotos ins Licht hält, bis man das Bild sieht, was in den Schatten verborgen ist, wenn du verstehst, was ich meine? Am Ende meiner Predigt lief mir der Schweiß nur so vom Gesicht. Grad so, als hätte der alte Hurensohn den Arm ausgestreckt und mir einen Finger durch den Nabel gebohrt.“
Er versuchte zu grinsen, aber es gelang ihm nicht richtig.
„Du redest völlig konfuses Zeug, Partner“, sagte ich.
„Ich rede von meinem alten Herrn, Verise Sonnier. Bis ich unten im Publikum war, war er verschwunden, aber er war es. So einen hat Gott nicht zweimal geschaffen.“
„Dein Vater ist in Port Arthur ums Leben gekommen, als du noch ein Kind warst.“
„So hieß es damals. Und das haben wir auch gehofft.“ Wieder grinste er, dann schüttelte er mit einem Ruck allen Humor aus seinem Gesicht. „Lebendig begraben unter einem Haufen glühend heißer Kesselplatten, als die Chemiefabrik in die Luft flog. Irgendjemand schaufelte einen kleinen Sack von der Größe eines Kissenbezugs voll mit Asche und Knochenresten und meinte dann, das sei alles, was von ihm übriggeblieben ist. Aber meine Schwester Drew bekam dann einen Brief aus dem Staatsgefängnis von San Antonio, von einem Mann, der behauptete, er sei unser Vater und wolle hundert Dollar, um nach Mexiko abzuhauen.“ Er hielt inne und starrte mich einen Augenblick lang wortlos an, um seinen Sätzen Nachdruck zu verleihen, als blicke er in eine Fernsehkamera. „Sie hat’s ihm geschickt.“
„Also irgendwie klingt mir das alles zu schwer nach Theater, Lyle.“
„Ach ja?“
„Warum sollte dein Vater Weldon etwas antun wollen?“
Sein Blick schweifte weg zu den Bäumen. Ein dunkler Schatten lag auf seinem Gesicht, und gedankenverloren rieb er an der Narbenkette, die aus seinem Augenwinkel herauszufließen schien.
„Er hat allerdings Grund genug, uns allen was anzutun. Nachdem wir ihn für tot hielten, haben wir jemandem etwas angetan, der ihm sehr nahestand.“ Er sah mir wieder ins Gesicht. „Und nicht zu knapp.“
„Was genau war das?“
„Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Das wird dir jemand anders erzählen müssen.“
„Dann weiß ich auch nicht, was ich in dieser Angelegenheit für dich tun kann.“
„Nun, ich kann dir sagen, was Weldon getan hat. Oder zumindest, was der Alte denkt, das Weldon getan hat.“ Er wartete, und als ich darauf nichts erwiderte, fuhr er fort. „Als wir klein waren, hatte der Alte noch seinen Traum. Er war richtig besessen davon. Er sah sich als unabhängigen Ölmann, als Wildcatter, so eine Art lebende Legende, wie Glenn McCarthy drüben in Houston. Angefangen hat er mit einem kleinen Bohrschiff, für eine dieser Firmen, die seismografische Messungen vornehmen. Dann hat er wild überall in Texas und Oklahoma gebohrt, und anschließend im Auftrag von Texaco Zufahrtswege in die Sümpfe gebaut. Nach einer Weile war er tatsächlich in der Lage, Land im Atchafalaya-Becken zu pachten und genügend verrosteten Schrott zusammenzukaufen, um seinen ersten richtigen Bohrturm aufzustellen. Ein Geologe aus Lafayette hatte ihm gesagt, dass direkt auf unserer Farm der beste Ort für eine Bohrung wäre.
Nur, dass das ein ziemliches Problem für den Alten war. Er war so eine Art Hexer, ein traiteur, und er hat immer behauptet, er könne Warzen heilen, das Bluten von Schweinen stillen, das Feuer aus einer Brandwunde blasen, das Geschlecht eines Kindes vorbestimmen, dieses ganze Pseudo-Voodoo-Zeug halt. Aber er hat uns auch erzählt, dass in dem alten spanischen Brunnen in der Mitte unseres Zuckerrohrfeldes ein Indianergrab sei, und wenn er auf unserem Grund und Boden ein Loch bohrte, würden uns ihre Geister heimsuchen.
Er hatte tatsächlich Angst vor Geistern in der Erde, nur glaube ich, dass die in Wirklichkeit von einer ganz anderen Art waren. Mein Onkel hat mir mal im Vollrausch erzählt, dass der Alte für dreißig Cents die Stunde einen Schwarzen angeheuert hatte, um sein Feld zu pflügen. Der Schwarze fuhr mit dem Pflug über einen großen Stein, sodass die Pflugschar brach, und legte sich dann einfach unter einen Baum, um ein Nickerchen zu halten. Der Alte fand den zerstörten Pflug, das voll aufgezäumte Maultier stand noch daneben, und er ging rüber zu dem Baum, gab dem Schwarzen einen Tritt, dass der aufwachte, und brüllte ihn an. Dann machte der Schwarze einen großen Fehler. Er brüllte zurück. Der Alte kriegte einen Wutanfall, jagte ihn quer übers Feld und schlug ihm den Schädel mit einer Hacke ein. Mein Onkel hat erzählt, dass er ihn irgendwo da bei dem spanischen Brunnen begraben hat.“
„Was hat das jetzt alles mit Weldon zu tun?“
„Hörst du mir nicht richtig zu? So gierig und erfolgsgeil er auch war, der Alte traute sich nie, auf seinem Land zu bohren. Aber da kennst du Weldon schlecht, Kumpel. Genau da hat der nämlich seinen ersten Bohrturm aufgestellt, er hat mitten durch diesen spanischen Brunnen durchgebohrt. Gewissermaßen als Statement, glaube ich. Einer der Arbeiter dort hat mir erzählt, dass anfangs lauter Knochenstücke an der Bohrspitze waren.“
„Ich werd’s mir merken. Danke, dass du gekommen bist, Lyle.“
„Als den großen Durchbruch in dem Fall scheinst du das ja nicht gerade zu betrachten?“
„Wenn Menschen anderen Menschen vorsätzlich und mit Plan nach dem Leben trachten, dann im Normalfall wegen Geld. Nicht immer, aber doch meistens.“
„Nun, jeder hört eben das, was er hören muss.“
„Ach ja?“
„Ich war selbst nie gut im Zuhören. Jedenfalls so lange nicht, bis mich jemand da oben wachgerüttelt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf, Dave.“
„Weißt du, was ein passiv-aggressives Verhaltensmuster ist?“
„Bin nie auf dem College gewesen, anders als du und Weldon. Klingt richtig gelehrt.“
„Das ist kein sonderlich gelehrtes Konzept. Es besagt, dass eine Person mit viel Aggressivität und Feindseligkeit lernt, dies in Unterwürfigkeit und bisweilen sogar Religiosität zu maskieren. Ein sehr effektives Verhaltensmuster.“
„Wirklich? Hast du das alles im College gelernt? Wirklich zu schade, dass mir das entgangen ist.“ Er grinste mit einem Mundwinkel, zeigte kaum Zähne dabei, wie ein Opossum.
„Ich will dir mal eine Frage stellen, ohne Umschweife, ohne Drumherum, Lyle“, sagte ich.
„Schieß los.“
„Gibst du mir die Schuld an deinem letzten Tag?“
„Was meinst du damit?“
„In Vietnam. Ich habe dich schließlich in diesen Tunnel geschickt. Ich wünschte, wir hätten ihn einfach in die Luft gejagt und wären weitergezogen.“
„Du hast mich da nicht runtergeschickt. Mir hat’s da unten gefallen. Das war meine eigene unterirdische Horrorshow. Die Schlitzaugen dachten, der Zorn Gottes komme zu ihnen in die Eingeweide der Erde herabgekrochen. Dafür hab ich gesorgt. Das war nicht gut, mein Sohn.“ Er zuckte halb amüsiert zusammen und hob die Hände. „Tut mir leid, ist mir nur so rausgerutscht.“
Ich sah auf die Uhr.
„Ich schätze, das ist das Zeichen für meinen Abgang“, sagte er. „Danke für deine Zeit. Sag Bootsie einen Gruß von mir, und denk nicht allzu schlecht von mir.“
„Das tue ich nicht.“
„Das ist schön.“
Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und ging durch das welke Laub zu seinem Cadillac. Dann blieb er stehen, rieb sich heftig hinten im Nacken, als ob sich ein Moskito tief in seine Haut gegraben hätte, drehte sich um und starrte mich mit leerem Blick an, als habe ihn blitzartig eine böse Erkenntnis getroffen.
„Es ist eine Krankheit, die im Blut lebt. Sie heißt Lupus. Tut mir leid, Dave. Bei Gott, es tut mir leid“, sagte er.
Ich stand da mit offenem Mund und mit dem Gefühl, ein kalter Windzug wäre eben durch meine Seele gefahren.
Am nächsten Morgen war Samstag. Der Sonnenaufgang leuchtete blumig-rosa über den Trauerweiden und abgestorbenen Zypressen im Sumpf und den Nebelbänken, die aus den Buchten heraustrieben. Batist und ich öffneten den Köderladen, sobald es hell wurde, und die Luft war so kühl und mild, es war ein so vollendet schöner Morgen mit den blauen Schatten und dem Duft des Jasmins, der nachts blühte, dass ich Lyle und sein vorgebliches Wissen über die Krankheit meiner Frau einfach vergaß. Für mich selbst war ich zu dem Schluss gekommen, dass Lyle kaum anders war als die ganzen anderen schmierigen Fernsehprediger. Jemand, der Bootsie gut kannte, hatte ihm vermutlich von ihrer Krankheit erzählt. Jedenfalls hatte ich nicht vor, mir das Wochenende mit weiteren Gedanken an die Sonnier-Familie zu verderben.
Manche Menschen waren wohl einfach dazu geboren, früher oder später tief zu stürzen, dachte ich bei mir. Wahrscheinlich gehörte Weldon zu ihnen. Außerdem konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Lyle einer dieser Typen war, die sich selbst mit allerlei theologischem Brimborium neu erschaffen, nur um schließlich doch von den eigenen Neurosen aufgefressen zu werden.
Nachdem wir die meisten unserer Boote vermietet hatten, fischten Batist und ich mit Netzen die toten Köderfische aus den Aluminiumbecken, schütteten kleingestoßenes Eis über die Bier- und Limonadenflaschen in den Kühltruhen und entfachten den Grill, den ich selbst aus einem alten, längs halbierten Ölfass zusammengebaut hatte. Um acht stand die Sonne schon leuchtend hell und heiß am Himmel und vertrieb den letzten Nebel aus den Zypressen. Der Wind roch schwach nach Verwesung – ein totes Tier irgendwo im Sumpf.
„Geht dir was im Kopf rum, Dave?“, fragte Batist. Er hatte einen Schädel wie eine Kanonenkugel, ein Paar Marinehosen hing ihm schlaff an den schmalen Hüften, und sein vom vielen Waschen fast aufgelöstes Unterhemd wirkte auf der massigen pechschwarzen Brust und dem breiten Rücken wie ein zerfetzter weißer Lumpen.
„Nein, eigentlich nicht.“
Er nickte, steckte sich eine kalte Zigarre in den Mund und blickte aus dem Fenster auf ein Gewirr toter Äste und Hyazinthen, das in der Strömung des Bayou an uns vorbeitrieb.
„Ist nix Schlimmes, wenn einem was im Kopf rumgeht“, sagte er. „Schlimm ist bloß, wenn man’s keinem sagt.“
„Was meinst du, wie sollen wir die Hühnchen würzen?“
„Sie kommt schon wieder in Ordnung. Wirst schon sehen. Dafür gibt’s ja all die Doktors.“
„Danke, Batist.“
Da sah ich Alafair. Sie lief mit Tripod an der Kette zwischen den Pecanbäumen hindurch vom Haus zu uns her. Sie war jetzt in der dritten Klasse und ein richtiger Wonneproppen, das alte T-Shirt von der Louisiana State University, in Gold und Lila mit dem lächelnden Maskottchen Tiger Mike drauf, reichte ihr schon nicht mehr ganz bis über den Bauch. Man sah den Nabel und den Stretchbund ihrer Jeans. Ihr glänzendes schwarzes Haar ging ihr bis über die Ohren, und ihre Haut blieb das ganze Jahr sonnengebräunt. Ihre typisch indianischen Zähne standen leicht auseinander, und wenn sie lächelte, verschwanden ihre dunklen Augen fast völlig in den weichen Wangen. Wenn ich sie jetzt hochhob, kam sie mir schwer und kompakt vor, voller Energie und Spieltrieb und Erwartungsfreude. Aber drei Jahre zuvor, als ich sie draußen auf dem Meer nach einem Flugzeugabsturz aus der schnell sinkenden Maschine gezogen hatte – der Pilot war ein Prediger aus Lafayette gewesen, der illegal Flüchtlinge aus El Salvador ins Land brachte –, da hatte sie Wasser in den Lungen gehabt, und ihre Augen waren vor Entsetzen geweitet, als wir in einem Strudel von Luftblasen zur Wasseroberfläche hochstiegen, und ihre dünnen Knochen waren so zart und zerbrechlich wie die eines Vogels gewesen.
Tripod stapfte heraus auf den Bootssteg. Seine Kette rasselte laut auf den Holzplanken.
„Dave, du hast das Kaninchenfutter draußen liegen lassen. Tripod hat’s im ganzen Garten verstreut“, sagte Alafair. Sie strahlte.
„Und das findest du wohl sehr komisch, Kleines?“, fragte ich.
„Ja“, sagte sie und grinste wieder.
„Batist hat mir gesagt, dass du Tripod gestern in den Köderladen mitgebracht hast, wo er sich über die hartgekochten Eier hergemacht hat.“
Sie blickte mich fragend an, als wisse sie von nichts.
„Tripod hat das getan?“, fragte sie.
„Kennst du sonst noch jemanden, der ein hartgekochtes Ei im Köderbecken waschen würde?“
Sie blickte nachdenklich über den Bayou, als läge zwischen den Ästen der Zypressen die Lösung eines tiefgründigen Rätsels verborgen. Tripod lief im Zickzack an der Kette. Er roch den Fisch auf dem Bootssteg.
Ich strich Alafair über den Kopf. Das Haar war schon warm von der Sonne.
„Wie wär’s mit etwas Pastete, Kleines?“, fragte ich und blinzelte ihr zu. „Aber du und Tripod, ihr solltet euch Batist gegenüber etwas mehr Zurückhaltung auferlegen.“
„Was sollen wir?“
„Sieh lieber zu, dass Tripod Batist nicht mehr in die Quere kommt.“
Ich holte ein Tablett mit gewürzten und ölbestrichenen Hühnchenteilen aus dem Laden und machte mich daran, sie auf dem Grill zu verteilen. Das Hickoryholz, das ich verwendete, um das Feuer richtig in Gang zu bringen, war zu heißer, weißer Kohle verglüht, und vom Hühnerfleisch tropfte Öl in die Asche, das sich in zischenden Dampf verwandelte, der vom Wind davongetragen wurde. Ich spürte Alafairs Blick auf meinem Gesicht.
„Dave?“
„Ja, Alf ?“
„Bootsie hat mir gesagt, ich soll’s dir nicht erzählen.“
„Dann erzählst du mir’s vielleicht auch besser nicht.“ Ich drehte den Kopf zu ihr und lächelte sie an, ihre dunklen Augen waren verschleiert und beunruhigt.
„Bootsie hat eine Gabel auf den Boden fallen lassen“, sagte sie. „Als sie sie aufheben wollte, wurde auf einmal ihr Gesicht ganz weiß, und dann musste sie sich ganz schnell hinsetzen.“
„Ist das heute Morgen gewesen?“
„Gestern, als ich aus der Schule gekommen bin. Sie hat geweint, bis sie gemerkt hat, dass ich sie angucke. Ich musste ihr versprechen, dass ich dir nix sage.“
„Es ist nichts Schlechtes, so was weiterzuerzählen, Alf.“
„Dave? Ist Bootsie wieder krank?“
„Vielleicht müssen wir ihr wieder eine andere Medizin geben. Aber das ist alles.“
„Das ist alles?“
„Das kommt schon alles wieder in Ordnung, Kleines. Lass mich kurz hier fertig machen, und dann holen wir Boots und gehen zu Mulate’s Krebse essen.“
Sie nickte wortlos. Ich hob sie hoch, und sie schlang mir die Beine um die Hüften. Tripod wuselte in wilden Kreisen vor meinen Füßen umher, und die Kette rasselte übers Holz.
„Hey, komm, wir besorgen dir heute ein paar neue Malbücher“, sagte ich.
„Ich bin zu alt für Malbücher.“
Ich drückte sie an mich und blickte über ihren Kopf hinweg zum Haus, über dem ein dunkler Schatten lag. Einen Augenblick lang meinte ich, mein Puls schlage so heftig im Hals, als wolle er herausspringen – wie eine kaputte Uhr, der die Zeit davonläuft.
Ganz gelang es mir dann doch nicht, das Wochenende von den Sonniers freizuhalten.
Am Nachmittag, wir waren gerade in einem heftigen Platzregen von Mulate’s zurückgefahren, klingelte das Telefon, als wir von meinem Pick-up durch die Pecanbäume hindurch auf die Veranda rannten, um ins Trockene zu kommen. Ich nahm in der Küche den Hörer ab und wischte mir gleichzeitig mit dem Handrücken das Regenwasser aus den Augen.
„Ich dachte mir, ich melde mich besser noch mal bei dir, bevor wir die Stadt verlassen“, sagte die Stimme am anderen Ende.
„Weldon?“