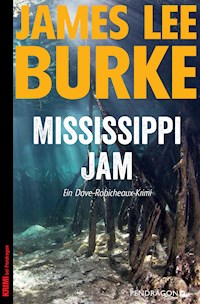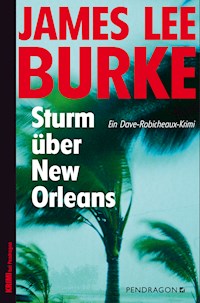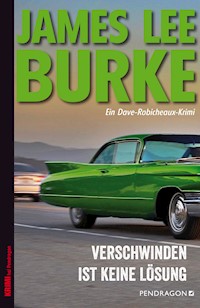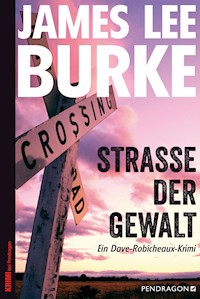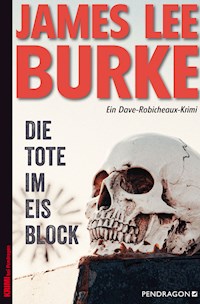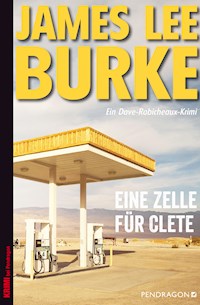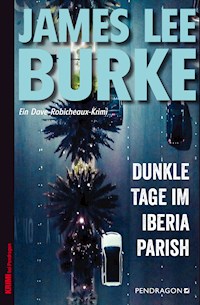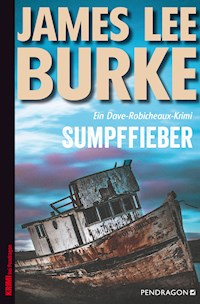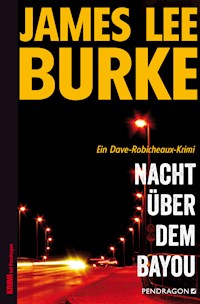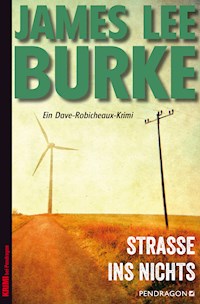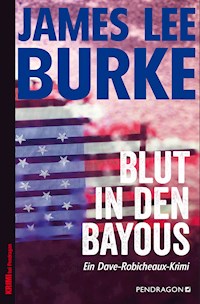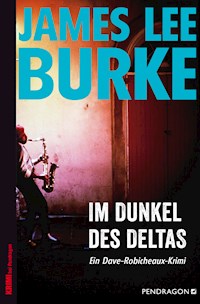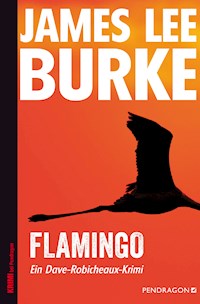Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der 1. Band der Dave-Robicheaux-Reihe Ein Meisterwerk von Bestseller-Autor James Lee Burke Nur noch drei Stunden bleiben Johnny Massina bis zu seiner Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Der letzte Mensch, den er vor seinem Tod sprechen möchte, ist ausgerechnet ein Cop von der Mordkommission New Orleans. Massina lässt Dave Robicheaux wissen, dass er beseitigt werden soll. Mit seinen Ermittlungen ist er einigen mächtigen Gangstern in die Quere gekommen. Robicheaux vermutet, dass der geplante Anschlag auf ihn auch etwas mit der Leiche der jungen Frau zu tun hat, die er aus dem Bayou gefischt hat. Seine Kollegen bei der Polizei gehen von Selbstmord aus. Nur Dave glaubt nicht daran und ermittelt gegen alle Widerstände weiter. Dabei verstrickt er sich schnell in einen Fall, der noch viel morastiger ist als das Sumpfloch, aus dem er das tote Mädchen zog. »Niemand erweckt Schauplätze so gut zum Leben wie James Lee Burke, und niemand beschreibt emotionale Konflikte so perfekt wie er.« Elizabeth George Diese Ausgabe wurde im Pendragon Verlag NEU überarbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Neonregen
Für die Familie Walter J. Burke in New Iberia, Louisiana,
in herzlicher Verbundenheit für ihre liebevolle, freundliche Wesensart.
JAMES LEE BURKE
Neonregen
Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 1
Aus dem Amerikanischen von Hans H. Harbort
Mit einem Vorwort von James Lee Burke und einem Nachwort von Alf Mayer
Dave und ich Ein Grußwort an meine deutschen Leser
Mitten in meiner Karriere als Schriftsteller gab es dreizehn Jahre, in denen ich kein einziges neues Buch unterbringen konnte, obwohl meine ersten drei Romane in New Yorker Verlagen erschienen waren, bereits der erste von der Kritik mit offenen Armen empfangen wurde. Innerhalb von neun Jahren wurde mein vierter Roman – sein Titel war The Lost Get-Back Boogie – von insgesamt 111 Verlagen abgelehnt. Aber ich schrieb weiter Kurzgeschichten und Bücher, der Stapel meiner Ablehnungsschreiben wuchs. Eines Nachmittags, als ich mit meinem Freund Rick Demarinis beim Angeln war, sagte der: „Jim, außer einem Kriminalroman hast du schon alles geschrieben. Warum versuchst du es nicht einmal? Du brauchst nur ein paar Kapitel, um einen Vorschuss zu erhalten.“
Drei Tage später war ich mit meiner Frau Pearl im North-Beach-Bezirk von San Francisco und wir kamen zufällig an Lawrence Ferlinghettis „City Lights Book Store“ vorbei. Aus Spaß ging ich hinein, kaufte mir einen Schreibblock und ging dann in ein Straßencafé gegenüber einer katholischen Kirche, setzte mich an einen Tisch, bestellte mir einen Espresso und begann, den ersten Absatz einer Geschichte zu schreiben, die von einem Polizeibeamten aus New Iberia, Lousiana, erzählte, der Heimatstadt meiner Familie.
Ich wusste nicht warum, aber mir war klar, dass aus dieser Geschichte ein Buch würde, das mein Leben verändern könnte. Die Worte flossen mühelos, als ob sie seit Jahren nur darauf gewartet hätten, endlich geschrieben zu werden.
Einige Wochen später schickte ich die ersten zwei Kapitel an Charles Willeford, meinen alten Freund in Miami. Er machte einige gute Vorschläge zum Gebrauch von Ellipsen im Dialog und sagte mir dann, dass ich da eine Figur erschaffen hatte, die das Zeug hätte, zu einem der erfolgreichsten Protagonisten in der amerikanischen Kriminalliteratur zu werden.
Die Louisiana State University Press brachte dann schließlich The Lost Get-Back Boogie und eine Sammlung meiner Erzählungen mit dem Titel The Convict heraus. The Lost Get-Back Boogie, dieses 111 Mal abgelehnte Buch, wurde für den Pulitzer-Preis nominiert. Ich vollendete „The Neon Rain“ und drei Verlagshäuser überboten sich darin, das Buch zu bekommen. Ich war geplättet.
Die Geschichte von Dave Robicheaux setzte ich mit Heaven’s Prisoners und Black Cherry Blues fort. Die drei Bücher bildeten eine Trilogie, die lose auf John Miltons Paradise Lost gründet. Die größere Geschichte in den drei Romanen ist Daves Abstieg in den alkoholischen Abgrund und sein allmählicher Ausstieg aus einer sein Leben bestimmenden Sucht.
Zwanzig Romane mit Dave Robicheaux sind es mittlerweile geworden. Auf alle bin ich stolz. Ich hoffe, sie bereiten Ihnen so viel Vergnügen wie mir, sie zu schreiben. Nie habe ich Schreiben als Arbeit betrachtet, immer empfand ich es als Geschenk. Ebenso sehe ich es als ein Geschenk an, dass möglicherweise jemand Freude an meinem Werk empfindet und Anteil nimmt an Daves Versuchen, denen eine Stimme zu geben, die keine haben.
Mit allen guten Wünschen,Ihr James Lee Burke
1
Der Abendhimmel war mit violetten Streifen durchzogen, einem Farbton, der an überreife Pflaumen erinnerte, und ein leichter Regen hatte eingesetzt, als ich das Ende der Asphaltstraße erreichte, die dreißig Kilometer weit durch eine dichte, beinahe undurchdringliche Vegetation aus Zwergeichen und Kiefern führte und vor dem Eingangstor des Staatsgefängnisses von Angola endete. Vor dem Zaun hatte sich die übliche Gemeinde von Todesstrafengegnern zur Andacht versammelt: Priester, Nonnen in Zivilkleidung, Studenten der Louisiana State University mit brennenden Kerzen in der Hand. Doch es gab auch eine andere Gruppe, eine seltsame Mischung aus Verbindungsstudenten und Rednecks, die Bier aus eisgefüllten Plastikkühlboxen tranken, „Glow, Little Glow Worm“ sangen und Schilder in der Hand hatten, auf denen PROST, MASSINA, EIN BUD AUF DEIN WOHL oder JOHNNY, HEUTE GEHT’S AUF DEN GRILL stand.
„Ich bin Lieutenant Dave Robicheaux vom New Orleans Police Department“, sagte ich zu einem der Wächter am Tor und zeigte ihm meine Dienstmarke.
„Oh, ja, Lieutenant. Ihr Name steht auf meiner Liste. Ich fahr mit Ihnen rüber zum Block“, sagte er und stieg in meinen Wagen. Die Ärmel seines Khakihemdes waren über den sonnengebräunten Armen hochgekrempelt, und er hatte die typischen wässerig grünen Augen und kräftigen Wangenknochen der Leute aus dem nördlichen Hügelland von Louisiana. Er roch leicht nach getrocknetem Schweiß, Kautabak und Talkumpuder. „Ich weiß gar nicht, welche Bande mich mehr ärgert. Diese religiösen Typen, die so tun, als würden wir jemanden wegen Falschparken grillen, oder die Jungs mit den Schildern, die offenbar drüben auf der Uni nicht genug zu bumsen kriegen. Bleiben Sie bis zum Schluss?“
„Nee.“
„Haben Sie den Kerl hopsgenommen, oder was?“
„Er war bloß ein kleiner Eintreiber, über den ich früher ab und zu mal gestolpert bin. Ich hab ihn aber nie wegen irgendwas drangekriegt. In Wirklichkeit, glaub ich, hat er mehr versiebt, als er durchgezogen hat. Vielleicht ist er durch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm beim Mob gelandet.“
Der Wachmann lachte nicht. Er blickte aus dem Wagenfenster auf das riesige, flache Areal der Gefängnisfarm und verkniff jedes Mal die Augen, wenn wir auf der unbefestigten Straße an einem der Vertrauenshäftlinge vorbeikamen. Der Hauptwohnbereich des Gefängnisses, mehrere einstöckige Gebäude mit Hochsicherheitszellen, von einem Maschendraht umgeben, durch überdachte Laufgänge und Höfe miteinander verbunden und in ihrer Gesamtheit als der „Block“ bezeichnet, war hell erleuchtet und strahlte im Regen wie Kobalt. In der Ferne sah ich die mit chirur gischer Präzision angelegten Zuckerrohr- und Süßkartoffelfelder, die Silhouetten verfallener Lagerbaracken aus dem neunzehnten Jahrhundert vor dem roten Nachglühen der Sonne, die sich im Wind biegenden Weiden entlang des Mississippiufers, unter denen manch ein ermordeter Häftling begraben lag.
„Steht der Stuhl noch im Red Hat House?“, fragte ich.
„Ganz genau. Dort kriegen sie Feuer unterm Arsch gemacht. Wissen Sie, woher der Name stammt?“
„Ja“, antwortete ich, aber er hörte nicht zu.
„Damals, bevor die Gemeingefährlichen im Block eingesperrt worden sind, mussten sie unten am Fluss arbeiten und diese gestreiften Joppen und rot gefärbten Strohhüte tragen. Abends mussten sie sich dann nackt ausziehen, eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen, wurden dann ins Red Hat House getrieben, und ihre Klamotten hat man ihnen hinterhergeschmissen. An den Fenstern war kein Fliegendraht, und die Moskitos haben einem Mann schneller die Gottesfurcht beigebracht als ein Baseballschläger.“
Ich parkte den Wagen, und wir betraten den Block, passierten den ersten Zellentrakt, wo sowohl die Spitzel als auch die gefährlicheren Häftlinge einsaßen, gingen durch den langen, strahlend erleuchteten Gang zwischen den Auslaufhöfen zum nächsten Bereich, dann durch eine weitere hydraulische Sperre und einen Verbindungsraum, in dem zwei Wachen an einem Tisch Karten spielten und wo ein Schild AB HIER KEINE WAFFEN an der Wand hing, kamen dann zu den Aufenthalts- und Speiseräumen, wo schwarze Vertrauenshäftlinge mit elektrischen Bohnermaschinen die glänzenden Fußböden polierten, und stiegen endlich die eiserne Wendeltreppe zu dem kleinen Hochsicherheitstrakt empor, in dem Johnny Massina die letzten drei Stunden seines Lebens zubrachte.
Der Wachmann vom Tor verließ mich hier, und ein anderer betätigte den einfachen Hebel, der die Zellentür öffnete. Johnny trug ein weißes Hemd, schwarze Hosen und ein Paar schwarze Air-Force-Schuhe mit weißen Socken. Sein drahtiges, grau-schwarzes Haar war schweißnass, und sein Gesicht hatte die Farbe und Beschaffenheit von altem Papier. Er blickte von seinem Platz auf der Pritsche zu mir auf, seine Augen glänzten heiß und fiebrig, und auf seiner Oberlippe sammelten sich kleine, feuchte Perlen. Mit nikotingelben Fingern hielt er eine Camel-Zigarette, der Boden rings um seine Füße war mit Kippen übersät.
„Streak, bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Ich war mir nicht sicher, ob Sie’s rechtzeitig schaffen“, sagte er.
„Wie geht’s, Johnny?“
Seine Hände umklammerten die Oberschenkel, und er blickte auf den Fußboden, dann wieder zu mir. Ich sah, wie er schluckte.
„Haben Sie schon mal so richtig Schiss gehabt?“, fragte er.
„In Vietnam ein paarmal.“
„Richtig. Sie waren ja drüben, nicht?“
„Damals, ’64, bevor es richtig heiß wurde.“
„Wette, Sie waren ein guter Soldat.“
„Ich hab’s überlebt, das ist alles.“
Auf der Stelle merkte ich, wie dumm meine Bemerkung war. Er sah mir am Gesicht an, dass ich sie bedauerte.
„Machen Sie sich nichts draus“, sagte er. „Ich hab Ihnen ’nen ganzen Haufen zu erzählen. Erinnern Sie sich noch, wie Sie mich ein paarmal zu diesen Versammlungen von den Anonymen Alkoholikern mitgenommen haben, an diesen Schritt, den ihr da immer macht, wenn ihr was zu beichten habt – wie sagt ihr noch mal dazu?“
„Schritt fünf, wo man vor sich selbst, vor Gott und anderen alle seine Fehler offen und ehrlich eingesteht.“
„Genau. Tja, das hab ich auch gemacht. Bei ’nem farbigen Pfarrer, gestern Morgen. Ich hab ihm jede Schlechtigkeit erzählt, die ich je begangen hab.“
„Das ist gut, Johnny.“
„Nein, hören Sie zu. Ich hab ihm die Wahrheit gesagt und bin ein paar echt schlimme Sachen losgeworden, sexuelles Zeug, wegen dem ich mich immer geschämt und das ich nie so richtig kapiert habe. Wissen Sie, was ich meine? Ich hab alles rausgelassen. Ich hab ihm auch von den beiden Jungs erzählt, die ich in meinem Leben abgemurkst hab. Den einen hab ich auf dem Weg nach Havanna über die Reling von ’nem Passagierschiff gekippt, und 1958 hab ich den Cousin von Bugsy Siegel mit ’ner Schrotflinte erledigt. Wissen Sie, was es heißt, ’nen Verwandten von Bugsy Siegel kaltzumachen? Sobald ich dem Pfarrer alles gebeichtet hatte, hab ich’s auch dem Wächter und dem stellvertretenden Direktor erzählt. Wissen Sie, dass es den blöden Arschgeigen absolut egal war?
Moment noch, lassen Sie mich ausreden. Ich hab all das Zeug erzählt, weil mir einfach irgendwer glauben muss, dass ich diese Braut nicht alle gemacht habe. Ich würd kein junges Mädchen aus ’nem Hotelfenster werfen, Streak. Ich fang nicht an zu zetern, weil ich gegrillt werde. Ich schätze, letzten Endes geht das schon alles klar, aber ich möchte, dass diese Mistkerle wissen, dass ich nur die Jungs über die Klinge hab springen lassen, die nach den gleichen Regeln gespielt haben wie ich. Begreifen Sie das?“
„Ich glaube schon. Und ich bin froh, dass Sie auch den fünften Schritt gemacht haben, Johnny.“
Zum ersten Mal lächelte er. Sein Gesicht glänzte im Licht. „He, sagen Sie mal, stimmt das, dass Jimmie the Gent Ihr Bruder ist?“
„Auf der Straße hört man allerhand Quatsch.“
„Sie haben diese schwarzen Cajun-Haare mit dem weißen Fleck drin, als hätten Sie Stinktierblut in den Adern.“ Er lachte. Seine Gedanken lösten sich von dem Gang, den er, mit einer Kette um den Bauch gefesselt, in drei Stunden zum Red Hat House antreten würde. „Er hat uns mal den Auftrag gegeben, ein paar Pokerautomaten für seine Läden aufzustellen. Sobald die Dinger installiert waren, haben wir ihm gesagt, dass er ab jetzt alle Automaten von uns kriegt: Zigaretten, PacMan, Gummis. Und er sagt, Gummis nicht, er hat nur erstklassige Clubs, und in denen will er keine Gummiautomaten aufstellen. Also sagen wir ihm, er hat keine Wahl – entweder kauft er das ganze Paket, oder sein Wäschedienst fällt aus, die Gewerkschaft stellt Streikposten vor seinem Laden auf und das Gesundheitsamt kriegt raus, dass seine Tellerwäscher Lepra haben. Und was macht der Typ? Er lädt Didoni Giacano – Didi Gee höchstpersönlich – und seine ganze Sippe zum Lasagne-Essen in sein Restaurant ein, und am Sonntagnachmittag trudeln alle bei ihm ein wie eine Bande cafoni, die gerade mit dem Schiff aus Palermo kommt, weil nämlich Didi glaubt, dass Jimmie anständige Beziehungen hat und ihn bei den Knights of Columbus unterbringen kann oder so. Didi Gee wiegt so um die hundertfünfzig Kilo und ist behaart wie ’n Affe, und unten in New Orleans hat jeder mehr Schiss vor ihm als Vaterlandsliebe, aber seine Mama ist eine vertrocknete kleine sizilianische Lady, die aussieht wie eine in schwarze Tücher gewickelte Mumie, und sie haut Didi heut noch mit dem Löffel auf die Finger, wenn er über den Tisch langt, statt höflich zu bitten.
Mitten beim Essen fängt also Jimmie an, Mama Giacano zu erzählen, was für ein toller Bursche ihr Didi Gee doch ist, dass beim Better Business Bureau und der Handelskammer jeder der Meinung ist, er wäre ein großes Plus für die Stadt, und dass Didi es nicht zulässt, wenn jemand seine Freunde rumschubst. Zum Beispiel, sagt er, haben da so ein paar Dreckskerle versucht, in Jimmies Restaurant Automaten aufzustellen, die Jimmie als guter Katholik nicht haben will. Nun sieht Mama Giacano vielleicht aus, als wär sie aus vertrockneter Pasta gemacht, aber ihre kleinen, heißen schwarzen Augen verraten jedem, dass sie genau weiß, wovon die Rede ist. Und Jimmie sagt, dass Didi die Automaten rausgerissen und sie mit ’nem Hammer zertrümmert hat und hinter dem Restaurant noch ’n paarmal mit ’nem Lastauto drübergefahren ist.
Didi Gee hat den Mund voll Bier und roher Austern und erstickt fast dran. Er speit den Sülz quer über seinen Teller, seine Kinder klopfen ihm auf den Rücken, und er hustet eine Auster raus, die glatt den Abfluss verstopft hätte. Mama Giacano wartet, bis sein Gesicht nicht mehr blau angelaufen ist, dann sagt sie ihm, dass sie ihren Sohn nicht großgezogen hat, damit er sich bei Tisch wie eine Herde Schweine benimmt, und er soll auf die Toilette gehen und sich den Mund ausspülen, weil den andern am Tisch vom bloßen Zuschauen schlecht wird, und als er nicht sofort aufsteht, haut sie ihm mit ihrem Löffel auf die Fingerknöchel. Dann sagt Jimmie, er würd gern die ganze Familie auf sein Segelboot einladen, und vielleicht sollte Didi Gee auch in den Jachtclub eintreten, weil die ganzen Millionäre ihn für einen tollen Kerl halten, und außerdem würden Mama Giacano bestimmt die Feiern zur italienisch-amerikanischen Freundschaft gefallen, die dort jedes Jahr am vierten Juli und am Columbus Day veranstaltet werden. Und selbst wenn Didi nicht beitritt – was jeder schon vorher weiß, weil er wasserscheu ist und sich schon auf der Mississippi-Fähre immer die Seele aus dem Leib kotzt –, bietet Jimmie an, Mama Giacano abzuholen, wann immer sie will, und mit ihr auf dem Lake Pontchartrain segeln zu gehen.“
Er lachte wieder und strich sich mit der Hand durch das feuchte Haar. Dann leckte er sich über die Lippen und schüttelte den Kopf, und ich sah ihm an den Augen an, wie die Angst wiederkehrte.
„Wette, er hat Ihnen die Geschichte schon erzählt, oder?“, sagte er.
„Die haben mir nur ein paar Minuten gegeben, Johnny. Willst du mir sonst noch was sagen?“
„Yeah, eins noch. Sie haben mich immer anständig behandelt, und ich hab gedacht, ich könnte ’n bisschen was gutmachen.“ Er wischte sich mit der flachen Hand den Schweiß aus den Augen. „Ich denke, vielleicht muss ich da drüben noch für ’ne Menge Dinge gradestehen. Da kann’s nicht schaden, wenn man probiert, jetzt so viel wie möglich auszubügeln, nicht wahr?“
„Du bist mir nichts schuldig, Johnny.“
„Wenn man so viel auf dem Kerbholz hat wie ich, ist man der ganzen verdammten Welt was schuldig. Jedenfalls, die Sache ist folgende: Gestern hat dieser Schwachkopf von L. J. Potts aus der Magazine Street draußen auf dem Korridor gefegt und immer mit dem Besen an mein Zellengitter geschlagen und jede Menge Krach gemacht, sodass ich nicht schlafen konnte. Also sag ich ihm, ich will keinen Preis als Saubermann des Jahres, und wenn er nicht sofort seinen Besen fortschafft, bevor ich ihn in die Finger kriege, ramm ich ihm das Ding in sein Loch. Da will mir doch dieser Sack, der einen Bruder namens Wesley Potts hat, imponieren. Er fragt mich, ob ich einen Greifer namens Robicheaux von der Mordkommission New Orleans kenne, und dabei grinst er so komisch, verstehen Sie, weil er glaubt, Sie sind einer von den Cops, die mich hopsgenommen haben. Ich sag also, vielleicht, und er grinst immer noch so komisch und sagt, na ja, vielleicht hat er gute Nachrichten für mich, weil sein Bruder Wesley nämlich gehört hat, dass dieser spezielle Greifer von der Mordkommission die Nase in Sachen gesteckt hat, die ihn nichts angehen, und wenn er’s nicht sein lässt, wird er abgemurkst.“
„Das klingt nach Sprücheklopfer, Johnny.“
„Yeah, ist er wahrscheinlich auch, bis auf den Unterschied, dass sein Bruder und er, glaub ich, irgendwie mit den Schmalzlocken zusammenhängen.“
„Den Kolumbianern?“
„Volltreffer. Die breiten sich schneller im Land aus als AIDS. Die legen einfach jeden um – ganze Familien, Kinder, alte Leute, das spielt für die keine Rolle. Erinnern Sie sich an diese Bar an der Basin Street, die abgefackelt worden ist? Der Schmalzkopf, der das gemacht hat, stand am helllichten Tag mit ’nem beschissenen Flammenwerfer in der Tür, und weil er gute Laune gehabt hat, hat er den Leuten ’ne Minute gegeben, den Laden zu räumen, bevor er ihn in ’nen Haufen geschmolzenes Plastik verwandelt hat. Nehmen Sie sich vor diesen Arschgeigen in Acht, Streak.“
Er zündete sich mit der Kippe, die er in der Hand hielt, eine neue Camel an. Er schwitzte jetzt heftig, wischte sich mit dem Hemdsärmel das Gesicht ab und schniefte gleichzeitig daran. Dann wurde sein Gesicht grau und leblos, und er starrte geradeaus, während seine Hände die Oberschenkel packten.
„Gehen Sie jetzt lieber. Ich glaub, mir wird wieder schlecht“, sagte er.
„Du wirst es schon packen, Johnny.“
„Diesmal nicht.“
Wir schüttelten uns die Hand. Seine fühlte sich glitschig und leicht an.
Um Mitternacht wurde Johnny Massina hingerichtet. Ich saß wieder in meinem Hausboot auf dem Lake Pontchartrain, während der Regen auf das Dach prasselte und die Tropfen draußen auf dem Wasser tanzten, und erinnerte mich an die Verse, die ich einmal einen schwarzen Häftling in Angola hatte singen hören:
I ax my bossman, Bossman, tell me what’s right.
He whupped my left, said, Boy, now you know what’s right.
I wonder why they burn a man twelve o’clock hour at night.
The current much stronger; the peoples turn out all the light.
Mein Partner war Cletus Purcel. Unsere Schreibtische standen einander gegenüber, in einem kleinen Zimmer der alten umgebauten Feuerwache an der Basin Street. Bevor das Gebäude als Feuerwache genutzt wurde, war es ein Baumwolllager gewesen, und vor dem Bürgerkrieg wurden im Keller Sklaven gehalten und die Treppe hoch auf einen ungepflasterten Hof geführt, der sowohl als Auktionsplatz wie auch als Hahnenkampfarena diente.
Cletus’ Gesicht sah aus wie gekochte Schweinsschwarte, abgesehen von den Nahtnarben quer über den Nasen rücken und durch eine Augenbraue, wo ihn als Kind drüben im Irish Channel ein Eisenrohr erwischt hatte. Er war ein großer Mann, der erfolglos gegen sein Übergewicht ankämpfte, indem er viermal die Woche abends in seiner Garage Gewichte stemmte.
„Kennst du einen Typen namens Wesley Potts?“, fragte ich.
„Lieber Gott, ja. Ich bin mit ihm und seinem Bruder zur Schule gegangen. Es war, als hätte man Schimmelpilz als Nachbarn.“
„Johnny Massina sagte, der Kerl erzählt rum, er will mir das Lebenslicht ausblasen.“
„Klingt mir nach Blödsinn. Potts ist feiger Abschaum. Hat drüben an der Bourbon Street ein Pornokino laufen. Ich stell ihn dir heut Nachmittag vor. Den Kerl wirst du echt mögen.“
„Ich hab gerade seine Akte hier. Zweimal wegen Narkotika, sechsmal wegen Sittenwidrigkeit hopsgenommen, keine Verurteilung. Offensichtlich einmal ernsthaft Zoff mit dem Schatzamt.“
„Er macht den Strohmann für die Schmalzlocken.“
„Genau das hat auch Massina gesagt.“
„Also gut, wir gehen nach dem Mittagessen hin und reden mit ihm. Ich sag, nach dem Mittagessen, weil dieser Kerl ein echter und einzigartiger Scheißhaufen ist. Übrigens, der Leichenbeschauer vom Bezirk Cataouatche hat zurückgerufen und gesagt, dass sie bei dem farbigen Mädchen keine Autopsie gemacht haben.“
„Was soll das heißen, sie haben keine gemacht?“, fragte ich.
„Er meint, sie hätten keine Autopsie gemacht, weil das Büro des Sheriffs keine verlangt hat. Die Sache ging als Tod durch Ertrinken durch. Was soll das Ganze überhaupt, Dave? Hast du nicht genug ungelöste Fälle, ohne dass du dir noch im Bezirk Cataouatche Arbeit suchst? Die Leute dort unten spielen sowieso nach andern Regeln als wir. Das weißt du doch.“
Zwei Wochen zuvor war ich mit einer Piroge auf dem Bayou Lafourche zum Angeln gewesen und hatte am Rande der Wasserlilien, die sich vom Ufer her ausbreiten, meine künstlichen Fliegen ausgeworfen. Das Land war zu beiden Seiten dicht mit Zypressen bewachsen, und es war kühl und still gewesen im grüngoldenen Morgenlicht, das durch das Blätterdach über mir fiel. Die Wasserlilien waren übersät mit violetten Blüten, und ich konnte die Bäume, das Moos, die feuchtgrünen Flechten auf der Rinde und den Duft der karmesinroten und gelben Wunderblumen riechen, deren Blüten an den schattigeren Stellen noch geöffnet waren. Dicht neben ein paar Zypressenwurzeln lag ein Alligator, der mindestens anderthalb Meter lang gewesen sein muss. Nur sein mit kleinen Krebsen und Muscheln bewachsener Kopf und die Augen ragten aus dem Wasser und sahen einem Haufen brauner Steine zum Verwechseln ähnlich. Ein Stück weiter sah ich einen zweiten schwarzen Schatten an einer anderen Zypresse, und ich dachte, es sei vielleicht der Gefährte des ersten Alligators. Dann kam ein Boot mit Außenborder vorbei, und das Kielwasser rollte den Schatten hoch zu den Zypressenwurzeln, und plötzlich sah ich ein nacktes Bein, eine Hand und ein kariertes, von einer Luftblase aufgeblähtes Hemd.
Ich legte meine Angelrute beiseite, ruderte näher und berührte den Körper mit meinem Paddel. Der Körper drehte sich im Wasser, und ich sah in das Gesicht einer jungen schwarzen Frau, die Augen weit aufgerissen, den Mund geöffnet wie zu einem Wassergebet. Sie trug ein Herrenhemd, unter der Brust zusammengeknotet, und abgeschnittene Bluejeans, und einen Augenblick lang sah ich, dass sie eine Zehn-Cent-Münze an einer dünnen Schnur um das Fußgelenk trug. Es war eine Art Glücksbringer, wie ihn manche Acadians und Schwarze trugen, um den grisgris, eine Art bösen Fluch, abzuwehren. Ihr junges Gesicht sah aus wie eine Blume, die jemand jählings vom Stängel geschnitten hatte.
Ich wickelte ihr mein Ankertau um den Knöchel, schleuderte den Anker möglichst weit unter die Bäume am Ufer und band mein rotes Taschentuch an einen der überhängenden Zweige. Zwei Stunden später sah ich zu, wie die Deputys vom Büro des Bezirkssheriffs den Leichnam auf eine Bahre legten und zu einem Krankenwagen trugen, der im Röhricht am Wasser stand.
„Einen Augenblick noch“, sagte ich, ehe sie sie in den Wagen hievten. Ich lüftete das Tuch, um noch einmal einen Blick auf etwas zu werfen, was mir aufgefallen war, als sie die Leiche aus dem Wasser gezogen hatten. Auf der Innenseite ihres linken Armes waren zahlreiche Nadeleinstiche, während der rechte, soweit ich sehen konnte, nur einen einzigen aufwies.
„Vielleicht spendet sie beim Roten Kreuz Blut“, sagte einer der Deputys grinsend.
„Sie sind hier wohl der Komiker vom Dienst“, sagte ich.
„War doch bloß ein Witz, Lieutenant.“
„Richten Sie dem Sheriff aus, dass ich ihn wegen des Autopsieberichtes anrufe“, sagte ich.
„Jawohl, Sir.“
Aber der Sheriff war nie im Büro, wenn ich anrief, und er rief auch nicht zurück. So telefonierte ich schließlich direkt mit dem Büro des zuständigen Leichenbeschauers und erfuhr, dass der Sheriff eine Autopsie des toten schwarzen Mädchens für nicht so wichtig hielt. Nun, das werden wir ja sehen, dachte ich.
In der Zwischenzeit machte ich mir immer noch Gedanken darüber, warum sich diese Kolumbianer, vorausgesetzt Johnny Massina hatte recht, für Dave Robicheaux interessierten. Ich ging alle meine Fälle durch und fand keinerlei Anhaltspunkte. Es handelte sich aber auch um eine ganze Aktenschublade voller Not und Elend: eine Prostituierte, von einem psychotischen Freier mit dem Eispickel abgestochen; ein siebzehnjähriger Ausreißer, dessen Vater keine Kaution stellen wollte und der am nächsten Morgen von seinem schwarzen Zellengenossen erhängt wurde; die Augenzeugin eines Mordes, von dem Mann, gegen den sie aussagen sollte, mit einem Kugelhammer erschlagen; ein vietnamesischer Bootsflüchtling, den man vom Dach einer städtischen Mietskaserne gestürzt hatte; drei kleine Kinder, von ihrem arbeitslosen Vater nachts in ihren Betten erschossen; ein Fixer, während einer Satansmesse mit Blumendraht erdrosselt; zwei Homosexuelle, bei lebendigem Leibe verbrannt, nachdem ein abgewiesener Liebhaber das Treppenhaus eines Schwulenlokals mit Benzin getränkt hatte. Meine Schublade war sozusagen das mikrokosmische Abbild einer anomalen Welt, bevölkert von Heckenschützen, mit Rasiermessern herumfuchtelnden Schwarzen, hirnlosen Kleinganoven, die irgendwann die Nerven verlieren und wegen sechzig Dollar einen Ladenverkäufer umbringen, und Selbstmördern, die in ihrer Wohnung das Gas aufdrehen und das ganze Haus in einen schwarzorangen Feuerball verwandeln.
Und dieser Sorte Mensch widmete ich mein Leben.
Doch ich suchte vergebens nach einer Nabelschnur, die ins südliche Ausland führte.
Cletus beobachtete mich die ganze Zeit.
„Verdammt, Dave, ich könnt schwören, du bist ernsthaft beleidigt, wenn die Schmalzlocken nicht scharf auf dich sind.“
„Ansonsten hat unser Job ja nicht viel zu bieten.“
„Also gut, ich sag dir was. Wir machen ein bisschen früher Mittag, du lädst mich ein, und ich mach dich mit Potts bekannt. Der Kerl ist eine Wucht. Ein richtiger kleiner Sonnenschein.“
Es war dunstig und gleißend hell, als wir ins French Quarter fuhren. Kein Luftzug war zu spüren, und die Palmwedel und Bananenstauden in den Vorgärten standen grün und bewegungslos in der Mittagshitze. Die Gerüche im French Quarter erinnerten mich jedes Mal wieder an das kleine Kreolenstädtchen am Bayou Teche, wo ich geboren wurde: die Kisten mit Wasser- und Honigmelonen und Erdbeeren unter den verschnörkelten Kolonnaden, der saure Wein- und Bierdunst und das Sägemehl in den Bars, die Poorboy-Sandwiches voller Shrimps und Austern, der kühle, feuchte Duft des alten Mauerwerks in den kleinen Gassen.
Es gab immer noch einige wenige echte Bohemiens, Schriftsteller und Maler, die im French Quarter lebten, und auch ein paar Freiberufler, die bereit waren, astronomische Mieten für die modernisierten Apartments am Jack son Square zu zahlen, aber die Mehrzahl der Bewohner des Vieux Carré bestand aus Transvestiten, Fixern, Wermutbrüdern, Prostituierten, Gaunern jeder Couleur sowie ausgebrannten LSD-Freaks und anderen Eckenstehern, die aus den sechziger Jahren übriggeblieben waren. Die meisten von ihnen lebten von den zahlreichen gutbürgerlichen Konferenzteilnehmern und Familien aus dem Mittleren Westen, die durch die Bourbon Street zogen, Kameras um den Hals, als besuchten sie den Zoo.
In der Nähe von Pearl’s Oyster Bar war kein Parkplatz frei, und so musste ich ein paarmal um den Block fahren.
„Dave, woran merkt man eigentlich, ob man ein Alkoholproblem hat?“, fragte Cletus.
„Wenn’s anfängt, wehzutun.“
„Mir scheint, als war ich in letzter Zeit so gut wie jeden Abend halb besoffen. Ich kann scheinbar nicht mehr heimgehn, ohne vorher in der Kneipe an der Ecke einzukehren.“
„Wie läuft’s denn zwischen dir und Lois?“
„Ich weiß nicht. Es ist für uns beide die zweite Ehe. Vielleicht hab ich einfach zu viele Probleme, vielleicht haben wir die beide. Es heißt doch, wenn man’s beim zweiten Mal nicht schafft, schafft man’s überhaupt nicht. Glaubst du, da ist was dran?“
„Das weiß ich nicht, Clete.“
„Meine erste Frau hat mich verlassen, weil sie nicht mit einem Mann verheiratet sein wollte, der jeden Tag die ganze Gosse von der Arbeit mit nach Hause bringt. Damals hab ich noch bei der Sitte gearbeitet. Sie sagte, ich hab immer nach Huren und Joints gestunken. Dabei war die Arbeit bei der Sitte gar nicht so übel. Und jetzt kommt Lois daher und sagt, sie will nicht, dass ich jeden Abend meine Knarre mit nach Hause bringe. Sie macht jetzt auf Zen, meditiert jeden Tag und schickt unser ganzes Geld an irgend’nen Buddhistenpriester in Colorado, und dann sagt sie mir, sie will nicht, dass ihre Kinder mit Waffen aufwachsen. Waffen sind schlecht, weißt du, aber dieser Kerl da drüben in Colorado, der meine Kohle kassiert, der ist gut. Vor zwei Wochen komm ich angesäuselt nach Hause, und sie fängt an zu heulen und braucht ’ne ganze Packung Kleenex auf. Da hab ich mir dann noch ’n paar Gläser Jack Daniel’s eingepfiffen und ihr erzählt, wie du und ich den ganzen Nachmittag damit zugebracht haben, mit ’ner Harke die Überreste von ’nem vierzehnjährigen Bengel aus ’nem Abfallhaufen zu kratzen. Heraus kam ’ne weitere Viertelstunde Tränen und Naseschnäuzen. Da bin ich einfach loskutschiert, noch was zu trinken holen, und in ’ner Mausefalle kriegen die mich fast dran. Nicht grade gut, was?“
„Jeder hat irgendwann mal Ärger daheim.“
Er verzog das Gesicht und starrte nachdenklich aus dem Fenster. Dann zündete er sich eine Zigarette an, inhalierte tief und schnippte das Zündholz hinaus ins helle Sonnenlicht.
„Mann, spätestens um zwei säg ich dir einen weg“, sagte er. „Ich werd zum Mittagessen ’n paar Bierchen trinken. Betäubt das Hirn, stillt den Magen und beruhigt die Nerven. Hast du was dagegen?“
„Es ist dein Leben. Du kannst damit tun, was du willst.“
„Sie will mich verlassen, ich kenn die Vorzeichen.“
„Vielleicht könnt ihr euch noch irgendwie einigen.“
„Komm schon, Dave, du bist schließlich nicht von gestern. So läuft das nicht. Du erinnerst dich doch, wie es damals war, kurz bevor deine Frau abgehauen ist.“
„Stimmt, ich erinnere mich. Ich weiß, wie es war. Aber niemand sonst. Verstehst du, was ich meine?“ Ich grinste ihn an.
„Schon gut, tut mir leid. Aber wenn alles in den Eimer geht, geht’s halt in den Eimer. Du kriegst nicht damit die Kurve, dass du deine Knarre im Spind lässt. Stell dich da drüben in die Ladezone. Ist verdammt heiß hier draußen.“
Ich hielt in der Ladezone vor Pearl’s Oyster Bar und stellte den Motor ab. Cletus schwitzte in der Sonne.
„Sag mal ehrlich“, sagte er, „hättest du dich auf so was eingelassen, bloß deiner Frau zuliebe?“
Ich wollte nicht einmal darüber nachdenken, was ich alles meiner Frau zuliebe getan hätte – meiner blassen, dunkelhaarigen, wunderschönen Frau aus Martinique, die mich wegen eines Ölmannes aus Houston hatte sitzenlassen.
„Hey, du musst wohl doch das Essen bezahlen“, sagte ich.
„Was?“
„Ich hab kein Geld dabei.“
„Nimm deine MasterCard.“
„Die wollten sie mir nicht erneuern. Irgendwas von wegen, ich hätte meinen Dispo um vierhundert Dollar überzogen.“
„Großartig. Ich hab noch einen Dollar fünfunddreißig. Große Klasse. Was soll’s, lassen wir eben anschreiben. Und wenn’s ihm nicht passt, sagen wir einfach, wir geben der Einwanderungsbehörde ’nen Tipp wegen der Haitianer, die er in seiner Küche beschäftigt.“
„Ich wusste gar nicht, dass er welche hat.“
„Ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, was er dazu sagt.“
Das Pornokino war direkt an der Bourbon Street. Die Straße hatte sich verändert, seit ich vor mehr als zwanzig Jahren als Student immer hierherkam. Die alten Dixielandbands mit Leuten wie Papa Celestin oder Sharky Bonnano waren von Pseudo-Countrybands abgelöst worden, bestehend aus jungen Spunden in Designer-Jeans, Kunstlederwesten und weitärmeligen weißen Seidenhemden mit Brokatstickereien, wie sie Mambotänzer oder Transvestiten tragen. Die Tingeltangels waren immer schon ziemlich halbseiden gewesen, wo die Tänzerinnen zwischen ihren Auftritten im Publikum Drinks schnorrten und kurz vor Schluss die letzten Freier aufgabelten, aber damals hatten sie auf städtische Anordnung hin G-Strings und aufgeklebte Sterne auf den Brustwarzen tragen müssen, außerdem hatte es damals noch keine Drogen gegeben, von dem einen oder anderen Joint abgesehen, den die verzweifelten, ausgebrannten Musiker rauchten, die in einer kleinen, dunklen Grube unten vor dem Laufsteg spielten. Inzwischen jedoch waren die Tänzerinnen auf der Bühne splitternackt, ihre Augen glänzten schwarz vor Speed, und manchmal sah man, dass ihre Nasenlöcher noch feucht waren und zuckten von dem Koks, das sie durch zusammengerollte Dollarnoten schnupften.
Die Fenster von Plato’s Adult Theatre waren mit Hohlziegeln vermauert, sodass niemand in den Laden hineinschauen konnte, und das Innere der kleinen, in Gold und Violett gehaltenen Vorhalle war mit Meisterwerken erotischer Kunst geschmückt, die aussahen, wie von Blinden gemalt. Wir durchquerten den Vorraum und gingen direkt in das Büro, ohne vorher anzuklopfen. Ein dünner Mann mit einem spitzen glänzenden Gesicht sah überrascht von seinem Schreibtisch auf. Er trug einen ultramarinblauen Anzug aus Polyester und Lackschuhe mit silbernen Schnallen, und sein schütteres geöltes Haar glänzte im Licht der Schreibtischlampe. In einem Holzregal an einer der Seitenwände waren zahlreiche Filmdosen aufgestapelt. Die Überraschung und die Angst wichen sofort wieder aus seinem Gesicht, dann kratzte er sich mit der einen Hand die Wange und nahm die mit einem Filtermundstück versehene Zigarre aus dem Aschenbecher.
„Was wollen Sie, Purcel?“, sagte er gleichmütig.
„Dave, darf ich dir Wesley Potts vorstellen, unsern heimischen Scheißhaufen“, sagte Cletus.
„Ich hab keine Zeit für Ihre Beleidigungen, Purcel. Haben Sie ’nen Durchsuchungsbefehl oder so?“
„Das sagen die doch bloß im Fernsehen, Pottsie“, sagte Cletus. „Siehst du hier irgendwo Fernsehkameras, Dave?“
„Ich sehe keine Fernsehkameras“, antwortete ich.
„Die Typen im Fernsehen sagen immer: ‚Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl‘ oder ‚Sie müssen mir meine Rechte vorlesen‘“, fuhr Cletus fort. „Aber in der Welt der Erwachsenen machen wir das anders. Das solltest du doch wissen, Pottsie.“
„Ich dachte, Sie arbeiten nicht mehr für die Sitte“, sagte Potts.
„Ganz richtig. Ich bin jetzt beim Morddezernat. Mein Partner hier heißt mit Nachnamen Robicheaux. Fängt dir dabei nicht der Sektquirl an zu zittern?“
Der Mann hinter dem Schreibtisch blies Zigarrenrauch vor sich hin und starrte mit stumpfem Blick hinein, aber ich sah, wie sich seine Finger auf der Schreibunterlage verkrampften.
„Dein kleiner Bruder da oben in Angola sagt, du würdest überall rumposaunen, dass Dave hier abgemurkst werden soll“, sagte Cletus.
„Wenn mein Bruder das sagt, dann sollten Sie mit ihm drüber reden. Ich hab keine Ahnung, worum’s geht.“
„Die Leute da oben in Angola haben es nicht so gern, wenn die Bullen ihre Strafgefangenen anhauen. Sie meinen, das wäre schlecht für ihr Image und so“, sagte Cletus. „Aber was zwischen dir und uns läuft, das ist eine ganz andere Kiste, Wes.“
Potts blickte mit kleinen stechenden Augen geradeaus.
„Entspann dich“, sagte Cletus. „Du bist Geschäftsmann, du zahlst Steuern, mit dir kann man reden. Die Sache ist nur die, dass dein Mundwerk Durchfall hat und du Gerüchte in die Welt gesetzt hast, und dass wir nun gern wissen möchten, warum du das getan hast. Wirklich kein großes Ding. Du brauchst uns bloß zu erklären, was es mit diesen komischen Sachen auf sich hat, die wir gehört haben, und dann kannst du weiter deine Perversen unterhalten. Schau dir das Zeug hier an. Große Klasse.“ Cletus fing an, die Filmdosen auf dem Holzregal zu durchstöbern. Er nahm eine Dose in beide Hände und inspizierte mit kritischem Blick das mit Bleistift beschriebene Etikett. „Das hier ist wirklich Pornografie allererster Qualität, Dave. In einer Szene bringt ’n Typ ’n nacktes Mädchen mit ’ner Nagelknarre um. Sie schreit und bittet, aber der Kerl jagt sie durchs ganze Haus und nagelt sie Stück für Stück an die Holzwände.“ Cletus öffnete die Dose, hielt das eine Ende des Films mit den Fingern fest und ließ die Rolle zu Boden fallen. Dann hielt er den Filmstreifen ans Licht. „Das Komische ist bloß, Wes, dass manchmal ein Freier ausflippt und ’ne Nutte abschlachtet, und ich hab das Gefühl, dass dieser Kerl vielleicht kurz davor in deinem Kino sein Popcorn gefuttert hat. Was sagst du dazu?“
„Ich hab mir das Zeug noch nie angesehen. Ich hab keine Ahnung, was drauf ist. Ich bin hier bloß der Geschäftsführer. Dies ist ein Kino, wir haben eine Lizenz, wir haben Notausgänge, wir haben saubere Toiletten, genau wie andere Kinos auch. Wenn Ihnen der Laden nicht gefällt, dann wenden Sie sich an die Leute, die uns die Lizenz gegeben haben.“
Cletus machte sich daran, weitere Filmdosen zu öffnen, die Spulen auf den Boden fallen zu lassen, und während er sich durch die gesamte Länge des Regals vorarbeitete, trampelte er auf den Filmstreifen herum. Bald hatten sich die Filme um seine Schuhe und Knöchel geschlungen.
„Hören Sie auf damit, Sie Mistkerl“, schimpfte Potts.
„Wie hast du eigentlich Zoff mit dem Schatzamt bekommen?“, fragte Cletus.
„Leck mich!“
„Du machst den Strohmann für die Kanaken, hab ich nicht recht?“, sagte Cletus. „Du hast da draußen wahrscheinlich grade mal fünfzehn Besucher, aber du machst ’nen Profit, als hättest du das Rad erfunden. Wie kann das angehen?“
„Ich verkauf ’ne Menge Popcorn.“
„Das ganze Geld aus Koks und Mexenheroin muss schließlich in irgendwelchen Büchern auftauchen“, sagte Cletus. „Die Sache ist bloß die, dass die Jungs vom Finanzamt kurz davor sind, dir den Arsch aufzureißen.“
„Ich seh’ hier niemanden vom Finanzamt. Ich seh’ bloß ein Arschloch in Zivil, das sich aufführt wie ’n Schuljunge“, erwiderte Potts. „Was zum Teufel soll das Theater? Sie kommen hier rein, Sie ruinieren meine Filme, Sie machen mir die Hölle heiß, weil mein kleiner Bruder irgendwas gesagt hat, von dem ich überhaupt nichts weiß, und Sie erzählen mir was von mexikanischem Heroin, wo Sie doch, wenn ich mich recht erinnere, nie jemand wegen ’ner größeren Sache verhaftet haben als vielleicht mal ’nen Fixer mit ’n paar Tütchen Stoff in der Unterhose. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja hier und da ’n bisschen Schmiergeld genommen, als Sie bei der Sitte waren, was? Sie sind ein verdammter Witz, Purcel.“
„Hör dir bloß diesen Kerl an“, sagte Cletus. „Ich glaube, wir müssen uns mal privat mit ihm unterhalten. Die Tür hier führt doch ins Kino, oder? Vielen Dank, hab ich mir gedacht.“
Er öffnete eine kleine Seitentür, hinter der sich der Kinosaal befand, der wie eine umgebaute Garage aussah. Im flackernden Halbdunkel starrten ungefähr ein Dutzend Männer wie gebannt auf die Leinwand.
„Wie läuft’s denn so, ihr Spanner?“, rief Cletus mit lauter Stimme und knipste in schneller Folge das Licht an und aus. „Hier spricht die Polizei von New Orleans. Ich wollte bloß mal kontrollieren, ob auch alles funktioniert. Viel Spaß weiterhin.“
Die Zuschauer erhoben sich eilig aus ihren Sitzen, gingen geschlossen den am weitesten von Cletus entfernten Gang hinunter und verschwanden durch den mit einem Vorhang verhängten Ausgang.
„Tolle Aktion. Dieselben Kerle sitzen heut Abend wieder hier“, sagte Potts.
„Könntest du mich mal ’n paar Minuten mit Wesley allein lassen?“, fragte ich Cletus.
„Hab mir schon gedacht, dass du das vorschlägst“, antwortete er, stapfte gemächlich über die ruinierten Filmstreifen, verließ das Büro und schloss die Tür hinter sich.
Ich setzte mich auf eine Ecke von Potts’ Schreibtisch und faltete die Hände auf dem Oberschenkel.
„Was glauben Sie, wie die Sache ausgehen wird?“, fragte ich ihn.
„Wie meinen Sie das?“
„Genau, wie ich’s gesagt habe. Glauben Sie, Sie können überall rumerzählen, dass jemand mich umlegt, und ich verschwinde einfach wieder von hier?“
Er biss sich auf die Lippen und starrte die Wand an.
„Erzählen Sie mir mal, was Ihrer Meinung nach jetzt passieren wird“, sagte ich.
„Ich weiß nicht. Ich hab Sie nie gesehen. Warum sollte ich rumlaufen und Sachen über Sie erzählen?“
„Wer will mir an den Kragen, Wes?“
„Ich hab keine Ahnung von so was.“
„Sie halten mich wohl für einen Dummkopf?“
„Ich hab keine Ahnung, was Sie sind.“
„Oh, doch, haben Sie. Ich bin der Kerl, von dem Sie meinten, Sie würden ihn nie zu sehen kriegen. Sie hatten nur so ein verschwommenes Bild von mir im Kopf und dachten sich, Sie könnten sich eins lachen, wenn ich umgelegt werde. Dass ich jetzt hier aufgetaucht bin, muss Ihnen vorkommen wie ein böser Traum, stimmt’s?“
„Ich hab doch überhaupt nichts gegen Sie“, sagte er. „Ich betreibe ein legales Geschäft. Ich hab Ihnen noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gemacht.“
„Aber jetzt sitze ich plötzlich hier auf Ihrem Schreibtisch. Das ist so, als würde man aufwachen und hätte einen Geier auf dem Bettpfosten sitzen, nicht wahr?“
„Und was wollen Sie jetzt machen? Den Laden in Schutt und Asche legen und mich fertigmachen? Na, und wenn schon.“
Ich holte mein Puma-Messer aus der Hosentasche und klappte es auf. Mit der Klinge konnte ich einen Barsch filieren wie mit einem Rasiermesser. Sie schimmerte im Schein der Lampe.
„Guter Gott, Mann, was haben Sie vor?“, fragte er.
Ich nahm seine Zigarre aus dem Aschenbecher, legte sie auf den Schreibtisch, schnitt das glimmende Ende ab und steckte den noch warmen Stummel in Potts’ Hemdtasche.
„Den Rest kannst du später rauchen“, sagte ich.
„Was zum Teufel soll das? Sind Sie verrückt geworden, Mann?“ Sein Gesicht war kalkweiß. Er schluckte und starrte mich an, die Augen voller Angst und Verwirrung.
„Du weißt doch, wer Didi Gee ist, nicht?“
„Klar, weiß doch jeder. Warum fragen Sie nach …?“
„Und was treibt er so?“
„Wie meinen Sie das?“
„Ich meine, was er so treibt. Komm schon, raus damit.“
„Alles Mögliche. Huren, Lotteriegeschäfte, Gewerkschaften – das wissen Sie doch!“
„Weißt du was? Wir leisten ihm beim Essen Gesellschaft und ich erzähle ihm, was du mir verraten hast.“
„Was?“
„Er geht jeden Dienstag pünktlich um vierzehn Uhr in das Res taurant von Jimmie the Gent zum Mittagessen. Wir beide werden uns an den Tisch neben ihm setzen und ein wenig mit dem fetten Kerl plaudern. Glaub mir, er wird seine helle Freude an dir haben.“
„Ich geh nicht mit.“
„O doch, das tust du. Du bist verhaftet.“
„Wofür denn? Ich hab gar nichts getan“, sagte er verzweifelt.
„Du hast vorhin was von Asche gesagt. Das klang mir verdammt nach ’nem Bestechungsversuch.“
Seine Blicke zuckten aufgeregt hin und her. Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn.
„Ich hab ‚Schutt und Asche‘ gesagt. ‚In Schutt und Asche legen‘.“
„Vielleicht bin ich schwerhörig. Wie dem auch sei, ich werde noch mal drüber nachdenken, während wir zum Restaurant rübergehen. Glaubst du eigentlich diese Geschichte mit Didi Gees Aquarium voller Piranhas? Ich hab gehört, er hat mal die Hand von einem dieser Leute von der Transportarbeitergewerkschaft ’ne volle Minute da hineingehalten. Aber vielleicht ist das auch nur eine dieser albernen, übertriebenen Geschichten, die man der Mafia nachsagt. Streck mal die Hände aus, ich will dir Handschellen anlegen. Du kannst ja deinen Mantel über den Arm legen, wenn’s dir peinlich ist, so gesehen zu werden.“ „Hören Sie, darauf fall ich nicht rein. Sie treiben doch ein Spielchen mit mir.“
„Du hast das Blatt ausgeteilt, Wes. Jetzt musst du’s auch ausspielen. Aber jetzt streck erst mal die Hände aus, sonst schlag ich dir deine verdammte nichtsnutzige Fresse ein.“
Er atmete jetzt laut, seine Hände waren auf der Schreibunterlage zu Fäusten geballt.
„Hören Sie, Lieutenant, ich hab bloß gehört, wie ’n paar andere Jungs was erzählt haben. Meistens protzen die bloß so rum, und normalerweise steckt gar nichts dahinter. Jedenfalls hab ich’s nicht von Mr. Segura gehört. Haben Sie mich verstanden? Es kam nicht von Mr. Segura. Es ist bloß Gerede. Ein paar Burschen, die auf der Straße rumalbern und Quatsch erzählen.“
„Du meinst den Kolumbianer?“
„Er ist aus Nicaragua.“
„Sprich weiter.“
Er wischte sich mit der Hand über den Mund und zog dann mit den Fingern an der Hautfalte unter seinem Kinn.
„Es hat irgendwas zu tun mit ’nem Niggermädchen. Ich glaub, sie war mal Straßennutte. Haben Sie nicht vor kurzem ’ne Niggerin aus dem Bayou gezogen, drüben in Cataouatche?“
„Erzähl mir einfach alles, was du weißt.“
„Guter Gott, Lieutenant, wofür halten Sie mich eigentlich? Ich bin bloß ein kleiner Kinobesitzer. Also, einmal im Monat oder so lädt Mr. Segura ’nen Haufen Leute in sein Haus da draußen am See ein. Es gibt ein Büfett, ’nen Haufen Schnaps, ’n paar Nutten im Swimmingpool. Er schüttelt allen die Hand, trinkt vielleicht ’nen Tom Collins mit uns oder spielt ’n paar Minuten Karten unter einem dieser Gartenschirme, dann verschwindet er irgendwo im Haus.“
„Was hatte dieses Mädchen bei Julio Segura zu suchen?“
„Sie haben mich nicht verstanden, Lieutenant. Das sind Dinge, über die er nicht mit mir spricht. Ehrlich gesagt, spricht er überhaupt nicht viel mit mir. Hören Sie, der Kerl ist echt ein großer Fisch. Ich glaub, er hat Beziehungen zu den ganz großen Leuten. Warum wollen Sie sich mit ihm anlegen? Für solche Typen ist doch die Bundespolizei zuständig.“
Ich starrte ihn einfach weiter schweigend an. Seine Hände auf der Schreibunterlage zuckten, als ob sie an einem Faden hingen.
„Es heißt, Sie machen ’ne große Sache draus, dass Sie in ’nem andern Bezirk ein Niggermädchen gefunden haben“, erzählte er weiter. „Das ist nicht Ihr Revier, und deshalb fragt man sich, warum Sie sich so dafür interessieren. Aus irgendeinem Grund sind die der Meinung, Sie wären hinter ihnen her. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich mag nicht mal in der Nähe sein, wenn drüber geredet wird. Ich hau dann immer ab. Das ist die Wahrheit, bei Gott.“
„Du machst mir wirklich Sorgen, Wes. Ich mach mir so meine Gedanken über deine Ehrlichkeit. Außerdem hab ich den Eindruck, du hältst dich für allwissend.“
„Hä?“
„Sag’s mir, wenn ich falsch liege. Ich glaube, du rechnest dir ziemlich genau aus, was ich akzeptiere und was nicht. Du meinst, du kannst mich an der Nase rumführen und mir irgendwelche Märchen erzählen und dir dann ein paar Lines reinziehen, wenn ich wieder weg bin, und deine Nerven beruhigen, und damit ist die Welt wieder in Ordnung. Das lässt darauf schließen, dass du ein relativ großes Problem mit Eitelkeit und Stolz hast. Was meinst du?“
„Hören Sie …“, setzte er an, ein Lächeln um den Mund, den Blick scheinbar unterwürfig gesenkt.
„Nein, nein, jetzt hört Wes mal zu, und ich rede. Weißt du, wenn man sein Maul aufreißt und damit angibt, dass ein Polizeibeamter umgelegt werden soll, dann halst man sich schnell ein paar gefährliche Komplikationen auf. Erstens macht dich die Tatsache, dass du davon weißt, zu einem Mitschuldigen, Wes. Und zweitens gibt es, um’s mal einfach auszudrücken, ein paar Männer, mit denen ich zusammenarbeite und die dich ganz einfach kaltstellen würden. Verstehen wir uns in diesem Punkt?“
„Ja“, antwortete er unsicher.
„Keine Missverständnisse?“
„Nein.“
„Also gut, Wes. Wir werden uns später noch mal drüber unterhalten. Du verstehst doch, was das heißt, oder?“
„Jawohl.“
Ich erhob mich von seinem Schreibtisch und ging zur Tür. Hinter mir konnte ich ihn tief aufatmen hören.
Dann plötzlich: „Lieutenant?“
Ich drehte mich um und sah ihn an. Sein Gesicht wirkte schmal und blass.
„Wird Mr. Segura von unserer Unterhaltung erfahren?“, fragte er. „Ein paar von den Latinos, die für ihn arbeiten … grausame Jungs … die waren früher mal Bullen oder Nationalgardisten oder so was in Nicaragua … Mir wird ganz anders, wenn ich dran denke, was die machen.“
„Keine Garantien, Wes. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas in der Luft liegt, dann komm zu uns, und wir schaffen dich aus der Stadt.“
Draußen brannte die Sonne. Auf der anderen Straßenseite, im Schatten der eisernen Kolonnaden, führten drei schwarze Jungen einen Stepptanz für die Touristen auf. Die klobigen Platten, die sie an den Schuhen hatten, klangen wie Trommelstöcke auf Metall. Cletus stand im Schatten und sah zu, die Jacke über den Arm gehängt. „Na, was rausgekriegt aus dem alten Pottsie?“
„Es hat was mit dem schwarzen Mädchen zu tun, das ich drüben im Bayou Lafourche gefunden habe. Es riecht nach Dope und den Barataria-Piraten. Hast du bei der Sitte irgendwann mal mit Julio Segura zu tun gehabt?“
„Kann man wohl sagen. Der Typ ist der Inbegriff von ’nem Schmalzkopf. Dem kommt die Pomade aus jeder Pore.“
„Ich dachte, er sei Kolumbianer.“
„Er steckt mit denen unter einer Decke, aber er ist aus Managua. Ich hab gehört, dass ihm da unten so ungefähr hundert Puffs gehört haben sollen. Es heißt, die Sandinisten haben sein Flugzeug völlig durchsiebt, als die Maschine grade abgehoben hatte. Der Kerl ist ein Überlebenskünstler. Wir haben zwei- oder dreimal vergeblich versucht, ihm was anzuhängen. Ich glaube, er hat ’n paar Leute von ganz oben auf seiner Seite.“
Wir spazierten im warmen Schatten zurück zur Royal Street und zum Wagen, den wir vor der Oyster-Bar abgestellt hatten. Unterwegs ging ich in einen dieser kleinen, dunklen Lebensmittelläden mit einem riesigen hölzernen Ventilator unter der Decke und kaufte mir eine Times-Picayune. Im Innern des Ladens roch es nach Bananen, Kaffee, großen Käsestücken und riesigen Holzkästen voller Rosinen und getrockneter Pflaumen. Im Weitergehen schlug ich den Sportteil der Picayune auf.
„Hast du Lust, heut Abend mit mir zum Rennen zu gehen?“, fragte ich.
„Vergiss die Rennen. Greifen wir uns den Kanaken. Wir sagen dem Captain vorher Bescheid, und dann fahren wir zu seinem Haus und ziehen ihm ein bisschen am Schlips.“
„Nee. Zu früh.“
„Quatsch. Diesen Jungs muss man sofort auf den Sack treten, das ist die einzige Art, wie man mit denen fertig wird. Und was diesen Fall betrifft, so soll er kapieren, dass das ’ne persönliche Sache ist. Wir stellen ihm die Glückwünsche direkt im Wohnzimmer zu.“
„He, ich weiß es zu schätzen, Clete, aber ich sag dir Bescheid, wenn’s Zeit zum Loslegen ist. Keine Sorge, du wirst die Party nicht verpassen.“
„Du nimmst das alles viel zu leicht. Ich sag dir, dieser Typ ist echt kein Mensch. Im Vergleich zu dem wirkt Didi Gee fast wie der Erzbischof.“
„Verdammt“, sagte ich.
„Was ist?“
„Nächstes Mal nehmen wir dein Auto, wenn wir essen gehen.“
„Warum?“
„Weil sie meinen Wagen grade abschleppen.“
Ein sanftes, weiches Licht lag über dem See, als ich mich am Abend auf meinem Hausboot anzog. Am Ufer sah ich die Palmen und Zypressen in der Brise schwanken, die vom Golf herüberwehte. Es roch wieder nach Regen. Ich fühlte mich ziemlich alleine, aber zugleich auch gelöst, und ich fragte mich, ob dieses Gefühl von Selbstsicherheit und Ruhe, von innerer Gelassenheit, nicht nur ein trügerisches Vorspiel für eine weitere turbulente Phase meines Lebens war. Vielleicht war es so etwas wie ein kurzfristiger Anfall von Narzissmus. Mein Körper war immer noch schlank und kräftig und meine Haut sonnengebräunt, und die alte Narbe von dem mit Mist beschmierten Pungi-Stock sah aus wie eine auf meinen Bauch tätowierte, seltsame graue Schlange. Mein Haar und mein struppiger Schnurrbart waren immer noch schwarz wie Tinte, abgesehen von einem kleinen weißen Fleck über dem einen Ohr, und ich redete mir jeden Morgen vor dem Spiegel ein, die Tatsache, dass ich alleine lebte, habe ebenso wenig mit Alter und Versagen zu tun wie mit Jugend und Erfolg. Die dunkelvioletten Wolken, die sich am südlichen Horizont über dem Golf aufgetürmt hatten, wurden von Wetterleuchten durchzuckt.
An diesem Abend saß ich ganz allein in einer Loge beim Pferderennen und schaute ebenso entspannt wie fasziniert auf die hell erleuchtete Rennbahn, die sorgfältig angefeuchtete und geharkte Grasnarbe, den schimmernden, kurzgemähten Rasen auf dem Innengrün. Es war die gleiche unbestimmte, beinahe lähmende Euphorie, die ich immer empfunden hatte, wenn ich nach einer zweitägigen Sauftour sanft ins Delirium tremens abrutschte. Ich war plötzlich allwissend. Mein weißer Tropenanzug leuchtete im Licht der Bogenlampen über mir. Ich holte mir das Geld für meine drei Platzwetten und zwei Gewinne nacheinander ab. Die Kellnerinnen im Clubhaus, alle mit einem pfirsichfarbenen Teint, brachten mir geschälte Shrimps auf Eis sowie eine Portion Hummer und Steak und streiften absichtlich mit ihren Hüften meinen Arm, als sie meine schmutzige Serviette und den blutverschmierten Teller abräumten.
Irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass das, was sich ein Spieler am meisten wünscht, nämlich in die Zukunft sehen zu können, uns alle in den Wahnsinn treiben würde. Als ich an diesem warmen Sommerabend nach Hause zurückfuhr und sah, wie der Mond sich auf der Wasserfläche des Sees spiegelte und die Glühwürmchen in den Palmen und Eichen leuchteten, da fühlte ich ein leichtes Zittern in mir, wie das leise Klirren von Kristall oder die fast unhörbaren Resonanzen von mitschwingenden Gitarrensaiten – ein Hauch von Kassandras tragischer Gabe, und ich war geneigt, das Gefühl auf meine alten Alkoholikerängste zurückzuführen, die in meinem Unterbewusstsein herumwühlten wie blinde Schlangen. Aber einer, der auf der Rennbahn gewonnen hat, schert sich nicht um Vorsicht oder Ahnungen im Mondschein.
2
Am nächsten Morgen verließ ich in aller Frühe New Orleans in südwestlicher Richtung und fuhr ins Bayou Country. Hier, im Süden Louisianas, in der Nähe von New Iberia, war ich aufgewachsen. Eichen, Zypressen und Weiden säumten die zweispurige Landstraße. Der Nebel hing noch wie zerrupfte Watte in den halb im Wasser stehenden toten Bäumen des Marschlandes, und das dichte Röhricht leuchtete intensiv grün in der Sonne. Am Ufer des Bayous wucherten Kolonien von Lilien, die Blätter benetzt mit quecksilbrigen Tröpfchen und von Blüten übersät, die deutlich hörbar aufsprangen. Die Brassen und Barsche waren noch auf Futtersuche im schattigen Wasser nahe den Wurzeln der Zypressen. Ein Stück weiter, wo die Sonne bereits über die Baumwipfel geklettert war, nisteten Silberreiher im Sand, und hin und wieder erhob sich ein Graureiher von seinem Futterplatz dicht bei den Rohrkolben und schwebte mit vergoldeten Schwingen das lange Band des braunen Wassers entlang durch die Schneise im Gehölz.
Jetzt waren diese Bayous, Kanäle und Sümpfe, in denen ich meine Jugend verbracht hatte, das Revier der Barataria-Piraten. Im Vergleich zu ihnen waren ihre Namensvettern, jene Bande von Briganten und Sklavenhändlern, die Jean Lafitte einst um sich geschart hatte, beinahe schon romantische Figuren. Die heutigen Piraten setzten sich aus Marihuana-, Kokain- und Heroinschmugglern zusammen, die da draußen auf dem Golf ohne Skrupel eine unschuldige Familie umbrachten, um mit ihrem Boot eine einmalige Lieferung an Land zu bringen und es danach durch Öffnen der Seeventile zu versenken. Manchmal fand die Küstenwache eines dieser Boote halb voll Wasser irgendwo auf einer Sandbank gestrandet, das Deck blutverschmiert. Aber was war daran schon schockierend oder abstoßend? Die gleichen Leute brachten es fertig, ein Kleinkind mit einer Injektion zu töten, den Leichnam zu konservieren und ihm den Bauch mit Heroinbeuteln zu füllen. Dann gingen weibliche Kuriere damit unbehelligt durch den Zoll, als trügen sie ihr schlafendes Kind auf dem Arm.
Der Sheriff des Bezirks Cataouatche war nicht im Gerichtsgebäude, sondern auf seiner Pferderanch außerhalb der Stadt. Er hatte Gummistiefel an den Füßen und fütterte gerade zwei Vollblutaraber, die auf einer kleinen, abgetrennten Koppel standen. Das frisch geweißte Wohnhaus besaß eine breite, mit Fliegendraht geschützte Veranda. Rings um das Haus standen Azaleen und flammend rote Hibiskusbüsche. Ein lang gestreckter weißer Zaun, mit Kletterrosen überwachsen, umgrenzte die Pferdekoppeln. Der Sheriff war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, der seinen Besitz und seine politische Karriere im Griff hatte. Seine blaue Uniform saß eng auf dem kompakten, muskelharten Leib, und sein rundliches, frisch rasiertes Gesicht mit den direkt blickenden Augen vermittelte den Eindruck eines selbstsicheren ländlichen Polizeichefs, der leicht mit allen Schwierigkeiten von außerhalb fertig wurde.
Zu seinem Leidwesen erwies ich mich als die Ausnahme von der Regel.
„Sie ist ertrunken“, sagte er. „Meine Deputys haben berichtet, dass ihr ein Eimer Wasser aus der Lunge lief, als sie sie von der Bahre nahmen.“
„Sie hatte Einstichspuren an den Armen.“
„Na und? Auch Süchtige ertrinken. Brauchen Sie eine Autopsie, um das festzustellen?“
„Wissen Sie vielleicht, ob sie rechtshändig oder linkshändig war?“
„Wovon, zum Teufel, sprechen Sie?“, antwortete er.
„Sie hatte sich offenkundig regelmäßig in den linken Arm gespritzt, aber an ihrem rechten Arm war nur ein einziger Einstich zu sehen. Das müsste Ihnen doch was sagen.“
„Das sagt mir, verdammt noch mal, überhaupt nichts.“
„Wenn ein Fixer die Vene im einen Arm ramponiert hat, nimmt er den anderen. Aber ich glaube nicht, dass das Mädchen schon so lange an der Nadel hing. Ich schätze, jemand hat ihr einen goldenen Schuss verpasst.“
„Der Leichenbeschauer des Bezirks hat den Totenschein ausgestellt. Darin heißt es, dass sie ertrunken ist. Wenden Sie sich an ihn, wenn Sie die Sache wirklich weiterverfolgen wollen. Ich habe zu arbeiten, bin schon spät dran.“ Er verließ die Pferdekoppel, zog sich auf dem Rasen die schmutzigen Gummistiefel aus und stieg in seine polierten halbhohen Stiefel. Ich konnte sein rundes Gesicht nicht sehen, als er sich vornüber bückte, aber ich hörte die mühsam unterdrückte Wut in seinen Atemzügen.
„Das sind wirklich sehr schöne Araber“, sagte ich. „Ich kann mir vorstellen, dass die gut dreißigtausend Dollar bringen, wenn sie eingeritten sind.“
„Das würde bei weitem nicht reichen, Lieutenant. Wie ich schon sagte, ohne unhöflich sein zu wollen, aber ich bin spät dran. Möchten Sie, dass ich Sie mit dem Leichenbeschauer bekannt mache?“
„Ich glaube nicht. Aber sagen Sie mir, nur interessehalber, wie, glauben Sie, kann eine gesunde junge Frau, die ihre sämtlichen Kleider anhat, in einem schmalen Bayou ertrinken?“
„Wie hätten Sie’s denn gern, Lieutenant? Wollen Sie eine schriftliche Bestätigung, dass sie an einem goldenen Schuss gestorben ist? Möchten Sie diese Bestätigung mit nach New Orleans nehmen? Also gut, meinetwegen. Uns kratzt das nicht. Aber was ist mit ihrer Familie? Die Kleine ist auf einer Zuckerrohrplantage etwa acht Kilometer von hier aufgewachsen. Ihre Mutter ist geistesschwach, ihr Vater halb blind. Wollen Sie vielleicht zu denen rausfahren und ihnen erklären, dass ihre Tochter eine Fixerin war?“
„Das Ganze stinkt doch geradezu nach Mord, Sheriff.“
„Lassen Sie mich nur noch zwei Dinge sagen, Kollege, und ich möchte, dass Sie das richtig verstehen. Ich vertraue auf das, was meine Deputys mir sagen, und wenn Sie sich beschweren wollen, dann gehen Sie gefälligst zum Leichenbeschauer. Und zweitens: Unsere Unterhaltung ist beendet.“
Er schaute zu seinen Pferden weit draußen auf der Koppel, als wäre ich überhaupt nicht da, setzte sich seine Pilotensonnenbrille auf, stieg in seinen Cadillac und fuhr die kiesbestreute Auffahrt zum Highway hinunter. Ich kam mir vor wie ein Zaunpfahl.
Der Name des toten Mädchens war Lovelace Deshotels. Ihre Eltern lebten in einer der verwitterten, ungestrichenen Hütten an einer kleinen unbefestigten Nebenstraße hinter einer der Zuckerrohrplantagen eines großen Konzerns. Die Hütten sahen alle gleich aus. Die kleinen überdachten Veranden bildeten eine so gerade Linie, dass man einen Pfeil durch die gesamte Reihe hätte schießen können, ohne irgendwo Holz zu treffen. Die satten grünen Zuckerrohrfelder erstreckten sich kilometerweit und wurden nur von ein paar einzeln stehenden Eichen und der Silhouette der entfernten Zuckerfabrik unterbrochen, deren Schlote die Hütten im Winter mit einem eklig süßen Gestank umgeben würden, bei dem einem die Augen tränten.
Die Hütte sah aus wie tausend andere, die ich mein Leben lang überall in Louisiana und Mississippi gesehen hatte. Die Fenster besaßen keine Scheiben, sondern nur Läden aus Brettern, die oben an Scharnieren befestigt waren und mit Hilfe eines Stockes hochgestellt werden konnten. Die Wände waren mit dem Papier eines Versandhauskatalogs ausgestopft und dann mit Tapete überklebt, die sich nun bereits löste und mit braunen Wasserflecken übersät war. Neben einem kleinen Schweinekoben stand das Klohäuschen, mit einem rostigen alten Reklameschild für R.C. Cola als Dach.
Aber es gab noch andere Dinge, die einem ins Auge sprangen, wenn man ins Haus trat: ein Farbfernseher, eine nachgemachte Kuckucksuhr über dem mit Holz beheizten Ofen, Plastikblumen in Marmeladengläsern, ein leuchtend gelber, mit Resopal beschichteter Frühstückstisch neben einem uralten gemauerten Kamin, der mit Müll vollgestopft war.
Die Eltern erzählten mir nur wenig. Die Mutter starrte ständig mit leerem Blick auf die Gameshow im Fernsehen. Ihr massiger Körper steckte in limettengrünen Stretchhosen und einem alten Herrenoberhemd mit abgetrennten Ärmeln. Der Vater war grauhaarig und alt und ging am Stock, als habe er einen Wirbelschaden. Er roch streng nach der Maiskolbenpfeife, die er in der Hemdtasche trug. Seine Augen waren verhornt und getrübt vom grauen Star.