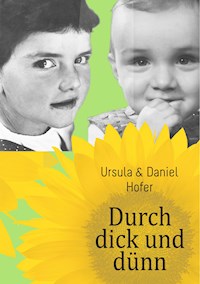
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit vierzig Jahren gehen Daniel und ich gemeinsam durchs Leben, seit 34 Jahren sind wir verheiratet. Vor ungefähr zehn Jahren, als mein Mann die Bundesverfassung wieder einmal las, hatte er die Idee, auch für unsere Ehe eine «Verfassung» zu erstellen. Der Schluss lautete so: Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Warum daraus nicht einen Buchtitel machen? Im Buch enthalten sind Geschichten aus Daniels und meiner Kindheit, unsere Beziehung, die Heirat und das Leben im Südtirol bis zur Geburt der jüngsten Tochter Livia in Stammheim.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Dä Daneli
Ein großer Verlust
Die Schule
Ferien
Lehre, Glaube, Beruf
S’ Urseli
»Ach du, mit deinem Geißberg!«
Die Hostie
Familienleben
Schulkarriere
Oberseminar und die Liebe
Hochzeit und Südtirol
Perugia
Menschen in Südtirol
Joels Geburt und zurück zu den Wurzeln
Stammheim und s Nachzügerli
VORWORT
Als ich das Buch »Tragen und Getragen« fertig hatte, bekam ich bald wieder Sehnsucht weiterzuschreiben. Ich wollte mich nicht erneut an ein schweres Thema wagen und entschied mich, Erlebnisse aus meiner Kindheit zu schildern. Wenn ich sie Daniel vorlas, amüsierte er sich köstlich und ermutigte mich weiterzumachen. Irgendwann stand der Entschluss fest, die Geschichten aneinanderzureihen und daraus ein Buch entstehen zu lassen. Im Dezember letzten Jahres hatte ich den Text bis zur und mit der Geburt von Livia geschrieben.
Da wir dieses Jahr beide sechzig Jahre alt werden, steckte ich mir das Ziel, das Buch bis zu unserem runden Geburtstag fertig zu haben. Aber ein wichtiges Kapitel fehlte noch: Daniels Kindheit. Er nahm seine Erinnerungen auf Band auf; und das Formulieren und Zusammenstellen überließ er mir.
Die Geschichten entsprangen unserer Erinnerung. Und das ist etwas ganz Eigenes. Es kann sehr gut sein, dass unsere Geschwister oder Eltern, aber auch Freunde die eine oder andere Situation anders erlebt haben. Bei Erinnerungen bringt es nichts, von falsch und richtig zu reden. Jede Geschichte hat ihre Berechtigung und soll so, wie sie ist, stehengelassen werden.
Seit vierzig Jahren gehen Daniel und ich nun gemeinsam durchs Leben, seit 34 Jahren sind wir verheiratet. Vor ungefähr zehn Jahren, als mein Mann die Bundesverfassung las, hatte er die Idee, dass wir eine »Eheverfassung« erstellen könnten. Der Schluss lautete so:
Lebensziel: Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Warum daraus nicht einen Buchtitel machen?
Das Buch ist ein Dankeschön an euch alle, die ihr mit uns ein Stück Weg gegangen seid und immer noch geht.
Dani und Ursi
DÄ DANELI
G eboren wurde ich am 22. September 1959 von meiner Mutter in der Pflegerinnenschule in Zürich, glaube ich. Als dritter Sohn. Da war noch der Ernst, sieben Jahre älter, und Martin, drei Jahre älter.
Meine Eltern hatten Freude, dass nochmals ein Bub kam. So wurde es mir erzählt. Auch dass ich immer gestrahlt und gelacht hätte, hieß es.
Aber meine Geschichte beginnt ja nicht mit mir. Da sind auch noch die Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits. Die Eltern meines Vaters kamen um 1920 nach Dietikon. Sie hatten mit finanzieller Hilfe der Familie meiner Großmutter einen Bauernhof in der Silberen übernehmen können. Er lag außerhalb des damaligen Dorfes. Heute ist Dietikon eine Stadt und den Bauernhof findet man nicht mehr: Er musste der Autobahn von Zürich nach Bern weichen. An den Namen erinnert nur noch das Industriegebiet und Einkaufszentrum Silbern. Das zweite E ging verloren.
Der Hof war heruntergewirtschaftet und die Gebäude in keinem guten Zustand. Die vier Kinder mussten alle mitanpacken, sobald sie groß genug waren. Mein Vater, Kurt, wurde 1926 als Zweitältester geboren. Er erzählte mir, dass er in jeder freien Minute mithelfen musste. Früh am Morgen nach dem Melken machte er sich auf den weiten Weg in die Schule nach Dietikon, natürlich zu Fuß. Kam er am Mittag nach Hause, konnte es sein, dass er noch rasch bei der Kartoffelernte half, bevor er wieder in die Schule musste. Im Sommer kam die Heuete und Emdete dazu, im Winter die Arbeit im Wald. Das war keine einfache Zeit, weder für die Großeltern noch für meinen Vater und seine Geschwister. Doch sie schafften es, sich eine Existenz aufzubauen. Da habe ich große Achtung vor meinen Großeltern und auch vor meinem Vater, der sie unterstützte.
Da er das Ziel hatte, den Hof zu übernehmen, besuchte mein Vater die landwirtschaftliche Schule. Bald lernte er »s Martheli« kennen – soviel ich weiß, an einem Trachtenabend. Meine Mutter war immer wieder krank. Mal hatte sie Gallenprobleme und konnte nicht alles essen, was sie wollte, mal machte ihr etwas anderes zu schaffen. Ihre schwache Konstitution war auch der Grund, dass Vater den Bauernhof nicht übernahm. Martha hätte ihn nicht in dem Maß, wie es notwendig gewesen wäre, unterstützen können. Bald wurde ihm die Försterstelle in Dietikon angeboten. Er sagte gerne zu und stieg mit seiner Erfahrung im Holzen als Bauer in diesen Beruf. Es gab damals keine Ausbildung zum Förster. Was er noch brauchte an Wissen und Können, eignete er sich in Holzerkursen an.
Meine Großmutter mütterlicherseits war auch aus Dietikon. Sie war im unteren Fahr aufgewachsen, nahe der Silberen. Ihre Eltern besaßen einen Gasthof mit Fährbetrieb über die Limmat, und da sie eine gute Fischküche hatten, sprach man im Dorf nur von »Fisch-Bachmes«. Das »Fahr« war bis zum Zweiten Weltkrieg die nächstgelegene Telefonstation des Flugplatzes Spreitenbach, den es in der Nähe gab. Wenn ein Anruf für den Flughafen kam, musste ein Meldefahrer die Botschaft übermitteln, wieder zurückkehren und die Antwort melden.
1920 verkauften die Eltern die Wirtschaft und erworben ein Haus an der Neumattstraße 15. Im gleichen Jahr heiratete meine Großmutter Ernst Ungricht, der von allen der »Grachappi« genannt wurde. Er besaß einen Bauernhof an der Bühlstraße mitten in Dietikon. Als das Dorf wuchs, konnte er Land verkaufen und mit dem Geld Mehrfamilienhäuser bauen. 1960 hörten sie mit Bauern auf, da es wegen der großen Bautätigkeit immer weniger Boden für die Landwirtschaftsnutzung hatte. Land, das sie gebraucht hätten, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Mein Großvater hat nie einen Traktor gekauft, sondern bis zum Schluss mit Rossen gearbeitet.
Wie ihre Eltern konnte auch meine Großmutter sehr gut kochen. Ihre Fischgerichte waren ein Traum. Bei ihr gab es sogar Aal zu essen. Sie war eine lebendige, offene Persönlichkeit. 1930 gründete sie den Trachtenverein in Dietikon und ist noch heute als Verfasserin von volkstümlichen Gedichten und Theaterstücken bekannt. Aus Erzählungen meiner Tante Margrit weiß ich, dass während der Kriegszeit ihre Haustür immer offen war und Soldaten bei ihnen übernachteten. Das Feuer im Herd sei nie erloschen, damit zu jeder Zeit eine Suppe oder sonst etwas Essbares für Bedürftige oder die Soldaten gekocht werden konnte. In diesem Rahmen wuchs also s Martheli, meine Mutter, an der Bühlstraße auf. Ihr Geburtshaus steht immer noch, da es unter Heimatschutz gestellt wurde. Martha war die älteste von zwei Töchtern. Ihre Schwester hieß Margrit und war vier Jahre jünger. Nach der Schulzeit machte sie ein Welschlandjahr und arbeitete eine Zeitlang auswärts. Doch in der Regel half sie zu Hause auf dem Hof, bis sie meinen Vater heiratete.
Als Vater und Mutter 1952 heirateten, konnten sie das renovierte und mit einer neuen Küche ausgestattete Haus an der Neumattstraße 15 beziehen. Luxus wie eine Waschmaschine, ein Kühlschrank und ein Rotormixer gehörte auch dazu. Sonst war alles alt. Heizen mussten sie mit Holz. Doch nur im Wohnzimmer war es in der Regel warm. In meinem Zimmer stand schon ein kleiner elektrischer Ofen, aber der wurde kaum gebraucht, weil der Strom damals sehr teuer war. Das Zimmer von Martin war das kälteste im ganzen Haus. Dort konnte man nichts machen, da war man einfach und fror oder schlüpfte unter die schwere Bettdecke. Jeden Abend füllte Mutter drei Bettflaschen mit heißem Wasser, damit wir wenigstens die Zehen wärmen konnten.
Einer unserer Nachbarn war die Firma Planzer. Wenn die schweren Lastwagen vorbeifuhren, zitterte das ganze Haus. Ebenso, wenn der Zug Zürich–Bern – gegenüber unserem Haus – vorbeibrauste, bebten die Wände. Beim Elf-Uhr-Zug am meisten. Das war der TEE-Zug (Trans-Europ-Express) nach Amsterdam.
Am allerschlimmsten waren aber die Flugzeuge. Wenn eine Caravelle oben vorbeiflog und ihre schwarzen Streifen am Himmel zog, war es so lärmig, dass wir die Stimme des anderen nicht mehr verstanden und das Geschirr auf dem Tisch schepperte.
Mein liebster Ort war die Stube. Da spielte ich nach Herzenslust. Mal mit der Briobahn, mal mit Legos. Zu Weihnachten bekam ich manchmal kleine Autos geschenkt, die mit einem Elektromotor fuhren. Sie waren aber nicht lange ganz. Ich zerlegte sie in alle Einzelteile. Mit dem Motor, einer Batterie und einem meiner eigenen Legoautos bastelte ich so lange, bis das Auto fuhr. Noch heute erinnere ich mich an den Stolz, den ich beim Gelingen fühlte. Sehr gerne hielt ich mich auch in der Werkstatt auf. Da zimmerte ich zum Beispiel Garagen aus Holz für meine Autos zusammen.
Als ich einmal bei meinem Götti in den Ferien war, lernte ich einen Bumerang zu basteln. Als ich nach Hause kam, beschloss ich ein Bumerang-Geschäft aufzutun. Ich sägte, feilte und lackierte tagelang, bis ich zehn Stück hergestellt hatte. Ein Bumerang kostete fünf Franken und meine Kollegen kauften sie mir tatsächlich ab.
Meine Brüder und ich sammelten auch Briefmarken. Stundenlang studierte ich den Zumstein-Katalog, verglich meine Briefmarken mit den abgebildeten und wusste so genau, was jede einzelne wert war. Am freien Nachmittag traf ich mich mit meinen Schulkollegen und wir zeigten unsere Schätze, feilschten und tauschten, jeder natürlich mit dem Ziel, sich einen Vorteil zu verschaffen.
Einmal schnitt ich aus einem Katalog eine Züri-4- und Züri-6-Marke aus. Das sind die ersten Marken, die es im Kanton Zürich gab, sogar noch ohne Zacken. Ich klebte sie auf einen Briefumschlag und schwärzte ihn so lange, bis er alt aussah. »Werden meine Kollegen darauf hereinfallen?«, fragte ich mich. Am nächsten freien Nachmittag traf ich mich mit Thomas.
Er stürzte sich sofort auf den Brief und meinte: »Wo hast du den her? Ist der echt?«
Ich tat so, als hätte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung.
»Gibst du mir diesen Brief? Du kannst dafür zehn Marken von mir haben«, sagte er.
»Ja, weißt du, ich möchte ihn lieber für mich behalten«, antwortete ich ihm.
Thomas biss an. Jetzt hatte ich ihn an der Angel!
»Ich gebe dir noch zwanzig Marken dazu!«
Wir verhandelten so lange, bis ich die Hälfte seiner Schätze in der Hand hielt. Stolz trug er seinen »wertvollen« Besitz nach Hause.
Am Abend klingelte das Telefon. Ich hörte, wie mein Vater sich mit »Hofer« meldete. Dann sagte er lange nichts mehr und meinte dann: »Ja, das ist nicht in Ordnung. Ich werde dafür sorgen, dass Daniel die Marken zurückgibt.«
Natürlich musste ich Thomas alles zurückgeben und mich bei ihm entschuldigen. Ob es vom Vater auch noch eine Strafe gab, weiß ich nicht mehr.
Häufig kamen die guten Ideen, wenn ich schlief. Einmal wollte ich unbedingt Fallschirmspringen. Ich nahm aus dem Kasten ein weißes Leintuch und kletterte auf den Nussbaum. Ich stellte mich auf einen dicken Ast und hielt das Leintuch an zwei Ecken fest. Eins, zwei, drei und los ging der Flug. Kurz war er und die Landung ziemlich schmerzhaft.
Mit Martin und Ernst zusammen baute ich eine Seifenkiste mit Kugellager! Warum nicht ein Segel aufspannen, damit die Kiste von alleine fährt? Ich holte wieder mein Leintuch, bastelte ein Gestell zusammen, um das Segel aufzuhängen, und setzte mich voll Erwartung in die Seifenkiste. Schon sah ich mich in einem Karacho durch die Straße flitzen. Doch das Leintuch hing schlapp im Gestell und nichts bewegte sich. Auch mit Wind funktionierte das Ganze nicht.
Unser Garten beim Haus war prädestiniert für Erlebnisse aller Arten. Meistens trafen sich die Kinder der ganzen Nachbarschaft bei uns. Wir spielten Fußball, organisierten Olympiaden im Sommer wie im Winter. Vom Sommer weiß ich nur noch, dass wir zum Beispiel über Heuhaufen springen mussten, über die »Schöchli« oder mit unseren selbergebastelten Pfeilbogen auf eine Zielscheibe schossen. Im Winter gab es damals ziemlich viel Schnee. Einmal entstand eine riesige Schneehütte.
Mit Kisten bauten wir Türme, bepflasterten sie mit Schnee und fuhren mit Ski oder dem Schlitten die Schanzen hinunter. Einmal wollte ich für eine Olympiade auch ein Eisfeld herstellen. Ich stampfte den Schnee auf einem Viereck, bis es eine Fläche gab, bespritzte sie mit Wasser und hoffte, dass sie gefrieren würde. Aber die Arbeit war vergebens. Es klappte nicht. Aber wir hatten den Marmoriweiher, der am Rand von Dietikon lag. Sobald die Eisschicht dick genug war, konnten wir dort nach Herzenslust Schlittschuh laufen und Eishockey spielen. Wenn Schnee lag, mussten wir das Eis zuerst selber freischaufeln. Da wir auch keine Schläger hatten, bastelten wir sie uns selber: Ein langer Stecken, unten ein Brett so hingenagelt, dass das Ganze wie ein richtiger Eishockeyschläger aussah, und los ging der Spaß. Mit blaugefrorenen Füßen, aber von ganzem Herzen zufrieden, kehrten wir beim Eindunkeln von unseren Schlachten nach Hause zurück.
Wir drei Brüder bekamen als Kinder große Freiheiten zugestanden. Dietikon war noch ein Dorf. Ich hatte das Gefühl, alle zu kennen. Die Großeltern und Verwandten waren zu Fuß erreichbar. Die Nachbarn an der Neumattstraße kannte ich sogar mit Namen. Ich fühlte mich geborgen und zuhause.
EIN GROSSER VERLUST
A n einem Abend im Juni 1964 lagen wir beim Mueti im Bett und sie erzählte uns eine Geschichte. Nachher gingen wir schlafen.
Am nächsten Morgen war alles anders. Vater kam zu uns ans Bett und mit Tränen in den Augen sagte er: »S Mueti isch hüt z Nacht gstorbe.« Ich konnte im ersten Moment gar nicht richtig verstehen, was das bedeuten sollte. »Chömmet, leget oi aa, denn chönd er sie go aaluege.«
Da lag sie. Still, mit geschlossenen Augen, in den Händen einen Blumenstrauß. Aber das war nicht mehr meine Mutter. Die war doch warm und hatte ein Strahlen im Gesicht. »Jetzt macht sie dann die Augen auf und alles ist wieder wie vorher«, dachte ich.
Ich flüchtete auf den Balkon, stand dort und wusste mit meinen viereinhalb Jahren, dass jetzt etwas Heftiges, Einschneidendes geschehen war, das mich mein ganzes Leben lang begleiten würde, und dass nichts mehr so wie vorher sein würde.
Vier Tage lang konnten die Leute vorbeikommen, um sich von Mutter zu verabschieden. Alle brachten Blumen mit und bald erfüllte ihr Duft das Haus.
Irgendwann war die Beerdigung. Ich durfte nicht mit, weil die Großeltern dachten, ich wäre zu klein. Sehr wahrscheinlich war ich bei einer Nachbarin. Meine zukünftige Schwiegermutter hat in ihrem Buch die Beerdigung so beschrieben: Die ganze Dorfbevölkerung begleitete Martheli auf ihrer letzten Reise. Ein grosser Trauerzug zog von ihrem Wohnhaus entlang der Reppischstrasse, weiter durch die Bühlstrasse zu ihrem Elternhaus. Vor diesem gab es einen kurzen Halt. Dann weiter zum Friedhof. Ich hörte, wie die Leute sagten: »Das Martheli war viel zu gut für diese Welt, darum hat sie der Herrgott zu sich geholt.«
Ein paar Tage nach der Beerdigung, als ich Milch im »Lädeli« an der Reppisch holen musste, dachte ich beim Zurücklaufen: »Jetzt ist sie wieder zuhause!« Dieses Gefühl übermannte mich noch lange. Manchmal hoffte ich, aus einem Traum zu erwachen, und alles wäre wieder wie vorher. Eine schwierige Zeit für Vater und uns begann. Die Großeltern kamen zwar häufig vorbei, um nach uns Kindern zu schauen. Großmutter von der Silberen machte die Wäsche. Sie besaß auch als eine der Ersten einen Fernseher, schwarz-weiß. Wenn sie bügelte, setzten wir uns auf die »Choscht« des Kachelofens und sie erzählte alles, was sie gesehen hatte. Zum Teil könnte ich die Szenen heute noch erzählen. Sie kannte auch sehr viele Geschichten. Ich hatte sie sehr, sehr gern. Sie war mir auch am nächsten, weil sie einfach viel bei uns war. Natürlich kam auch die Großmutter von der Bühlstraße. Sie brachte uns »Päckli« mit Mickey-Mouse-Heftchen oder mit Trudi-Gerster-Schallplatten.
Dann kam Fräulein Schlatter von der Hauspflege Dietikon zu uns. Sie machte den Haushalt, kochte und schaute, dass es uns Buben gut ging. Ich hatte sie sehr gern. Sie war etwas dick und ich konnte sie so gut umarmen. Sie füllte das Haus mit ihrer Liebe und Gegenwart, fast so wie Mueti es getan hatte. Sie rettete mich auch immer wieder vor den Streichen meiner Brüder.
Einmal schliefen wir im gleichen Zimmer. Martin und Ernst in einem Bett auf der einen und ich auf der anderen Seite des Zimmers. Ohne dass ich es merkte, legten sie eine Bocciakugel in meine Nachttischschublade. Als es eindunkelte und ein Zug vorbeifuhr, hörte ich ein Rumpeln und sah, dass bei meinem Nachttischchen die Schublade ein Stück rausgerutscht war. Ich stieß sie wieder zu. Ich hörte wohl die Brüder kichern und lachen. Aber ich dachte mir nichts dabei. Einen Moment lang war es ruhig. Der nächste Zug und wieder öffnete sich die Schublade. War die Erschütterung durch den Zug schuld daran? Ich nahm alle Bücher, Hefte und die Bocciakugel heraus und stapelte sie auf dem Boden. Auch das half nichts, die Schublade rutschte beim nächsten Zug trotzdem ein Stück heraus. Langsam stieg in mir ein ungutes Gefühl auf. Geisterte es im Zimmer? Es blieb nur noch eine Lösung: Ich zog die Schublade heraus und stellte sie auf den Boden. Zu meinem Entsetzen bewegte sie sich auch dort. Ich begann vor Angst laut zu weinen. Fräulein Schlatter kam ins Zimmer und machte Licht: »Ernst und Martin! Müsst ihr euren Bruder plagen?« Sie nahm die Schublade hoch und jetzt erkannte auch ich den weißen Faden, der an der Schublade befestigt war. Jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifuhr, hatte einer der Brüder daran gezogen. Fräulein Schlatter schimpfte mit ihnen und befahl: »Jetzt wird geschlafen!«
Die zwei spielten mir immer wieder Streiche und nutzten meine Ängste aus. Ich fürchtete mich vor dem Keller, dem Estrich und vielem anderen. Und auch vor Hunden. Der Großvater an der Bühlstraße hatte einen großen Berner Sennenhund, einen Dürrbächler. Der bewachte den Hof. Er war oft im eingezäunten Obstgarten untergebracht, aber ich hatte auch hinter dem sicheren Zaun wahnsinnige Angst vor ihm. Wenn ich mich dem Hof näherte, bellte er so laut und »gfürchig«, dass ich fast in die Hosen machte. Eines Tages sagte Ernst zu mir: »Komm doch mal mit in den Obstgarten. Der Hund macht dir nichts.« Ich weiß nicht mehr, ob ich ihm etwas beweisen wollte oder weshalb: Ich betrat mit ihm den Obstgarten. Schon kam das schwarzweiße Ungetüm auf mich zugerannt, wedelte, bellte und sprang an mir hoch.
»Ernst, dä will mi frässä!« Aber Ernst war gar nicht mehr da. Er hatte sich aus dem Gehege geschlichen. Der Hund tänzelte um mich herum und leckte mir das Gesicht. Ich schrie mir die Seele aus dem Leib und erwachte erst aus dem Albtraum, als ich Großvaters Hand spürte, der mich aus dem Garten führte. Heute weiß ich, dass der Hund »nur« mit mir spielen wollte, aber damals entwickelte ich eine richtige Hundephobie.
1967 heiratete Vater noch einmal, Elisabeth Vogelsang. Sie war eine Kindergärtnerin. Fräulein Schlatter war wohl den Tag hindurch bei uns, aber am Abend ging sie in ihre eigene Wohnung. Vater hatte es im Wald sehr streng und darum fast keine Zeit, auch noch zu den drei Buben zu schauen. Er war auch froh, wieder eine Frau zu haben. Es wurde dann schon sehr anders zuhause, als s Großmuetti – so nenne ich sie heute am liebsten – bei uns einzog. Wie soll ich das beschreiben? Für sie war Ordnung sehr wichtig. Freiheiten verschwanden und ich musste viel schlafen gehen. Manchmal sogar am Nachmittag. Die Nachbarskinder kamen weniger zu uns in den Garten, weil ihnen s Großmuetti zu streng war.
DIE SCHULE
I ch ging gerne in die Schule, das heißt vor allem in die erste bis dritte Klasse. Da hatte ich einen Status und war ein beliebter Schüler. Beim Gruppenmachen im Turnen wählten sie mich immer zuerst. Die Noten waren auch sehr gut. Mein Zeugnis zeigte ich dem Vater immer gerne.
In der Mittelstufe wechselten die Lehrkräfte jedes Jahr. In der fünften Klasse hatten wir sogar schon nach einem halben Jahr wieder eine neue Lehrerin. Erst in der sechsten Klasse kehrte mit Frau Weber Ruhe ein. Mit ihrem strengen Unterricht schaffte sie es, dass ich auch in die Sekundarschule gehen konnte. Damals brauchte man einen Notenschnitt von 4–5, um prüfungsfrei die Oberstufe zu besuchen. Deutsch mündlich und schriftlich sowie Rechnen waren maßgebend für diese Note.
Drei Jahre Sekundarschule beim Lehrer Stäuble folgten. Eine Katastrophe! Die Noten sanken und sanken. Ich denke gar nicht gerne an diese Zeit zurück. Dafür lernte ich Markus kennen. Damals begann unsere Freundschaft, die bis heute andauert. Häufig war ich bei ihm zuhause, um Schallplatten zu hören. »Queen« zum Beispiel. Er hatte in einem kleinen Raum eine große Stereoanlage aufgebaut. Wir machten es uns bequem, er legte eine Schallplatte auf und drehte die Lautstärke auf das Maximum. Einfach so lange, bis seine Mutter uns ermahnte, leiser zu stellen.
Auch den Schulweg genoss ich sehr. Ich ließ mir jeweils viel Zeit, um nach Hause zu gehen. Einen Teil des Weges legte ich mit Vincenz, einem Schulkollegen, zurück. Manchmal rauchten wir eine Zigarette zusammen. Jedes Mal gab es zuhause ein Geschimpfe, weil s Großmuetti natürlich den Rauch roch. Aber ich ließ mich nicht davon abhalten, hie und da einen Glimmstängel zu paffen.
Jeder Bub, der vierzehn wurde, schaffte sich ein Mofa an. Ich wollte natürlich auch ein »Töffli«. Mit Sparen und der Unterstützung der Eltern konnte ich mir endlich ein Mofa der Marke Cilo kaufen. Ich hatte schon Freude daran, aber mit einem Sachs-Töff war es nicht zu vergleichen. Den musste man haben, um jemand zu sein. Nach langem Suchen erwarb ich mir einen Motor der Marke Sachs. So weit gut, aber er passte nicht auf den Rahmen meines Mofas. Was blieb mir anderes übrig, als auch ein Sachs-Gestell zu organisieren?
Unterdessen wohnten wir nicht mehr an der Neumattstraße, sondern in der Nähe des Guggenbühl-Waldes. Vater hatte schon lange den Traum gehegt, ein eigenes Haus zu bauen. Er konnte Land an bester Lage in Dietikon erwerben und ich war ungefähr zwölf Jahre alt, als wir umzogen. Das Haus war groß, jeder hatte ein eigenes Zimmer und mir gefiel vor allem die Garage. Dort baute ich mir eine Mofa-Werkstatt auf.





























