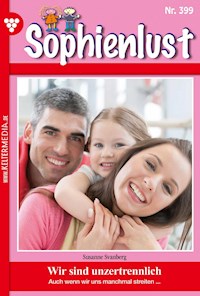25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1868 - Mein Papa ist der größte E-Book 1869 - Kleine Mädchen - großes Leid E-Book 1870 - Wir streiten nie mehr! E-Book 1871 - Marios Traum ... E-Book 1872 - Wenn kleine Mädchen lügen... E-Book 1873 - Meine geliebte Familie E-Book 1874 - Endlich fröhlich Kinder E-Book 1875 - Wer heiratet Papi und mich? E-Book 1876 - Ein Mann für Mami E-Book 1877 - Frau Doktors Sorgenkind E-Book 1: Mein Papa ist der größte E-Book 2: Kleine Mädchen – großes Leid E-Book 3: Wir streiten nie mehr! E-Book 4: Marios Traum ... E-Book 5: Wenn kleine Mädchen lügen ... E-Book 6: Meine geliebte Familie E-Book 7: Endlich fröhliche Kinder E-Book 8: Wer heiratet Papi und mich? E-Book 9: Ein Mann für Mami E-Book 10: Frau Doktors Sorgenkind
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1192
Ähnliche
Inhalt
E-Book 1868 - 1877
Mein Papa ist der größte
Kleine Mädchen – großes Leid
Wir streiten nie mehr!
Marios Traum ...
Wenn kleine Mädchen lügen ...
Meine geliebte Familie
Endlich fröhliche Kinder
Wer heiratet Papi und mich?
Ein Mann für Mami
Frau Doktors Sorgenkind
Mami – Staffel 15 –
E-Book 1868 - 1877
Susanne Svanberg Lisa Simon Edna Meare Silva Werneburg Myra Myrenburg Anna Sonngarten Linda Lorenz Annette Mansdorf
Mein Papa ist der größte
… aber Jessica ahnt nichts von dem Geheimnis ihres Vaters
Roman von Svanberg, Susanne
Länger als alle anderen blieb Johannes Roteck am offenen Grab stehen. Noch immer konnte er nicht daran glauben, daß seine Frau nie mehr zurückkommen würde. Nie mehr würde er ihre Stimme hören, Felicitas nie mehr in seine Arme schließen. Dabei war sie noch so jung, zweiunddreißig erst, und sie hatten noch so viele Pläne. Auf dem Skihang war sie vor fünf Tagen so unglücklich gestürzt, daß jede Hilfe zu spät kam. Johannes hatte seither kaum geschlafen, kaum etwas gegessen. Er war von Schmerz und Verzweiflung wie betäubt. Die Formalitäten für die Trauerfeier hatten die Schwiegereltern erledigen müssen. Er war nicht dazu in der Lage.
Äußerlich völlig unbeteiligt, in seinen Empfindungen aber aufgewühlt und grenzenlos traurig, nahm er an der Zeremonie teil. Er sah und hörte nicht, was um ihn herum vorging. Er war wie ein entwurzelter Baum: haltlos, kraftlos, herausgerissen aus einem Leben, das glücklich und erfüllt war.
Erst als es dunkel wurde, tappte er den Weg zurück. Er erinnerte sich nicht dran, daß sein Auto auf dem Parkplatz stand, und ging den ganzen Weg zu Fuß. Länger als eine Stunde war er unterwegs, doch auch das nahm er nicht wahr. In dem Haus, das sie bewohnten, ließ er sich in einen Sessel fallen und lehnte sich stöhnend zurück. Weinen konnte er schon lange nicht mehr, und doch brannten seine Augen.
Die ganze Nacht über rührte er sich nicht vom Fleck, und auch am nächsten Tag blieb er sitzen, den Kopf in die Hände gestützt, ein Bild des Jammers.
Das Telefon läutete, doch Johannes hörte es nicht. Er war in Gedanken weit weg. An die erste Zeit seiner Ehe dachte er und an den Tag, da Jessica, das Kind ihrer Liebe, geboren wurde. Felicitas und er waren unbeschreiblich glücklich gewesen. Das alles war unwiderruflich vorbei.
Später klingelte es an der Tür, doch auch das registrierte Johannes nicht. Niemand konnte seine Trauer stören. Vor elf Jahren hatte er Felicitas bei einem Skiurlaub kennengelernt, und seither waren sie unzertrennlich. Eine ungewöhnlich intensive Zuneigung war es, die sie beide verband. Daß es der gemeinsame Lieblingssport sein würde, der sie für immer trennte, hätte Johannes nie gedacht. Jetzt machte er sich Vorwürfe darüber, daß er den Unfall nicht verhindern konnte. Doch wer hätte geglaubt, daß so etwas passieren würde, denn die Abfahrtsstrecke, auf der das Unglück geschah, galt als sicher und nicht besonders schwierig.
Johannes merkte nicht, daß sich ein Schlüssel im Schloß drehte und seine Schwiegermutter das Haus betrat. Sich neugierig umschauend ging sie durch alle Räume, überzeugt davon, daß niemand zu Hause war. Sie zog Schubladen auf, öffnete Schränke und inspizierte deren Inhalt.
Da sie sich unbeobachtet glaubte, erschrak sie, als sie im Wohnzimmer plötzlich ihrem Schwiegersohn gegenüberstand. Sie stieß einen schrillen Schrei aus und wich unwillkürlich einige Schritte zurück, wobei sie ihre hochmütige Haltung ablegte und ganz gegen ihre Gewohnheit Angst zeigte.
»Du bist hier?« fragte sie und ließ die gekünstelt vornehme Sprechweise vermissen.
Gleichgültig sah Johannes hoch. »Wo sollte ich sonst sein?« murmelte er, den Körper vornüber gebeugt, das dunkle Haar zerwühlt, grau das Gesicht.
»Hast du Jessicas Sachen gerichtet?« fragte Elfi Schumann. Sie hatte sich gefangen und rasch erkannt, daß ihr von dem gebrochenen Mann keine Gefahr drohte. Deshalb klang ihre Stimme jetzt wieder hochmütig und ironisch, was ihr nirgends Freunde einbrachte. Elfi hob den Kopf und straffte herrisch die Schultern. Wo sie auch hinkam, signalisierte sie ihren Reichtum, der ihr Macht über andere gab. Eine Macht, die sie mit sadistischer Freude ausnutzte.
Johannes öffnete die geröteten Augen und sah seine Schwiegermutter verständnislos an. »Wieso sollte ich Jessis Sachen richten? Wo ist sie überhaupt?« Schwerfällig drehte Roteck den Kopf, um festzustellen, ob sein Töchterchen in der Nähe war.
Doch er konnte nur Elfis große Gestalt ausmachen. Die eitle Frau des Fabrikanten Karl Schumann trug ein elegantes graues Ensemble und darüber einen Nerz von ausgesuchter Schönheit. Diese Nebensächlichkeiten wären Johannes bestimmt nicht aufgefallen, doch die Art, wie sich Elfi präsentierte, zwang sie ihm auf.
»Jessica ist vorübergehend bei uns, nachdem du ja nicht in der Lage warst, sich um sie zu kümmern.«
»Das ist gut. Danke. Ich war so durcheinander und bin es auch jetzt noch, daß ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Nur eines ist mir bewußt: Ich habe Felicitas verloren.« Rotecks imponierend breite Schultern sanken noch ein Stück tiefer.
»Ph!« machte Elfi und setzte sich mit verblüffender Herzlosigkeit über den Schmerz des Schwiegersohns hinweg. »Wir haben unsre Tochter schon vor elf Jahren verloren. Damals, als du ihr voller Berechnung den Kopf verdreht hast.«
»Das ist nicht wahr«, murmelte Johannes, doch seiner Stimme fehlte die Überzeugungskraft. »Ich habe Felicitas geliebt…«
»Wen interessiert das?« fragte Elfi hochmütig. Den verhaßten Schwiegersohn so demütig zu sehen, verschaffte ihr Genugtuung. »Unsere Tochter hätte eine andere Partie machen können. Sie war hübsch, gebildet und vermögend. Aber du hast ihr alle Chancen verdorben.« Elfis schwarze Augen blitzten leidenschaftlich. Sie standen in krassem Kontrast zu den blondgefärbten Haaren, denen ein geschickter Friseur Volumen verlieh.
Johannes hatte diese Vorwürfe oft genug gehört. Früher hatte er sich dagegen gewehrt. Beruflich hatte er im Werk des Schwiegervaters sein Bestes gegeben und entscheidend dazu beigetragen, daß sich die Firma ständig vergrößerte und in diesen Jahren ein Unternehmen von Weltruf geworden war. Jetzt hatte e nicht die Kraft, auf Elfis Gehässigkeit zu antworten. Er wünschte sich, sie möge wieder gehen.
Doch die arrogante Elfi Schumann dachte gar nicht daran. Es machte ihr Freude, den unerwünschten Schwiegersohn noch etwas zu quälen.
»Vielleicht erhebst du dich demnächst und packst Jessicas Koffer. Sonst wäre ich gezwungen, ein Hausmädchen herzuschicken, das diese Arbeit verrichtet.
»Jessi braucht keinen Koffer. Ich werde sie später bei euch abholen.«
»Hast du dir gedacht«, höhnte Elfi feindselig. »Du kannst das Kind nicht versorgen. Du hast es ja nicht einmal vermißt.«
Johannes seufzte laut. »Entschuldige, das war eine Ausnahmesituation. In Zukunft werde ich selbstverständlich für meine Tochter sorgen. Ich werde eine verläßliche Haushälterin einstellen, die Jessi tagsüber beaufsichtigt.«
»Nichts wirst du, denn das ist alles längst entschieden«, belehrte ihn Elfi mit der ihr eigenen Überheblichkeit. »Jessica kommt in ein Schweizer Internat. Das ist eine sehr teure, aber hervorragende Institution. Es werden nur Kinder aus vermögenden Familien aufgenommen. So zum Beispiel der Nachwuchs aus einigen europäischen Fürstenhäusern. Jessica soll eine Ausbildung bekommen, die dem Stand ihrer Großeltern entspricht. Auf diese Weise kann sie vielleicht den Makel ausgleichen, der dadurch entstanden ist, daß ihre Mutter dummerweise den falschen Mann geheiratet hat.« Verächtlich sah Elfi ihren Schwiegersohn an. Er sah gut aus, auch jetzt, und er war ein tüchtiger Ingenieur. Doch nie und nimmer hätte Elfi das anerkannt, denn Johannes stammte aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater war ein biederer Handwerker und seine Mutter eine tüchtige Schneiderin, fleißig und ehrlich, aber eben weit unter Elfis Niveau. Sie verkehrte nur mit Leuten, die entweder viel Geld hatten oder hochrangige Titel.
Johannes wußte aus Erfahrung, daß seine Schwiegermutter gern übertrieb. Deshalb maß er der Schilderung des Internats auch keine Bedeutung zu. Dagegen empörte es ihn, daß er nicht gefragt worden war. »Ihr habt Jessi in einem Internat angemeldet, ohne mich darüber zu informieren?« keuchte er und konnte nicht glauben, daß man ihn derart übergangen hatte. »Das ist doch völlig unnötig. Das Kind bleibt selbstverständlich bei mir!« Beim letzten Satz gewann Rotecks Stimme endlich wieder etwas Festigkeit.
Elfi lachte dunkle und voll Hohn. »Weshalb hätten wir dich einbeziehen sollen? Deine Zeit ist um, Johannes. Du wirst dorthin zurückgehen, woher du gekommen bist. In die Gosse!«
Roteck blinzelte irritiert. Was sollte das nun wieder heißen? Er war daran gewöhnt, daß ihm die Schwiegereltern nur Schwierigkeiten machten, doch glaubte er nicht, daß es noch viel schlimmer kommen würde.
Rotecks Schweigen brachte Elfi erst so richtig in Fahrt. Endlich konnte sie dem Schwiegersohn heimzahlen, was sie elf Jahre lang geärgert hatte. Sie hatte damals für ihre Tochter einen reichen Engländer als Ehemann ausgewählt. Einen, der in den allerersten Kreisen verkehrte. Er besaß ein Schloß in Schottland und ausgedehnte Ländereien in Wales. Elfi war der Ansicht, daß dies der richtige Umgang und die angemessene Umgebung für sie waren. Doch dann mußte Felicitas Johannes Roteck heiraten, weil sie ein Kind von ihm erwartete. Damit waren Elfis ehrgeizige Pläne gescheitert. Die Schuld daran gab sie Johannes, auch jetzt noch.
»Wie willst du denn für das Kind sorgen, nachdem du dich zunächst selbst über Wasser halten mußt?«
»Wie soll ich das verstehen?« fragte Johannes und ahnte Schlimmes. Felicitas zuliebe war er mit seiner kleinen Familie in der Nähe der Schwiegereltern geblieben und hatte manches gute berufliche Angebot ausgeschlagen. Jetzt zeigte sich, daß das ein Fehler war.
»Hast du denn nicht mit meinem Gatten gesprochen?« fragte Elfi herausfordernd. Ihren Ehemann nannte sie im Gespräch mit anderen stets ihren ›Gatten‹, weil sie das für vornehm hielt. Dazu gehörte auch, daß sie die Lippen spitzte und wirkungsvoll die Augenlider senkte.
Johannes fand das lächerlich, aber er nahm es hin. »Karl war nicht hier.«
»Ich weiß, daß er mehrmals versucht hat, dich telefonisch zu erreichen, aber du hast ja nicht abgenommen.«
»Tut mir leid.« Zerknirscht zuckte Johannes die Schultern. Karl Schumann war sein Chef, und er wäre gut mit ihm ausgekommen, hätte Elfi ihn nicht ständig gegen den Schwiegersohn beeinflußt.
»Nun wirst du dich in unsere Villa bemühen müssen«, meinte Elfi schadenfroh.
Johannes dachte daran, daß er dieses Haus immer widerwillig betreten hatte, weil man ihm nur zu offen zeigte, daß er dort nicht willkommen war. »Kannst du mir nicht sagen, worum es geht?« fragte er und wußte im gleichen Moment, daß er von Elfi kein Entgegenkommen erwarten durfte. Sie konnte wohl nie vergessen, daß er es war, der ihr den Zugang zum englischen Adel vermasselt hatte.
»Nein, ich kann dir den Weg nicht ersparen«, erklärte sie stolz. »Und falls du dein Auto brauchst, es steht noch am Friedhof. Die Verwaltung hat bei uns angerufen, weil du nicht zu erreichen warst. Ich habe ihnen gesagt, daß wir über den verblödeten Schwiegersohn auch nicht glücklich sind, daß sich das Problem aber nun löst. Die übergangenen Telefongespräche und die Sache mit dem Auto sind doch der Beweis dafür, daß es ratsam ist, Jessica deinem schädlichen Einfluß zu entziehen.
Schließlich soll sie später einmal keinen armen Schlucker heiraten, wie es ihre Mutter dummerweise getan hat. Vielleicht hat der englische Earl noch Interesse.« Die ehrgeizige Elfi machte bereits neue Pläne.
Johannes schüttelte verständnislos den Kopf. »Jessi ist noch ein Kind. Und dieser Earl war schon für Felicitas viel zu alt. Mit ihm wäre sie kreuzunglücklich geworden.«
»Jessica ist zehn. Wenn sie ihrer Mutter nachschlägt, wird sie ein sehr hübsches junges Mädchen, und wenn sie dann noch in diesem vornehmen Schweizer Internat erzogen wurde, ist sie genau die richtige Partnerin für einen Mann von Welt, wie es der Earl ist.«
Johannes hielt sich demonstrativ die Ohren zu, denn er konnte die unangenehm laute Stimme seiner Schwiegermutter nicht mehr hören.
»Typisch für dich«, fauchte sie. »Du weißt einfach nicht, was sich gehört. Und du wirst es auch nie lernen!«
*
Johannes hätte seinen Schwiegervater lieber allein gesprochen, doch Elfi ließ es sich nicht nehmen, bei dieser Unterredung dabei zu sein. Herausfordernd schaute sie Karl Schumann an.
»Wir haben dich gestern nach der Trauerfeier vermißt. Viele haben nach dir gefragt«, begrüßte der Unternehmer seinen Schwiegersohn.
»Ich wollte allein sein«, antwortete Johannes wahrheitsgemäß. »Wo ist Jessi?« Roteck hatte erwartet, sein Töchterchen hier zu sehen.
»Ballett-Unterricht«, antwortete Elfi rasch. »Auch etwas, das man dem Kind bisher vorenthalten hat, das aber zur Erziehung einer jungen Dame unseres Standes gehört.« Wieder spitzte Elfi die Lippen, weil sie glaubte, daß dies ihre vornehme Herkunft unterstrich. Daß ihre Eltern eine kleine Bäckerei betrieben, hatte sie stets sorgsam vertuscht.
Karl Schumann haßte die ständigen Prahlereien seiner Frau, aber er war längst im Kampf gegen sie unterlegen. Wenn er sich gegen Elfi stellte, hatte er sofort Streit und Zank im Haus, und das hielt sein geschwächtes Herz nicht aus. Elfi nutzte seinen angegriffenen Gesundheitszustand aus, um ihre Wünsche durchzusetzen. So war es auch jetzt. Es fiel Karl nicht leicht, ihre Forderungen zu erfüllen, aber er hatte keine andere Wahl. Jeder Widerstand war für ihn lebensbedrohend.
»Ich möchte Jessi später mitnehmen.« Johannes sah seinem Schwiegervater fest in die Augen.
Elfi antwortete für ihn. »Das kannst du vergessen. Unser Chauffeur bringt das Mädchen schon morgen in die Schweiz. Je eher Jessica dort am Unterricht teilnimmt, um so besser ist es für sie.«
»Ich bin aber strikt gegen diesen Internatsaufenthalt. Jessi wird Heimweh bekommen. Sie ist noch viel zu klein…«
»Eine harte Erziehung hat noch keinem geschadet«, unterbrach Elfi den besorgten Vater.
Karl Schumann hob beide Hände, was andeuten sollte, daß er unschuldig war an den Beschlüssen, die gefaßt worden waren.
»Es ist besser, glaub’ mir«, meinte er vermittelnd. »Nachdem Felicitas nicht mehr da ist, wollten… äh, müssen wir auf deine Mitarbeit im Werk verzichten. Das bedeutet, daß du auch das Haus räumen… na ja, eben ausziehen solltest.« Karl war nicht so rachsüchtig wie seine Ehefrau, weshalb er wie zur Entschuldigung die Achseln hochzog. Er sah zwar nicht ein, weshalb das alles nötig sein sollte, aber er hatte auch nicht die Kraft, mit Elfi darüber zu diskutieren.
Johannes nahm die Aussage ruhig und gelassen auf. »Ich habe verstanden«, erklärte er schwer atmend. »Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.«
»Du warst lange genug der Schandfleck auf unserer Visitenkarte«, giftete Elfi in unüberbrückbarem Haß.
Karl Schumann fand, daß sie dem Schwiegersohn Unrecht tat, denn es hatte schließlich nie etwas an ihm auszusetzen gegeben. Er war ein vorbildlicher Ehemann, ein zärtlicher Vater, und beruflich war er für die Firma ein unschätzbarer Gewinn. So manche Neuentwicklung, die sich später als Renner herausstellte, war sein Verdienst. Elfi wollte von alldem nichts wissen. Sie war nur daran interessiert, Rache zu üben und ihre Macht auszuspielen. Nicht gerne ließ sich Karl dazu mißbrauchen, doch seine Frau ließ keines seiner Argumente gelten.
»Viel Zeit wirst du nicht haben. Schon in einer Woche kommen die Handwerker, um das Haus zu renovieren. Richte dich darauf ein. Wir werden dieses Haus an den neuen Betriebsleiter vermieten.« Es machte Elfi sichtlich Spaß, den Schwiegersohn zu demütigen. »Mit den Möbeln hast du keine Arbeit, denn sie wurden ja seinerzeit von uns angeschafft. Es bleibt also alles stehen. Hast du das verstanden?« Elfi schaute auf Johannes herab wie auf ein ungezogenes Kind. Das war ihr nur möglich, weil sie stehengeblieben war. Ihr Blick war voll Verachtung.
Johannes nickte. Wenn er das Haus, in dem er mit Felicitas glücklich war, verließ, wollte er ohnehin nichts mitnehmen. Auch die Stücke nicht, die er bezahlt hatte. Sie würden ihn immer wieder an jenes Glück erinnern, das unwiderbringlich verloren war.
»In Zukunft hast du also keinen Job, keine Wohnung, keine Freunde. Unter diesen Umständen ist es dir nicht möglich, für unsere Enkelin zu sorgen. Du kannst von Glück sagen, daß wir dir die Verpflichtung abgenommen haben.« Beifallheischend sah Elfi auf ihren Mann.
Er beeilte sich, zustimmend zu nicken.
»Du hast an alles gedacht, Elfi«, brummte Johannes, stemmte sich hoch und verließ schwankend den Raum, den Elfi das Biedermeierzimmer nannte.
*
Der Mann, dem Johannes eine Woche später gegenüber saß, erinnerte ihn stark an seinen Schwiegervater. Er war ebenfalls korpulent, kurzatmig, hatte eine Glatze und trug eine randlose Brille. Auch er war auffallend darum bemüht, jeden Konflikt mit seiner Frau zu vermeiden. Welchen Grund das hatte, sollte Johannes erst viel später erfahren.
»Es hat keinen Sinn«, erklärte Walter Schubart, Hauptaktionär eines bedeutenden Automobilwerks. »Ich kann Sie nicht einstellen, Sie sind überqualifiziert. Einem Mann wie Ihnen kann ich unmöglich zumuten, meine Frau zur Schneiderin zu fahren oder meinen Sohn zur Sporthalle.«
»Die Anforderungen sind meine Sache. Ich brauche den Job«, drängte Johannes. »Ich verspreche Ihnen auch, mich niemals zu beschweren.«
Schubart schüttelte den Kopf. »Sie werden etwas Besseres finden. Ein Mann mit Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung. Reden Sie mit dem Technischen Direktor des Werks. Früher oder später wird eine passende Stelle frei.«
»Ich brauche die Anstellung nicht irgendwann, sondern jetzt, denn ich sitze auf der Straße, und das wörtlich.«
»Die Frage, wie es dazu gekommen ist, steht mir nicht zu, aber ich möchte Sie nochmals warnen. Sie verdienen nur einen Bruchteil dessen, was Sie gewohnt sind. Sie müssen rund um die Uhr zur Verfügung stehen, auch sonntags, selbst nachts. Sie werden eine blaue Uniform tragen und im Kutscherhaus wohnen, das nicht grade luxuriös ist.« Schubart zählte all diese Nachteile an den dicken Fingern auf.
»Für mich ist das alles nebensächlich. Ich bin mit allem einverstanden«, erklärte Johannes, ohne auch nur einen Augenblick lang zu überlegen.
»Und was wird Ihre Frau dazu sagen? Was Sie da anstreben, ist ein sozialer Abstieg. Damit wird sie nicht glücklich sein.«
»Meine Frau ist…«, Johannes beendete den Satz nicht, denn er fühlte die Tränen hochsteigen.
»Aha«, nickte Schubart in männlicher Loyalität. »Private Probleme. Kenne ich. Für Sie ist das hier so etwas wie ein Verschwinden von der Bildfläche. Verstehe. Wir wohnen weitab von der Stadt, ziemlich isoliert. Niemand wird Sie hier suchen. Und in der blauen Uniform wird Sie auch niemand erkennen. Ich bin ja kein Unmensch. Wenn ich Ihnen helfen kann, warum nicht. Wir Männer müssen doch zusammenhalten.« Schubart lachte polternd.
Johannes verzog höflich den Mund. Sein Gesprächspartner hatte ihn gründlich mißverstanden, aber auch das war ihm gleich. »Ich bin Ihnen dankbar«, versicherte er mit leichter Verbeugung.
Schubart räusperte sich. »Damit wir uns richtig verstehen. Schenken kann ich Ihnen nichts. Ich bin ein Autonarr, das habe ich Ihnen ja schon erzählt. In meiner Garage stehen sechs Oldtimer und acht neue Modelle verschiedener Baureihen. Es wird Ihre Aufgabe sein, dafür zu sorgen, daß alle tadellos in Ordnung sind. Jedes Stäubchen auf der Karosserie stört mich. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.« Erwartungsvoll sah der Dicke den Bewerber an.
Roteck nickte. »Sie werden zufrieden sein«, versprach er glaubhaft. Ein Traumjob war es mit Sicherheit nicht, was ihm hier geboten wurde. Aber er würde eine Beschäftigung haben und ein Dach über dem Kopf. Seine Ersparnisse hätten gereicht, um für einige Wochen in ein bescheidenes Hotel zu ziehen, doch er hätte die Untätigkeit nicht ertragen, nicht einen Tag lang.
Walter Schubart wandte sich bereits wieder den Geschäftsberichten zu, die auf seinem Schreibtisch lagen. »Lassen Sie sich von meinem Butler die Uniform geben und Ihre Behausung zeigen«, meinte er so nebenbei.
»Danke«, sagte Johannes und war sich schon jetzt darüber klar, daß der Chef nichts mit ihm zu tun haben wollte. Außer Anweisungen würde er von ihm nichts mehr zu hören bekommen. Roteck war das ganz recht.
*
Angela Steger war schon seit mehr als zwei Jahren im Haushalt der reichen Familie Schubart. Es war ihre Aufgabe, den zwölfjährigen Sohn Alexander zu betreuen und zu unterrichten. Anfangs war das keine leichte Arbeit gewesen, denn das verwöhnte Kind akzeptierte die Hauslehrerin nicht. Schon mehrere Damen hatte Alexander so genervt, daß sie nach kurzer Zeit kündigten. Natürlich hatte es Alexander auch bei Angela probiert, allerdings ohne Erfolg.
Sie reagierte gelassen, wenn sie eine tote Maus in ihrem Bett fand, wenn ihr BH plötzlich am Kronleuchter im Eßzimmer hing oder wenn Käfer, Spinnen oder Mücken halb betäubt zwischen den Buchseiten krabbelten. Sie schrie auch nicht, wenn es unerwartet hinter ihr knallte, wenn der Teppich wegrutschte, weil sich Erbsen darunter befanden, und sie beschwerte sich nicht, wenn ihre Zahnpastatube gegen schwarze Schuhcreme ausgewechselt wurde.
Für sie war dieser Job eine Herausforderung, der sie sich gerne stellte. Das Schwierigste dabei war, den aggressiven Jungen zum Lernen zu bewegen. Alexander war intelligent, aber faul. Deshalb war er in der öffentlichen Schule, wo man sich nicht so intensiv mit ihm befassen konnte, gescheitert. Er war der Ansicht, daß er es gar nicht nötig hatte, etwas zu lernen, denn mit dem Geld seines Vaters würde er sich später genügend Angestellte halten können, die für ihn dachten und arbeiteten.
Angela hatte von Anfang an versucht, ein gutes Verhältnis zu ihrem Schüler aufzubauen. Die Freundlichkeit war zunächst einseitig, und die junge Erzieherin mußte allerhand Rückschläge einstecken. Aber ihre Beharrlichkeit führte schließlich doch zum Ziel. Alexander entdeckte, daß in den Büchern, die er zuvor nie zur Hand genommen hatte, auch interessante Dinge standen.
Als Angela begonnen hatte, ihn zu unterrichten, vermochte er nur mühsam einige Worte zu lesen, doch er lernte schnell, und inzwischen hatte er den Wissensstand gleichaltriger Schüler erreicht. Darauf war die junge Hauslehrerin besonders stolz. Natürlich gab es immer wieder Rückschläge, und dann zweifelte Angela daran, ob es richtig gewesen war, daß sie im schloßartigen Besitz Schubarts ausharrte.
Längst akzeptierte Alexander die Pädagogin. Trotzdem war und blieb er ein Lausbub, dem nie zu trauen war. Als sich Angela an diesem Vormittag auf ihren Stuhl am Schreibtisch setzte, ertönte ein langgezogenes, unanständiges Geräusch.
»Oh, oh«, machte Alexander und verdrehte vielsagend die mausgrauen Augen. Zusammen mit dem widerspenstigen roten Haar und der etwas spitzen Nase gaben sie dem Jungen das Aussehen eines lustigen Kobolds.
Angela lachte über den harmlosen Scherz, holte eine Gummiblase unter ihrem Stuhlkissen hervor und ging zur Tagesordnung über.
»Du solltest gestern noch den französischen Text übersetzen. Würdest du ihn mir bitte vorlesen?« Angela lächelte ihren Schüler gewinnend an. Sie war eine hübsche junge Frau, was ihr diesen Job gewiß erleichterte. Mit ihren 29 Jahren war sie jung genug, Verständnis für die Interessen des Zwölfjährigen zu haben. Da er kaum Freunde hatte, spielte sie in der Freizeit Basketball oder Fußball mit ihm und imponierte Alexander durch ihre Sportlichkeit.
»Der Text ist bescheuert«, brummte Angelas Gegenüber trotzig. »So blöde Sachen mag ich nicht übersetzen.« Verächtlich schnaubend hieb der rothaarige Junge auf das Buch.
Angela wußte, es hatte keinen Sinn auf der Forderung zu bestehen. Mit Toleranz kam sie in diesem Fall weiter. Sie überging den Ärger und sah Alexander freundlich an. »Du hast recht, die Texte in den Schulbüchern sind manchmal nicht besonders einfallsreich. Lassen wir das also. Ich schlage vor, wir legen statt dessen eine CD in den Computer und sehen uns einen Film an.« Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen war Angela technisch versiert und benutzte gerne moderne Unterrichtsmethoden. »Ich habe da eine ganz neue Story. Sie wird dich interessieren.«
»Deutsch?« erkundigte sich Alexander mit wachem Blick.
»Natürlich nicht. Wir haben Französischstunde, das weißt du doch.«
»Sch…« zischte der Junge ungezogen.
Angela tat, als bemerkte sie es nicht. Für sie gab es neuerdings einen stichhaltigen Grund, bei den Schubarts zu bleiben. Dieser Grund hieß Johannes Roteck und war der neue Chauffeur. Er war freundlich und pflichtbewußt, aber er sprach mit keinem. Seine schönen braunen Augen wirkten traurig, und wenn Roteck sich unbeobachtet glaubte, ließ er den Kopf hängen wie jemand, der eine schwere Last zu tragen hatte. Der neue Mitarbeiter gefiel Angela. Wie ein Flugkapitän sah er aus in der schicken blauen Uniform mit der Schildmütze. Deshalb war es Angelas Wunsch, ihn näher kennenzulernen. Das war gar nicht so einfach, denn Roteck verschwand im Kutscherhaus, sobald er nicht mehr gebraucht wurde.
Trotz Alexanders Protest flimmerte gleich darauf ein turbulentes Geschehen über den Bildschirm. Zunächst sah der Junge trotzig zur Seite, denn die Unterhaltung wurde in französischer Sprache geführt. Doch dann zwangen ihn die vielfältigen Geräusche zum Hinsehen. »Spielt das im Weltall?« fragte er interessiert.
»Ja. Im Hintergrund ist die Weltraumstation zu sehen, das wurde schon mehrmals erwähnt. Wenn du genau hinhörst, verstehst du die Unterhaltung. Es sind einfache Sätze. Außerdem können wir das Ganze mehrmals abspielen.«
Angela hatte sich nicht verrechnet. Die Handlung faszinierte den Zwölfjährigen, und so kam das Interesse an der Sprache ganz von selbst. Schon nach dem zweiten Ansehen vermochte Alexander den Test, der zum Lernprogramm gehörte, einwandfrei zu lösen. Als Belohnung für diesen Erfolg kürzte Angela den Unterricht etwas ab und schlug ein sportliches Wettschwimmen im hauseigenen Hallenbad vor.
Der Junge war begeistert. Er wußte zwar, daß die schlanke, zierliche Angela besser und schneller war als er, doch das spornte seinen Ehrgeiz an. Er wollte sich seiner hübschen Hauslehrerin gegenüber keine Blöße geben und mobilisierte all seine Kraft.
Schließlich waren sie beide erschöpft, standen keuchend am Beckenrand und sahen durch die breite Glasfront hinaus in den gepflegten Park. Die ersten Krokusse blühten auf den weiten Rasenflächen, die Gärtner säuberten die Wege und bei den durch hohe Bäume halb verdeckten Garagen polierte Roteck das Lieblingskabrio seines Chefs, einen roten Jaguar. Das war die Aussicht, die Angela am meisten interessierte.
Alexanders Augen folgten ihrem Blick. »Sieht geil aus, nicht wahr?«
»Hm«, stimmte Angela verträumt zu, wobei sie keine Ahnung davon hatte, daß sie von verschiedenen Objekten schwärmten.
»Mit dem möchte ich mal durch die Gegend brettern. Du auch?«
»Hm.« Angela lächelte bei dem Gedanken. Schubart würde nie erlauben, daß der neue Chauffeur sie irgendwo hin kutschierte.
»Was glaubst du, wieviel PS der hat?«
Erstaunt sah Angela zur Seite und begriff, daß der Junge für den Sportwagen schwärmte, sie hingegen für den Mann, der ihn auf Hochglanz brachte. »Keine Ahnung«, gestand sie erleichtert. Beinahe hätte sie in ihrer Zerstreutheit etwas verraten, das unbedingt geheim bleiben mußte.
»Sollen wir Johannes fragen? Der weiß das bestimmt. Er ist schwer in Ordnung. Echt.« Es kam selten vor, daß Alexander eine solche Behauptung aufstellte. Der Neue mußte Eindruck auf ihn gemacht haben.
»Klar«, antwortete Angela spontan. Die Möglichkeit, auf diese Weise mit Roteck ins Gespräch zu kommen, entsprach ihren Wünschen.
*
Bereitwillig zeigte der neue Chauffeur wenig später dem Jungen den Motor des Sportwagens und erklärte ihm die technische Funktion. Alexander staunte, was der Neue alles wußte, und Angela wunderte sich, wie gut er es verstand, mit dem etwas schwierigen Junior der Familie umzugehen.
Sie hielt sich etwas abseits. Ihre dichten braunen Haare, noch naß vom Schwimmen, hatte sie zu einem besonders hübsch geflochtenen Zopf zusammengenommen. Das betonte ihr schmales Profil mit den vollen Lippen und der reizvollen kleinen Nase.
»Angela gefällt der Jaguar auch«, machte Alexander schließlich auf seine Lehrerin aufmerksam.
Johannes, der noch gar nicht bemerkt hatte, daß Alexander nicht allein gekommen war, drehte flüchtig den Kopf und grüßte.
Diese Geste nahm Angela zum Anlaß, näherzukommen. »Sie erklären das erstaunlich gut«, meinte sie und ließ die Bewunderung erkennen, die sie für den neuen Angestellten empfand.
»Das ist leicht, wenn man selbst eine Tochter in diesem Alter hat. Etwas jünger vielleicht…«, meinte er zögernd. »Jessi ist zehn.«
Angela schluckte. Der Neue war also verheiratet und hatte Familie. Das hätte sie sich ja denken können. Wer so fabelhaft aussah wie er, blieb nicht allein. »Kommt Ihre kleine Tochter Sie mal besuchen? Vielleicht mit der Mama?« fragte Angela und versuchte krampfhaft, ihre Enttäuschung zu überspielen.
Johannes schüttelte traurig den Kopf. »Jessi hat keine Mama mehr. Sie lebt in einem Schweizer Internat. Leider konnte ich sie nicht zu mir nehmen. Es wäre hier unmöglich. Sie wissen ja.«
»Das tut mir leid«, murmelte Angela, obwohl dies nicht die Wahrheit war. Sie war froh darüber, daß es keine Ehefrau gab, denn sie hatte sich in Johannes Roteck verliebt. Ihr gefiel seine ruhige, besonnene Art, auch die Zurückhaltung, die er zeigte. Ihr Wunsch, ihn zu trösten und etwas aufzuheitern, wurde bei jeder Begegnung stärker. »Sie vermissen Ihre Frau wohl sehr?« fragte sie leise.
Johannes gab keine Antwort, nickte nur. Es gab keinen Tag, keine Stunde, in der er nicht an Felicitas dachte. Doch darüber wollte er nicht reden. Er spürte zwar, daß es die junge Lehrerin gut mit ihm meinte, aber er wollte das gar nicht. Er würde allein bleiben mit seinem Kummer, ganz allein.
»Was ist das?« fragte Alexander und zeigte auf einen schwarzen Kasten mit gelben Knöpfchen.
»Das ist die Batterie. Sie liefert Strom für den Anlasser, für die Lampen und alle elektronischen Teile.« Johannes zeigte dem Kind die technischen Raffinessen, über die dieser Wagen verfügte. Er erklärte ihm auch gleich die Neuerungen, die es inzwischen gab. Aufmerksam hörte der Junge zu.
»Die Belegschaft des Hauses Schubart trifft sich zu den Mahlzeiten immer im Raum neben der Küche«, erwähnte Angela in einer Gesprächspause. »Es ist dort für alle Platz, und es geht meistens recht lustig zu. Ich habe Sie aber noch nie dort unten gesehen. Hat man Ihnen nicht gesagt, daß es diese Möglichkeit gibt?«
»Der Butler sprach davon«, antwortete Johannes steif. »Es war mir bisher allerdings lieber, die Mahlzeiten im Kutscherhaus einzunehmen. Es gibt dort eine kleine Küche.« Daß sie nur aus einem Elektrokocher und einem Waschbecken bestand, verschwieg Johannes. Ihm genügte die primitive Kochgelegenheit ohnehin, weil er nie mehr als eine Suppe oder eine Tasse Tee zubereiten würde. Auch der Rest der Behausung war alt und verwohnt. Die Wände mußten dringend gestrichen werden, und die sanitären Anlagen waren unzumutbar. Johannes fand sich damit ab. In seinen Augen waren das Nebensächlichkeiten, die er gar nicht beachten wollte.
»Heute hat der Koch Geburtstag. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, denn zu solchen Gelegenheiten strengt er sich mächtig an. Ich werde einen Platz für Sie freihalten.«
Johannes erschrak. »Bitte nicht«, wehrte er sich. »Mir ist nicht nach feiern. Außerdem braucht mich Herr Schubart heute abend.«
»Schade. Vielleicht können Sie noch reinschauen, wenn Sie wieder zurück sind. Wir sitzen sicher länger beisammen.«
»Ich komme auch«, versprach Alexander, und seine grauen Augen signalisierten Interesse, was er den Angestellten gegenüber noch nie getan hatte.
»Schon gut.« Johannes fuhr dem Jungen zärtlich übers rostrote Haar. »Wir werden noch oft Gelegenheit haben, uns zu unterhalten.« Alexander nahm seine Arbeit wieder auf. Dabei lächelte er sogar ein bißchen.
Angela beobachtete ihn und fühlte, wie ihr Herz rascher schlug. Alexander rannte den Weg zurück, und Angela ging langsam hinterdrein. »Fang’ mich doch!« schrie er, aber diesmal reagierte seine Betreuerin nicht.
*
Jessica war ein kluges Mädchen. Sie wußte, daß es für sie nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder mußte sie künftig bei den Großeltern wohnen oder in diesem Heim, in das Oma Elfi sie gleich nach der Beerdigung ihrer Mami gebracht hatte. Der Papa konnte vorerst nicht für sie sorgen, das hatte er selbst gesagt, und die Oma hatte gemeint, er wäre fertig für immer und ewig.
Wie das gemeint war, hatte Jessica nicht ganz verstanden. Sie spürte aber, daß sie dem Papi Zeit lassen mußte.
Im Heim fand Jessica nette Kameraden, die ihr über den Kummer der ersten Tage hinweg halfen. Sie war froh und erleichtert darüber, daß sie nicht bei Elfi bleiben mußte, die ständig etwas zu nörgeln fand und der Jessica nichts recht machen konnte.
Neben dem Unterricht bot das Heim ein umfassendes Freizeitprogramm, so daß Jessica nicht viel Zeit zum nachdenken blieb.
Riesengroß war ihre Freude, als der erste Brief ihres Vaters eintraf. Seither schrieben sie einander regelmäßig, und Jessica hatte immer viel zu erzählen.
Sie berichtete von kleinen Ausflügen, von den Tieren, die zum Heim gehörten, und von ihren neuen Freundinnen. Auch über die Vorbereitungen fürs Frühlingsfest, das demnächst stattfinden würde, informierte Jessica den Papa in ihren Briefen.
Wann immer die anderen von ihren Eltern erzählten, prahlte Jessica mit ihrem Papi. Für sie war und blieb er der Größte. Er konnte und wußte alles, und je länger sie getrennt waren, um so mehr idealisierte ihn Jessica in ihren Gedanken.
Auch heute saß sie wieder am Schreibtisch in ihrem Zimmer vor einem langen Brief an Johannes. Ihre Zimmerkameradin Sara drängte sie ungeduldig zur Eile.
»Mach doch! In einer Stunde fängt das Frühlingsfest an, und wir müssen uns noch umziehen. In der Turnhalle haben sie schon alle Stühle aufgestellt. Die ersten Gäste kommen auch schon. Sogar der Bürgermeister.« Sara zappelte voll Unruhe.
»Weiß ich ja«, gab Jessi unbeeindruckt zurück. »Ich schreibe gerade, daß fast alle Eltern zu diesem Fest kommen. Mein Papa kann aber nicht, weil er so wichtig für seinen Chef ist. Nicht einmal sonntags hat er frei.« Was für eine Beschäftigung es war, die ihr Vater ausführte, wußte Jessi nicht. Sie war aber überzeugt davon, daß es etwas sehr Anspruchsvolles war. »Und dann muß ich ihm noch schreiben, daß der Joschi, der Hund vom Hausmeister, in der Küche das Fleisch geklaut und die neuen Schuhe der Oberin zerbissen hat.« Jessi kicherte.
»Du, ich bin so aufgeregt«, gestand Sara der Freundin. »Weil ich doch die Hexe spiele.« Sara war aus Bayern und normalerweise nicht aus der Ruhe zu bringen. Doch seit man ihr in dem Singspiel, das die Kinder aufführen würden, eine Hauptrolle übertragen hatte, war sie nervös.
Jessi hatte dieses Problem nicht, denn sie sang im Chor, und das war für sie keine Belastung. »Cool bleiben, es klappt schon«, riet die Zehnjährige ihrer etwas älteren Freundin.
Für Sara war es nicht leicht, den Rat zu befolgen. Sie war in der nächsten Stunde ständig in Bewegung. Keinen Augenblick konnte sie stillsitzen. Weder bei der Begrüßungsansprache durch den Direktor, noch bei der Einstimmung durch den Schulchor war Sara an ihrem Platz.
Dann war es Zeit für die Kostümierung der kleinen Schauspieler. Sie wurden geschminkt und gestylt und bekamen letzte Anweisungen von der Musiklehrerin, die diese Aufführung einstudiert hatte. Sara trug eine furchterregende Hexenmaske mit großer, warzenbesetzter Nase und einem hämisch grinsenden Mund. Das dunkle Kleid reichte ihr bis auf die Füße und wies viele bunte Flicken auf. Wenn Sara gebeugt an einem Stock über die provisorisch errichtete Bühne ging, saß eine Katze auf ihrer Schulter. Bei den Proben war es ein Stofftier, das aber nicht die gewünschte Wirkung hatte. Deshalb brachte die Musiklehrerin zur Premiere ihren echten Schmusekater mit, ein ruhiges, phlegmatisches Tier, das alles mit sich machen ließ.
Sara war begeistert, und es klappte auch tadellos. Schläfrig thronte der Kater auf ihrer Schulter, als sie die Tür des Hexenhäuschens öffnete. Die Kulissen waren von den Kindern selbst fantasievoll bemalt worden. Fara, die eine sehr schöne Stimme hatte, stimmte ihr Solo an.
In der Turnhalle war es mäuschenstill, selbst die kleinen Zuschauer lauschten aufmerksam. Aufmerksam war auch Joschi, der Riesenschnauzer des Hausmeisters. Er hatte zwar zu dieser Veranstaltung keinen Zutritt, verstand es aber, sich heimlich in die vordersten Zuschauerreihen zu mogeln. Dort sah er wie gebannt auf das Tier, das gelassen auf der Hexenschulter saß. Joschi mochte Katzen nicht, und in Verbindung mit einer Hexe erschienen sie ihm doppelt hassenswert. Stufte er schon die gebückte Gestalt als höchst verdächtig und gefährlich ein, so war es der Kater erst recht. Joschi schlich sich seitlich an, um die Situation besser beobachten zu können. Besonders geschickt machte er das nicht, denn er wurde vom Kater bemerkt, der prompt zu fauchen begann.
Für Joschi war das das Zeichen zum Angriff. Mit gesträubten Nackenhaaren und laut knurrend duckte er sich.
Der Kater wiederum sah darin eine Bedrohung, richtete sich auf und wuchs durch einen Katzenbuckel zu doppelter Größe heran. Sein Schwanz wurde dick und buschig, und sein Fauchen übertönte beinahe Saras Gesang.
Sie hielt sich tapfer, obwohl ihr das Katzentier seine gespreizten Krallen in die Schulter drückte. Sie konnte sich zwar selbst nicht sehen, wußte aber, daß der aufgebrachte Kater den furchterregenden Gesamteindruck noch verstärkte. Hänsel und Gretel wichen erschrocken zurück. Das gehörte zwar zum Konzept, kam aber durch die Situation richtig gut zur Geltung.
Was dann geschah, durchbrach allerdings den Rahmen der Handlung. Der Hausmeister, darum bemüht, den störenden Joschi zurückzuholen, stürmte zur Bühne. Joschi sah sein Herrchen kommen und war sich klar darüber, daß man ihn an der Ausübung seiner Pflichten, nämlich die gefährlichen Gestalten in die Flucht zu jagen, hindern würde. Also mußte er handeln, und zwar sofort. Er wollte den Kater samt Hexe stellen und der strafenden Gerechtigkeit übergeben.
Doch es kam anders. Als Joschi bellend vorpreschte, rettete sich der vierbeinige Akteur durch einen kühnen Sprung auf das Dach des Hexenhäuschens. Sara schrie kurz auf, weil der Absprung für sie sehr schmerzhaft war. Die Musik spielte weiter, aber die Hexe war völlig aus dem Konzept gebracht. Sie sah Joschi auf sich zustürzen und streckte abwehrend die Hände aus.
Doch der Angriff galt gar nicht ihr, sondern dem Kater, der Anstalten machte, Joschi von oben anzuspringen. Um das zu verhindern, versuchte der Hund, auf gleiche Ebene zu kommen. Besonders hoch war das mit aufgemalten Lebkuchen verzierte Häuschen nicht. Deshalb war Joschi der Ansicht, daß er ebenfalls hinaufspringen konnte. Er konnte ja nicht ahnen, daß die Kulisse nur aus dünnen Pappwänden bestand. Joschi setzte zum Sprung an, und noch bevor der Hausmeister eingreifen konnte, landete er auf der provisorisch errichteten Hexenunterkunft.
Der Kater kreischte empört, und im nächsten Augenblick purzelten beide unsanft in die Tiefe, gefolgt von bunt bemalten Pappwänden. Joschi war für das Provisorium eindeutig zu schwer gewesen.
So dramatisch die Aktion für die beiden Akteure und die sich in der Nähe aufhaltenden Laienspieler war, für das Publikum bedeutete das eine unglaublich lustige Zugabe. Die Kinder lachten vergnügt, und auch Eltern und Lehrer amüsierten sich. Das Internat am Züricher See führte in jedem Jahr irgendwelche Theaterstücke vor, doch noch nie war eine Darstellung so fröhlich und begeistert aufgenommen worden.
Alles spielte sich innerhalb weniger Sekunden ab, und später sah es fast aus, als hätte diese humorvolle Einlage dazugehört. Die Musiklehrerin reagierte sofort. Sie eilte hinzu, stemmte die umgefallenen Kulissen wieder hoch und fing ihren Kater ein, der durch den unerwarteten Sturz verschüchtert und überhaupt nicht mehr angriffslustig war.
Joschi zog es vor, in die Nähe seines Herrchens zu flüchten und die mutige Verfolgung des Katzentiers anderen zu überlassen.
Sara grapschte nach der heruntergefallenen Maske und drückte sie sich erneut vors Gesicht. Vor lauter Schreck erinnerte sie sich nicht mehr an ihren Text und sah hilflos zum Chor hinüber.
Zum Glück traten jetzt Hänsel und Gretel in Aktion, die ohnehin ungeduldig auf ihren Einsatz warteten. Hand in Hand kamen sie näher und begannen, die an dem inzwischen sehr einsturzgefährdeten Häuschen angebrachten Süßigkeiten zu verzehren.
Nun besann sich auch Sara wieder ihrer Rolle. »Knusper, knusper kneischen«, sagte sie mit hoher, verstellter Stimme.
Der Rest des Singspiels verlief ohne Störungen und doch war Sara als Hexe am Ende total erschöpft, und auch der tosende Beifall konnte sie nicht aus ihrem Tief holen.
»Ich schäme mich«, bekannte sie später Jessi gegenüber.
Die Freundin legte tröstend den Arm um Saras Schultern. »Du warst großartig. Alle haben das gesagt. Ich hätte das nie gekonnt.«
Sara schnaubte wütend. »Alle haben gebrüllt vor Lachen.«
»Ja, aber nur, weil der Joschi sich so ulkig verhalten hat. Er war wirklich super. Du müßtest ihn jetzt mal anschauen. Er hat den unschuldigsten, harmlosesten Blick drauf, den du je gesehen hast.«
»Umbringen könnte ich das Vieh«, zischte Sara und rieb sich dabei die Verletzung auf ihrer Schulter.
*
Für Johannes Roteck war es längst zur Gewohnheit geworden, die dunkelblaue Uniform zu tragen und diensteifrig neben dem Auto auf seinen Chef zu warten. Sobald er erschien, hatte Johannes die Tür zum Beifahrersitz aufzureißen und sich ehrerbietig zu verneigen. Nicht jeder hätte das getan, aber ihm war es gleichgültig. Ohne Widerrede tat er, was von ihm verlangt wurde, auch wenn er oft keinen Sinn darin sah. Es war, als seien mit dem Verlust seiner Frau auch sein Stolz und sein Ehrgeiz verloren gegangen.
»Aufsichtsratssitzung!« sagte Schubart an diesem Morgen so laut, daß es seine Frau, die an der Tür stand, hören mußte.
Johannes wußte inzwischen, daß diese kurze Information keineswegs eine Fahrt zum Werksgelände bedeutete, sondern zur Innenstadt, wo ihn Schubart vor einem mehrstöckigen Geschäftshaus anhalten ließ. Das obere Geschoß dieses Gebäudes bewohnte eine junge Dame, die sich Lola nannte und aufreizend kurze Röckchen zu tragen pflegte. Schubart ging nie ohne ein Geschenk dorthin, und oft mußte ihn Johannes zuvor zum Juwelier fahren. Wenn Schubart in dem betreffenden Haus verschwunden war, hatte Johannes ins Werk zu fahren und dort auf dem Parkplatz zu warten. Wie lange, das wurde ihm übers Handy mitgeteilt. Gewöhnlich waren es zwei oder drei Stunden. Es hatte aber auch schon wesentlich länger gedauert, und in solchen Fällen mußte Johannes die Chefin verständigen, die von der Absteige in der Stadt selbstverständlich nichts wußte. Schubart erwartete von seinem Chauffeur Diskretion, und auf Johannes konnte er sich verlassen, weil Roteck ohnehin mit niemand sprach. Das schloß aber nicht aus, daß er sich darüber Gedanken machte und daß seine Achtung vor dem Chef nicht besonders hoch war.
Wortlos kutschierte Johannes den Unternehmer Schubart zu der bekannten Adresse. Dort wurde der Dicke von Lola mit liebevollen Küßchen begrüßt. Das war ihm wohl peinlich, denn er schob die leichtbekleidete Freundin rasch ins Haus.
Johannes fuhr wie immer auf den Parkplatz am Werk und wartete auf Schubarts Anruf. Diesmal kam er schon nach einer Stunde. Johannes fuhr sofort los, traf seinen Chef, der bereits vor dem Haus wartete, und brachte Schubart zu seinem schloßartigen Anwesen zurück. Vorschriftsmäßig hielt er unmittelbar vor der Freitreppe, sprang aus dem Wagen und hielt für seinen Chef die Beifahrertür auf. So wünschte sich das der Dicke, und wenn es klappte, war er zufrieden. Johannes funktionierte wie ein Roboter, und es gab eigentlich niemand, der sich nicht darüber wunderte. Am meisten aber machte sich Angela Gedanken über dieses Verhalten. Johannes tat ihr leid, denn er war immer allein, blockte all ihre Annäherungsversuche ab.
Heute war Post für ihn gekommen, und Angela nahm die Gelegenheit wahr, ihm den Umschlag selbst zu überreichen. Da es gerade Mittagszeit war, suchte sie Roteck im Kutscherhaus auf. Dort war alles noch im alten Zustand, denn Johannes sah seine Umgebung gar nicht.
Da die Klingel nicht funktionierte, verschaffte sich Angela durch lautes Klopfen Gehör. Johannes, der sich gerade eine Suppe zubereitete, brauchte einige Minuten, ehe er zur Tür kam. Er hatte die Uniformjacke abgelegt und sich zum Schutz vor Spritzern ein Küchenhandtuch in den Hosenbund gesteckt. Es sah merkwürdig aus, und er schien sich ausnahmsweise dessen bewußt zu sein, denn er öffnete nur spaltbreit.
»Post von Ihrer kleinen Tochter«, informierte ihn Angela fröhlich und streckte ihm das Kuvert entgegen.
Johannes griff danach, bedankte sich und wollte die Tür sofort wieder schließen.
»Darf ich kurz hereinkommen?« fragte sie mit jenem Charme, der jedem Mann aufgefallen wäre.
Johannes zögerte. Er mochte Angela, denn sie bot nicht nur einen höchst erfreulichen Anblick, sie war auch ein rundum liebenswerter Mensch. Stets fröhlich und ohne Launen war sie der Sonnenschein in Schubarts 58-Zimmer-Häuschen.
Roteck zog voll Unsicherheit die Schultern hoch. »Entschuldigen Sie, aber ich bin auf Gäste nicht eingerichtet. Es sieht nicht besonders gut hier aus.«
Angela winkte ab. »Weiß ich ja. Wir können uns trotzdem ein bißchen unterhalten.« Angela trat einfach ein. Sie war der Ansicht, daß Roteck zu den Männern gehörte, die man zu ihrem Glück zwingen mußte.
»Ich bin gerade dabei, mir einen Teller Suppe…« Man roch, sah und hörte es, denn inzwischen kochte der Topfinhalt über, brannte auf der Kochplatte an und verbreitete einen unangenehmen Gestank. Johannes eilte zum Elektrokocher, zog den Topf herunter und verbrannte sich prompt die Finger. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schüttelte er beide Hände.
»Sofort unters kalte Wasser!« riet Angela, die mit Johannes litt. Er ließ den Brief fallen und befolgte Angelas Rat. Die Brandblasen, die sich sofort bildeten, schmerzten höllisch. Morgen würde er keinen Schraubenschlüssel halten können, dabei gab es täglich etwas zu montieren.
»Ich glaube, das war meine Schuld«, meinte Angela zerknirscht. »Es tut mir leid. Ich mache auch alles wieder sauber, und ich sorge für eine Ersatzmahlzeit.«
Johannes schüttelte etwas schwerfällig den Kopf. »Mit Ihnen hat das gar nichts zu tun, Angela. Mir fehlt eben die Übung als Hausmann. Das ist alles. Danke, daß Sie herübergekommen sind, um mir Jessis Brief zu bringen.« Johannes bückte sich. Dabei fiel ihm das lockige dunkle Haar ins Gesicht, was ihn jünger erscheinen ließ, als er mit seinen 34 Jahren war. »Jessis Briefe sind für mich der einzige Lichtblick. Ich liebe meine kleine Tochter und leide sehr unter der Trennung.« Die letzten beiden Sätze nuschelte Johannes wie im Selbstgespräch vor sich hin. Fast schien es, als habe er Angelas Anwesenheit vergessen. Er riß den Umschlag auf und überflog hastig den Briefbogen mit den kindlichen Schriftzügen.
»Jessi kommt mich besuchen«, verriet er, vor Freude ganz rot im Gesicht. »Sie will die Sommerferien hier verbringen. Oma Elfi hat nämlich bestimmt, daß sie im Internat bleiben soll, was ihr sicher keinen Spaß machen würde. Die meisten Schüler fahren zu ihren Eltern.«
Angela, die inzwischen die Kochplatte gesäubert hatte, freute sich mit Johannes. »Das ist eine gute Nachricht. Nun lerne ich Ihre kleine Tochter doch noch kennen. Ich bin nämlich während der Ferien ebenfalls hier. Unser Chef fliegt mit Frau und Sohn in die Südsee auf irgendeine kleine Insel. Wir werden es also sehr ruhig und gemütlich haben. So richtig zum Erholen.«
»O Gott, es geht ja gar nicht«, ächzte Johannes erschrocken. Die frische Farbe wich aus seinem hübschen Gesicht. »Unmöglich! Ich muß Jessi sofort mitteilen, daß, daß…« Ratlos sah Roteck die Hauslehrerin an.
»Was denn? Warum geht es nicht?« Angela schüttete den Rest der Suppe in einen anderen Topf und setzte sie nochmals auf. Schließlich mußte Johannes etwas essen.
»Schauen Sie sich doch um. Ist das eine Umgebung, in der sich ein Kind wohl fühlen kann? Ich kann Jessi doch nicht in dieses vergammelte Kutscherhaus bringen. Sie ist sehr behütet aufgewachsen und auch etwas verwöhnt. Daß man so leben kann wie ich im Moment, würde sie nicht begreifen. Sie würde mich verachten, denn ich hause hier wie ein Landstreicher.« Johannes war froh, daß er seine Bedenken mit jemand besprechen konnte.
Angela sah sich kritisch um. Es war zwar sauber, aber trotzdem alles andere als gemütlich. »Vielleicht müßte man nur die Wände frisch tünchen und ein paar Blumen aufstellen, vielleicht auch einen Teppich für den Raum drüben kaufen.«
»Nein«, ächzte Johannes. »Ich werde Jessi auf keinen Fall in diese Bruchbude führen. Für eine Person mag der Platz gerade noch ausreichen. Für zwei ist er ohnehin viel zu knapp. Wenn mir der Chef nur Urlaub zubilligen würde, könnte ich mit Jessi in ein Hotel ziehen. Aber Schubart besteht auf den gesetzlichen Regelungen. Vor sechs Monaten besteht kein Anspruch auf Urlaub, sagt er. »Ich bin jetzt fünf Monate hier. Während seiner Abwesenheit soll ich das neueste Automodell im Werk übernehmen und einfahren. Dafür benötige ich ohnehin nur zwei oder drei Tage. Was mache ich nur?« Stöhnend raufte sich Johannes die braunen störrischen Locken.
»Essen Sie zunächst die Suppe. Vielleicht fällt uns etwas ein«, meinte Angela kumpelhaft. Lächelnd stellte sie den gefüllten Teller auf den alten, wackeligen Tisch, der gleichzeitig als Anrichte diente.
Johannes genoß es, seit langem einmal wieder bedient zu werden. Er zog den Hocker her und bedankte sich herzlich bei Angela. Zum ersten Mal sah sie ihn lächeln.
»Leider kann ich Ihnen keinen Platz anbieten, es gibt nur diese eine Sitzgelegenheit. Sorry.« Johannes zuckte die Achseln und schämte sich für seine primitive Unterkunft.
»Kein Problem.« Ohne zu zögern setzte sich Angela auf die Holzkiste neben dem gußeisernen Ofen. »Ich dachte gerade, ob Sie vielleicht für die Zeit, in der Ihre Tochter hier ist, einen oder mehrere Räume in Schubarts Haus bewohnen könnten. Er braucht es ja nicht zu erfahren. Es sind genügend Gästezimmer da, die so gut wie nie benutzt werden.«
»Was sollen die anderen von mir denken?« Johannes runzelte sorgenvoll die hohe Stirn.
»Während unser Chef Urlaub macht, sind nur der Koch, der Butler und ein Zimmermädchen anwesend. Niemand hätte etwas dagegen, und es würde auch niemand etwas verraten, da bin ich sicher.«
»Ich könnte Herrn Schubart ja fragen«, überlegte Johannes, während er die Suppe löffelte.
Angela schüttelte resignierend den Kopf, daß der lange Zopf nach vorne flog. »Das können Sie vergessen. Ganz am Anfang, als ich hier arbeitete, wollte ich meine Mutter kommen lassen, damit sie die Umgebung, in der ich lebe, kennenlernt. Sie wäre nur zwei Tage geblieben, und sie hätte in meinem Zimmer geschlafen. Selbst das hat der Boss strikt abgelehnt. Er hat kein Hotel, hat er gemeint.«
»Hm. Ich weiß, er ist nicht gerade sozial. Aber ich werde Jessi, ich meine meine Tochter, nicht absagen. Es wäre belastend für das Kind, die Ferien im Heim verbringen zu müssen, während die meisten Kameraden bei ihren Familien sind. Eine derartige Härte kann man doch einem zehnjährigen Mädchen nicht zumuten«, meinte Johannes wie im Selbstgespräch.
»Ich meine, es wäre auch für Sie eine große Hilfe, mit Ihrer kleinen Tochter die Ferien über zusammen sein zu können. Ich werde mit den Hausangestellten, die hier bleiben, reden, und ich bin überzeugt davon, sie spielen alle mit.« Angela verschwieg absichtlich, daß die Kollegen den Neuen mißtrauisch beobachteten, weil er mit niemandem sprach und sich immer abseits hielt. Nicht ein einziges Mal war er in den Raum neben der Küche gekommen, den Schubart ›Speisesaal‹ nannte.
»Danke. Sie sind sehr nett zu mir, Angela. Warum?« Es war Johannes bewußt, daß er bei den Kollegen nicht gerade beliebt sein konnte.
Die junge Hauslehrerin zögerte. Dann entschied sie sich dafür, die Wahrheit zu sagen. »Ich mag Sie«, gestand sie mutig.
Für den Bruchteil einer Sekunde flackerte Interesse in Rotecks Augen auf. Es war ihm nicht entgangen, daß Angela eine sehr reizvolle junge Frau war. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit Felicitas, aber das hätte er sich auch nicht gewünscht. »Womit habe ich das verdient?« fragte er und verfiel schon wieder in dumpfe Gleichgültigkeit.
Angela ließ sich nicht entmutigen. »Ich weiß, daß Sie ganz anders sind, als Sie sich geben. Irgendwann werden Sie die Trauer überwinden und wieder ein normales Leben führen. Vielleicht kann Ihnen das Kind dabei helfen.« Angelas Stimme klang mitfühlend. Sie war bestimmt nicht die Frau, die Männer ›anmachte‹, doch sie wußte auch, daß Johannes Roteck nie von sich aus die Initiative ergreifen würde. Er war gefangen in seinem Leid wie in einem ausbruchsicheren Käfig.
»Einerseits wünsche ich mir, daß Sie recht haben, andererseits hätte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Frau nicht vergessen will.«
»Das sollen Sie auch nicht. Aber ich bin sicher, sie wollte nicht, daß Sie sich ewig grämen.« Angela sah ihrem Gesprächspartner in die Augen. Das hatte sie schon öfter versucht, doch er war immer ausgewichen. Diesmal wandte er den Blick nicht ab, und es war, als glimme ein winziger Funken Zuneigung in seinen Pupillen.
»Sie haben recht, und doch fürchte ich, daß ich noch lange ein alter, unausstehlicher Griesgram bleibe. Eine schöne, kluge junge Frau wie Sie sollte keine Minute mit so jemand vergeuden.«
»Immerhin sprechen wir miteinander. Das ist ein Fortschritt.« Angela lachte vergnügt.
Etwas hilflos zuckte Johannes die Achseln. »Danke, daß Sie so viel Geduld mit mir haben, und danke auch für die Suppe. Ohne Sie wäre ich heute hungrig geblieben.«
Angela spürte, daß Roteck allein sein wollte, und respektierte das. Sie verließ das Kutscherhaus und ging leichtfüßig hinüber zu dem langgestreckten Luxusbau. Daß Johannes ihr nachschaute, ahnte sie nicht.
*
Diesmal war Jessica aufgeregt und zappelig. Ihre Reisetasche stand gepackt vor der Zimmertür. Von Sara hatte sie sich schon dreimal verabschiedet. Gern hätte sie unten vor dem Portal gewartet, doch das erlaubte die strenge Oberin nicht.
»Es tut mir leid, Sara, daß deine Eltern noch in Australien sind und du deshalb nicht nach Hause kannst. Wenn mein Papa nicht auch in den Ferien arbeiten müßte, hättest du mitkommen können.«
Die Zimmerkameradin winkte ab. »Ich werd’s überstehen. Im November sind meine Eltern eh zurück. Dann beginnt der australische Sommer, und dann ist es dort unerträglich heiß, haben sie geschrieben.«
Vor dem Portal fuhr ein Auto der Spitzenklasse vor, nagelneu mit superteurer Ausstattung. Jessica sah nicht die Luxuskarosse, sondern nur den Mann, der ausstieg. »Papaa!« schrie sie und stürzte fast aus dem Fenster.
»Mann, ist das ein Schlitten. Dein Vater muß enorm viel Geld verdienen«, staunte Sara ohne Neid.
Diesmal blieb ihr Jessica die Antwort schuldig. Sie schnappte ihre Reisetasche, rannte die Treppe hinunter und lief in der Halle in die ausgebreiteten Arme ihres Vaters. Achtlos ließ sie das Gepäck fallen und klammerte sich jauchzend an Johannes fest.
Er war dem Ansturm kaum gewachsen, denn seine Knie waren schon zuvor weich und drohten jetzt kraftlos einzuknicken. Tränen hatte er in den Augen, und er schämte sich nicht, als sie ihm über die Wangen liefen. Fast wagte er nicht zu atmen, um den Zauber dieser Minuten länger festzuhalten. So lange hatte er sich nach seiner kleinen Tochter gesehnt, nach dem einzigen Menschen, der ihm geblieben war, der zu ihm gehörte. Seine Erregung war so groß, daß er nicht sprechen konnte, nicht einmal ein ›Hallo‹ zur Begrüßung kam über seine Lippen. Überwältigt schloß er die Augen und wünschte sich, die Zeit möge stehenbleiben.
Jessica war ihm ein Stück voraus, denn in ihrer jugendlichen Unbekümmertheit ließ sie Sentimentalität nicht aufkommen.
»Endlich, Papa! Ich warte schon so lange. Fahren wir gleich? Du kannst dir das Heim ansehen, wenn du mich wieder zurückbringst.«
Hätte die Oberin, die diese erste Begegnung kritisch beobachtete, einen Zweifel an der Echtheit der Beziehungen gehabt, wäre er jetzt ausgeräumt worden. Jessica überschüttete ihren Vater mit einer Menge kindlicher Küsse und Streicheleinheiten, daß Rotecks Tränen noch reichlicher flossen, und er befangen stammelte: »Jessi… meine kleine Jessi.« Es lag so viel Gefühl in diesen Worten, daß sich die Oberin abwandte. In achtzehn Dienstjahren hatte sie schon manche freudige Wiedersehensszene erlebt, doch noch nie war die innige Bindung zwischen einem Kind und seinem Vater so deutlich geworden.
Jessica verließ das Internat, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. Nicht einmal an ihre Freundin Sara dachte sie mehr.
Johannes erledigte die Formalitäten und stolzierte steif und noch immer bewegt zu dem neuen Auto, das er für seinen Chef abgeholt hatte und das er nun weisungsgemäß einfuhr. Entgegen der Dienstvorschrift trug er heute keine Uniform, doch Karl Schubart, der mit seiner Familie in die Südsee geflogen war, sah es ja nicht.
Jessica nahm auf der hinteren Sitzbank Platz. Dort hatte Johannes zu ihrer Überraschung einige Päckchen deponiert. Kleinigkeiten waren es, von denen er glaubte, daß sie seiner Tochter Freude machen würden. In dieser Hinsicht hatte er sich nicht getäuscht. Strahlend packte das Mädchen aus und jubelte immer wieder über den Inhalt. Der Vater hatte Jessis Geschmack genau getroffen. Erfreut beobachtete er das Kind im Rückspiegel. Dabei fiel ihm auf, daß seine Tochter Felicitas immer ähnlicher wurde. Jessica hatte langes goldblondes Haar und große blaue Augen, genau wie ihre Mutter sie gehabt hatte. Die bronzefarbene Haut hatte sie ebenso vom Vater geerbt wie die langen dunklen Augenwimpern und die exakt gezogenen Brauen, die ihr Gesichtchen interessant machten. Schon jetzt war Jessica eine kleine Schönheit, allerdings ohne eitel zu sein. Und das machte sie so liebenswert, daß sie überall sofort Freunde fand.
Ein tiefes Glücksgefühl erfüllte Johannes, als er mit Jessica dem Besitz seines Chefs zufuhr. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau empfand er wieder Freude. Er war richtig erstaunt darüber. Bisher hatte er das Gefühl, sich wie eine lebendige Leiche zu bewegen. Nun stellte er überrascht fest, daß er lebte. Er hatte positive Empfindungen, obwohl er fest geglaubt hatte, daß ihm dies nie mehr möglich sein würde. Die Tatsache verwirrte Johannes.
Jessica, die nichts von diesen Gedanken ahnte, plapperte munter. Sie erzählte allerlei Begebenheiten aus dem Internat, teil lustige, teils Ereignisse, die nachdenklich stimmten.
Johannes war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt und gab nur knappe Antworten. Jessica störte sich nicht daran. Sie berichtete unbeirrt weiter. »Habe ich dir schon gesagt, daß der Joschi einen Fisch aus dem See geholt hat? Im Gras hat er ihn fallengelassen. Und keiner hat sich getraut, den armen Fisch anzufassen, weil er so gezappelt hat. Ich hab’ ihn ins Wasser zurückgebracht, und er ist weggeschwommen.«
»Das war gut«, lobte Johannes, der nicht ganz bei der Sache war. Mit einem flauen Gefühl im Magen dachte er daran, daß er Jessi gleich erklären mußte, daß ihm weder dieses Auto gehörte noch das Haus, nicht einmal das Kutscherhäuschen. Eben bogen sie nämlich auf die Privatstraße ein, die zu Schubarts Grundstück gehörte. Wie von Zauberhand öffnete sich ein schmiedeeisernes Tor. Der gepflegte Park präsentierte sich dem Besucher von seiner schönsten Seite. Wie ein imposantes Schloß lag Schubarts Heim im Sonnenlicht. Die Ziegel der beiden Rundtürme glänzten, und die Fahne auf dem Dach flatterte im Wind.
»Wow!« machte Jessica überrascht. »Das ist ja galaktisch!«
Dieser Ausdruck bedeutete höchste Anerkennung, dessen war sich Johannes bewußt. Deshalb brachte er es nicht fertig, sein Töchterchen zu enttäuschen. Ich werde ihr alles später erklären, vertröstete er sich.
»Dein Haus ist ja viel schöner als das von Oma Elfi. Das muß ich ihr unbedingt schreiben. Weil sie gesagt hat, daß du es nie mehr zu etwas bringen wirst.«
»Sicher hat sie recht damit«, murmelte Johannes, allerdings so leise, daß Jessi ihn nicht verstand.
»Das sieht ja aus wie das Dornröschenschloß in meinem Märchenbuch. Hat es auch so viele Zimmer?«
»Ich weiß es nicht«, seufzte Johannes, der sich plötzlich elend fühlte, weil ihm die Lügerei nicht lag. Aber sollte er Jessi gleich den ersten Tag verderben, indem er ihr erklärte, welch ein armer Hund er war? Das Kind mußte ihn ja verachten. Es würde ihn für einen jämmerlichen Versager halten, und das wollte Johannes nicht riskieren.
Er fuhr den neuen Wagen zur Garagenhalle und ließ Jessica dort aussteigen. Das große Tor öffnete sich schon, als sich der Wagen näherte. Die verschiedenen Automodelle, die in Reih und Glied nebeneinander standen, wurden sichtbar.
Jessica bekam große Augen. Ihr Mund blieb vor Überraschung offen. »Die gehören alle dir?« fragte sie mit Bewunderung in der Stimme.
Johannes fühlte sich geschmeichelt, aber er bejahte die Frage trotzdem nicht. Er überging sie kurzerhand und zeigte auf den hauseigenen Tennisplatz. »Schau mal, da drüben können wir miteinander üben.«
»Mann, das ist ja… ist ja sagenhaft.« Jessica kam aus dem Staunen nicht heraus. »Daß du es schön hast, hab’ ich ja gewußt, aber so schön…« Das blonde Mädchen schüttelte den Kopf mit dem langen Pferdeschwanz. »Wenn ich das im Internat erzähle, glauben sie mir nicht. Wir müssen unbedingt Fotos machen, Papa. Daß du der beste Ingenieur auf der ganzen Welt bist, hab’ ich ihnen schon gesagt, aber jetzt muß ich ihnen auch sagen, was dir alles gehört. Die werden staunen.«
»Langsam, langsam. Wir müssen da noch über etwas reden«, versuchte Johannes, sein Töchterchen vorzubereiten. Doch Jessica war viel zu aufgeregt, um drauf einzugehen.
*
Die Angestellten des Hauses Schubart, die während des Urlaubs ihres Chefs die Stellung hielten, hatten in dieser Zeit nicht viel zu tun. Deshalb kamen sie auf die Idee, ein wenig Theater zu spielen. Das brachte Abwechslung in die langweiligen Ferienwochen und machte außerdem Spaß.
Johannes ahnte von dieser Verschwörung nichts. Arglos ging er mit Jessica auf das Herrenhaus zu. Der Butler kam ihnen entgegen, grüßte mit höflicher Verbeugung und nahm Johannes die Reisetasche ab.
Roteck war so verblüfft, daß er wie festgewachsen stehenblieb. Er hatte bisher mit dem Butler seines Chefs nur ein paar belanglose Worte gewechselt, und nun wurde er so ehrerbietig empfangen, daß dies nur ein schlechter Scherz sein konnte.
»Des schönen Wetters wegen habe ich für die Herrschaften den Tisch auf der Terrasse decken lassen. Es ist alles bereit, Sie können sofort essen.«
In Johannes Kopf schrillten tausend Alarmglocken. Das Geräusch war so eindringlich, daß er die Augen schloß und schwankte, als habe sich ein Abgrund vor ihm aufgetan.
Jessica bemerkte nichts davon. Sie hüpfte nach Kinderart fröhlich voraus und schien neugierig darauf zu sein, das neue Zuhause kennenzulernen. Ihre Bewunderung für den Vater stieg von Minute zu Minute.
»Komm, Papa, beeile dich. Ich habe Hunger«, rief Jessica von der Freitreppe her.
Johannes hatte sich das alles etwas anders vorgestellt. Unauffällig wollte er zwei Zimmer im Seitentrakt beziehen und die Räume des Haupthauses meiden. Er wollte weder die Terrasse benutzen noch die Salons, die seinem Chef vorbehalten waren. Er wollte auch nicht vom Butler bedient und vom Küchenchef bekocht werden. In diesem Moment war Roteck fest entschlossen, die Sache sofort zu regeln. Doch dann sah er die Begeisterung in Jessis blauen Augen, und er hatte nicht den Mut, die Freude des Kindes schon in der ersten Stunde zu zerstören.
Fast ehrfürchtig sah sich Jessica um, als sie durch die mit Kunstgegenständen überladene Halle und den protzig eingerichteten Wohnraum gingen, dessen wandhohe Glasfront sich zur Terrasse hin öffnen ließ. Tatsächlich war unter dem bunten Sonnenschirm der Tisch für zwei Personen gedeckt. Sehr aufwendig sogar. Da fehlten weder die frischen Blumen noch die Stoffservietten. Sogar an eine süße Überraschung für Jessi war gedacht. Der Koch erschien in seiner weißen Berufskleidung, die hohe Mütze auf dem Kopf. Auf silbernen Platten servierte er allerlei Leckerbissen.
»Das ist wie im Film«, staunte Jessi. »Muß ich unbedingt Oma Elfi schreiben. Die ärgert sich grün und blau!« Jessi rieb sich kichernd die Händchen.