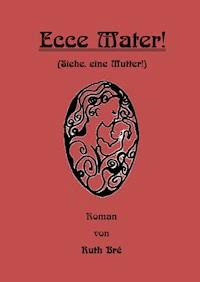
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ecce Mater! entstand um 1900 und war ursprünglich als Bühnenstück geplant. Es thematisiert das sogenannte Lehrerinnenzölibat, dem Lehrerinnen in Deutschland bis 1958 unterworfen waren. Die Protagonistin, die sich im Roman zwischen "Brot oder Liebe" entscheiden muss und die für die Abschaffung des Lehrerinnenzölibats und für die freie Mutterschaft kämpft, nimmt den realen Kampf der Autorin vorweg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorische Notiz
Diese ungekürzte Ausgabe entspricht der originalen Erstausgabe von 1905, die im Verlag Felix Dietrich in Leipzig erschienen ist.
Die ursprüngliche Schreibweise und Zeichensetzung wurden bewusst beibehalten.
Zu Ruth Bré
Der Name Ruth Bré ist ein Pseudonym. Der Geburtsname der Frau, die sich dahinter verbarg, war Elisabeth Bouness – zumindest wurde dieser Name in die Amtsbücher eingetragen, denn Elisabeth Bouness wurde am 19. Dezember 1862 in Breslau unehelich und heimlich geboren. Unter falscher Identität erlebte sie eine entbehrungsreiche, mutter- und vaterlose Kindheit in einem schlesischen Bergdorf.
Obwohl aus ärmlichen Verhältnissen stammend, schloss Bouness 1883 ein Lehrerinnenseminar ab, das üblicherweise ambitionierten Bürgerstöchtern vorbehalten war. Lehrerinnenseminare wurden – im Vergleich zur fundierten und besser bezahlten Ausbildung der Kollegen – systematisch mangelhaft ausgestattet, auch um dem wachsenden Konkurrenzdruck vorzubeugen. Zudem war der Beruf für Frauen mit der sogenannten Zölibatsklausel belegt.
Elisabeth Bouness entschied sich für ‚Brot statt Liebe‘ und unterrichtete zwei Jahrzehnte an evangelischen Breslauer Volksschulen unter anderem Religion und Gesang. Nebenbei schrieb sie romantisch-todessehnsüchtige Lyrik und inszenierte Sagen- und Märchenstoffe – auch unter dem Pseudonym Elisabeth Michael. Erst im reiferen Alter entstanden komödiantische Theaterstücke mit frauenrechtlerischem Unterton, mindestens ein Roman und schließlich – unter neuem Pseudonym – radikale mutterrechtliche Kampfschriften, die sie zu einer der meist gehassten, aber auch verehrten Frauenrechtlerinnen im Kaiserreich machten.
1904 gründete Ruth Bré den Bund für Mutterschutz. Sie starb am 7. Dezember 1911 verarmt in Herischdorf (Schlesien).
Zu Ecce Mater!
Das Drama Ecce Mater! entstand um 1900 unter dem Titel Mutter und war ursprünglich als Bühnenstück geplant. „Ich habe […] in dieses Werk alles hineingelegt, was ich bei dem Worte ‚Mutter‘ empfinde, und was viele Frauen mit mir empfinden, denen es verboten ist Mutter zu sein“, schrieb die unter ihrer unfreiwilligen Kinderlosigkeit leidende (in Das Recht auf die Mutterschaft, 1903).
Die Protagonistin des Dramas Ecce Mater! ‚Helene Baumann‘ tritt im Drama als Vorkämpferin des ‚dritten Geschlechts‘ auf, als handelnde, regelbrechende ‚neue Frau‘ – ein in der zeitgenössischen emanzipatorischen Tendenzliteratur beworbener Frauentypus. ‚Helene Baumann‘ nimmt den politischen Kampf vorweg, den Ruth Bré erst noch beginnen wird. Der Titel des Werks und der Vorname der Hauptfigur weisen auf Brés Mitstreiterin und spätere Konkurrentin hin, die Nietzsche-Verehrerin Helene Stöcker (1869-1943). Erst 1905 erschien das autofiktive Drama als patriarchatskritischer Roman unter Pseudonym. Der Roman galt als das bekannteste unter Brés dichterischen Werken.
Dr. Julia Polzin
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
I.
Es ist mittags nach Schulschluss. Die Klassen sind leer bis auf wenige „Nachsitzer“, die etwa noch hier und da stecken mögen. Im allgemeinen ist heute die Lust zum „Nachsitzen“ auch bei der Lehrerschaft nicht gerade gross, denn morgen ist Schluss! Morgen beginnen die grossen Ferien. Da ist das Herz nur noch halb hier. Die andere Hälfte ist „da draussen in der weiten, schönen Gotteswelt“, die sich mit allen ihren Wundern nun für einige Wochen auftun soll! Des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr wird morgen anhalten und vier Wochen lang nicht aufgezogen: ein geradezu unendliches Glücksseligkeitsgefühl für jeden, der, sei es in welchem Berufe immer, sein Leben lang nach dieser ewig gleichgestellten Uhr antreten muss.
In der fünften Klasse ist die Lehrerin noch anwesend. Sie sitzt auf dem Katheder und korrigiert emsig. Ihre Gedanken sind noch ganz bei der Sache, wie es scheint. Sie schweifen wohl noch nicht in die schöne Gotteswelt. Kaum dass ein Blick über die leere Klasse fliegt.
Helene Baumann ist eine jugendliche, biegsame und doch kräftige Erscheinung mit anmutigen, ernst überhauchten Zügen, etwa 25 Jahre alt.
Dunkles Haar umrahmt ein ausdrucksvolles Gesicht, in dem grosse dunkle Augen leuchten. Eigentlich sind sie grau, aber sie erscheinen fast schwarz in ihrer unergründlichen Tiefe.
Helene Baumann repräsentiert nicht im geringsten den Typus „Lehrerin“, wenigstens bis jetzt nicht und selbst im Umgange mit den Kindern nicht, die sehr an ihr hängen. Viel eher könnte man sie für die Mutter oder die ältere Schwester der kleinen Schar halten. Das Kollegium mag sie gut leiden. Sie ist so „vernünftig“, meint Anni Lenz, die jüngste Kollegin, die in diesem Augenblicke den Kopf zur Tür hereinsteckt.
„Ich glaube gar – richtig, da ist sie noch!“ ruft Anni mit ihrer hellen Stimme nach draussen zurück. – Sie kommt herein, gleich hinter ihr Fräulein Walde, die älteste Lehrerin der Schule, eine liebenswürdige Vierzigerin mit graumiliertem Haar und jener stillen Resignation, die sich mitunter über die Züge derer breitet, die „nur noch Lehrerinnen“ sind, die darauf verzichtet haben Weib sein zu wollen mit eigenem Menschenglück.
Anni, ein lebhafter Blondkopf von kaum 23 Jahren – man möchte sie für neunzehn halten – springt auf Helene zu und überschaut mit Feldherrenblick das Schlachtfeld der korrigierten und der nicht korrigierten Hefte. „Ja, Baumännchen, was machten Sie denn noch hier? Das ganze Haus ist ja schon leer“, meint Fräulein Anni beinahe strafend. „Ich korrigiere, Kleines“, sagt Helene lächelnd, ohne sich in ihrer Arbeit stören zu lassen.
Anni ist empört. „Einen Tag vor den grossen Ferien? Schämen Sie sich!“ „Aber ich muss doch!“ verteidigt sich Helene.
„Schämen Sie sich!“ beharrt Anni, „diese Fachsimpelei! Fräulein Walde, nein, sehen Sie nur! Bis zur letzten Minute verspritzt sie ihr teures Blut für das heranwachsende Jung-Deutschland“. Sie schlägt ein Heft auf, in dem viele Fehler rot angestrichen sind. „Hu, die Fehler!“ schaudert sie. „Was ist denn das für eine Nummer!“ Sie liest das Titelblatt. „Grete Heider! – na ja,“ meint sie verständnisinnig. „Geistreiche Familie! habe auch einen Ableger davon! Belegexemplar für die Darwinsche Theorie.“
Sie schlägt noch mehrere Hefte auf und wirft sie unordentlich durcheinander. „Sie Unband“, droht Helene. „Werden Sie mir die Hefte nicht durcheinander werfen!“ „Grade werde ich sie durcheinander werfen“, lacht Anni. „Sind das Ferienvorbereitungen, Sie???“
Helene seufzt: „Ach, Kinder, mir ist gar nicht nach Ferien zu Mute.“
„Mir sehr!“ Anni trommelt vor Vergnügen auf ein Pult. Jugendlust lacht aus ihrem rosigen Gesicht.
„Ja, zu sehr“, neckt Fräulein Walde. „Ihnen stecken die Ferien schon acht Tage in den Gliedern, wie den Kindern.“
„Sie haben recht, ja, ja!“ frohlockt Anni. Sie dehnt sich mit ausgebreiteten Armen, ganz Lebensfreude, ganz Glückssehnsucht, ganz Freiheitsrausch. „Gott, Gott – ist das ein Gefühl! Ich hab᾽s den Kindern gar nicht verdacht, wenn sie zerfahren waren. Ich bin ja selber so!“, gesteht sie ohne Umschweife.
„Das habe ich gemerkt“, bestätigt Marie Walde. Zu Helene gewendet, fährt sie mit gespieltem Ernst fort: „Gesehen und gehört hat sie schon ein paar Tage nicht, die Kleine. Ist gestern im Korridor an mich gestreift und hat mich nicht gesehen.“
„Wirklich, Fräulein Walde?“ frägt Anni entschuldigend. „Da muss es wohl sehr dunkel gewesen sein. Gewiss in der finstern Ecke“.
„Na, na“, neckt Fräulein Walde. „Ihnen leuchtete es sehr hell aus den Augen.“
Anni wird ein bischen verlegen, aber sie schüttelts rasch ab. „Ach – Sie wollen mich blos ärgern.“ Sie hockt auf eine Bank nieder und erklärt kategorisch: „Einen Tag vor den grossen Ferien ärgere ich mich aber grundsätzlich nicht. Punktum“.
Schon leuchtet᾽s wieder aus ihren Augen.
„Kinder, Kinder, es ist doch ein Hochgefühl! Vier Wochen frei! Mensch, nichts als Mensch sein! Nicht immer die Amtsmiene mit sich herumrumtragen!“
Der Hinweis auf Annis „Amtsmiene“ lässt Helene lächeln und Fräulein Walde herzlich lachen. Jetzt ist Anni doch ein wenig beleidigt. „Na, ja, Baumännchen, – hier bin ich doch nicht vor der Klasse. Hier brauch᾽ ich doch nicht so feierlich sein.“
„Haben Sie das Kleine schon einmal feierlich gesehen?“
„Oho, neulich in der Geschichtsstunde erst, bei dem Tode der Königin Luise,“ verteidigt sich Anni, nun wirklich ernst werdend. „Da hat die ganze Klasse geweint und ich natürlich mit. Ich kann mir nicht helfen: ein solches Frauenschicksal ergreift mich tiefer als die blutigsten Kriege und die gefährlichsten Staatsaktionen.“
„Auch Helene ist ernst geworden. Sie steht auf und umarmt Anni: „Sie liebes Herz“.
„Ja, ja, Ihr müsst nicht denken, dass ich noch so ein Kind bin,“ meint Anni, in deren erst noch so übermütigen Gesicht sich jetzt tiefer Lebensernst spiegelt und die verborgenen Schätze dieser erst erwachenden Frauenseele ahnen lässt.
„Das denkt auch niemand, Anni!“ sagt Fräulein Walde, im Innern eigentümlich berührt von der Wandlung des so lebensprühenden Lieblings.
Anni verscheucht die nachdenkliche Stimmung schon wieder. Noch hat das Quecksilberne bei ihr die Oberhand. „Na, lassen wir᾽s, macht sie mit einer den Zwischenfall beendenden Handbewegung. „Jedenfalls bis nach den Ferien. Sagen Sie mir lieber, was Sie in den Ferien vorhaben.“
„Ich setze mich in einen stillen, grünen Winkel und ruhe mich aus“, sagt Fräulein Walde. „Das wissen Sie ja.“
„Und Helenchen?“ fragt Anni.
„Ich weiss es noch nicht, Anni.“
Anni ist starr. „Ja, wann wollen Sie᾽s denn wissen? Morgen ist doch Schluss!“ – „Ich werde mich erst in den nächsten Tagen entscheiden,“ meint Helene zögernd.
„Wie ich das finde!“ Anni wittert Geheimnisse. Ihre jungen Augen durchdringen manchmal ganz merkwürdig Menschen und Dinge. „Sie sind überhaupt – so – so – wie wenn was nicht richtig wäre! – Ja, ich besitze Menschenkenntnis, – wenn man mir᾽s vielleicht auch vielleicht nicht ansieht,“ setzt sie hinzu, da die anderen nicht umhin können, über die kleine Weltweise zu lachen, wenn es auch beiden, zumal Helene, nicht sonderlich zum Lachen zu Mute ist.
„Ich wette, Sie kennen augenblicklich nicht mal Ihren eigenen inneren Menschen“, will Marie Walde ablenken.
„Ach, der ist auch nicht weiter interessant“. Anni schnippt mit den Fingern. Sie überhebt sich nicht. „Aber Helene“ – von ihren Gedanken über diese Helene, „diese Lehrerin“, die am Tage vor dem Schulschluss noch nicht weiss, was sie in den grossen Ferien anfangen will, während andere schon ein halbes Jahr vorher Reisepläne fix und fertig haben, – von den Gedanken über diese Helene kommt sie nicht los. Da ist etwas nicht richtig. Das ist doch klar. Sie versucht von anderer Seite, „hinten herum“, wie sie inwendig denkt.
„Sehen Sie, Helenchen, voriges Jahr war᾽s doch so nett, wie wir zusammen im Altvatergebirge gewandert sind.“ – Sie blinzelt zu Helene hinüber. „Wissen Sie noch: die endlose Waldschneise?“
Ein Lächeln huscht über Helenens Züge bei der fröhlichen Erinnerung. „Die uns die Gebirgsweiblein empfohlen hatten, weil sie uns für fromme Waller hielten“ –
Anni: „Die ihre Sünden unterwegs schon abbüssen wollten!“–
Helene: „Und nun fünf Stunden kein Haus, kein Quell, kein Mensch“ –
Anni: „Endlich das Wallfahrtskirchklein ‚zum Heidebrünnel‘ wie ein herziges Spielzeug drüben am Berge“ –
Helene: „Und abends die Fidelitas im Georgenschutzhause“–
Anni: Der Harfner mit seinem ‚Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein‘?“
Anni᾽s Nachahmung des Baudensängers weckt einen stürmischen Heiterkeitsausbruch.
„Und dabei draussen strömender Regen“, erinnert sich Helene lachend.
„Und die armen Durchnässten!“. Anni schüttelt sich in der grausigen Erinnerung. Mir tragischer Gebärde singt sie:
„Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt: ‚Das ist, das ist Lützows wilde, verwegene Jagd‘.“
Bei dem Refrain summt, von Anni᾽s unwiderstehlicher Komik angesteckt, Helene leise mit, was zur Folge hat, dass Anni in ausgelassener Lustigkeit über sie herfällt.
„Ach, war das fidel! war das fidel!“ sprudelt sie hervor. „Sehen Sie Helene, so lustig hätte es jetzt wieder werden können, wenn Sie mit uns nach Tirol gingen.“
Der Schatten huscht wieder über Helenens Gesicht.
Sie setzt sich, wie Anni, auf ein Pult, während Marie Walde den einzigen Stuhl im Klassenzimmer nimmt. „Ach, Kindchen, ich und nach Tirol! Das erlaubt meine Kasse nicht. Ich habe andere Pflichten, als Sie.“ –
„Ich weiss es ja, Sie haben für ihr Mütterchen zu sorgen“, meint Anni mit dem lieben, sehnsüchtigen Ausdruck eines Kindes, das keine Mutter mehr hat. „Ich könnt᾽s ja auch nicht, wenn ich nicht noch bei Papa wohnte. Aber so habe ich doch wenigstens das übermenschlich massenhafte Wohnungsgeld zum Verreisen.“
Jeder Stadtvater würde sein Vergnügen an dem „übermenschlich massenhaften Wohnungsgelde“ haben, in einer Zeit, wo die Petitionen einander jagen. Ironie würde er hinter diesen lachenden Augen ja nicht vermuten.
„Dieser Uebermut“, verweist Fräulein Walde. „Sie werden es dahin bringen, dass man Ihnen etwas abzieht“, mahnt Helene.
„Ich sag᾽s doch nur zu Euch, Kinder“, lacht Anni. „Nach aussen hin schimpf᾽ ich natürlich.“
Entzückend, dieses „natürlich“. Wieder schade, dass es kein Stadtvater hört.
Jetzt motiviert sie ihre Reiselust: „Sehen Sie, ich muss doch auf die Berge raufkraxeln, so lange ich noch jung bin. Was nützen sie mir denn später, wenn ich sie mir nur von unten ansehen kann.“ Das lässt sich hören. Aber sie hat noch andere Argumente, diesmal wehmütige, die man aus ihrem Munde garnicht gut hören kann.
„Und dann – wenn ich erst mal bei mir wohne, ohne meinen guten Papa, dann hört überhaupt alle Lebensfreude auf!“
„Anni, bis dahin wohnen Sie längst bei einem andern“, sagt Fräulein Walde bewegt.
„Ich? Wieso? Ach Unsinn!“, wehrt Anni, ebenfalls bewegt und dazu verlegen. Aber sie fasst sich. Sie lenkt ab. „Helenchen, wie ist᾽s? Mögen Sie nicht doch noch mitkommen?“
„Es geht wirklich nicht, Kind.“
„Denken Sie, Tirol!“ fährt Anni, Sturm laufend, fort. „Ach, wie freue ich mich! Ich träume schon die ganze Zeit von Gletschern und Eisfeldern und Alpenglühen und Wasserstürzen – und grünen Matten und Sennhütten – was weiss ich! – In der Geographie hab᾽ ich diese Woche nochmal die Alpenländer gründlich wiederholt, weil ich doch nichts anderes denken konnte. Eigentlich ist Mathematische dran, aber die nehme ich nach den Ferien weiter. Sämtliche Fixsterne und die übrigen Planeten interessieren mich augenblicklich garnicht, wo doch unsre gute, alte Erde so schön ist.“
Wie glücklich muss sie sein, diese junge Lehrerin, wenn ihre Lebensfreude so den gesamten Unterricht beherrscht und verklärt. Die beiden anderen sehen nachdenklich drein. Helene seufzt. Aber sie soll nicht seufzen, Anni will alle Menschen froh und glücklich sehen.
„Fräulein Walde, reden Sie doch Helene zu, dass sie mitkommt“, wendet sich Anni an die ältere Kollegin.
„Sie muss es selber am besten wissen, Kind“, sucht Marie Walde die ungestümen Bitten zu dämpfen.
Anni ist noch nicht schachmatt.
„Sehen Sie, Helene, wir richten uns ja auch ganz billig ein. Zu Vieren reist es sich überhaupt billiger, meint Papa.“
„Zu Vieren?“ fragt Helene. Da hat sie sich verschnappt, die kleine Anni. „Ja“, macht sie wie beiläufig, „ja so! Sie wissen doch, dass Herr Färber mit uns reist.“
„So, so?“ sagt Helene gedankenvoll. Nun weiss sie, warum Anni „die alte Erde so wunderschön“ findet, dass sie nach Himmel und Sternen nicht fragt. Glückliche Anni!
Fräulein Walde muss die Stimmung retten. „Offiziell wissen wir von dieser Familienreise bis jetzt nichts.“ Sie zieht Anni ein bischen am Ohr. „Ja“, meint Anni mit gut gespielter allgemeiner Menschenliebe, „der arme Kollege ist doch so verlassen, wissen Sie, da seine Mutter gestorben ist. Darum nehme ich mich seiner an. Das ist doch kollegialische Pflicht. Nicht?“
„Freilich, freilich!“ bestätigt Marie Walde. Pflicht des liebenden weiblichen Herzens ist es jedenfalls, denkt sie.
Anni᾽s Gedanken sind schon wieder, auch zur besseren Motivierung, dem Praktischen zugeflogen. „Und einen praktischen Nutzen hat die Sache auch,“ doziert sie. „Er trägt mir nämlich meinen Rucksack, hat er mir versprochen!“ „O je!“ ruft sie mit plötzlichem Schreck.
„Was denn?“, fragen die Kolleginnen rasch. „Ja, dem wollten wir doch eben kaufen gehen,“ erklärt Anni bestürzt. „Das habe ich ja ganz vergessen.“
„Der Aermste“, bedauert Helene. „Sie Grausame!“ droht Fräulein Walde.
Aber bei Anni überwiegt die Angst. „Er wird doch nicht fortgelaufen sein?“
„Sicher nicht“, tröstet Helene. Sie öffnet die Tür und ruft hinaus: „Herr Färber, bitte, kommen Sie doch herein! Fräulein Lenz ist noch lange nicht fertig.“ Der Gerufene tritt ein.
Hermann Färber ist eine liebenswürdige Erscheinung, schlanke Gestalt, dunkle Augen und schwarzes Schnurrbärtchen, blühende Gesichtsfarbe, gewandtes Auftreten, ohne im mindesten geckenhaft zu sein. Als Kollege erfreut er sich durch allzeit gefälliges Verhalten und eine Dosis frischen Humors, die nur in letzter Zeit durch den Tod seiner Mutter etwas beeinträchtigt war, allgemeiner Beliebtheit. Dieser Flor, der nach dem Todesfalle über seinem sonst so frischen Wesen lag, hatte wohl Anni mehr und mehr zu ihm hingezogen. Sie konnte „ihn nicht ernst sehen“, „es stand ihm nicht“, meinte sie. In Wirklichkeit fühlte ihr Herz die Tiefe, ehrliche Trauer mit, und sie suchte die Lücke, die dem nun Vereinsamten entstanden war, so gut als möglich auszufüllen, den Verlust an Liebe ihm so zart als möglich zu ersetzten. Sie war dabei auch manchmal ganz ernst, die kleine Anni. Aber er fand, „das stand ihr sehr gut“. War sie dann wieder heiter, „so stand᾽s ihr aber auch“. Kurz, Anni war ihm lieb, wie sie war. Und er wollte diese Reise mit ihr und ihrem Vater machen, um sich auf den freien, grossen Bergen sein Glück zu holen. Darum fand Anni die alte Erde so wunderschön, dass alle Fixsterne und die übrigen Planeten neben ihr nichts, aber auch rein garnichts waren. –
Färber hat sich von den drei Kolleginnen in seiner netten ungezwungenen Art verneigt. „Ist᾽s erlaubt, meine Damen, die spezifisch weibliche Konferenz zu stören?“
„Ach, entschuldigen Sie, dass Sie solange warten mussten“, bettelt Anni, „aber wir trennen uns doch jetzt auf ganze vier Wochen. Und Helene kommt wirklich nicht mit.“
„Ach, wie schade, Fräulein Baumann“, sagt der junge Mann, aufrichtig bedauernd. „Wir hätten uns so sehr gefreut.“
„Und erst Papa!“ wirft Anni ein. „Es wäre auch eine viel bessere Einteilung gewesen“, fügt sie hinzu.
„Ja so“, lächelt Helene.
„Nein, wirklich“, fährt Anni beteuernd und voll Eifer fort. Man soll sie nicht verkennen, die geliebte Helene, soll ihr nicht etwa egoistische Motive unterschieben, als ob Anni, um mit ihrem noch geliebteren Hermann möglichst viel ungestört zu sein, etwa die Freundin nur als Gesellschafterin für den Papa engagieren wolle. „Ich glaub᾽s ja, mein Herz“, beruhigt Helene. „Aber diesmal müsst Ihr Euch wirklich einen anderen vierten Mann suchen.“
Da alle Bitten bei Helene scheitern, mahnt Anni nunmehr zum Aufbruch, den Damen die Hände schüttelnd, nicht ohne ihren Herzallerliebsten etwas „anzuulken“, wie sie das nennt.
„Kommen Sie, Herr Schönfärber“, ruft sie, als Färber sich mit einigen Artigkeiten von den Damen verabschiedet.
„Das lassen Sie sich gefallen?“, neckt nun Fräulein Walde den jungen Kollegen.
„Vor läufig, Fräulein Walde“, erwidert dieser prompt. „Ach was“, dekretiert Anni, schon in der Tür, „den Namen habe ich ihm gegeben, und den behält er. Er schneidet zu sehr auf, besonders wenn er von sich spricht.“
„Und das Aufschneiden lassen Sie sich gefallen?“ fragt Helene. „Vorläufig“, ahmt Anni nach und hüpft hinaus. Färber folgt ihr. „Adieu, Kinder“, ruft sie in᾽s Zimmer zurück. Klapp, ist die Tür zu.
Die beiden Zurückbleibenden lachen. Helene sagt darauf mit leiser Wehmut: „Herziger Liebling du!“
Der „Liebling“ öffnet sofort wieder die Tür, kommt mit feierlichen Schritten vor und sieht herausfordernd nach beiden Seiten.
„Kinder, seht Ihr mir nichts an?“ fragt sie endlich. Fräulein Walde betrachtet sie ringsum. „Nein“, sagt sie nach ernsthafter Ueberlegung.
Anni zieht die Augenbrauen hoch. „Keine neue Würde?“
„Anni!“ fragt Helene mit einer Ahnung.
„Das Sie nur nicht falsch raten, Helenchen“, fällt ihr Anni ins Wort. „Also, damit ich Euch nicht länger auf die Folter spanne:
Ich bin unwiderruflich bestätigt.“
„Ja, Anni? Ich gratuliere!“ sagt Helene und schüttelt ihr die Hand.
„Soeben gekommen“, fährt Anni fort. „Der Rektor stand draussen und machte den Brief gerade auf. – Kann also nicht mehr rausgeworfen werden“, setzt sie lustig hinzu.
„Jetzt wird der Uebermut wohl in den Himmel wachsen“, meint Helene.
„Morgen kommt der Schulinspektor – feierliche Ansprache, Ueberreichung der Vokation. „Unwiderruflich“, sagt sie noch einmal mit grossem Nachdruck. An der Tür wendet sie sich um und sagt schelmisch:
„Also ich bitte die geehrten Kolleginnen, mich jetzt für voll anzusehen. – Adieu!“
Klapp – ist die Tür zum zweiten Male zu.
Fräulein Walde sieht Anni lange und gedankenvoll nach. Sie hat sie nicht beglückwünscht zu der definitiven Anstellung. Kein Wort hat sie gesagt. Auch jetzt sagt sie nichts. Sie schaut nur ganz verloren nach der Tür, die sich hinter Anni geschlossen hat.
Es fällt Helene auf.





























