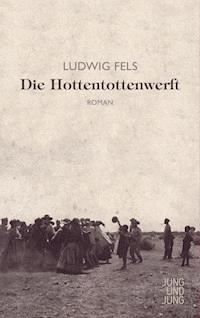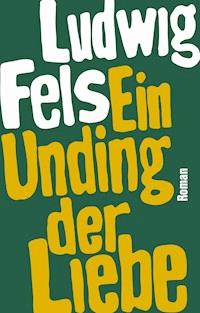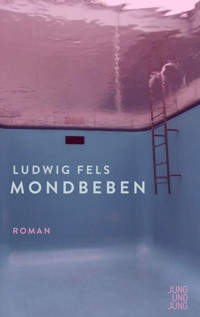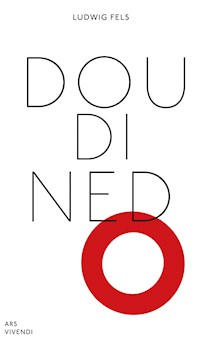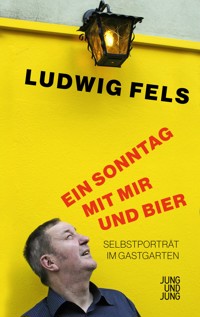
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nicht einmal im Biergarten hat man eine Ruhe vor sich selbst! Ein Dichter nimmt Platz für ein Porträt, in einem Biergarten irgendwo im Fränkischen. Vor der Kamera und aller Welt soll er Auskunft geben über sich und sein Leben, weil er das selbst angeblich am besten kann. Nach und nach verfällt er dem Rausch des Erzählens. Nicht frei von der Leber weg, denn der Regisseur (»Klappe! Text!«) weiß wiederum am besten, was er hören will. Schnell und unversehens wird aus der Selbstauskunft eine Selbstverteidigung gegen Ansprüche, Erwartungen und Zuschreibungen. Der Dichter setzt sich zur Wehr, gegen Steuerfahnder, Verleger und Kritiker, gegen den Platz, der ihm von anderen zugewiesen wird. Er durchmisst die Welt von Treuchtlingen bis nach Antananarivo, begegnet liebeskranken Dackeln und gutmütigen Yetis und taumelt durch die Ahnengalerie einer proletarischen Familiengeschichte. Es ist ein berührendes Selbstbildnis mit Augenzwinkern, ein urkomisches Lebensdokument aus dem Nachlass des großen Romanciers und Lyrikers, an dessen Ende ein nüchterner Befund steht: »Bin da, sage nichts.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EIN SONNTAG MIT MIR UND BIER
© 2025 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlagbild: Jacqueline Godany
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-319-7
LUDWIG FELS
Ein Sonntag mit mir und Bier
Selbstporträt im Gastgarten
Warum trinkt der Mensch mehr, als er ißt
so viel, daß er aufs Essen ganz vergißt
warum trinkt er sich um Kopf und Kragen
und seufzet nur zu allen ernsten Fragen
ja, seufzt sich gar um Hirn und Bauch
als sei Verstummen und Verdummen gleichsam Brauch?
unbekannter Schriftgelehrter
INHALT
STATT EINES VORWORTS
1. SZENE
STATT EINES VORWORTS
Ein Vorwort macht sich immer gut. Bei einem Vorwort denkt man sich gleich, gut, daß noch gar nichts angefangen hat von alledem, was am Ende dann vielleicht doch nicht passiert oder jedenfalls nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ein Vorwort klingt wichtig. Beim Nachwort ist alles bloß ein Schuß ins Schwarze. Übrigens, haben Sie schon gewußt, daß Arbeiter und Arsch dieselben beiden Anfangsbuchstaben haben. Ebenso wie Proletariat und Prekariat. Immer wieder werde ich gefragt: Haben Sie mehr Geld als Arbeiter oder als Dichter verdient? Wederdoch, antworte ich jedesmal. Und auf die Frage: In welchem Leben waren Sie am glücklichsten?, sage ich nur noch: Als Eintagsfliege im Neandertal! Zum Nachbeten: Wenn es darauf ankäme, könnte ich auch auf einem verkrüppelten Eselchen über Palmblätter reiten und meine Gedichte verschenken wie ein Buße tuender Raubritter, kurz bevor er in den Faulturm der Literaturkritik geworfen wird. Womöglich geschähe mir recht, denn zu meiner Entschuldigung könnte ich nur anführen, daß ich in meiner Jugend manchmal arbeiten ging, weil ich nicht dauernd auf Kosten meiner Mutter leben mochte, die Putzfrau war und Fürsorge bezog, weil sie keinen Mann hatte, der für sie dichtete oder arbeitete oder beides. Daß – jedenfalls die hiesige – Literatur in den seltensten Fällen etwas mit Leben zu tun hat, darf hiermit als bekannt vorausgesetzt werden, womit ich mit meinem Vorwort auch schon am Ende wäre und vermeide, daß es als eine Art Sprungschanze benutzt wird, von der aus man den Inhalt weiträumig überfliegen kann, ohne in Franken zu landen, also im Bodensatz der Herkunft meiner selbst. Kein Kriegsgeschrei hie, kein Lobgesang da! Parolen verpönt! Ich bin der Versprengte eines vergessenen Volkes. Ein Vorwort ist wie eine Gesichtsmaske für den Geist aus der Geisterbahn, der sich angstverzerrt grinsend unter seiner Vermummung auf die Achterbahn verirrt hat. Das heißt, wer nicht will, muß das Leichentuch der Schönheit gar nicht erst zurückschlagen, um seiner Existenz ansichtig zu werden. Alles andere ist Babberlababb, wie wir in Franken sagen, wenn wir nicht gerade dichten.
1. SZENE
Ein Biergarten, irgendwo im Fränkischen. Man hat einen Blick unter Kastanienbäumen hervor, entweder auf das jeweilige Stadttheater oder auf eine Raubritterburgruine, und, wenn man sich umdreht, auf eine Bratwurstfabrik, auf ein Brauereiparadies und – wenn man sich erhebt, um den Weg alles Bieres und Fleisches zu gehen – auf ein Ortsschild, auf dem – vielleicht oder bitte – »End« steht; in ländlichen Teilen Frankens locken die Biergärten mit angrenzenden Wildschweingehegen und Kinderspielplätzen. Und jetzt machen Sie einfach die Augen auf oder zu, je nachdem, ob es Tag oder Nacht ist und welche Jahreszeit herrscht.
Auftritt Ich.
Die Kamera zoomt auf das Ich, als es den Biergarten betritt. Es hat ein Pappschild umhängen, auf dem in Großbuchstaben Ichsteht, handschriftlich gemalt, damit es mit niemandem verwechselt werden kann. Es nimmt an einem leeren Tisch Platz, legt einen Stapel Papier ab, schneuzt sich und niest, was aber nicht sein muß, falls es in dieser Szene zu menschlich wirkt. (Man könnte Ichauch eine Bettfeder ins Haar dichten oder eine grüne Zahnbürstenborste in den Mundwinkel, es in einer Bibel blättern lassen, während ihm der Hosenstall offen steht, aber der Maskenbildner wird schon wissen, was er tut.)
Bedienungnähert sich beschwingt, fast tänzelnd (so wie man es mag), macht, egal ob Mann oder Frau, einen Knicks: Darf ich stören?
Unbedingt, sage ich.
Die Bedienung bringt eine Maß, läuft rücklings, damit sie sieht, wie ihr die Kamera folgt. Der Regisseur ruft, das schaue scheiße aus und bricht die Szene ab. Zwei Krüge, meint er, zwei Krüge müßten es mindestens sein, die sie zu schleppen hat, naturnahes Abbild einer volkstümlichen Sklavin für Profialkoholiker. Wir, halte ich dagegen, sind hier nicht auf dem Oktoberfest, sondern in Vrangen, wo es am schönsten ist, und in Vrangen ist es überall schön. Beim zweiten Take bringt die Bedienung zwei Krüge.
Ichkriegt langsam Durst. Trinkt beidhändig und behende, immer zwei Schluck auf einmal, denkt: Endlich spiele ich die Hauptrolle in meinem Leben.
Regisseur: Klappe! Text!
Ich: Wie Sie sich denken können, ich heiße L. F. und bin Vrange! Nach einer Weltreise durch die Arbeitswelt bin ich in diesem Biergarten gelandet. Ich lebe hier und trinke Bier!
Ein sintflutartiges Geräusch. Kontinente ertrinken, die Seele geht unter; es regnet sogar im Paradies. Aber das gehört nicht hierher.
Wissen Sie, ich liebe es, um Mitternacht zu frühstücken, eine Scheibe Brot mit Leber- und eine zweite mit Blutwurst belegt und aufeinandergeklappt, dazu ein Kännchen Whisky Cream, gezuckert und heißgemacht. Nach dieser Stärkung arbeite ich von 1.00 Uhr bis 23.00 Uhr, weil ich nämlich von Beruf Arbeiterdichter bin. Mein Gewerbegebiet liegt in einer Kammer zwischen Bad und Klo, und die Eckpfeiler meines Daseins sind Kühlschrank und Waschmaschine. Das richtige Leben muß man sich erarbeiten, wenn man ein Dichter ist, ganz besonders, wenn man ein Arbeiterdichter ist, weil da muß man dichten und arbeiten gleichzeitig, täglich und nächtlich, also wie pausenlos.
Sonntags schreibe ich auswärts. Auswärts schreiben kann ich nur im Biergarten, wo die erste Ewigkeit beginnt. Dies, weil ich gelesen habe, daß es Dichter gegeben hat, die in großen Städten ferner Länder im Kaffeehaus geschrieben haben, mitten unter Touristen und Idioten, die sich manchmal zum Verwechseln ähnlich waren. Ich würde das nicht aushalten, dauernd irgendwelche Kellner, die sich räuspernd und hüstelnd anschleichen und einem ins Glas oder in die Tasse äugen, ob da noch was drin ist.
Am Sonntag gönne ich mir die Zeit, die Gott zur Erschaffung der Welt brauchte. Am neunten Tag erschuf Er Franken und paßte auf, daß da allerorten genug Platz für Biergärten vorhanden war; erst viel später, um den Zehnten rum, bekamen die Bayern auch ein paar ab, und sie taten, als sei deswegen schon das Paradies auf Erden ausgebrochen.
Ich versuche immer, der Erste zu sein, allein mit mir und meinem Bier. Andere hocken um diese Zeit im Frühnebel an den Fischteichen und lauschen dem Gesang der Karpfen, während ich eine Brotzeit einnehme: einen ansehnlich dicken Schnitz Preßsack und ein halbes Ringelchen Stadtwurst mit Musik; es herrscht schönes Wetter, mir fällt nichts ein, und gerade das ist erholsam. Daheim würde ich zur Entspannung die Waschmaschine laufen lassen und wie in das Bullauge eines Kreuzfahrtschiffs starren. Die Bedienungen eilen zu den Startlöchern, denn jetzt muß alles schnell gehen und lange dauern, denn das ist die Kunst, das Leben der Kunst voranzustellen: das Dasein vor die Empfindung, den Genuß vor die Reue, das Bild vor die Musik, die Literatur vor die Schlachtschüssel, Lyrik, Poesie zum Schmalz ins Kraut, Metzelsuppe und Wellfleisch, Wurstzipfel und Schweinspfoten, Hirnsulz, Sulzhirn. Genuß! GROSSGESCHRIEBEN! Es lebe die Muttermilch des Proletariats! Krug um Krug, bis man in den Brunnen bricht! Die Herzen in Fetzen! Säue vor die Perlen! Dann die Brandung der Wohltaten unter der Schädeldecke, wenn der Anfang gemacht ist und die Schlucke, die man nimmt, nicht mehr gezählt werden, und die einzig verbliebene Steigerung wäre, wenn für die Krüge nicht mehr gezahlt würde, aber von diesem volkswirtschaftlich bedenklich anmutenden Gelüste darf man sich nicht anstecken oder gar besiegen lassen, weil irgendjemand – und wer, wenn nicht ich – hat schließlich die niederen Klassen in der öffentlichen Wahrnehmung zu vertreten. Ich bin zwar nur ein Arbeiterdichter und hätte nichts zu sagen, wenn ich nicht schreiben würde, einer von unten, obwohl niemand so genau weiß, wo das ist, dieser Bodensatz der Gesellschaft, den ich mit meiner Sprache formte, ein Gemisch aus Dreck und Inbrunst, veredelt mit Pathos und Kalkül – denn zu denen zu gehören, die zu allen gehören, käme einer grausamen Bestrafung gleich, die ich nicht verdient hätte, weil mir in meinem Hilfsarbeiterhilfsschriftstellerdasein stets daran gelegen war, mehr Geld zu verdienen, als ich hätte vertrinken können.
In Wirklichkeit bin ich kein Arbeiterdichter. Wenn ich etwas bin, dann ein Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller mit Schreibmaschinenkunstgewerbeabschlußdiplom, also jemand, der in der Vorstellung der Bildungsarbeiter mit hochgekrempelten Ärmeln bis zum Ellenbogen im Klorohr steckt und die Musen dirigiert wie einen wildgewordenen Nixenschwarm. Oder ist Ihnen die Wahrheit lieber?
Kaum lese ich den ersten Satz, den ich geschrieben habe, bringt mir die Bedienung wie maßlos Maß um Maß und das Bier rauscht nur so in mich hinein und hinunter, es ist, wie soll ich sagen, berauschend. Nur so kann der Mensch arbeiten. Auch wenn ich Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller bin, bin ich zuvörderst Mann und Mensch. Morgen ist Werktag, und ich werde mich wieder in meinen Blaumann kleiden, mir meinen orangen Schutzhelm aufsetzen und die Schreibmaschine bearbeiten, proletarische Fingerübungen. Es ließe sich sagen (und auch schreiben), daß alle, die lebten, besser schreiben als jene, die nur zu lesen lernten: triumphaler Blödsinn, der einem morgens um sechs vor der Stechuhr einfällt, nachdem man fünfzig Kilometer als Pendler unterwegs war, weil das Leben Spaß macht und man seine Freude hat an frühen Morgen und kurzen Nächten, langen Tagen in der Fabrik oder am Bau im Akkord zur besten Lebenszeit und Gedichte träumt, und vom Umsichschlagen mit allem, was man hat. Der Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller geht schon deswegen jeden Tag zur Arbeit, weil er sonst nichts zu schreiben weiß. Nach Feierabend kämmt er sich die Haare nach vorne ins Gesicht und sehnt sich nach Drogen, zwingt seine Mutter, auf dem Tisch zu tanzen, doch sie schafft es nur, auf die Knie zu fallen, was das eigentlich Bittere ist, und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als weiterzuschreiben, ein Leben zu erfinden, in dem die Seelen atmen, auch die Seelen der Toten, von denen manche, wie er hörte, bis in ferne Länder kamen oder auch einfach nur zu Geld – – – Ein Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller muß aus dem PEN-Club austreten und der Gewerkschaft Lebwohl sagen, er muß im Knast singen und eines dieser einfachen Mädchen aus dem Volke heiraten, die sein ganzes Glück sind, muß an die Weltrevolution glauben und daran, daß sie bis heute verraten wird, auch von ihm, schon weil er weiß, daß Champagner, ins Bier gegossen, am besten schmeckt, man muß es sich nur leisten können, in einem großen Haus mit großen Zimmern an einem großen Meer zu leben, am besten gleich an einem Ozean: ein Swimmingpool im Park, in dem auch das Hauspersonal baden darf, wenn es seine Rechte einklagt und seine Pflichten nicht vernachlässigt, allerdings nur zusammen mit den Bluthunden, die Tag und Nacht auf dem Grundstück patrouillieren und die Paparazzi mit ihren verdammten Kameras verjagen. Sämtliche Doktoren und Professoren der Literatur und alle angeblichen und alle unmaßgeblichen Kritiker werden auf meinem Grund und Boden zum Freiwild erklärt. In meiner Villa habe ich Büsten von Tarzan und Prinz Eisenherz aufstellen lassen, und ein Gemälde, das Nscho-tschi zeigt, hängt hinter meinem Schreibtisch. Hinten im Garten steht eine detailgetreue Nachbildung von Onkel Tom’s Hütte, wo ich manchmal nächtige, um mich an das einfache Leben zu erinnern, das ich einst führte. Ich könnte ewig so fortfahren und Hymnen dichten auf jene Heroen meines Fachs, denen es gelang, in den Reichtum zu flüchten. Der Kapitalismus ist eine Sau, aber es ist trotzdem immer wieder