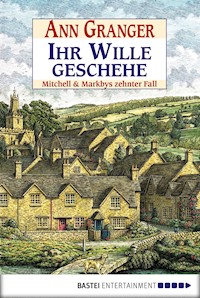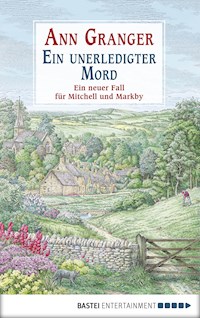
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Mitchell und Markby kehren aus dem Ruhestand zurück, um bei der Aufklärung eines lange zurückliegenden ungelösten Falles zu helfen.
Eigentlich kümmert sich Alan Markby in seinem Ruhestand höchstens noch um Gartenarbeiten. Doch als er von dem grausigen Fund seines Nachbarn Josh Browning hört, beginnen seine Alarmglocken zu schrillen. Die Geschichte weist auf den nie geklärten Fall einer spurlos verschwundenen jungen Frau hin. Zusammen mit seiner Frau Mitchell und mit Inspector Jess Campbell erforscht Markby das ungelöste Geheimnis. Sie sind fest entschlossen, diesmal den Täter zu fangen, der fast mit einem Mord davongekommen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Mitchell und Markby kehren aus dem Ruhestand zurück, um bei der Aufklärung eines lange zurückliegenden ungelösten Falles zu helfen. Eigentlich kümmert sich Alan Markby in seinem Ruhestand höchstens noch um Gartenarbeiten. Doch als er von dem grausigen Fund seines Nachbarn Josh Browning hört, beginnen seine Alarmglocken zu schrillen. Die Geschichte weist auf den nie geklärten Fall einer spurlos verschwundenen jungen Frau hin. Zusammen mit seiner Frau Mitchell und mit Inspector Jess Campbell erforscht Markby das ungelöste Geheimnis. Sie sind fest entschlossen, diesmal den Täter zu fangen, der fast mit einem Mord davongekommen wäre.
ÜBER DIE AUTORIN
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Kriminalromanen »Wer sich in Gefahr begibt« und »Neugier ist ein schneller Tod« knüpft sie mit »Stadt, Land, Mord«, dem ersten Band der Reihe um Inspector Jessica Campbell, wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
EINUNERLEDIGTERMORD
EIN NEUER FALL FÜRMITCHELL UND MARKBY UNDJESSICA CAMPBELL
Kriminalroman
Aus dem Englischenvon Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »An Unfinished Murder«
First published in Great Britain by HEADLINE PUBLISHING GROUP
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth; Lektorat: Stefan Bauer
Titelillustration: © David Hopkins / Phosphorart
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7261-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vor einigen Jahren schrieb ich eine Serie von zwölf Kriminalromanen mit Alan Markby und Meredith Mitchell in den Hauptrollen. Seither wurde ich viele Male nach einem »neuen« Mitchell und Markby gefragt. Doch es ist nicht so einfach, nach einer Reihe von Jahren zu alten Charakteren zurückzukehren. Sind sie immer noch im gleichen Alter? Oder sind sie inzwischen für ein Seniorenticket qualifiziert? Wie hat sich die Welt rings um sie verändert?
Nun ja, sie sind älter geworden, und Markby ist im Ruhestand. Doch als ein alter Fall unerwartet wieder aufgenommen wird, bitten Superintendent Ian Carter und Inspector Jess Campbell ihn um Hilfe.
Somit ist dieses Buch nicht nur für die Freunde von Campbell und Carter, sondern auch für all die vielen Fans von Mitchell und Markby. Sie sind wieder da!
ERSTER TEIL
KAPITEL EINS
Die Biegung der Straße lag vor ihm, und Josh machte sich bereit. Er wusste, dass Dilys, sobald sie dort ankamen und außer Sichtweite vom Haus waren, ihn schlagen würde. Sie war ein Jahr jünger als er, erst acht, und kleiner, aber kräftig gebaut, und sie war blitzschnell. Obwohl Josh wusste, was ihn erwartete, und obwohl er bereit war auszuweichen, wusste er auch, dass sie ihm trotzdem ein paar schmerzhafte Tritte und Schläge versetzen würde, bevor er davonkam. Er durfte nicht zurückschlagen – Tante Nina sagte immer, dass Jungen keine Mädchen schlagen würden. Vielleicht war das so, aber Josh wusste auch, dass sie es trotzdem taten. Die vielen Freunde, die im Leben seiner Mutter gekommen und gegangen waren, hatten ihr regelmäßig ein blaues Auge geschlagen, wenn nicht Schlimmeres.
Als sie noch bei ihrer Mutter gelebt hatten (Josh dachte immer noch als »Zuhause« daran zurück), waren die Cops alle paar Tage oder Nächte bei ihnen gewesen, oder jedenfalls erschien es ihm rückblickend so. Wenn sie nicht aufgrund der lautstarken Streitereien erschienen waren, dann hatten sie die Wohnung auf der Suche nach Drogen auseinandergenommen. Einmal hatten sie die Wohnung gestürmt, weil sie nach einer Schrotflinte gesucht hatten, die ihrem damaligen Freund gehört hatte. Das Gewehr hatte unter Dilys’ Bett gelegen, und ihre Mutter war ausgerastet, als ihr klar geworden war, wo ihr derzeitiger Freund das Gewehr versteckt hatte. Drei Uniformierte waren nötig gewesen, um sie festzuhalten, als sie sich auf ihn hatte stürzen wollen, in der Hand eine drohend geschwungene Schere.
Nach diesem Zwischenfall hatte das Jugendamt endgültig eingegriffen, und sie waren zu Tante Nina gebracht worden, wo sie heute lebten.
Josh war nicht das einzige Opfer von Dilys’ Angriffen. Sie hatte auch andere Kinder geschlagen in der neuen Schule, die sie inzwischen besuchten. Das hatte eine Menge Scherereien nach sich gezogen. Dilys wusste jetzt, dass sie das nicht tun durfte, doch sie hatte immer noch die Wut in sich, und so ließ sie alles an Josh aus. Der Kinderpsychologe, zu dem Dilys gehen musste, hatte es damit erklärt, dass sie und Josh in einem gewalttätigen Zuhause aufgewachsen waren. Es war eine Form von Selbstverteidigung, hatte er gesagt. Sie, Dilys, würde auf diese Weise jedem, der ihr zu nahe kam, klarmachen, dass es sich nicht auszahlte, wenn er sich mit ihr anlegte. Und deswegen schlug sie als Erste zu.
Das mochte wohl so sein, überlegte Josh, aber es erklärte nicht, warum er jedes Mal mit eingeschlossen war, wenn sie ihre Strafpredigt erhielten, dass man andere Kinder nicht schlagen durfte – schließlich hatte er überhaupt nichts getan. Das war die bittere Ungerechtigkeit von allem. Josh wollte niemanden schlagen. Er hasste Gewalt. Er liebte seine Schwester. Er hatte seine Mutter geliebt – liebte sie immer noch, wo auch immer sie jetzt war –, und damals nicht imstande gewesen zu sein, sie zu beschützen, erfüllte ihn mit Schuldgefühlen.
Das Leben bei Tante Nina war so weit ganz in Ordnung, wenn man ihre Regeln respektierte – und davon gab es viele. Wenigstens gab es keine Streitereien und keine Kämpfe und niemand kotzte die Wohnung voll und die Polizei kam nicht vorbei. Was bedeutete, wie Tante Nina regelmäßig zu sagen pflegte, dass er und Dilys »eine Menge Glück« hatten. Sie hatten die Chance auf ein »normales Leben«, was immer das war. Er hätte dagegen argumentieren können, weil er von den Eltern, die an den Schultoren auftauchten, wusste, dass Kinder in einem normalen Leben bei ihren Müttern wohnten und nicht bei den Tanten dieser Welt. Die meisten der anderen Kinder hatten außerdem Väter. Josh wusste nicht, wer sein Vater war – er hatte nie danach gefragt, weil er furchtbare Angst gehabt hatte, es könnte einer der tätowierten Freunde ihrer Mutter sein. Außerdem vermutete er insgeheim, dass sie es selbst nicht wusste. Doch diese Meinung behielt er wie vieles andere auch für sich, denn wenn er etwas gelernt hatte, dann den Mund zu halten.
Doch jetzt meldete er sich zu Wort. »Hör zu, Dilys! Fang bloß nicht wieder an, mich zu schlagen, ja?«
»Ich will aber!«, sagte Dilys einfach.
»Aber ich will nicht, dass du mich schlägst!«
»Es geht mir danach besser«, entgegnete Dilys, nachdem sie kurz über seine Antwort nachgedacht hatte.
»Mir geht es danach nicht besser. Ich habe einen großen blauen Fleck am Arm, wo du mich gestern geschlagen hast. Magst du mich denn nicht?«
Bei dieser Frage fing Dilys leise an zu weinen, und Tränen rollten über ihre Wangen. Also legte er tröstend die Arme um sie, weil er sie verstand. Es war immer zu viel gewesen für Dilys, und sie kam nicht damit klar. Sie war nicht klargekommen mit dem Gebrüll der Angst einflößenden Männer und dem Blut im Gesicht ihrer Mutter, und sie war nicht klargekommen mit der von Drogen hervorgerufenen Starre ihrer Mutter auf dem Sofa, außerstande, auf irgendetwas zu reagieren, was sie und Josh zu ihr sagten. Sie kam nicht mit Tante Ninas Regeln klar, und sie kam nicht klar mit den selbst zubereiteten Mahlzeiten, von denen die Tante sagte, sie wären gesund und gut für sie. Sie mussten alles essen, auch wenn sie noch nie im Leben Rosenkohl oder Pastinake gesehen hatten und ihr ganzes kurzes Leben – bis zu dem Tag, an dem sie zur Tante gekommen waren – nichts als Fast-Food-Essen und Mikrowellenpizza gekannt hatten.
Dilys schniefte für einen Moment oder zwei in sein T-Shirt, bis die Tränen versiegt waren. Dann trat sie ihm gegen das Schienbein.
»Los, geh da rüber!«, befahl Josh, während er ein paar Schritte zur Seite humpelte.
»Wohin gehen wir?«, fragte Dilys vollkommen ruhig.
So war es immer. Die Wut war heraus aus dem engen Gefängnis irgendwo in ihr, und jetzt war sie normal – bis zum nächsten Mal.
»Tante Nina sagt, wir sollen raus an die frische Luft und uns bewegen. Aber es ist schon fünf Uhr, und wir müssen um sechs wieder zurück sein, also können wir nicht weit gehen«, sagte Josh. »Wo würdest du gerne hin?«
»In das Wäldchen«, sagte Dilys.
Das »Wäldchen« war eine Ansammlung von Bäumen und Sträuchern hinter der Reihe von Sozialwohnungen, die sich Brocket’s Row nannte. Tante Nina lebte im ersten Haus. Sie konnte das Wäldchen zwar von ihrem Küchenfenster aus sehen, doch sie konnte nicht hineinsehen, weil es am Fuß einer Senke lag. Deswegen waren sie, wenn sie dort spielten, außerhalb von Tante Ninas Einflussbereich.
»Einverstanden«, stimmte Josh ihr zu. Dilys lächelte und begann ein Weihnachtslied zu summen, Guter König Wenzeslaus, das sie vor ein paar Monaten in der Schule für Weihnachten gelernt hatten. Sie mochte die Geschichte, die in dem Lied erzählt wurde, und es war ihr egal, dass es nicht die richtige Jahreszeit war.
Alle Kinder aus der Gegend gingen zum Spielen in das Wäldchen, nicht nur Josh und Dilys. Sie kletterten in die niedrigen Zweige oder bauten Lager in den Büschen oder pflückten Brombeeren. Sie ließen Josh und Dilys nur selten mitspielen, also bauten er und seine Schwester an anderen Stellen ihre eigenen Lager. Doch Josh war ein erstklassiger Kletterer, und wenn irgendjemandes Mütze oder ein Ball nach oben in die Äste geworfen worden und dort hängen geblieben war, riefen sie Josh herbei, damit er in den Baum stieg und die Sachen barg. Das war stets mit einem vorübergehenden Waffenstillstand verbunden, währenddessen sie in die Lager der anderen Kinder durften. Der Waffenstillstand war stets nur von kurzer Dauer, weil Dilys unausweichlich einen ihrer Wutanfälle bekam.
Josh und Dilys kletterten über eine Bruchsteinmauer, die ein Feld säumte, überquerten das Feld zur anderen Seite und rannten dann hinunter in einen Graben, wo Dilys in Brennnesseln geriet, die stark brennende Flecken auf ihrer Haut hinterließen. Was zehn Minuten Suche nach Ampferblättern nach sich zog, um sie zur Linderung auf dem sich rötenden Fleisch zu verreiben – und Dilys’ schlechte Stimmung wieder hochkochen ließ.
Als sie schließlich im Wäldchen angekommen waren, lag es verlassen. Josh war erfreut, dass sie es für sich allein hatten und nicht mit den anderen Kindern um einen Flecken verhandeln mussten, wo sie spielen konnten. Dilys fand einen herabgefallenen Ast und begann damit auf die Büsche und die Baumstämme einzuschlagen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch ihn damit malträtierte, vermutete Josh. Also ging er voraus und schlug sich abseits vom Pfad durch das Unterholz, weil es Dilys’ gesamte Aufmerksamkeit erfordern würde, sich den Weg zu bahnen – mit ein wenig Glück würde das ihre Energie absorbieren. Er konnte sie hinter sich hören, wie sie ihm wild auf das Gestrüpp einschlagend folgte.
Er hatte sich geirrt, als er geglaubt hatte, sie wären allein im Wäldchen, denn das waren sie nicht. Ein Stück voraus konnte er durch die Vegetation hindurch einen Flecken Weiß und einen weiteren Flecken Blau erkennen. Vermutlich hatte jemand seinen Abfall liegen lassen. Doch als er näher kam, sah er, dass dort jemand am Boden lag und anscheinend schlief. Die Person war halb bedeckt von Blättern und Zweigen, an manchen Stellen dicker als an anderen. Es sah aus, als hätte jemand versucht, den Schlafenden zuzudecken, wäre aber mit seiner Arbeit nicht fertig geworden. Der untere Teil eines Beines in einer Bluejeans und ein Fuß in einem weißen Turnschuh waren überhaupt nicht zugedeckt. Josh zögerte kurz, bevor er näher schlich. An dem dem weißen Turnschuh entgegengesetzten Ende der schlafenden Person spähte ein blasses Gesicht durch die Blätter, den Kopf angehoben, als wollte es sehen, wer sich da näherte. Es war das Gesicht einer Frau. Josh dachte, dass sie ziemlich jung war, weil sie lange blonde Haare hatte wie seine Mutter. Ihr Kopf war zur Seite gedreht, und er konnte ihre Stirn, ihre Nase und ein Auge sehen. Eine Hand kam aus dem Laub und zeigte mit rosa lackierten Fingernägeln auf ihn.
»Ist sie betrunken?«, fragte Dilys, die unterdessen neben ihm angekommen war und die Frau am Boden kritisch anstarrte. »Vielleicht ist sie letzte Nacht hier gefallen, auf dem Heimweg vom Pub?«
»Nein«, sagte Josh. Das Auge stand offen und war trüb. Es starrte sie an, ohne irgendetwas zu registrieren. Diese Frau konnte sie nicht sehen. Sie konnte niemanden sehen, weder jetzt noch irgendwann, denn sie war tot. Josh spürte, wie ihm übel wurde, doch es war die Übelkeit der Verzweiflung, nicht des Abscheus.
Vielleicht war ihre Mutter inzwischen auch längst tot, ähnlich wie diese Frau, und niemand hatte es ihm oder Dilys erzählt. Das war eine Sorge, die ihn ununterbrochen beschäftigte, dennoch hatte er Angst, Tante Nina zu fragen, weil sie möglicherweise »Ja, eure Mutter ist tot« geantwortet hätte. Solange er in Unwissenheit blieb, bestand die Chance, dass sie noch am Leben war und er sie irgendwann wiedersah, auch wenn er jetzt, die tote Frau am Boden vor Augen, zu fürchten begann, dass es für seine Mutter genauso geendet haben könnte.
»Was denn, sie schläft einfach?«, fragte Dilys.
»Ja!«, log Josh. »Komm weiter, sonst wird sie vielleicht wach und böse.«
Dilys hatte immer noch den Ast, und sie schwang ihn hoch über dem Kopf. »Ich könnte ihr damit eins überziehen. Dann wär sie bestimmt wach.«
»Nein!« Josh packte ihren Arm und zog sie zurück. »Hör zu, wir müssen wieder zurück, okay? Du darfst niemandem was sagen über die Frau hier. Das gibt bloß Ärger. Verstehst du? Sie schieben uns wieder irgendwas in die Schuhe. Wie immer.«
»Ich sag nichts«, erwiderte Dilys entschieden, und er wusste, dass sie schweigen würde. Dilys machte nicht viele Worte. Sie zog es vor zu handeln. Abgesehen davon wusste sie selbst, dass Schweigen manchmal besser war als Reden.
»Dann komm jetzt.« Josh ließ ihren Arm los und wandte sich ab, um den gleichen Weg zurückzugehen, auf dem sie gekommen waren. Nach ein oder zwei Sekunden fiel ihm auf, dass er Dilys nicht hinter sich hörte. Er blieb stehen und sah über die Schulter. Seine Schwester stand immer noch bei der Frau. Als sie seinen Blick bemerkte, starrte sie trotzig zurück.
»Los, komm«, drängte Josh. »Bevor sie aufwacht.«
Dilys kam ihm hinterher, und sie gelangten auf den Hauptpfad. Den Rest des Nachhausewegs verbrachten sie schweigend, bis sie wieder über die Steinmauer geklettert und in der schmalen Straße angekommen waren. Als Dilys von der Mauer sprang, bemerkte Josh, dass sie etwas in der schmutzigen Faust hielt. Etwas Glitzerndes.
»Was ist das?«, wollte Josh von ihr wissen und versuchte, ihre Hand zu packen. Doch wie üblich war Dilys zu schnell, und er fasste in die Luft.
»Was ist das?«, fuhr er sie an, und ausnahmsweise schien er einmal wirklich zornig geklungen zu haben, denn sie öffnete zögernd die Faust, und er sah eine silberne Kette mit kleinen, silbernen Objekten daran. Es war ein Bettelarmband. Ihre Mutter hatte auch so eins besessen, bis einer ihrer Freunde es gestohlen und verkauft hatte, um sich Drogen zu besorgen.
»Das hast du von der Frau gestohlen!«, japste er entsetzt.
Dilys sah ihn so aufsässig und störrisch an, wie nur sie es konnte. »Nein, nicht gestohlen«, sagte sie. »Sie hat nämlich nicht geschlafen. Ich glaube, sie ist tot. Sie war ganz kalt und hat sich eigenartig angefühlt. Wie ein toter Fisch.«
»Du hast sie angefasst?«
Joshs Stimme war ein Krächzen.
»Nur, um das Armband zu nehmen. Es ist so hübsch.« Dilys hielt es hoch und streckte es zu einer Linie, von welcher die winzigen Anhänger baumelten.
Jetzt konnte Josh sehen, dass es keine Jou-Jous waren, sondern Buchstaben des Alphabets. So, wie Dilys die Kette jetzt hielt, bildeten sie den Namen R-E-B-E-C-C-A.
»Wirf es weg, jetzt sofort!«, befahl er.
»Nein!«, protestierte Dilys aufsässig.
»Tante Nina wird es sehen!«
»Nein, wird sie nicht. Ich verstecke es. Ich bin gut darin, Sachen vor ihr zu verstecken. Sie ist dumm. Sie hat noch nie etwas gefunden, das ich vor ihr versteckt habe.«
Josh hatte eine albtraumhafte Vision von einem geheimen Hort kleiner gestohlener Dinge, den seine Schwester irgendwo angelegt hatte. »Wenn jemand es findet, kriegen wir einen Haufen Ärger!«, sagte er und fügte dann einer spontanen Eingebung folgend hinzu: »Und sie sagen es dem komischen Doktor, zu dem du immer gehen musst.«
Das machte Eindruck auf Dilys. Sie murmelte und wand sich unbehaglich, doch schließlich warf sie das Armband in eine nahe Ansammlung rosafarbener Wildblumen. Kuckucksnelken, hatte Tante Nina diese Blumen genannt.
»Vergiss nicht!«, warnte er sie, als sie das Haus der Tante erreichten. »Kein Wort über irgendwas von dem, was wir gesehen haben!«
Dilys nickte und boxte ihm auf den Arm. Es war ihre Art, das letzte Wort zu haben.
Wie ausgemacht redeten sie nicht darüber, viele, viele Jahre nicht. Josh hatte noch als Erwachsener Albträume von diesem stumpfen Auge, das durch die Blätter in den Himmel gestarrt hatte, doch er konnte und wollte nicht darüber reden. Aber dann, eines Tages, brach er sein Schweigen. Er hatte erfahren, dass Mr. Markby früher ein Polizist gewesen war, ein Detektiv und ein hochrangiger noch dazu. Also redete er mit Mr. Markby darüber. Weil er, wie Josh hoffte, nicht schockiert wäre.
KAPITEL ZWEI
»Ich bin im Ruhestand«, sagte Markby.
Er sagte es salopp, obwohl er neugierig war, was der Anlass für die Frage sein mochte.
»Aber Sie waren ein richtiger Detektiv? Tante Nina sagt, Sie wären bei der Kriminalpolizei gewesen.«
Josh Browning war ein erwachsener Mann, doch er lebte immer noch bei der älteren Dame, die früher seine und die Pflegemutter seiner Schwester gewesen war. Eigentlich war ihr Name Mrs. Pengelly, dennoch redete Josh stets als Tante Nina von ihr. Seine Schwester war aus der Gegend fortgezogen, aber Mrs. Pengelly und Josh teilten ein Heim in der langsam verfallenden Reihe von Sozialwohnungen, die im zweiten Drittel des vergangenen Jahrhunderts aus Fertigbetonplatten errichtet worden waren. Die Siedlung war nach einem Farmer benannt, von dem die Gemeinde das Bauland erstanden hatte. Zu dem Zeitpunkt, als man die Häuser errichtet hatte, waren sie als Provisorium gedacht gewesen. Überall sonst im Land waren diese »Siedlungen« längst niedergerissen und durch modernere Häuser ersetzt worden. Gott allein wusste, warum Brocket’s Row immer noch stand. Doch es war zu der Sorte von Projekt geworden, die man ans Ende jeder Liste schob und schließlich vergaß.
Die Häuser hatten ursprünglich an freies Land und Wälder gegrenzt. Dieses Land war zum Großteil einem Gewerbegebiet und Lagerhäusern gewichen, ursprünglich optimistisch als Einkaufspark bezeichnet. Brocket’s Row hatte die Baumaßnahmen unbeschadet überdauert.
Mit Ausnahme einer Schwester, die er lediglich einmal flüchtig erwähnt hatte, besaß Josh keine weitere Familie, soweit Markby wusste.
Josh redete nicht gerne. Er redete meistens überhaupt nicht, es sei denn, es war absolut notwendig. Das verführte manche Menschen dazu, ihn für geistig zurückgeblieben zu halten, doch Markby wusste, dass dies nicht der Fall war. Josh war schlau und aufmerksam, und er vergaß nie, was er sah, nicht die kleinsten Details. Manchmal erzählte er scheu das eine oder andere Detail über den Garten. Vor einem Jahr hatte eine Ratte ein Loch unter dem Zaun hindurchgegraben, aber Josh hatte es wieder aufgefüllt. Die Ratte war nicht zurückgekehrt, weil Josh ein starkes Desinfektionsmittel über das zugeschüttete Loch ausgegossen hatte, und das mochten Tiere nicht. Dieses Jahr hatte sich eine Dohle im Garten angesiedelt, wo sie stets auf Abfälle wartete. Es war immer die gleiche, ein wenig lahm, und Josh hatte keinen Gefährten gesehen. Andere Dohlen wohnten im Kirchturm nebenan, doch diese hier, sie schlief auch im Garten. Sie war ein Einzelgänger, »wie ich«, hatte Josh mit einem seltenen Lächeln hinzugefügt.
Er arbeitete als Handlanger und konnte die meisten Dinge richten. Alan Markby und seine Frau Meredith lebten in einem alten viktorianischen Haus, einem ehemaligen Vikariat; es gab ständig irgendetwas zu reparieren oder zu renovieren, und so war Josh über die Jahre zu einem vertrauten Besucher geworden, der anstrich, hämmerte, auf das Dach kletterte, um nach den Winterstürmen verschobene Ziegel zu richten, und zunehmend auch die anstrengenderen Arbeiten in dem großen Garten erledigte. Dort arbeitete er auch an diesem Tag zusammen mit Markby; sie gruben das Gemüsebeet um und bereiteten alles vor zum Anpflanzen von Zucchini. Die Zucchini waren Merediths Idee gewesen.
Markby hatte keine Ahnung, was Josh zu seiner unvermittelten Frage geführt hatte: »Sie waren doch früher Polizist, oder?«
Sie saßen im Schuppen, tranken Kaffee und machten Frühstückspause. Josh war ein großer, stark gebauter Mann, der viel Raum einnahm. Er hatte einen Schopf roter Haare und Gesichtszüge, die aussahen wie von einem Bildhauer gemeißelt, der das Handwerk noch lernte. Er hatte die Beine lang ausgestreckt und betrachtete, wie es schien, den Lehm, der an seinen Stiefeln klebte. Seine Frage war wie aus dem Nichts gekommen, ausgesprochen ohne jede Vorrede.
»Warum?«, fragte Markby, denn es musste einen Grund geben. Josh plauderte nicht einfach so.
»Sie waren ein wichtiger Polizist hier in Bamford, meinte Tante Nina.«
»Ich war Superintendent, und das ist schon eine ziemliche Weile her. Spielt das eine Rolle?«
Markby achtete darauf, seine Stimme beiläufig klingen zu lassen, doch er beobachtete aufmerksam Joshs abgewandtes Gesicht. Markby kannte sich aus mit Zeugen. Viele Jahre Ermittlungsarbeit bei der Aufklärung schwerer Verbrechen hatten ihn gelehrt, dass sie in den unterschiedlichsten Gestalten daherkamen. Da gab es die Lügner und die Fantasten, die Ungenauen, die Ausschmücker und hin und wieder den einen oder anderen Aufmerksamen. Und es gab jene, die etwas wussten, aber die Polizei nicht damit belästigen wollten, weil es vielleicht nicht wichtig war oder weil es peinlich war, darüber zu reden. Man konnte sie nicht dazu bringen zu reden, doch wenn sie bereit waren, wenn die Zeit gekommen war, dann redeten sie von sich aus – auch wenn es manchmal sehr lange Zeit brauchte, bis sie sich dazu durchrangen. Manchmal waren ihre Informationen tatsächlich nicht wichtig, aber manchmal waren sie essenziell, ärgerlicherweise. Markby konnte nicht wissen, in welche Kategorie Joshs Informationen fallen würden, doch er war absolut sicher, dass er etwas wusste – ein Geheimnis – und dass er den Drang verspürte, dieses Wissen zu teilen. Das Dumme war, Josh wusste nicht, wie er anfangen sollte, und nachdem er die Unterhaltung begonnen hatte, schienen ihm die Ideen ausgegangen zu sein, und er fiel zurück in sein gewöhnliches Schweigen.
»Schon eigenartig, wie manche Dinge geschehen …«, sagte Markby in seinen Kaffeebecher. Es war ein Schuss ins Dunkle, und im Geiste hatte er die Finger gekreuzt.
Joshs Miene hellte sich sofort auf. »Das ist so!«, pflichtete er Markby bei. »Man weiß nie, wie sie sich entwickeln.«
»Und?«, wagte Markby zu fragen. »Wie haben sie sich entwickelt?«
Josh zog die Beine an, sodass die Stiefel fest auf dem Boden standen, und drehte sich in seinem Stuhl so, dass er Markby direkt ansehen konnte. »Nicht, dass Sie eine falsche Vorstellung von unserer Dilys kriegen …«, sagte er.
Dilys? Moment – war das nicht Joshs mysteriöse Schwester? »Ich welcher Hinsicht?«, fragte er laut. »Ich habe sie nie kennengelernt, deine Schwester. Wenn du sie meinst.«
»Nun, das wird auch nicht passieren, nicht in nächster Zeit, Sir«, sagte Josh. »Sie ist im Gefängnis.«
»Was hat sie angestellt?«, fragte Markby. Er konnte sich nicht erinnern, den Namen von Dilys Browning in der Lokalzeitung gelesen zu haben.
»Sie hat immerzu andere Leute geschlagen«, sagte Josh todernst. »Sie hat es nicht böse gemeint. Sie hat mich auch geschlagen. Sie hat andere Kinder auf dem Schulhof geschlagen, als wir hergeschickt wurden, um hier zu leben.«
»Um bei Mrs. Pengelly zu leben, deiner Tante Nina?«, soufflierte Markby.
Josh nickte, offenkundig angespornt. »Sie tut das, weil sie unglücklich ist, verstehen Sie? Als wir Kinder waren, wurde sie zu irgend so einem vornehmen Doktor geschickt, einem Psychiater, aber es hat nicht geholfen. Am Ende hat Dilys den Doktor geschlagen. Danach wurde sie von einem Doktor zum anderen weitergereicht, aber es hat alles nichts genützt.«
»Und sie schlägt immer noch Leute? Ist sie deswegen im Gefängnis?«
»Ganz genau!« Josh lächelte unerwartet. Es war ein Lächeln purer Erleichterung. »Ich wusste, Sie würden das verstehen. Aber das ist alles, was sie je getan hat. Leute geschlagen. Sie ist keine Diebin oder so!«
»Hat jemand sie des Diebstahls beschuldigt?«, wollte Markby wissen.
»Nein!«, sagte Josh indigniert. »Ich bin noch nicht so weit gekommen.«
»Oh. Bitte entschuldige. Sprich weiter.«
»Sie bekam in vielen Clubs und Pubs und anderen Lokalen Hausverbot«, sagte Josh traurig. »Und sie hat oft vor dem Richter gestanden oben in London, wo sie gewohnt hat. Doch das letzte Mal war es wirklich schlimm. Sie hat einen Kerl in einem Pub mit einem Glas angegriffen und ihm fast die Kehle durchgeschnitten. Überall war Blut, auch Dilys war voll davon. Sie mussten ihn ins Krankenhaus einliefern und den Schnitt nähen. Es war ein Unfall. Sie wollte ihn nicht verletzen. Sie begreift nicht, dass sie andere Leute verletzt, wegen dem Schmerz, der in ihr ist. Das ist alles, was sie denkt, dass sie voll Schmerz ist.« Josh sah Markby ernst an. »Ich kann es nicht erklären. Nur, dass sie das nicht wollte. Sie hat einfach zugeschlagen, aber sie hatte ein Glas in der Hand.«
Markby seufzte, als er die allzu vertraute Ausrede vernahm. Ich hatte zufällig eine Flasche in der Hand … ich hatte zufällig ein Messer in der Hand …
»Und?«
»Und dann haben sie ihr gesagt, dass sie sicher sein könnte, diesmal eine Gefängnisstrafe zu kriegen. Also hat sie mich besucht. Sie hat einen Karton mit all ihren persönlichen Sachen mitgebracht, den ich aufheben soll, solange sie im Gefängnis sitzt. Sie konnte die Sachen nicht dalassen, wo sie gewohnt hat. Sie wären gestohlen worden.«
»Bestimmt«, sagte Markby und nickte.
»Nachdem sie wieder weg war, hat Tante Nina in den Karton gesehen. Es waren hauptsächlich Sachen zum Anziehen und ein paar DVDs. Nichts Besonderes. Aber Tante Nina meinte, sie wollte keinen Karton rumstehen haben, und außerdem würden die Anziehsachen wahrscheinlich muffig, wenn man sie in dem Karton ließ. Sie sagte, ich sollte alles herausnehmen. Sie wollte die Sachen waschen und ordentlich weglegen – die anderen Sachen sollte ich in meinem Zimmer verstauen, in einer Schublade oder so. Dabei hab ich es dann gefunden. Ganz unten im Karton.«
»Gefunden?«, fragte Markby. Es war wie Zähneziehen. Aber sie kamen zum Punkt, so viel war klar. Es war ganz wichtig, Josh jetzt nicht unter Druck zu setzen.
»Das Armband. Wir haben es damals gefunden. Na ja, Dilys hat es gefunden, quasi. Als wir Kinder waren. Sie war damals erst acht. Leichen ausrauben ist doch ein Verbrechen, oder?«
Josh starrte Markby an, während er auf eine Antwort wartete. Aber der befremdliche Sprung von einem Armband in einem Karton zu einer Leiche hatte Markby für den Augenblick die Sprache verschlagen.
»Leichen …?«, krächzte er mühsam. Was um alles in der Welt kam als Nächstes? Wer hatte eine Leiche ausgeraubt? »Das kommt auf die Umstände an, Josh«, sagte er vorsichtig. »Archäologen finden oft Dinge in Gräbern, die dann in Museen landen.«
»Ich habe eine Frau gefunden. Eine tote Frau in dem Wäldchen hinter dem Haus, den Hügel runter. Dilys kam ein oder zwei Minuten später dazu. Sie war überall mit Blättern und Zweigen zugedeckt, aber nicht ganz.«
»Wann war das?«, ächzte Markby, während er ganz automatisch nach seinem Mobiltelefon griff und dann die Hand wieder sinken ließ, weil er Josh nicht unterbrechen wollte.
»Vor zwanzig Jahren oder so. Wir waren noch Kinder. Dilys und ich … die anderen Familien mochten uns nicht, weil wir aus einem schlechten Zuhause kamen und Dilys immer wieder ihre Kinder schlug und weil wir nicht aus der Gegend kamen. Wir kriegten ständig die Schuld für alle möglichen Sachen, meistens Sachen, die wir gar nicht gemacht hatten. Da dachte ich, sicher würden wir auch die Schuld dafür kriegen. Nicht, dass wir sie umgebracht hatten, aber wir hätten nicht im Wald herumstreunen dürfen. Ich weiß nicht …« Josh hielt inne und schüttelte den Schopf roter Locken. »Sie hätten bestimmt was gefunden, wofür sie uns die Schuld geben konnten. Also hab ich zu Dilys gesagt, dass sie kein Wort darüber sagen durfte. Niemals. Ich erzähl Ihnen das jetzt nur wegen diesem Bettelarmband.«
Sag jetzt nichts!, warnte Markby sich im Stillen. Warte einfach ab. Er kommt zum Punkt.
»Wir haben die Frau liegen lassen, wo sie war, und sind nach Hause gegangen. Wir waren schon fast da, als ich gesehen hab, dass Dilys was Glänzendes in der Hand hielt. Es war so ein Bettelarmband, nur, dass es keine Jou-Jous waren, sondern Buchstaben. Dilys hatte es der toten Frau vom Handgelenk gestreift, ohne dass ich es bemerkt hatte. Dilys war schon immer verdammt schnell, wissen Sie? Ich war wütend, richtig wütend, das kann ich Ihnen sagen. Dilys wollte es unbedingt behalten und meinte, es wäre nicht gestohlen, weil die Frau tot war. Aber ich hab ihr gesagt, sie soll es wegwerfen. Sie hat es gemacht. Ich hab es gesehen. Sie hat es in ein Büschel Blumen am Straßenrand geworfen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie später wieder hingeschlichen ist und es zurückgeholt und all die Jahre behalten hat!«
Josh seufzte. »Es ist meine Schuld. Ich hätte wissen müssen, dass sie das tut. Zurückgeht und es holt. Ich hätte vor ihr hingehen und es woanders hinwerfen sollen, wo sie es nicht mehr finden konnte. Und jetzt hat es in diesem Karton gelegen, den sie mir zum Aufbewahren gegeben hat. Die Sache ist die, ich habe die ganzen Jahre über an diese tote Frau denken müssen. Ich dachte, vielleicht hatte sie Familie, und vielleicht haben ihre Leute nach ihr gesucht. Vielleicht hatte sie Kinder wie uns, wie wir damals waren …«
Josh ließ niedergeschlagen die Schultern hängen. »Und dann, als Tante Nina mir erzählt hat, dass Sie früher bei der Polizei waren, dachte ich, na ja, vielleicht sind Sie die richtige Person, um es zu erzählen.« Josh sah auf. »Es ist Zeit, es jemandem zu erzählen, oder?«
»Ja«, sagte Markby freundlich. »Das war richtig von dir, Josh. Hast du dieses Armband noch?«
Zur Antwort steckte Josh die Hand in die Jeanstasche und zog ein silbernes Schmuckstück hervor. Er hielt es hoch und strich die kleinen Anhänger glatt, sodass Markby die Buchstaben lesen konnte, R-E-B-E-C-C-A.
»Wie alt warst du, Josh, als ihr es gefunden habt? Dilys war acht, sagst du?« Markby konnte nicht verhindern, dass seine Stimme zitterte.
Josh nickte. »Ich war neun. Fast zehn.«
Markby überschlug im Kopf den Zeitraum. »O mein Gott …«, flüsterte er. »Rebecca Hellington. Du und Dilys, ihr habt Rebecca Hellington gefunden …«
»Josh«, sagte er nach einer Sekunde. »Lass mir das Armband da, und ich sehe, ob ich damit etwas anfangen kann. Jemand wird sich mit dir in Verbindung setzen und dir Fragen stellen und dich bitten, deine Geschichte noch einmal zu erzählen, sodass sie es aufschreiben oder aufnehmen können. Nichts Schlimmes, keine Angst, es ist das normale Vorgehen in solch einem Fall. Erzähl einfach, was du mir erzählt hast. Und mach dir keine Gedanken, dass du oder Dilys wegen irgendeines Verbrechens angeklagt wirst. Ihr wart beide noch keine zehn Jahre alt und nicht schuldfähig. Es wäre besser gewesen, ihr hättet damals erzählt, was ihr gefunden hattet. Es hätte gereicht, es eurer Tante Nina zu berichten. Sie hätte die Polizei kontaktieren können. Aber vor dem Gesetz habt ihr euch keines Vergehens schuldig gemacht.«
»Oh, das ist gut.« Josh klang aufrichtig erleichtert.
»Ihr habt es eurer Tante nicht erzählt – Mrs. Pengelly?«
Josh sah ihn an, die Augen weit vor Schreck. »Sie hätte uns die Hölle heißgemacht! Wir haben nicht ein Wort gesagt!« Er zögerte. »Außerdem, als ich das nächste Mal in das Wäldchen gegangen bin, war die Frau nicht mehr da.«
»Wann war das? Wann warst du wieder dort?«
Josh runzelte die Stirn. »Nicht am nächsten Tag, weil es schlimm geregnet hat. Es muss am übernächsten Tag gewesen sein. Und sie war nicht mehr da, wie gesagt.«
»Also gut.« Markby erhob sich und sammelte die leeren Kaffeebecher ein. »Ich bringe sie ins Haus.«
Josh wand sich aus dem Segeltuchstuhl, in den er sich geklemmt hatte, und stand ebenfalls auf. Er musste den Kopf einziehen wegen der niedrigen Decke – die Gartenlaube war einfach zu klein für ihn. Markby selbst war immer noch ein großer Mann – das Alter hatte ihm nicht viel davon genommen. Doch Josh war bestimmt über eins neunzig, dachte er.
»Ich grab das Beet noch fertig um«, sagte Josh und wandte sich zum Gemüsegarten.
Markby kehrte nachdenklich zum Haus zurück und betrat die Küche. Sie war verlassen. Er stellte die Kaffeebecher ab und ging weiter ins Haus, um Meredith zu suchen.
KAPITEL DREI
Er fand seine Frau im Arbeitszimmer, wo sie angestrengt auf ihren Computer starrte. Ihr rötlich braunes Haar, immer noch dicht mit nur ein paar grauen Strähnen, rahmte ihr Gesicht, und ihre Finger ruhten in einer Weise auf der Tastatur, die vermuten ließ, dass sie mitten im Satz aufgehört hatte zu schreiben.
»Läuft es nicht gut?«, fragte er leise.
»Schon, aber irgendwas ist nicht richtig …« Sie lehnte sich zurück, streckte die Arme über den Kopf und wandte sich lächelnd zu ihm um. »Und? Was gibt es Neues?«, fragte sie.
Seit sie von ihrem Posten im diplomatischen Dienst in den Ruhestand gegangen war, hatte Meredith angefangen, Bücher zu schreiben, genauer gesagt: Detektivgeschichten. Als sie mit dem ersten angefangen hatte, hatte Markby noch protestiert: »Ich bin ja dafür, dass du schreibst, aber, na ja, Kriminalromane … die Leute werden denken, es sind echte Verbrechen, von denen ich dir erzählt habe.«
»Nein, werden sie nicht«, hatte sie widersprochen. »Weil all meine Geschichten in den 1920er Jahren spielen. Abgesehen davon, die Leser wissen doch gar nicht, dass ich mit einem ehemaligen Polizeibeamten verheiratet bin.«
»Sie werden es bald herausfinden.«
»Na und? Abgesehen davon, der Detektiv in meinem Buch ist von Beruf Klavierstimmer.«
»Was? Im Ernst? Wieso?«, hatte er ungläubig gefragt.
»Ich habe mir das genau überlegt, weißt du?« Sie hatte gereizt geklungen. »In den Zwanzigern war es Mode, ein Klavier zu Hause zu haben. Wie heutzutage einen Fernseher. Und ein Klavier muss regelmäßig gestimmt werden. Mein Klavierstimmer besucht also alle möglichen verschiedenen Häuser, um die Klaviere zu stimmen. Es ist eine zeitaufwendige Arbeit, also ist er eine Stunde oder länger in dem jeweiligen Haus und sitzt still im Salon, während er die Klaviersaiten einstellt. Der Haushalt rings um ihn herum läuft weiter, und die Leute vergessen, dass er da ist. Also hört er Dinge, bemerkt Dinge, ist dabei, wenn etwas Merkwürdiges geschieht.«
»Da ist was dran …«, hatte Markby eingeräumt.
Und so wusste er jetzt nicht genau, ob die ihm gestellte Frage rhetorisch war, was bedeutete, dass sie auf einen Haken in ihrer Handlung gestoßen war, oder ob sie ihm am Gesicht abgelesen hatte, dass er mit ihr reden wollte, was sie sehr gut konnte. Das Rätsel wurde schnell gelöst.
»Was stimmt nicht?«, fragte sie.
»Nichts. Das heißt, ich habe etwas erfahren über einen Fall, der lange zurückliegt. Ein altes, ungelöstes Rätsel im Zusammenhang mit einer Untersuchung, die ich vor vielen Jahren für das Revier von Gloucestershire durchgeführt habe. Mit verdächtigem Mangel an Erfolg, wie ich hinzufügen möchte.«
»Erzähl mir nicht, du und Josh habt im Kartoffelbeet einen entscheidenden Hinweis ausgegraben!«
Markby hob einen warnenden Zeigefinger. »Mach keine Witze! Du bist der Wahrheit viel näher, als du ahnst. Die Sache ist, ich hatte soeben eine sehr eigentümliche Unterhaltung mit Josh.«
Meredith hob die Augenbrauen. »Eine Unterhaltung mit Josh an sich ist schon eigentümlich genug, oder? Ich kriege nie mehr als einen Satz aus ihm heraus. Im Allgemeinen fragt er, was er machen soll, und sobald ich geantwortet habe, nickt er nur und geht gleich an die Arbeit.«
»Nun, diesmal hatten wir unsere Kaffeepause im Schuppen, als er mich plötzlich gefragt hat, ob es stimmt, dass ich früher ein höherer Polizeibeamter gewesen wäre, bevor ich in den Ruhestand gegangen bin. Er sagt, seine Tante Nina – Mrs. Pengelly – hätte ihm das erzählt.«
»Sie ist seine Pflegemutter, oder war es«, sagte Meredith. »Keine richtige Tante. Wie kommt sie dazu, ihm plötzlich zu erzählen, dass du bei der Polizei warst? Ich bin überrascht, dass er es nicht längst wusste.«
»Ich weiß nicht, warum sie es ihm gesagt hat, aber ich denke, das sollte ich herausfinden. Ich bin nicht sonderlich überrascht, dass er es nicht wusste, weil er nicht viel mit anderen redet. Hör mal, lass mich dir erzählen, was er mir erzählt hat.«
Sie lauschte schweigend, während er Joshs Geschichte wiederholte.
»Wow …«, sagte sie leise, als er geendet hatte. »Wer war Rebecca Hellington?«
»Sie ist vor zwanzig Jahren verschwunden. Es gab nie – bis heute nicht – einen Hinweis darauf, dass sie tot sein könnte. Ihre Familie – zumindest ihr Vater – glaubte, dass sie tot sein musste, weil sie sich nicht mit ihren Eltern in Verbindung setzte, und normalerweise rief sie mindestens einmal die Woche an. Sie war Studentin an einer pädagogischen Hochschule im West County. Ihre Familie lebte in Bamford. Die Eltern hatten ein Reisebüro in der Stadt. Wenn jemand verschwindet, heißt das nicht unbedingt, dass er tot ist. Es geschieht immer wieder, dass Menschen absichtlich aus ihren gewohnten Umgebungen verschwinden und den Kontakt abbrechen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Rebeccas Mutter hat lange Zeit darauf bestanden, dass es einen Grund geben musste und dass Rebecca irgendwann wieder auftauchen würde. Doch ich muss gestehen, dass die Polizei damals geneigt war, sich der Vermutung ihres Vaters anzuschließen. Die Sache war, wir hatten keinerlei Hinweise, weder auf das eine noch auf das andere, ob sie tot war oder lebendig.« Er verstummte.
»Habt ihr hier nach ihr gesucht?«, fragte Meredith schließlich, als sich das Schweigen in die Länge zog.
Markby schrak zusammen. »Ja, sicher. In Kooperation mit Gloucestershire, wie ich bereits sagte. Die Kollegen haben in ihrem Bezirk ermittelt. Sie haben sich mit uns in Verbindung gesetzt, dass sie zwei Leuten in ihrem Studentenwohnheim und ihrem Freund erzählt hatte, dass sie überlegte, am Wochenende nach Hause zu ihren Eltern zu fahren. Falls sie losgefahren ist, kam sie nie zu Hause an. Ihre Eltern waren vollkommen verzweifelt.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Meredith leise. »Insbesondere, wenn sie ihre Tochter erwartet haben. Also hatte sie ihre Eltern definitiv informiert, dass sie kommen wollte, und nicht nur die Freundinnen von der Hochschule?«
»Sie hatte es als eine Möglichkeit erwähnt, aber nicht bestätigt. Ihre Eltern hatten darauf gewartet, von ihr zu hören, zu erfahren, um welche Zeit ihr Bus ankam. Sie fuhr immer mit dem Bus, National Express, weil es viel preiswerter war als mit dem Zug.«
»Noch preiswerter, und auch riskanter, wäre es gewesen, per Anhalter zu fahren …«, schlug Meredith vor.
»Ihr Vater versicherte mir, dass sie so etwas nicht getan hätte. Ich erinnere mich, dass er gesagt hat, sie wäre zu vernünftig. Außerdem hatte er ihr gesagt, wenn sie wirklich abgebrannt wäre und sich das Busticket nicht leisten könnte, würde er ihr das Geld oder den Fahrschein schicken. Sie musste ihm versprechen, nicht per Anhalter zu fahren.« Markbys normalerweise gelassene Gesichtszüge legten sich in grimmige Falten. »Ich weiß nicht mal, ob es dieses Wäldchen noch gibt! Ich hätte Josh fragen sollen. Ich erinnere mich an die Zeit, als hinter der Sozialsiedlung noch größtenteils freies Land lag. Ich bin erstaunt, dass die alten Häuser immer noch stehen – und dass Mrs. Pengelly noch dort lebt. Das Land wurde im Lauf der Jahre bebaut und entwickelt. Wenn ich es bedenke, es war eins von Dudley Newmans Projekten, vielleicht sogar sein letztes. Du erinnerst dich an Newman? Seine Vision war, die gesamte Umgebung mit neuen Häusern zu bebauen.«
»Newman, der Bauunternehmer? Ich erinnere mich an ihn. Ich hatte nie viel mit ihm zu tun. Aber ich erinnere mich, dass auf einer seiner Baustellen eine Leiche gefunden wurde! Es war eine ziemlich haarige Episode für mich! Erzähl mir nicht, es ist schon wieder passiert! Ich könnte anfangen, mir wegen Newman Gedanken zu machen.«
»Ja, ich erinnere mich auch, sicher, aber bei der Erschließung hinter Brocket’s Row ging es nicht um Wohnhäuser. Newman hatte größenwahnsinnige Ideen und hat eine Art Geschäftspark auf die grüne Wiese gestellt. Wenn ich mich richtig entsinne, fand man nichts Verdächtiges während der Bauarbeiten – oder es wurde nie berichtet, falls doch. Der Geschäftspark lief nicht besonders gut, und heute sind dort, glaube ich, hauptsächlich Lagerhäuser.«
»Also könnte das Wäldchen komplett zubetoniert worden sein, um Newmans Lebenstraum zu erfüllen?«
»Es könnte sein, obwohl Josh sagt, dass nicht alles verschwunden ist. Ein Teil ist noch da. Ich muss das überprüfen, bevor ich mit meiner Geschichte zu Trevor Barker gehe.«
»Du willst die Geschichte also der Bamford Police melden?«
»Selbstverständlich. Es ist meine Bürgerpflicht. Und ich melde es Inspector Barker, weil er aufgebracht reagieren würde, wenn ich ihn übergehe.« Markby seufzte. »Ich hoffe sehr, dass das betreffende Stück des Wäldchens die Bemühungen von Dudley Newman überstanden hat. Dann besteht die Chance, dass wir Rebecca finden. Allerdings, und das erscheint mir am ehesten der Fall, ist der Mörder zurückgekehrt, kurz nachdem die Kinder die Tote gefunden hatten, und hat sie fortgeschafft. Er hat die Kinder vielleicht gehört und sich erschreckt zurückgezogen – Oder vielleicht ist er zu dem Schluss gekommen, dass das Wäldchen ein zu belebter Flecken war, und er hat die Leiche ganz woanders hingebracht. Wir wissen lediglich, dass niemand anders mehr die Tote gesehen hat, nachdem Josh und seine Schwester Dilys sie gefunden hatten. Man hätte es uns damals gemeldet. Josh kehrte am übernächsten Tag zu der Stelle zurück, doch da war die Leiche verschwunden.«
Meredith hatte einen Einwand. »Wenn sie mehr oder weniger an der Oberfläche gelegen hat, nur zugedeckt mit Blättern und Zweigen, dann muss doch irgendjemand anders über sie gestolpert sein, genau wie die Kinder.«
»Was die Vermutung erhärtet, dass sie nicht lange so dort gelegen haben kann. Wie ich bereits sagte, der Mörder ist wohl später zurückgekehrt und hat gründlichere Arbeit geleistet und sie vergraben. Oder er hat sie fortgeschafft und ganz woanders verscharrt, und wir haben keine Ahnung wo.« Er richtete den Blick zum Fenster und auf die Kirche dahinter. »Rebecca, wo bist du jetzt?«
»Das bedeutet Aufregung für Josh«, sagte Meredith ernst. »Kommt er damit zurecht? Er zieht es vor, in Ruhe gelassen zu werden, um seine Arbeit zu machen. Es wird ihm nicht gefallen, wenn ein Haufen Fremder vor seiner Tür erscheint und Fragen stellt.«
»Ich habe ihn gewarnt, dass die Polizei kommen und ihn befragen wird«, seufzte Markby. »Ich frage mich vielmehr, wie Inspector Barker zurechtkommen wird! Er wird nicht glücklich sein, wenn ich ihm sage, dass er möglicherweise einen großen Flecken Land umgraben muss, um eine Leiche zu suchen, die vielleicht gar nicht mehr da ist.«
»Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war meine einzige Sorge, dass ich noch mehr Haare verliere«, sagte Inspector Barker.
Er fuhr sich unsicher mit der Hand über eine entschieden dünner werdende Stelle. Er war noch längst nicht alt, und es erschien ihm so unfair, dass er jetzt schon kahl wurde. Seine Mutter pflegte zu sagen, dass es ihn distinguiert erscheinen ließ. Sie erinnerte ihn immer wieder, dass auch sein Vater früh die Haare verloren hatte. Doch kein Mann wollte hören, dass er aussah wie sein Vater, wenn besagter Vater bereits in den Siebzigern und der Sohn erst vierundvierzig war.
»Ich wusste, dass mich die üblichen Probleme erwarten, wenn ich zur Arbeit gehe«, fügte er düster hinzu. »Womit ich nicht gerechnet habe, Alan, ist, dass Sie hereinspaziert kommen und mir erzählen, dass Ihr Gärtner vor zwanzig Jahren eine Leiche gefunden und es damals nicht gemeldet hat.«
Und außerdem sah er aus wie der verdammte Peter Pan. Wieso hatte Markby noch keine Haare verloren? Barker schäumte innerlich. Mehr noch, Markby war gesegnet mit jener Art von Haaren, die nie wirklich grau zu werden schienen. »Aschblond« hieß der Farbton auf den Packungen, die Frauen kauften, um sich die Haare zu färben. Er wusste dies, weil seine Frau sich ihre Haare damit färbte. Wäre er ein missgünstiger Mann gewesen, hätte er vielleicht angenommen, dass Markby sich das Haar ebenfalls gefärbt hatte. Doch er wusste, dass das nicht so war. Markby hatte Glück, das war alles. Er, Trevor Barker, hatte das kürzere Streichholz gezogen. Da war sein Besucher, bestimmt Ende sechzig, und er sah genauso alt aus wie Barker. »Distinguiert«, hatte seine Frau ihn einmal beschrieben, nachdem sie Markby und seine Frau in einem einheimischen Restaurant kennengelernt hatte. »Und diese blauen Augen! Sie rauben einem den Atem!«
Barker hatte mürrisch erwidert, dass sie die Klappe halten sollte.
»Josh war damals erst neun Jahre alt«, erinnerte Markby ihn. »Und er war bei einer Pflegemutter. Er hatte keine richtige Mutter mehr, zu der er mit seiner Geschichte nach Hause laufen konnte. Ich habe Ihnen das alles bereits erklärt.«
»Oh ja, Sie haben das alles groß und breit erklärt«, erwiderte Barker, indem er aus seinen Gedanken in die Gegenwart zurückkehrte. »Ich kenne die Stelle nicht selbst. Ist dieses Wäldchen, wie Sie es nennen, immer noch da?«
»Ich bin vorbeigefahren und habe mich umgesehen, bevor ich heute Nachmittag hergekommen bin«, informierte Markby ihn. »Der größte Teil steht noch, aber es ist in einem schrecklichen Zustand. Anscheinend wird es von den guten Bürgern von Bamford dazu genutzt, alte Kühlschränke und Fernseher zu entsorgen. Ganz zu schweigen von Säcken voll Gartenabfällen und anderem Müll. Nach Joshs Beschreibung war es ein ziemlich sauberer Fleck, als er noch ein Kind war. Heute ist es eine wilde Müllkippe. Furchtbar.«
Barker schnitt eine Grimasse. »Und Sie glauben die Geschichte Ihres Gärtners?«
»Absolut. Abgesehen davon, er hatte das Armband. Das dort.« Markby deutete auf das Bettelarmband, das vor Barker auf dem Schreibtisch lag.
Der Inspector starrte düster auf die kleine silberne Kette mit den Buchstabenanhängern, ordentlich eingepackt in eine kleine durchsichtige Asservatentüte. »Wie dem auch sei, ich muss die Sache weiterleiten. Ich kann keine umfangreiche Suchexpedition wie das Umgraben der ganzen Gegend autorisieren, das überschreitet meine Kompetenzen. Meine Vorgesetzten werden alles andere als erfreut reagieren, so viel kann ich Ihnen sagen. Alles wird inzwischen durchkalkuliert, bis auf den letzten Penny. Es gibt eine Abteilung für alte Fälle, aber sie müssen schon um Mittel kämpfen, wenn sie sich erfolgversprechendere Fälle vornehmen als diesen hier. Abgesehen davon verfügen sie nicht über ausreichend Personal. Besser, Sie machen sich nicht allzu große Hoffnungen. Wir reden hier von einem Armband, das vor mehr als zwanzig Jahren gefunden wurde, von Kindern, auf einem Stück Land, das inzwischen größtenteils überbaut ist. Der Gärtner sagt, seine Schwester hätte es einer Toten abgenommen. Dennoch könnte seine Schwester es auch einfach gefunden haben, nachdem die ursprüngliche Besitzerin es Monate zuvor verloren hatte. Ich kann mich nicht mehr in allen Einzelheiten an Dinge erinnern, die ich mit neun Jahren gemacht habe. Sie?«
»Ich verstehe Ihre Zweifel«, sagte Markby milde. »Es wäre trotzdem schön, wenn man den Fall abschließen könnte, meinen Sie nicht?«
Barker lehnte sich zurück und trommelte mit den Fingerspitzen auf seinen Schreibtisch. »Natürlich. Es war Ihr Fall, oder irre ich mich? Sie möchten, dass er abgeschlossen wird.«
»Es war nur ein Hilfeersuchen aus Gloucestershire. Unsere Aufgabe bestand einzig darin herauszufinden, ob das Mädchen nach Hause gekommen war oder nicht. Die Kollegen in Gloucestershire haben das eigentliche Verschwinden untersucht. Sie haben die Studenten befragt, die Rebecca kannten, und ihren Freund vernommen.«
Barkers Gesicht war ein misstrauisches Stirnrunzeln. »Sie haben den Freund hoffentlich genauer unter die Lupe genommen? Vielleicht war es ein Streit unter Liebenden, oder sie wollte die Beziehung beenden. Der Junge war eifersüchtig, Sie wissen, wie das so ist.«
»Ich glaube, er wurde damals mehr als einmal vernommen, und es gab nicht den geringsten Anhaltspunkt, dass er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun gehabt hatte. Er wurde mir als sehr erschüttert und verängstigt beschrieben.«
»Natürlich war er verängstigt!«, schnappte Barker. »Es war vielleicht sein schlechtes Gewissen!«
»Oder einfach nur, dass er ein junger Mann war, der noch nie in Schwierigkeiten gesteckt hatte und dessen Freundin verschwunden war, und er wusste nicht, was er tun oder sagen sollte. Aber ich habe ihn nicht vernommen damals. Das war die Aufgabe des CID in Gloucestershire, wie ich bereits sagte. Ich habe mit den Eltern hier gesprochen.«
»Leben sie noch?«, fragte Barker. »Wir brauchen ihre Bestätigung, dass es sich tatsächlich um das Armband ihrer Tochter handelt.« Er deutete auf den kleinen Plastikbeutel mit der silbernen Kette.
»Ich weiß es nicht. Ich könnte mir denken, dass sie inzwischen recht alt sind, genau wie ich.« Ein flüchtiges Lächeln huschte über Markbys Gesicht. »Ja, gut möglich, dass sie noch leben.« Zaghaft fügte er hinzu: »Da ist eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen sollte – nur ein Zufall, verstehen Sie?«
»Ich bitte darum!«, forderte Barker ihn säuerlich auf und sah ihn ahnungsvoll an.
»Nun, damals, als ich mit Gloucestershire zusammengearbeitet habe, gab es einen jungen Detective Sergeant, der dort den Fall bearbeitete. Ein heller Bursche, Hochschulabsolvent …«
»Oh …«, sagte Barker einfach.
»Er ist inzwischen Superintendent. Sein Name ist Ian Carter. Er ist viel herumgekommen, wie gewöhnlich, aber jetzt ist er wieder zurück in Gloucestershire.«
»Sie wollen auf etwas hinaus …«, sagte Barker misstrauisch.
»Nur, dass ich vor meiner Pensionierung hier eine neue Mitarbeiterin in meinem Team hatte, Inspector Jess Campbell. Sie war sehr jung. Und sie arbeitet heute in Gloucestershire unter Ian Carter. Reiner Zufall, wie ich bereits sagte.«
Eine Pause entstand und Barker sah nachdenklich zur Decke hinauf. Als er den Blick wieder senkte, sagte er: »Meinetwegen. Ich gebe die Sache nach oben weiter. Man wird mit Ihnen reden wollen, wenn nicht mehr.«
Markby beschloss, den Mangel an Begeisterung zu übersehen, und erhob sich von seinem Platz. »Ich danke Ihnen, dass Sie sich dies alles angehört haben«, sagte er höflich.
Barker, der sich nicht als unhöflich präsentieren wollte, erhob sich ebenfalls und streckte Markby die Hand entgegen. »Es war mir ein Vergnügen, wie ich unter anderen Umständen sicherlich gesagt hätte! Nur, dass Sie keine guten Neuigkeiten überbracht haben. Andererseits, für Sie sind es vielleicht welche.«
»Für mich?«, fragte Markby, indem er die dargebotene Hand ergriff.
Zum ersten Mal seit ihrer Begrüßung anlässlich Markbys Ankunft lächelte Barker. »Es geschieht schließlich nicht oft, dass ein Ermittlungsbeamter eine Chance erhält, lange nach seiner Pensionierung noch einmal aktiv zu werden.« Barkers Grinsen wurde breiter. »Das ist es doch, was Sie reizt, Alan, nicht wahr? Ein neuer Anlauf, um einen ungelösten Fall aufzuklären.«
»Ich bin im Ruhestand«, sagte Markby nur – zum zweiten Mal an diesem Tag.
»Wie ist es gelaufen?«, fragte Meredith ungeduldig. »Was hat Trevor Barker gesagt? Graben sie jetzt das Wäldchen um?«
Markby schlüpfte aus seiner Jacke und hängte sie in der riesigen Eingangshalle des alten viktorianischen Hauses an den Haken. Es war dunkler und drückender als üblich, weil die Abenddämmerung eingesetzt hatte. Er hatte nicht genug im Garten getan, überlegte er. Nachdem Josh seine außergewöhnliche Geschichte erzählt hatte, war Markby den Rest des Tages unterwegs gewesen. Er hatte sich das Wäldchen angesehen und anschließend mit Barker gesprochen. Bevor er ins Haus gegangen war, hatte er nachgesehen, ob Josh mit dem Umgraben fertig geworden war, und hatte mit gelinder Überraschung festgestellt, dass Josh, nachdem er die Werkzeuge gereinigt und ordentlich wieder in den Schuppen gestellt hatte, nach Hause gegangen war.
»Josh hat nicht gewartet, um zu erfahren, was ich erreicht habe«, sagte Markby zu seiner Frau. »Vermutlich nimmt er an, dass er sich keine weiteren Gedanken mehr machen muss, nachdem er mir alles erzählt hat. Es ist jetzt mein Bier.«
»Und? Was hast du erreicht?«
»Trevor Barker leitet es nach oben weiter«, berichtete Markby. »Er bespricht es mit seinen Vorgesetzten. Ehrlich gesagt, mehr kann er auch gar nicht tun. Den Fall wiederaufzunehmen ist eine komplizierte und kostspielige Geschichte, und wenn es keinen wirklich guten Grund gibt zu der Annahme, dass eine Leiche oder Überreste gefunden werden, wird man zögern, das zu tun. Letzten Endes hat Barker überhaupt nicht die Befugnis, das allein zu entscheiden.«
»Er glaubt Joshs Geschichte nicht?«
»Er weiß, dass ich sie glaube, und ich erwarte, dass er persönlich mit Josh reden wird. Außerdem haben wir das Armband als Beweisstück. Aber vielleicht reicht es nicht. Niemand außer den beiden Kindern ist über die Tote gestolpert. Nur Josh und Dilys. Und dann ist sie verschwunden, bevor jemand anders sie finden konnte, genau wie du gesagt hast. Der Killer war vielleicht sogar dort, als die Kinder im Wald waren. Er hat sie kommen hören und sich versteckt und kam wieder hervor, als sie weggelaufen sind.« Markby blickte unzufrieden drein. »Barker wird die Sache verschleppen, genau wie jeder andere, mit dem er redet.«
Sie waren ins Wohnzimmer gegangen, wo in Erwartung eines kühlen Abends bereits die Stäbe eines elektrischen Feuers im Kamin glühten. Im Winter brannte dort ein richtiges Holzfeuer, doch im Moment war es noch zu warm, wenigstens tagsüber.
»Die Kosten der Ermittlungen werden einen wichtigen Faktor spielen«, vermutete Meredith. Sie war Alan gefolgt und saß auf der Lehne des Sofas, auf das er sich mit einem Seufzer der Erleichterung hatte sinken lassen. »Irgendjemand wird beschließen, dass das Budget nicht ausreicht dafür.«