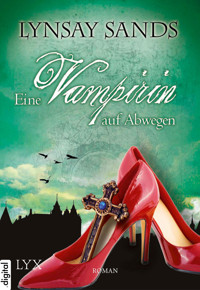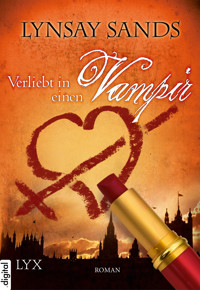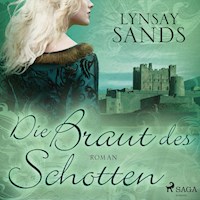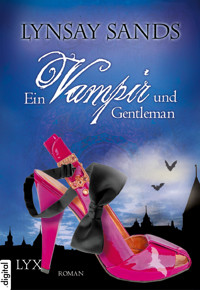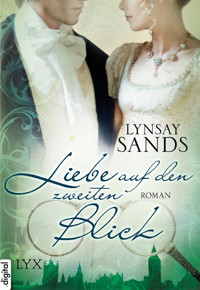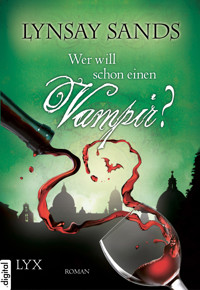9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Als die Vampirin Jeanne Louise Argeneau von der Arbeit nach Hause fahren will, wird sie von einem attraktiven Sterblichen entführt. Paul Jones bittet sie, seine Tochter zu retten, die an einem Hirntumor erkrankt ist. Jeanne fühlt sich augenblicklich zu Paul hingezogen. Doch die anderen Vampire haben von der Entführung erfahren und sind Paul auf den Fersen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
LYNSAY SANDS
Ein Vampir für alle Sinne
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Ralph Sander
Zu diesem Buch
Entführt und ans Bett gefesselt: Als die Vampirin Jeanne Louise Argeneau so erwacht, ist sie völlig fassungslos. Wer hat ihr das angetan? Ihr Schock weicht jedoch sehr schnell Überraschung, als sie das erste Mal auf ihren Entführer trifft. Paul Jones sieht nicht nur zum Anbeißen aus, sondern Jeanne kann seine Gedanken nicht lesen. Ergo: Er muss ihr Seelengefährte sein! Doch Paul steht der Sinn nicht nach amourösen Abenteuern – denn er ist verzweifelt! Und verzweifelte Männer greifen zu drastischen Maßnahmen: Paul hat Jeanne entführt, weil sie die Einzige ist, die ihm noch helfen kann. Pauls Tochter ist unheilbar an einem Gehirntumor erkrankt, und nur die Vampirin kann sie retten. Doch das ist alles nicht so einfach, denn die anderen Vampire haben von der Entführung erfahren und sind Paul auf den Fersen. Kann Jeanne es schaffen, Paul und seine Tochter zu retten? Sie muss tun, was eine Vampirin tun kann, um den Mann ihres Herzens wieder glücklich zu machen, und setzt dabei alles aufs Spiel …
1
»Tja, letzter Tag heute, Fred«, sagte Jeanne Louise und lächelte den Sicherheitsmann an, während sie sich der Wachstation näherte. Der Sterbliche hatte fast fünf Jahre lang den Ausgang der Forschungsabteilung von Argeneau Enterprises bewacht, nun wurde er in einen anderen Bereich des Unternehmens versetzt, damit ihm nicht auffiel, dass etliche Mitarbeiter der Abteilung nicht alterten. Ihr würde Fred fehlen. Er war stets freundlich gewesen, ob er ihr am Abend eine gute Nacht wünschte oder sich nach ihrer Familie erkundigte.
»Ja, Miss Jeanie, letzter Tag am alten Arbeitsplatz. Ab nächster Woche dann in einer der Blutbanken.«
Jeanne Louise nickte und ihr Gesichtsausdruck wurde ernst, als sie erwiderte: »Man wird sich dort glücklich schätzen, Sie zu haben. Sie werden uns hier fehlen.«
»Oh, Sie alle werden mir auch sehr fehlen«, versicherte er ihr und kam um den Tresen herum, damit er ihr aufschließen konnte. Er drückte die Tür auf und hielt sie fest, wobei er sich zur Seite drehte, damit Jeanne Louise an ihm vorbeigehen konnte.« Kommen Sie gut nach Hause, Miss Jeanie. Genießen Sie das lange Wochenende.«
»Das werde ich. Und Sie auch«, sagte sie und musste einmal mehr lächeln, als sie hörte, wie er sie »Miss Jeanie« nannte. Es gab ihr das Gefühl, ein junges Mädchen zu sein, was insofern bemerkenswert war, als er immerhin Ende fünfzig und sie über vierzig Jahre älter war als er. Natürlich hätte er ihr das nie geglaubt, da sie nicht älter als fünfundzwanzig aussah, was einer der Vorteile war, wenn man eine Vampirin oder – wie die Älteren unter ihnen sich lieber nannten – eine Unsterbliche war. Es gab noch etliche andere erfreuliche Aspekte, und sie war dankbar für jeden einzelnen davon. Und umso mehr verspürte sie immer wieder Mitleid mit Sterblichen, denen solche Dinge verwehrt blieben.
Na, großartig, eine Vampirin mit Schuldgefühlen, dachte sie ironisch und musste innerlich über dieses Klischee schmunzeln. Als Nächstes würde sie sich wohl noch darüber beklagen, dass ein so langes Leben vor ihr lag.
»So weit kommt’s noch«, murmelte sie zu sich selbst und horchte auf, als sie hörte, wie ein Kieselstein über den Asphalt kullerte. Sie schaute sich um und entdeckte einen Mitarbeiter aus der Blutabteilung, der hinter ihr das Parkhaus betrat. Nachdem sie ihm zum Gruß zugenickt hatte, ging sie weiter zu ihrem Wagen. Als sie hinter dem Steuer Platz genommen hatte, ließ sie den Motor an und rangierte rückwärts aus der Parklücke. Ihre Gedanken kreisten dabei um die Frage, ob sie noch aufbleiben und verschiedene Arbeiten erledigen oder nach Hause fahren und sich schlafen legen sollte.
Das war in der Tat ein Problem für einen Vampir, musste Jeanne Louise einräumen, während sie das Parkhaus verließ und die Straße entlangfuhr. Ihr Tagesablauf stand im völligen Widerspruch zum Rest der Welt. Ihre Schicht endete üblicherweise um sieben Uhr morgens, aber heute war sie etwas länger geblieben, um noch das eine oder andere wegzuräumen. Inzwischen war es halb acht, was für sie bedeutete, dass sie erst noch zwei Stunden aufbleiben musste, ehe die Geschäfte öffneten, zu denen sie fahren wollte. Bis dahin würde die Sonne aufgegangen sein und erbarmungslos vom Himmel brennen.
Im Augenblick fühlte sie sich jedoch einfach zu müde, um noch zwei Stunden wach zu bleiben.
Nein, sie würde heimfahren und sich ins Bett legen, entschied sie und hielt sich eine Hand vor den Mund, als sie den Wagen auf eine rote Ampel zurollen ließ und herzhaft gähnen musste.
Der Wagen war eben zum Stehen gekommen, da bemerkte sie im Rückspiegel eine Bewegung. Sie sah genauer hin und machte auf dem Rücksitz einen dunklen Schemen aus, der sich plötzlich aufrichtete. Noch bevor sie wusste, wie ihr geschah, hörte sie ein leises Zischen, und ein stechender Schmerz bohrte sich in ihren Hals.
»Aber was …?« Sie griff sich an den Hals und drehte sich um, da hörte sie, wie die hintere Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Gleich darauf wurde die Fahrertür aufgerissen, die düstere Gestalt griff an ihr vorbei und stellte den Wahlhebel auf Parken.
»Was ist …?«, fragte Jeanne Louise und wunderte sich, wieso sie so nuschelte und wieso ihr Verstand mit einem Mal so schwerfällig war. Der unbekannte Mann hob sie auf den Beifahrersitz und nahm selbst hinter dem Lenkrad Platz. Sie sah alles nur noch verschwommen, und als der Mann mit ihrem Wagen losfuhr, verlor sie schließlich das Bewusstsein.
Jeanne Louise regte sich schläfrig und versuchte sich auf die Seite zu drehen, doch das wollte ihr nicht gelingen. Verwundert machte sie die Augen auf und sah zur Decke, die weiß war, nicht blassrosa. Also war das hier auch nicht ihr Schlafzimmer. Sie wollte sich aufrichten, aber das war auch nicht möglich, da sie gefesselt war, wie sie mit Schrecken feststellen musste. Dicke Ketten waren von den Schultern bis zu den Füßen um ihren Körper gewickelt. Großer Gott!
»Das ist Stahl, den kriegen Sie nicht kaputt.«
Sie sah in die Richtung, aus der die Stimme kam, und stellte dabei fest, dass sie sich in einem winzigen Raum befand, der außer dem Bett, auf dem sie lag, keinerlei Einrichtung aufwies. Das einzig Bemerkenswerte in dem Raum war der Mann, der an der Tür stand und sie angesprochen hatte. Er war nicht sonderlich groß, vielleicht zehn oder zwölf Zentimeter größer als Jeanne Louise, die es auf nicht ganz eins siebzig brachte, aber er hatte bemerkenswert breite Schultern und eine schmale Taille. Sein braunes Haar, der kantige Kiefer und seine extrem leuchtend grünen Augen machten ihn dabei zu einem durchaus attraktiven Mann. In den bislang fast hundertdrei Jahren ihres Lebens hatte sie schon in die Augen vieler Sterblicher geschaut, aber er unterschied sich von ihnen allen auf eine einzigartige Weise.
»Wie fühlen Sie sich?«, fragte er, als sei er tatsächlich um ihr Wohl besorgt.
»Es ging mir schon besser«, gab sie mürrisch zurück und betrachtete erneut die Ketten. Stahl, hatte er gesagt. Himmel, sie war gefesselt wie ein Elefant, bei dem man verhindern wollte, dass er Amok läuft.
»Das Betäubungsmittel, das ich Ihnen gegeben habe, kann Kopfschmerzen auslösen, wenn die Wirkung nachlässt, aber auch ein Gefühl von Benommenheit«, erklärte er entschuldigend. »Haben Sie irgendwelche Symptome in dieser Richtung? Möchten Sie eine Schmerztablette haben?«
»Nein«, erwiderte sie schroff. Sie wusste, solche Nebenwirkungen würden sich dank der Nanos schnell von selbst erledigen. Dann kniff sie die Augen zusammen und sah dem Mann konzentriert ins Gesicht, während sie versuchte, seine Gedanken zu durchdringen und die Kontrolle über ihn zu erlangen. Dann würde sie ihn dazu veranlassen, ihr die Ketten abzunehmen und zu erklären, was das alles sollte – ehe sie ihn zu Onkel Lucian schickte, damit der sich den Kerl vornehmen konnte. Zumindest war das ihr Plan, aber so lief es nicht, da sie weder in seine Gedanken eindringen noch ihm befehlen konnte, sie zu befreien.
Muss an dem Mittel liegen, das er mir injiziert hat, überlegte Jeanne Louise und schüttelte leicht den Kopf, ehe sie einen zweiten Anlauf wagte. »Nichts«, murmelte sie gleich darauf. Die Injektion schien noch immer zu wirken. Sie sah den Mann finster an. »Was haben Sie mir da gespritzt?«
»Das neueste Betäubungsmittel, an dem wir in der Forschungsabteilung arbeiten«, antwortete er und verließ den Raum, sodass Jeanne Louise ihn nicht mehr sehen konnte.
Irritiert betrachtete sie die Stelle, an der er eben noch gestanden hatte. In welcher Forschungsabteilung arbeitete er, dass dort ein solches Betäubungsmittel entwickelt wurde? Für Sterbliche konnte das eigentlich nicht bestimmt sein, denn dann hätte es bei ihr kaum Wirkung gezeigt und sie erst recht nicht bewusstlos werden lassen. Aber …
Ihr Gedankengang wurde unterbrochen, da er zurück ins Zimmer kam und sich dem Bett näherte.
»Arbeiten Sie für Argeneau Enterprises?«, fragte sie und musterte interessiert, was er in der Hand hielt – ein großes Glas, in dem sich eiskaltes Wasser zu befinden schien. Auf einmal wurde ihr bewusst, wie ausgedörrt ihr Mund und Hals waren.
»Richtig. Ich arbeite so wie Sie in der Forschung, nur entwickle ich neue Medikamente, während Sie nach genetischen Anomalien suchen, wenn ich das richtig mitbekommen habe«, sagte er im Plauderton, während er sich neben das Bett stellte.
Jeanne Louise zog die Stirn in Falten. Bastien Argeneau, ihr Cousin und Chef von Argeneau Enterprises, hatte sie gleich nach ihrem Universitätsabschluss vor rund fünfundsiebzig Jahren eingestellt, und seitdem arbeitete sie für Argeneau Enterprises. Anfangs war sie in der Abteilung tätig gewesen, in der dieser Mann angeblich arbeitete, aber vor fünfundzwanzig Jahren hatte Bastien sie gebeten, ein paar Leute aus der Forschungsabteilung auszuwählen, mit denen sie ein Team bilden wollte. Sie sollte einen neuen Bereich leiten, der sich ausschließlich dem Thema widmete, wie ihr Cousin Vincent und ihr Onkel Victor sich ernähren konnten, ohne dafür Sterbliche beißen zu müssen. Sie wollten unbedingt so wie jeder andere ihrer Art Blutkonserven trinken, weil es das Leben ganz erheblich erleichterte. Aber beide litten an einer genetischen Anomalie, sodass Blut aus dem Plastikbeutel für sie genauso nahrhaft war wie Wasser. Hätten ihnen nur Blutkonserven zur Verfügung gestanden, wären sie über kurz oder lang gestorben.
Sie sollte herausfinden, was genau diese Reaktion hervorrief, um dann in einem zweiten Schritt zu erforschen, ob man den beiden irgendein Medikament verabreichen konnte, das so etwas unterband. Seitdem leitete sie dieses Team, doch bislang war es ihnen nicht gelungen, den Grund für die Anomalie zu bestimmen oder wenigstens einzugrenzen. An ein Gegenmittel war damit selbst auf lange Sicht nicht zu denken.
Mit einem leisen Seufzer angesichts dieser misslichen Lage sah sie wieder zu dem Mann und stellte fest, dass er nach wie vor neben dem Bett stand und zwischen ihr und dem Wasserglas hin- und herblickte.
»Können Sie Wasser trinken?«, fragte er. »Ich meine, ich weiß, dass Leute Ihrer Art essen und trinken können, aber hilft das was oder muss es unbedingt Blut sein? Ein bisschen davon hätte ich da.«
Schweigend starrte sie ihn an. Ich weiß, dass Leute Ihrer Art essen und trinken können? Leute Ihrer Art? Das klang so, als würde sie zu einer fremden Spezies gehören. Oder als sei sie ein Alien. Der Mann wusste, sie war keine Sterbliche. Aber was wusste er genau über sie? Sie musterte ihn mit ernster Miene, versuchte noch einmal ihn zu lesen und scheiterte auch dieses Mal. Dann kehrte ihr Blick zu dem Wasser zurück, das so kalt war, dass das Glas von außen beschlagen war und sich kleine Rinnsale gebildet hatten.
Jeanne Louise hätte sogar dafür bezahlt, nur um diese paar Tropfen ablecken zu können. Aber sie wusste nicht, was sich außer einigen Eiswürfeln noch in dem Glas befand. Möglicherweise noch mehr Betäubungsmittel, und das konnte sie nicht riskieren. Wenn er in der Forschungsabteilung angestellt war, dann standen ihm Medikamente zur Verfügung, die ihr ernsthaften Schaden zufügen konnten.
»Es ist nur Wasser«, sagte der Mann, als hätte er ihre Gedanken gelesen, was ausgesprochen ironisch war. Schließlich war er der Sterbliche – ein Blick in seine Augen genügte, um das zu erkennen –, und Sterbliche konnten keine Gedanken lesen. Unsterbliche waren jedoch dazu in der Lage, nur dass es ihr im Augenblick eben nicht möglich war. Vermutlich war es also nur ihr Gesichtsausdruck, der sie verraten hatte.
»Es gibt keinen Grund, Sie wieder zu betäuben«, fügte er hinzu, als wolle er sie überzeugen. »Von diesen Ketten können Sie sich aus eigener Kraft nicht befreien, und außerdem müssen Sie einen klaren Kopf haben, wenn Sie über den Vorschlag nachdenken sollen, den ich Ihnen unterbreiten werde.«
»Den Vorschlag?«, wiederholte sie leise und zerrte einmal kurz an ihren Ketten. Mit ein wenig Anstrengung wäre es ihr wohl gelungen, eines der Glieder durchzubrechen, allerdings auch nur, wenn der Kerl nicht auf die verrückte Idee gekommen wäre, sie wie eine Mumie einzuwickeln.
»Wasser oder Blut?«
Die Frage lenkte ihren Blick zurück zum Glas. Niemand konnte ihr garantieren, dass das Blut in Ordnung war. Sie ließ sich die Frage kurz durch den Kopf gehen, dann deutete sie mit einem Nicken auf das Wasser.
Der Mann beugte sich vor, schob eine Hand unter ihr Kinn und hob es hoch, bis er das Glas an ihre Lippen ansetzen und kippen konnte. Eigentlich wollte sie nur daran nippen, aber als die kalte Flüssigkeit auf ihre Zunge tropfte, gab es für sie kein Halten mehr. Mit gierigen Schlucken trank sie, bis das Glas nur Augenblicke später zur Hälfte geleert war. Er nahm das Glas weg und ließ ihren Kopf behutsam zurück auf das Bett sinken, ehe er sich aufrichtete.
»Haben Sie Hunger?«, fragte er dann.
Einen Moment lang dachte sie über seine Frage nach. Ihre letzte Mahlzeit war das Frühstück in der Argeneau-Kantine gut eineinhalb Stunden vor Feierabend gewesen, sodass sie eigentlich keinen Hunger hatte. Aber wenn er sie etwas essen lassen wollte, würde er die Ketten lösen müssen. Diese Vorstellung ließ sie erwartungsvoll lächeln.
»Ja«, antwortete sie und setzte rasch eine ernste Miene auf, als ihr auffiel, dass er die Augen ein wenig zusammengekniffen hatte.
Nach kurzem Zögern nickte er, drehte sich um und verließ abermals das Zimmer, wohl um etwas Essbares für sie zu besorgen.
Jeanne Louise sah ihm nach, und kaum dass er die Tür hinter sich zugezogen hatte, konzentrierte sie sich wieder auf die Kette, weil sie herausfinden wollte, ob es sich um eine einzige lange Kette oder um mehrere einzelne Stücke handelte. Vermutlich war das aber auch völlig egal, da sie in ihrer Position praktisch keine Hebelwirkung anwenden konnte, um irgendetwas zu erreichen.
Ihre einzige Hoffnung war die, dass der Mann ihre Fesseln löste, wenn er ihr etwas zu essen brachte. Dann würde sie ihn mühelos überwältigen können, was natürlich umso einfacher war, wenn ihr Verstand nicht mehr unter dem Einfluss des verabreichten Medikaments stand. Dann konnte sie ihn nämlich einfach kontrollieren und ihn dazu veranlassen, ihr die Ketten abzunehmen. Es würde ihr eine Menge Mühe ersparen.
Welchen Vorschlag dieser Mann im Sinn hatte, konnte sie nicht mal erahnen, aber es gab nur wenige Sterbliche, die von der Existenz der Unsterblichen wussten. Dabei handelte es sich um vertrauenswürdige leitende Angestellte bei Argeneau Enterprises oder um außergewöhnlich brillante Wissenschaftler, die eingeweiht sein mussten, damit sie ihrer Aufgabe gerecht werden konnten. Er musste zu den Letzteren gehören, aber welcher Gruppe auch immer er zuzurechnen war, ein Sterblicher musste stets im Auge behalten werden. Von Zeit zu Zeit wurden sie auf ihren Geisteszustand untersucht, um Gewissheit zu haben, dass sie nicht irgendeine Dummheit begehen und sich beispielsweise mit ihrem Wissen an die Presse wenden wollten. Und dass sie auch nicht auf die Idee kamen, eine Unsterbliche zu entführen, an ein Bett zu ketten und ihr irgendwelche Vorschläge zu unterbreiten.
Irgendjemand hatte bei diesem Mann offenbar geschlafen, überlegte Jeanne Louise verärgert. Die Tatsache an sich machte ihr keine großen Sorgen, sie hatte auch keine Angst. Sie war nur verärgert darüber, dass sie aus ihrer Routine gerissen worden war und sie wohl den größten Teil des Tages würde wach bleiben müssen, bis diese Angelegenheit erledigt war. Sie musste herausfinden, welche Pläne dieser Mann verfolgte und ob er irgendwen eingeweiht hatte, und dann mussten seine Erinnerungen gelöscht und die Situation ins Reine gebracht werden. Das einzig Gute daran war, dass Jeanne Louise sich nicht selbst darum kümmern musste. Die Vollstrecker erledigten solche Angelegenheiten, allerdings würde sie noch stundenlang Fragen beantworten und alles Mögliche erklären müssen. Es war einfach nur lästig, und Jeanne Louise mochte es ganz und gar nicht, wenn sie ihrem gewohnten Rhythmus nicht nachgehen konnte.
Ihre Gedanken wurden unterbrochen, als die Tür sich öffnete und sie erwartungsvoll in diese Richtung blickte. Ein zufriedenes Lächeln stahl sich auf ihre Lippen, als sie sah, dass der Mann mit einem Teller Essen in der Hand hereinkam. Er würde ihre Fesseln auf jeden Fall lösen müssen, um sie zu füttern. Doch im nächsten Moment musste sie einsehen, dass die Intelligenz des Kerls sich nicht auf die Forschungsabteilung bei Argeneau Enterprises beschränkte. Er hielt den Teller mit nur einer Hand fest, mit der anderen bediente er irgendwas neben dem Bett, woraufhin sich das Kopfende langsam nach oben zu bewegen begann.
»Ein Krankenhausbett«, erklärte er mit breitem Grinsen, als er ihre verblüffte Miene bemerkte. »Die sind sehr praktisch.«
»Allerdings«, bemerkte sie trocken, während er innehielt und sich suchend umsah.
»Bin gleich zurück«, sagte er, stellte den Teller auf dem Fußboden ab und ging erneut aus dem Zimmer. Diesmal dauerte es nicht mal eine Minute, bis er mit einem Holzstuhl zu ihr zurückkehrte, den er neben das Bett stellte. Er hob den Teller hoch und setzte sich hin. Dann führte er eine Gabel mit Essen zu ihrem Mund, woraufhin sie verärgert den Kopf zur Seite drehte.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Sie hatten aber doch gesagt, dass Sie Hunger haben«, gab er überrascht zurück.
»Das war gelogen.«
»Ach, kommen Sie. Ich habe das jetzt extra aufgewärmt. Sie können ja wenigstens mal davon probieren«, sagte er in einem Tonfall, als würde er mit einem störrischen Kind reden. Als sie ihn nur finster ansah, lächelte er sie charmant an und hielt ihr wieder die Gabel hin. »Es ist Ihr Lieblingsessen.«
Das ließ sie aufhorchen und erstaunt auf den Teller sehen. Das war tatsächlich ihr Lieblingsgericht: Käseomelett mit Würstchen. Es war das, was sie jeden Morgen in der Betriebskantine zum Frühstück aß. Als sie den Mann fragend anschaute, zuckte der nur mit den Schultern.
»Ich dachte mir, es soll Ihnen wenigstens an nichts fehlen, solange Sie hier sind. Ich möchte auf keinen Fall, dass Sie sich hier unbehaglich oder unglücklich fühlen.«
Ungläubig sah Jeanne Louise ihn mit großen Augen an und warf einen vielsagenden Blick auf die Ketten. »Ach, nennen Sie das etwa ›behaglich‹?«, konterte sie sarkastisch.
»Die Ketten nehme ich Ihnen ab, sobald ich Ihnen meinen Vorschlag erläutert habe«, versicherte er ihr. »Die sind nur erforderlich, damit Sie mir vorher nicht weglaufen.«
»Soll ich Ihnen mal sagen, wo Sie sich Ihren Vorschlag hinstecken können?«, knurrte sie ihn an, kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich wieder auf sein Gesicht, um in seine Gedanken vordringen zu können. Abermals fand sie sich vor einer Mauer wieder, die sie nicht überwinden konnte. Die Medikamente wirkten sich noch immer auf ihre Fähigkeiten aus, nahm sie zur Kenntnis und ließ sich nach hinten sinken.
»Also gut«, lenkte sie ein.« Dann erzählen Sie mir, um welchen Vorschlag es geht.« Hauptsache, er ließ sie bald wieder gehen.
Der Mann zögerte und schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass Sie jetzt in der Verfassung sind, mir zuzuhören. Sie wirken ziemlich aufgebracht.«
»Wie kommen Sie bloß auf so eine Idee?«, fauchte sie ihn an.
»Vermutlich, weil Sie Hunger haben«, sagte er mit sanfter Stimme und hielt ihr abermals die Gabel hin.
»Ich sagte bereits, dass ich keinen Hu…« Weiter kam Jeanne Louise nicht, da ihr Magen in dem Moment laut knurrte. Dass sie offenbar doch Hunger hatte, verwunderte sie, aber vermutlich war diese Reaktion durch den intensiven Essensgeruch ausgelöst worden und durch die Tatsache, dass sie heute Morgen nur eine halbe Portion gegessen hatte, da sie so in ihre Arbeit vertieft gewesen war. Jedenfalls hatte sie sich das eingeredet, als sie den noch halb vollen Teller weggeschoben hatte. Allerdings durfte sie dabei nicht vergessen, dass sie in letzter Zeit immer öfter Mahlzeiten ganz ausließ oder sich mit ein paar Happen begnügte. Es schmeckte ihr einfach nicht mehr so besonders wie früher. Nicht mal mehr Schokolade war so lecker, wie sie es einmal gewesen war.
Wahrscheinlich kam sie allmählich in dieses Alter, in dem Essen seinen Reiz verlor und nur noch eine lästige Betätigung darstellte. Aber auch wenn das Frühstück ihr fade und langweilig vorgekommen war, musste sie doch zugeben, dass das gleiche Gericht jetzt richtig verlockend duftete. Und sie verspürte tatsächlich leichten Hunger, ihr Blick wurde von der Gabel geradezu magisch angezogen. Als der Mann dann die Gabel leicht hin und her bewegte, so wie man es bei einem Kind machte, damit es zu essen begann, sah Jeanne Louise ihn mit zusammengekniffenen Augen an und warnte ihn: »Wenn Sie jetzt auch noch anfangen, wie ein Flugzeug zu brummen, dann werde ich ganz sicher keinen Happen essen.«
Er lachte überrascht auf, hielt ihr aber weiter die Gabel hin. »Tut mir leid.«
»Hmm«, grummelte sie und machte dann tatsächlich den Mund auf. Nachdem sie zu kauen begonnen hatte, musste sie feststellen, dass das Omelett so gut schmeckte, wie es roch. »Woher wissen Sie, dass das mein Lieblingsgericht ist?«, fragte sie, als sie geschluckt hatte.
»Ich habe jahrelang um die gleiche Zeit gefrühstückt wie Sie, jedenfalls bis vor einem Monat«, schränkte er mit einem Schulterzucken ein. »Es ist das, was Sie immer bestellen.«
Diesmal sah sich Jeanne Louise den Mann genauer an, dabei bemerkte sie seine sehr kurz geschnittenen Haare, die dunkelbraunen Augenbrauen und sein gefälliges Lächeln. Er war durchaus ein gut aussehender Mann, und es wunderte sie, dass er ihr in der Cafeteria nie aufgefallen war, obwohl sie angeblich jahrelang praktisch Seite an Seite gefrühstückt hatten. Allerdings neigte sie auch dazu, sich so in ihre Arbeit zu vertiefen, dass sie oft nicht viel von dem mitbekam, was sich um sie herum abspielte. Sie wollte unbedingt das Heilmittel für ihren Onkel und ihren Cousin finden, weshalb sie ihre Notizen auch in die Pause mitnahm, damit sie sich während des Essens weiter damit beschäftigen konnte. So besessen, wie sie davon war, hätte selbst Onkel Lucian persönlich neben ihr am Tisch sitzen können, ohne dass sie es gemerkt hätte.
Sie sah ihrem Gegenüber in die Augen, als ihr etwas ins Gedächtnis kam, was der Mann eben gesagt hatte. »Bis vor einem Monat? Arbeiten Sie jetzt nicht mehr für Argeneau Enterprises?«
»Doch, doch«, versicherte er hastig. »Ich habe mich nur für ein paar Monate beurlauben lassen.«
Jeanne Louise verarbeitete diese neue Information und kam zu dem Schluss, dass vielleicht doch niemand im Unternehmen nachlässig gewesen war. Wenn sich der Mann seinen Plan erst innerhalb der letzten Wochen ausgedacht hatte, konnte niemand aus dem Team, das die Sterblichen überwachte, irgendetwas in den Gedanken dieses Mitarbeiters entdeckt haben.
»Mehr?«, fragte er leise und hielt ihr die Gabel wieder hin.
Erst nach kurzem Zögern nahm sie den nächsten Happen Omelett mit Würstchen in den Mund und begann zu kauen. Nachdem sie geschluckt hatte, führte er erneut die Gabel mit dem nächsten Bissen zu ihrem Mund.
»Das ginge alles etwas einfacher, wenn ich die Gabel selbst halten würde«, beklagte sie sich.
»Ja, das ist wahr«, stimmte er ihr zu, und als sie gerade den Mund aufmachte, um ihn ungeduldig aufzufordern, sie dann doch auch gefälligst selbst essen zu lassen, nutzte er die Gelegenheit und schob ihr die Gabel in den Mund, bevor ihr auch nur ein Wort über die Lippen kommen konnte. Während sie kaute, redete er weiter: »Aber ich weiß auch, dass Ihre Art sehr stark ist, und ich möchte nicht riskieren, dass Sie einen Fluchtversuch unternehmen. Ich bin mir sicher, wenn ich Ihnen erst einmal die Situation dargelegt habe, werden solche Vorsichtsmaßnahmen nicht mehr nötig sein. Aber bis dahin … ist es besser, wenn wir es so lassen, wie es ist.«
»Meine Art«, wiederholte Jeanne Louise missbilligend, kaum dass sie geschluckt hatte. »Dass wir auch Menschen sind, wissen Sie ja wohl, oder?«
»Aber Sie sind keine Sterblichen«, hielt er dagegen.
»Schön wär’s. Wir können genauso sterben wie jeder von Ihnen. Wir sind nur nicht so leicht totzukriegen, und wir leben länger«, ergänzte sie widerstrebend.
»Und Sie bleiben immer jung, Sie sind immun gegen Krankheiten, und Sie verfügen über Selbstheilungskräfte«, fügte er verhalten hinzu und fütterte sie mit dem nächsten Happen.
Jeanne Louise beobachtete ihn aufmerksam, während sie kaute. »Lassen Sie mich raten. Das hätten Sie auch gern. Sie wollen jung sein, Sie wollen lange leben, stärker sein als …«
Er schüttelte den Kopf und brachte sie mit dem nächsten Bissen vorübergehend zum Schweigen. »Nein, das will ich nicht.«
»Und was wollen Sie dann?«, fragte sie frustriert, als sie wieder reden konnte. »Was für einen Vorschlag wollen Sie mir machen?«
Für einen Moment zögerte er, und sie konnte ihm ansehen, dass er das Für und Wider abwägte, bis er schließlich erneut den Kopf schüttelte. »Noch nicht.«
Als er diesmal die nächste Gabel folgen ließ, drehte sie kurzerhand den Kopf zur Seite. »Ich habe keinen Hunger mehr«, erklärte sie, da sie jetzt zu wütend war, um noch etwas essen zu wollen. Außerdem war der schlimmste Hunger erst einmal gestillt.
Eine Zeit lang saß er schweigend da, dann legte er seufzend die Gabel zurück auf den noch halb vollen Teller. »Sie können sich jetzt erst mal eine Weile ausruhen«, erklärte er, als er aufstand. »Wenn Sie wieder wach sind, sollte die Wirkung des Medikaments vollständig nachgelassen haben. Dann können wir uns unterhalten.«
Sie zeigte nicht die geringste Reaktion auf seine Worte, sondern starrte mit grimmiger Miene die Wand an, bis er irgendeinen Schalter betätigte und das Kopfende des Bettes in die ursprüngliche waagerechte Position zurückkehrte. Erst als sie hörte, wie er das Zimmer verließ und die Tür hinter sich schloss, entspannte sie sich ein wenig und ließ es zu, dass ihr die Augen zufielen.
Sie wollte von hier verschwinden und in ihr eigenes Leben zurückkehren. Aber sie war immer noch müde, und solange das Medikament wirkte, konnte sie wenig ausrichten. Sobald dann aber die Wirkung nachließ, würde sie die Kontrolle über die Situation an sich reißen, damit der Mann sie freiließ. Damit würde er nicht rechnen, sagte sich Jeanne Louise. Es gab zwar einige Sterbliche, die wussten, was es mit den Unsterblichen auf sich hatte und über welche Fähigkeiten sie verfügten. Doch dass Unsterbliche die Gedanken eines anderen lesen und dessen Verstand kontrollieren konnten, das vertrauten sie Außenstehenden normalerweise nicht an. Sterbliche reagierten meist entrüstet, wenn sie davon erfuhren, dass jemand mithören konnte, was ihnen durch den Kopf ging. Daher hatte »ihre Art« über die Jahrhunderte hinweg gelernt, dieses Wissen lieber für sich zu behalten. Falls es für seine Arbeit allerdings notwendig gewesen sein sollte, darüber Bescheid zu wissen, dann wäre er wahrscheinlich auch entsprechend eingeweiht worden. Doch davon ging Jeanne Louise nicht aus, denn sonst hätte er ihr weiter Medikamente verabreicht, anstatt darauf zu warten, dass sie wieder einen klaren Kopf bekam, ehe er ihr mehr über seinen rätselhaften Vorschlag verraten würde.
Sie fragte sich, wer er wohl eigentlich war, denn bislang wusste sie weder seinen Namen noch irgendetwas über seine Person. Sie wusste nur, dass er in der Forschungsabteilung bei Argeneau Enterprises arbeitete und zur gleichen Zeit Frühstückspause machte wie sie.
Das bedeutete wahrscheinlich, dass er auch in der Nachtschicht arbeitete, was sie verwunderte. Sterbliche waren normalerweise für die Nachtschicht nicht so zu begeistern. Eigentlich wimmelte es nachts im Unternehmen von Unsterblichen, während die Sterblichen die Tagschicht bevorzugten. Sie fragte sich, warum er wohl nachts arbeitete, aber dann ließ sie das Thema auf sich beruhen. Eine Antwort würde sie jetzt ohnehin nicht finden, außerdem musste sie hellwach und bei Kräften sein, wenn er zu ihr zurückkehrte.
Paul zog die Tür hinter sich zu und ging leise seufzend durch den Flur zur Treppe, während er noch einmal über alles nachdachte, was er bislang unternommen hatte. Er wollte sicher sein, dass er nichts übersehen hatte, was später zu Problemen führen würde, aber er konnte auch nicht erkennen, dass irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten waren. Er hatte gewartet, bis sie mit ihrem Wagen das Firmengelände verlassen hatte, ehe er zur Tat geschritten war – was wiederum so glatt gelaufen war, wie von ihm erhofft.
Als Paul ihr das Betäubungsmittel gespritzt hatte, wartete außer ihr niemand sonst darauf, dass die Ampel auf Grün umschlug, sodass sie auch keinen anderen Wagen hätte behindern können. Das war natürlich ein purer Glücksfall gewesen. Gott oder das Schicksal hatten es heute Morgen mit ihm wirklich gut gemeint.
Das Mittel hatte so schnell gewirkt wie bei den Labortests, und es waren nur Sekunden erforderlich gewesen, um aus dem Wagen auszusteigen, Jeanne Louise auf den Beifahrersitz zu heben und dann selbst mit ihrem Wagen weiterzufahren.
Ein Problem sah er allenfalls bei dem Teil des Plans, als er aus dem Kofferraum von Lesters Wagen geklettert war und sich in Jeanne Louises Auto versteckt hatte. Da war er von gleich drei Überwachungskameras gleichzeitig erfasst worden, aber er war komplett dunkel gekleidet gewesen und hatte zudem eine Skimütze getragen, die sein Gesicht verdeckte. Ein brauchbares Bild konnten die Kameras nicht von ihm erfasst haben.
In der Nacht war er in Lesters Garage eingestiegen, um sich im Kofferraum seines Wagens zu verstecken, damit er unbemerkt auf das Gelände von Argeneau Enterprises gelangen konnte. Für ihn hatte das bedeutet, den Kofferraumdeckel bis kurz vor Ende von Jeanne Louises Schicht festhalten zu müssen, um im letzten Augenblick das Fahrzeug zu wechseln. Seine größte Sorge war die gewesen, dass Jeanne Louise ihren Wagen abschloss, doch das machte kaum ein Angestellter. Wachleute drehten von Zeit zu Zeit ihre Runden, außerdem wurde jeder Winkel von Kameras erfasst, sodass von vornherein niemand auf dumme Gedanken kommen würde.
Zum Glück hatte auch Jeanne Louise ihren Wagen unverschlossen stehen lassen, und sie hatte auch nur ihre übliche halbe Stunde über den eigentlichen Feierabend hinaus gearbeitet, sodass er genau hatte abpassen können, wann er den Kofferraum von Lesters Wagen verlassen musste. Sollte ihn jemand beobachtet haben, dann waren sämtliche Sicherheitsleute auf jeden Fall zu langsam gewesen, denn Jeanne Louise war von niemandem am Verlassen des Firmengeländes gehindert worden.
Jetzt stand nur noch zu befürchten, dass man Lester für seinen Komplizen hielt und der deswegen Ärger bekam. Das wäre Paul sehr unangenehm, weil Lester ein netter Kerl war. Aber er konnte für den Mann jetzt nichts tun, also verdrängte er diese Gedanken und ging die Kellertreppe hoch. Er kam in der Küche aus, ging zur Spüle und wollte eben den Rest des Omeletts in den Abfalleimer kippen, als er es sich auf einmal anders überlegte und er stattdessen zur Treppe weitereilte, die in den ersten Stock führte. Hastig begab er sich nach oben, dabei fühlte er mit einer Hand unter den Teller, ob das Essen noch warm war. Es war erstaunlich warm, und es sah so appetitlich aus, dass er Hunger bekam. Er konnte nur hoffen, dass Livy das auch dachte, aber er rechnete eher mit dem Gegenteil. Nichts schien inzwischen noch ihren Appetit zu wecken.
»Daddy?«
Als er das leise Rufen hörte, setzte er ein gezwungenes Lächeln auf und ging quer durch das in Rosa gehaltene Schlafzimmer in Richtung Himmelbett, in dem das schmale blonde Mädchen inmitten von weichen Kissen und dicken Decken fast verschwand. »Ja, mein Schatz, ich bin hier.«
»Mrs Stuart hat gesagt, dass du letzte Nacht zur Arbeit gefahren bist«, sagte die Kleine mit verletzter Miene.
»Ja, aber nur für kurze Zeit. Außerdem bin ich jetzt ja wieder da«, erwiderte er leise. Es wunderte ihn nicht, dass sie Bescheid wusste. Er war mit Jeanne Louises Wagen zu dem glücklicherweise menschenleeren Parkplatz gefahren, auf dem sein eigenes Auto stand, mit dem er die Frau dann zu sich nach Hause gebracht hatte. Von der Garage aus hatte er sie direkt in den Keller getragen und angekettet, erst dann war er auf die Suche nach der Babysitterin gegangen.
Mrs Stuart hatte ihm berichtet, dass Livy eine schlimme Nacht hinter sich hatte, was ihn zwar traurig stimmte, aber nicht überraschte. In letzter Zeit war fast jede Nacht für sie eine Strapaze gewesen. Aber nicht mehr lange, sagte er sich und hielt den Teller ein wenig schräg, damit sie sehen konnte, was darauf war. »Hast du Hunger?«
»Nein«, sagte sie mit matter Stimme und drehte den Kopf weg.
Paul zögerte, dann redete er sanft auf sie ein: »Herzchen, du musst was essen, damit du bei Kräften bleibst und wieder gesund werden kannst.«
»Mrs Stuart hat gesagt, dass ich nicht wieder gesund werde. Und dass Gott …« Sie zog die Brauen zusammen, als versuche sie sich an den genauen Wortlaut zu erinnern. »… dass Gott mich zu sich holen wird. Sie hat gesagt, wenn ich sehr brav bin und er mich mag, dann darf ich auch Mommy sehen. Aber sie meint, dass das nicht klappen wird, weil ich nicht lieb bin und immer weine. Meinst du, Gott mag mich, auch wenn ich weine?«
Paul stand wie erstarrt da. Alles Blut schien ihm aus dem Kopf gewichen zu sein, sodass er zu keiner Handlung und keinem klaren Gedanken fähig war. Sein Gehirn hatte genug damit zu tun, zu verarbeiten, was Livy soeben gesagt hatte. Dann jedoch wurde das Blut zurück in den Kopf gepumpt und brachte einen rasenden Zorn mit sich.
Er sagte kein Wort, das Risiko war einfach zu groß. Die Beschimpfungen, die ihm auf der Zunge lagen, waren für Kinderohren eindeutig nicht geeignet. Nachdem er einen Moment mit sich gerungen hatte, brachte er nur ein knappes »Ja« heraus, dann machte er kehrt und ging nach unten in die Küche. Jede seiner Bewegungen wirkte abgehackt und ungelenk, während er das restliche Essen in den Abfalleimer kippte. Als er zum Spülbecken ging, hielt er den Teller aber nicht unter den Wasserhahn, sondern zerschlug ihn auf der Kante der Spüle. Ihm war gar nicht bewusst, was er da tat, und er bemerkte auch nur beiläufig, dass ihn der eine oder andere Splitter am Hals und im Gesicht traf.
Diese widerwärtige alte Schnepfe. Er hätte nie zulassen dürfen, dass Mrs Stuart auf Livy aufpasst. Ihm war klar gewesen, dass sie sich nicht davon abhalten lassen würde, anderen Menschen ihre Bibel um die Ohren zu hauen, aber er hatte keine andere Wahl gehabt. Mrs Stuart war vor ihrer Pensionierung Krankenschwester gewesen, und er kannte niemanden sonst, der wusste, was zu tun war, falls es mit Livy irgendein Problem geben sollte. Aber er würde das alte Miststück nicht noch einmal in die Nähe seiner Tochter lassen. Wenn sie brav war, würde Gott sie vielleicht mögen? Aber nicht, wenn sie weinte? Verdammt noch mal, das Kind lag im Sterben, es wurde bei lebendigem Leib vom Krebs aufgefressen, es hielt Schmerzen aus, die er sich nicht mal ansatzweise vorstellen konnte. Man hatte ihm ein Schmerzmittel mitgegeben, das er Livy in der höchsten Dosierung geben sollte, doch es bewirkte so gut wie nichts. Die einzige andere Möglichkeit wäre die gewesen, sie im Krankenhaus bis zu ihrem Ende in ein künstliches Koma zu versetzen, aber dazu konnte er sich nicht durchringen. Er konnte nicht einfach zusehen, wie sie starb. Er wollte, dass sie geheilt wurde. Nur gab es nichts, was bis dahin ihre Schmerzen wirklich lindern konnte. Und dann stellte sich Mrs Stuart auch noch auf den Standpunkt, dass Livy wegen der Tränen, die sie durch ihre Krankheit bedingt vergoss, bei Gott einen schlechten Stand hatte und er sie nicht ihre Mutter sehen lassen würde? Wie …?
»Daddy?«
Paul versteifte sich und atmete hastig ein, um sich wieder zu beruhigen. Dann sah er mit ausdrucksloser Miene seine fünfjährige Tochter an, die in der Tür zur Küche stand. Und schon im nächsten Moment lief er zu ihr, um sie in seine Arme zu schließen. »Was machst du denn hier unten, Liebling? Du sollst doch nicht aufstehen.«
»Ich hab keine Lust mehr, im Bett zu liegen«, antwortete sie betrübt und hob die Hände, um nach seinem Kinn zu fassen. »Du blutest ja. Hast du dich geschnitten?«
»Nein … ja … es ist alles in Ordnung«, versicherte er ihr und trug sie wieder in den ersten Stock. Sie war nur noch Haut und Knochen, was ihm einen Stich versetzte, als er sie im Arm hielt. Paul lebte für sie, und er würde auch für sie sterben, wenn es sein musste. Aber für den Augenblick musste er sie wieder ins Bett legen, weil er dringend ein paar Stunden Schlaf nachzuholen hatte. Die ganze Nacht über war er wach gewesen, und wenn er später mit Jeanne Louise Argeneau ein Gespräch führen wollte, musste er hellwach und bei klarem Verstand sein. Er musste sie davon überzeugen können, aus dem Mädchen eine von ihrer Art zu machen. Er würde alles dafür geben, sogar sein eigenes Leben, wenn sie seine Tochter bloß wandelte und ihr zeigte, wie man als Vampir in dieser Welt überlebte. Er würde alles geben für die Gewissheit, dass Livy weiterlebte. Bei ihrer Mutter – seiner Frau Jerri – hatte er schon versagt, aber das würde ihm nicht noch einmal passieren.
Er musste Jeanne Louise dazu bringen, Livy das Leben zu retten. Sie war seine einzige Hoffnung.
2
Jeanne Louise wachte auf, da sie spürte, dass sich jemand bei ihr im Zimmer aufhielt. Es war kein Instinkt, der sie das bemerken ließ, sondern das leise Summen der Gedanken eines Sterblichen, das sich am äußersten Rand ihrer Wahrnehmung bemerkbar machte. Diese Gedanken surrten wie eine Biene an ihrem Ohr vorbei und waren zunächst nicht deutlich zu verstehen, da sie noch nicht voll bei Bewusstsein war. Jeanne Louise schlug die Augen auf und drehte den Kopf zur Seite.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!