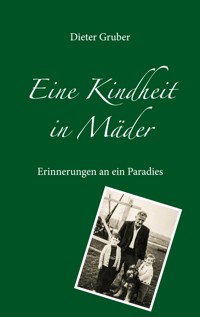Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieter Gruber ist schon über siebzig Jahre alt, als er sich in Gedanken auf den Weg in seine Vergangenheit macht. Ziel der Reise ist die Zeit seiner Kindheit, die er Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Hard am Bodensee und in Mäder, einer ländlichen Gemeinde im Vorarlberger Vorderland, verbracht hat. Dort trifft er alle wieder: seine Eltern und Großeltern, seinen Bruder, seine Verwandten und seine Spielgefährten von damals. Er begegnet den Tieren, die ihm so viel bedeutet haben, besucht die Häuser und Plätze seiner Kindheit und erinnert sich an unzählige Geschichten und Abenteuer, die diese Jahre prägten. Es sind wahrhaft paradiesische Welten, von denen Gruber hier erzählt, und seine Geschichten lassen beim Leser Bilder aus der eigenen Kindheit aufsteigen, die schon längst vergessen waren. Ein berührendes, fröhliches, ein Mut machendes Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Tina, meine Frau
Inhalt
Vorwort
Meine Eltern oder „Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn“
Räba und Hafaloab
Als die Fleischvögel fliegen lernten
Badespaß und Hygiene
Mein Vater, der Zöllner
Ein schrecklicher Unfall
Die Müllkippe oder Wie wir das Recycling entdeckten
Winter am See - Der Schlittschuhläufer
Holzfäller und Floßbauer
Mein Bruder und sein Tomahawk
Die Feuerleiter
Der Harder Fenstersturz
Spiele und Spielzeug
Wir lassen einen Drachen steigen
Meine Großmutter „Äla“
Der Ferialpraktikant
Rinaldos Unfall
„Blöckla“ oder Stammhüpfen
Meine Schulzeit - Abenteuer auf dem Schulweg
Das erste Schuljahr
Der „Tatzen-Lehrer“
Das erste Mal Fernsehen
Das verkappte Zeichentalent
Die Schönheitsoperation
Moosbrugger Monty und der Gondelkorso
Die tote Sau
Das Krottenloch
Liebe am Nachmittag
Der Kuss
Sie nannten mich „Bibele“
Die Maden im Speck
Hochwasser
Hans, der Glaser
Torfmull vom Rohrspitz oder „Die Beinahehavarie“
Holzaktion am See - „Holza“
Mein Bruder, der Diskuswerfer
Der Hasenbraten
Cavia Porcellus - Das gemeine Meerschwein
Kraut und Rüben
In der Metzgerei
Trivia
Über den Autor
Vorwort
Kürzlich war mein alter Schulfreund Gerhard mit seiner Frau bei uns zu Besuch. Wir hatten einen unterhaltsamen und recht gemütlichen Abend. Gerhard schreibt Bücher und meinte, ich sollte mich, gerade einmal siebzig Jahre alt geworden und im achten Lebensjahrzehnt angekommen, doch auch damit versuchen. Er meinte noch, wenn ich die mir angeborene Faulheit überwinden würde, könnte das auch mir gelingen. Zwei Geschichtensammlungen sind es schließlich geworden. Für diesen freundschaftlichen „Schubser“ bin ich ihm heute dankbar.
Danken möchte ich auch meiner Frau Tina, unserer Freundin Sigrid und meinem Sohn Jérôme. Tina und Sigrid haben sich ans Korrekturlesen gewagt und Jérôme als Spezialist für alles Digitale hat mich immer und ohne Murren in allen technischen Belangen unterstützt.
Mein Dank gilt auch Helmut mit dem ich so wie mit Gerhard vor mehr als einem halben Jahrhundert die Schulbank gedrückt habe. Helmut hat meine beiden Manuskripte redigiert und mit seiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten.
Vor allem möchte ich mich natürlich bei meinem Lieblingsonkel Arnold bedanken. Er hat sein neunzigstes Lebensjahr bereits hinter sich gelassen und sich ebenfalls der Mühe unterzogen, meine Manuskripte zu lesen. Für ihn war es vielleicht ein bisschen unterhaltsamer, weil er in einem der beiden Büchlein neben meinem Großvater eine Hauptrolle spielt.
Bregenz, Jänner 2018
Meine Eltern oder „Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn!“
Mein etwa zweieinhalb Jahre jüngerer Bruder Rinaldo und ich hatten eine unbeschwerte Kindheit. Wenn ich daran zurückdenke, habe ich nur schöne Erinnerungen. Die gleichermaßen fürsorgliche wie auch strenge und autoritäre Erziehung durch unseren Vater haben bei mir, zum Unterschied von meinem kleinen Bruder, keine zum Nachteil gereichende, seelische Spuren hinterlassen, die mich auf Dauer belastet hätten. Vater, Jahrgang 1918, war Katholik und bald nach seiner Rückkehr aus dem Krieg aus der Kirche ausgetreten.
Ich habe ihn nie nach dem Grund dafür gefragt, aber er konvertierte kurz nachdem ich als neuer, frisch gebackener Erdenbürger das Licht der Welt erblickt hatte, zu den Zeugen Jehovas. Danach begann er sich, vermutlich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, ernsthaft und über viele Jahre im Kreis seiner Glaubensbrüder mit der Bibel zu beschäftigen. Dazu hat er auch mich ermuntert und ich tat dies mit großer Freude, sobald ich mit dem Lesenlernen begonnen hatte. Ich weiß noch sehr gut, wie schwer ich mir mit der ungewohnten Ausdrucksform im Alten und Neuen Testament getan habe.
Vater praktizierte seinen neuen Glauben kompromisslos. Als überzeugter Mitbruder missionierte er fleißig und nahm regelmäßig an den sonntäglichen Versammlungen im sogenannten „Königreichssaal“ teil. Die Zeugen Jehovas waren damals der Meinung, dass die Frau dem Manne untertan sei. Ich habe keine Ahnung, ob das auch heute noch der Fall ist, aber Vater ließ sich, soweit ich das mitbekommen habe, schnell davon überzeugen, dass diese „Ordnung“ ihre Berechtigung habe und gute Gründe dafür sprächen, sie auch innerhalb der eigenen Familie durchzusetzen. Und so kam es dann auch. Mutter musste ebenfalls aus der Kirche austreten und durfte fortan keine Weihnachten, keinen Nikolaus, keine Ostern und keine Geburtstage mehr feiern. Nichts anderes hatte sie aber am katholischen Glauben bis dato wirklich interessiert und genau das wurde ihr nun verwehrt. Sie hat zeitlebens darunter gelitten.
Vaters eigene Kindheit, seine Kriegserlebnisse und auch das intensive Studium der Bibel, vor allem jenes des Alten Testaments, waren wahrscheinlich auch mit verantwortlich für sein Verständnis von Kindererziehung. Vater meinte wohl, dass es zu einer pädagogisch wertvollen Erziehung gehöre, wenn er ein bis zweimal pro Jahr zum Rohrstock aus Rattan greife, und zwar immer dann, wenn sich eine seiner Meinung nach ausreichend große Zahl an Straftaten angesammelt hatte. Dieser Stock lag immer griffbereit für uns unerreichbar hoch oben auf dem Küchenkasten. Von diesem Stock konnten wir jahraus, jahrein ein etwa zehn Zentimeter langes Stück sehen, das warnend vom Küchenkasten herunter lugte. Daran erinnere ich mich auch heute noch ganz genau und ich sehe das Stückchen vom Rattanstock immer noch vor mir.
Sobald Vater der Meinung war, unser beider Maß sei wieder einmal voll und das Fass drohe überzulaufen, ist er mit diesem Stock in der Hand über uns Buben zu Gericht gesessen und das im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn es wieder einmal so weit gewesen ist, nahm er auf dem Kanapee Platz, befahl uns zu sich und gleich drauf standen wir beide, Unheil schwanend und mit weichen Knien vor ihm.
Am Beginn des Verfahrens zählte er die seiner Meinung nach zu bestrafenden Taten auf, derer sich wir Buben schuldig gemacht hatten. Dabei vergewisserte er sich durch eingehende Befragung ganz penibel, ob seine beiden Söhne sich ihrer im vergangenen Halbjahr begangenen Straftaten auch bewusst seien. Um die bevorstehende Bestrafung möglichst rasch hinter uns zu bringen, bejahten wir Kinder natürlich regelmäßig wie aus der Pistole geschossen.
Was danach kam, muss bei uns beiden Brüdern recht unterschiedliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung unserer Beziehung zu Vater gehabt haben, wenn ich an die viele Jahre später eindrücklich erlebten Reaktionen meines Bruders Rinaldo zurückdenke. Eigenartigerweise kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob Vater sich mit meinem Bruder ebenso intensiv beschäftigt hat wie mit mir. Wenn ich heute an unsere Kindheit zurückdenke, kommt es mir eher so vor, als hätte er meinem Bruder nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Ich kann mich zwar noch recht gut daran erinnern, dass ich mit meinen Eltern ein paarmal meinen kleinen Bruder besucht habe, als er noch im Vorschulalter, mehrere Wochen oder gar Monate, das weiß ich nicht mehr genau, in der Lungenheilanstalt am Viktorsberg wegen Tuberkulose behandelt worden ist. Kann durchaus sein, dass er diesen Aufenthalt weit weg von zu Hause als eine Form des Weglegens empfunden hat. Schließlich war Viktorsberg von Hard eine halbe Weltreise entfernt. Mir kam es jedenfalls so vor, wenn wir mit Bus und Bahn hinaufgefahren sind. Ich weiß noch gut, dass mir das Abschiednehmen von meinem kleinen Bruder immer sehr schwergefallen ist, wenn wir nach der Besuchszeit wieder nach Hause gefahren sind und er uns zum Abschied gewunken hat.
Zumindest bin ich mir sicher, dass Vater sehr darauf bedacht gewesen ist, uns beide gleich zu behandeln, aber es könnte sein, dass er wahrscheinlich unbewusst zu wenig auf meinen Bruder eingegangen ist. Das scheint mir überhaupt ein generelles Problem von Eltern zu sein, die alle ihre Kinder zwar gleichbehandeln wollen, dabei aber übersehen, dass keines ihrer Kinder gleich gestrickt ist und jedes mit der Bewältigung von Druck und Stress unterschiedlich umgeht.
Weil Vater die drei Gewalten Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vollzug in seiner Person vereinigte, folgte nach der von uns Kindern „freiwillig“ zum Ausdruck gebrachten Einsicht auf jeden Fall immer, was denn kommen musste: Vater, in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber, Richter und Exekutivbeamter verhaute uns Delinquenten nach Verkündung des Strafausmaßes den nackten Hintern mit seinem Rohrstock.
Fairerweise sei hier festgehalten, dass diese Züchtigung in der Regel stets unter Berücksichtigung der Schwere der begangenen Straftaten geschah. Ich habe jedenfalls in meinem Vater deshalb keinen Schläger oder Gewalttäter gesehen. Vater schlug auch nie mit der bloßen Hand zu und hätte uns auch auf keinen Fall eine zu damaligen Zeiten durchaus als salonfähig geltende Ohrfeige gegeben. In den vierziger und Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts war diese Art von Bestrafung als mehr oder weniger wirksame Erziehungsmethode immer noch gang und gäbe. Das war nichts Außergewöhnliches, zumal dieses Prinzip ja auch in der Schule gegolten hat. Dort hat in meiner Kindheit immer noch eine Erziehungspraxis gegolten, die durch eine Zucht- und Prügelpädagogik bestimmt gewesen ist, die häufig von elterlichen Strafaktionen ergänzt wurde. Das weiß ich von einigen Klassenkameraden. Man wollte damit ein einförmiges, gehorsames und störungsfreies Wohlverhalten der Kinder erreichen. Jede Abweichung davon ist hart bestraft worden.
Ganz so streng war unsere Erziehung nicht, aber mit dem Rohrstock machten wir während unserer Kindheit doch ein paar Mal Bekanntschaft. Diese paar Male waren allerdings so eindrucksvoll und schmerzhaft, dass sie bis heute tief in meinem Gedächtnis eingebrannt sind.
Woran ich mich auch noch ganz genau erinnern kann, ist, dass Mutter sich, wenn es wieder einmal so weit gewesen ist, während der Dauer des Verfahrens ebenfalls in der als Gerichtssaal dienenden Küche aufgehalten hatte. Sie war während des ganzen “Prozesses“ anwesend, auch wenn man ihr ansehen konnte, dass sie keine Freude an diesem Ereignis hatte. Meines Wissens hat sie aber nie einen Versuch gemacht, diese Exekutionen zu vereiteln oder im bevorstehenden Verfahren etwa die Rolle der Verteidigung zu übernehmen. Für Mutter war prinzipiell klar und ganz selbstverständlich, dass sie alles, was Vater für richtig und notwendig ansah, auch gutzuheißen hatte. Dieses Prinzip schien für unsere Eltern die Grundlage ihrer ehelichen Beziehung zu sein und daran hat sie sich denn auch bis zu seinem Tod gehalten.
Vater war ein bibelfester und ein von allen geachteter Mann. Er hatte zwar ein gewisses Maß an Humor, war aber eher ein ernster und autoritärer Mensch. Manchmal konnte er auch laut lachen. Ich höre ihn heute noch als gefestigten und selbstsicheren Pädagogen, auch wenn er gar nicht danach gefragt worden war, im Brustton der Überzeugung sagen: „Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn!“
Viele Jahre später, ich wohnte schon lange nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern, beglückwünschte mich ein Arbeitskollege meines Vaters einmal, indem er meinte, es gebe nicht viele Väter, die ihre Söhne zu so strengem Gehorsam erzögen wie unserer. Er meinte auch noch, dass es gut wäre, wenn die Erziehungsmethoden meines Vaters einer größeren Kinderschar zugutekommen würden, weil nur so der schon überall deutlich erkennbare und immer rasanter fortschreitende Verfall der Sitten vermieden werden könne. Dann fügte er noch bewundernd an, dass ihm mein Vater einmal stolz erzählt habe, er pfeife seinen Söhnen nur einmal, wenn er sie zu sich rufe. Das kann ich nur bestätigen! Ich habe seinen energischen Pfiff bis heute immer noch in den Ohren.
Gerade weil ich selbst nichts von derartigen Erziehungsmethoden halte, mag es eigenartig erscheinen, dass ich trotz allem auch heute noch davon überzeugt bin, dass mein Bruder und ich im Grunde genommen einen sehr guten Vater gehabt haben. In meinen Augen war Vater ein Gerechtigkeitsfanatiker, der stets bemüht gewesen ist, uns Vorbild zu sein und die damit verbundene Haltung vorzuleben. Mir gab er auf jeden Fall das Gefühl, uns eine schöne Kindheit ermöglichen zu wollen.
Ein kleines Beispiel, das Vaters Sinn für Gerechtigkeit verdeutlicht, ist das folgende:
Wenn mein Bruder und ich etwas Essbares zu teilen hatten, von dem Vater wusste, dass wir beide gleichermaßen scharf darauf waren, warf er eine Münze und wir durften uns davor für Kopf oder Zahl entscheiden. Beim Objekt unserer Begierde konnte es sich um ein Stück Torte, eine Zimtschnecke, einen Nussgipfel, ein Salzstangerl, einen Krapfen oder was auch immer handeln: Nur mit dem Messer teilbar musste es sein. Das Los entschied also darüber, wer von uns beiden das Messer fürs Teilen in die Hand nehmen musste und wer aus beiden Teilstücken auswählen durfte. Sobald die Entscheidung gefallen war, haben sich zwei Augenpaare wie von selbst auf maximale Sehschärfe eingestellt. Es liegt auf der Hand, dass man sich lieber fürs Auswählen entschieden hat und jeder nur allzu gerne auf die mit der Ausübung von Macht verbundene Möglichkeit des Teilens verzichtet hätte!
Vater war zwar manchmal sehr aufbrausend, aber ich habe ihn nie angeheitert oder gar betrunken gesehen. Er war handwerklich sehr geschickt und nahm sich viel Zeit für uns. Wir durften bei jeder Gelegenheit mit ihm im Ruderboot zum Baden auf den See hinaus fahren. Er lehrte uns das Fischen vom Boot aus und zeigte uns, wie wir mit Angelleine und Köder umzugehen hatten. Von ihm habe ich gelernt, wie ich einen Angelhaken mit einem Schenkel ohne Öse, nur mit einem flachen Plättchen am Ende so an der Angelleine festmachen konnte, dass er gehalten hat. Er brachte uns die wichtigsten Knoten bei und wir lernten von ihm, wie eine Ankerleine aufgeschossen werden musste, damit sie jederzeit und ohne eine Wuling zu bilden, wieder sauber ausrauschen konnte. Er brachte uns auch bei, wie man Fische ausnimmt und essfertig zubereitet, oder wie man sie filetiert. Wir lernten auch von ihm, woran man erkennen konnte, ob das gesuchte Schwemmholz von seinem Zustand her zum Heizen taugte oder nicht.
Zur damaligen Zeit gab es in den Wohnungen im Zollamt noch keine Zentralheizungen. Das Zollamt war das Mehrfamilienhaus, in dem wir gewohnt haben und in dem auch die Wachstube oder Kanzlei der Zollwachebeamten untergebracht war. Auch in ihr ist ein Holzofen gestanden. Jede Familie hatte in der Wohnung zwei oder drei Öfen, in denen man Holz und Kohle verbrennen konnte. Auch wir beheizten unsere Wohnung den ganzen Winter über mit Brennholz aus dem See. Das wurde zersägt, gehackt und unterm Vordach des Schuppens zum Trocknen gestapelt. Weil das Holz nichts kostete und immer genug davon da gewesen ist, mussten wir nicht sparsam damit umgehen und hatten es zu Hause immer angenehm warm. Wir mussten also nie Geld für Kohle oder zugekauftes Brennholz ausgeben.
Trotz Mutters passivem Verhalten beim Strafvollzug durch unseren Vater will ich zu ihrer Ehrenrettung auf keinen Fall unterschlagen, dass sie uns manchmal auch verwöhnt hat. Dann fuhr sie mit uns im Bus nach Bregenz in eine im ganzen Unterland bekannte Eisdiele. Dort durften wir nach Herzenslust Eis schlecken. Das Eis wurde in einer Maschine gemacht, die wie ein einarmiger Bandit ausgesehen hat, und ist dann kunstvoll in einer Tüte aufgefangen worden, die man ebenfalls essen konnte.
Vater war gelernter Bäcker und Konditor und hat Mutter das Kuchenbacken beigebracht. Weil sie das oft und sehr gerne gemacht hat, schwelgten wir jeden Sonntag in Süßem. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es auch nur ein Wochenende ohne Torte, Kuchen, Krapfen oder anderes Gebäck gegeben hätte. Sobald sie mit dem Groben fertig war und die Torte oben und an den Seiten dick mit Creme beschmiert und mit gemahlenen Haselnüssen betupft hatte, war Vater an der Reihe. Seine Aufgabe war es, aus der Torte ein Kunstwerk zu machen. Das tat er mithilfe einer Tüte aus Pergamentpapier, das er geschickt zu einer Spritze formte, am unteren Ende gekonnt mit der Schere einkerbte und dann je nachdem mit weißer oder gefärbter Creme gefüllt hat. Er machte kleine Röschen mit grünen Blättchen, Pilze, deren Köpfchen er mit Kakaopulver puderte, damit sie schon braun wurden, oder auch kleine Fliegenpilze mit Hütchen aus rot eingefärbter Creme, auf die er dann Hagelzucker streute. Das sah alles so schön aus, dass man wirklich großen Hunger haben musste, um mit der Zerstörung zu beginnen. Irgendwie haben wir uns dann doch immer dazu überreden können und am Montag war nichts mehr da.
Konkurrenzlos war Mutter auf jeden Fall mit ihrem Zwetschgenkuchen. Den hat sie nach dem Rezept ihrer Tante Lina gemacht. Tante Lina hatte dieses Rezept aus dem Elsass mitgebracht. Unübertroffen waren auch die reich verzierten Erdbeertorten, ausschließlich mit Erdbeeren aus unserem Garten gemacht, die während der Erdbeersaison jedes Wochenende auf den Tisch gekommen sind. Vor allem mein Bruder konnte Unmengen von der Erdbeertorte verschlingen, so gut hat sie ihm geschmeckt. Ich weiß noch gut, dass er sich einmal als Geburtstagsgeschenk ganz für sich allein eine Erdbeertorte und eine Flasche „Maresi“ gewünscht hat. Beides, die Torte und die Kaffeesahne waren an einem einzigen Nachmittag Geschichte!
Ganz besonders gut fand ich auch ihre Topfentorte, die mir aber am besten geschmeckt hat, wenn sie als einfacher Blechkuchen mit einer schönen braunen Haut auf den Tisch gekommen ist. Auch ihr „Apfelkuchen sehr fein“ verdient es, erwähnt zu werden. Damit hätte sie wahrscheinlich jeden Wettstreit gewonnen. Wenn ich daran denke, rinnt mir heute noch das Wasser im Mund zusammen!
Was ich meiner Mutter wirklich hoch anrechne, ist, dass sie aus mir eine richtige Leseratte gemacht hat. Sie bestand darauf, dass ich spätestens mit meinem Eintritt in die Hauptschule eine Mitgliedskarte bei der örtlichen Bücherei bekam. Bücher waren mir seither immer schon sehr wichtig und ich habe sie buchstäblich gefressen. Niemand musste mich zu einem Bücherwurm erziehen, ich bin vermutlich schon als solcher auf die Welt gekommen. Vor allem von Karl May habe ich alles, was zu bekommen war, gelesen, und es waren weit über fünfzig Bände. „Lederstrumpf “, „Meuterei auf der Bounty“, „Die Schatzinsel“, „Robinson Crusoe“, die „Hornblower Trilogie“ von C. S. Forester, alles, was mit Seefahrt zu tun hatte und was ich darüber auftreiben konnte, habe ich gelesen. Auch für Mark Twain und das gesammelte Werk von Wilhelm Busch konnte ich mich immer begeistern. Dutzende Kriminalromane von Edgar Wallace, Kriminalfälle im Zusammenhang mit Schiffshavarien und alles, was ich an Literatur über Justizirrtümer und Gerichtsmedizin auftreiben konnte, habe ich verschlungen. Später sind dann Hunderte von Cowboy-Romanen dazugekommen – meine Mutter hat sie abwertend „Schundromane“ genannt – und alle Heftchen von „Jörn Farrow“, einem U-Bootkapitän oder „Rolf Torring“, einem Abenteurer, der sich im Dschungel jedes Erdteiles mindestens so gut ausgekannt hat wie mein Vater in seiner Werkstatt, im Garten und auf dem See. Und ganz klar, natürlich alle verfügbaren Comics, die wir so oft wie möglich getauscht haben, in der Hoffnung, dass ja keine Seite fehlen möge. Lesen war immer schon eine große Leidenschaft und das ist bis heute so geblieben.
Die Grundhaltung meiner Mutter, Vater eine gute und möglichst unkomplizierte, oft in vorauseilendem Gehorsam handelnde Ehefrau sein zu wollen, war nicht nur von Nachteil. So manches sich am Horizont abzeichnende Sturmtief begann sich für uns Lausbuben vor allem deshalb oft früher als befürchtet aufzulösen und endete schließlich in einer leichten Brise.
Mutter wusste genau, dass Vater großen Wert darauf legte und Freude daran hatte, wenn sie möglichst so kochte, wie er es von seiner eigenen Mutter Äla, meiner Großmutter aus Fußach, kannte. Das ging so weit, dass es ihr nicht zu umständlich war, mit dem Fahrrad nach Fußach zu ihrer Schwiegermutter zu fahren, um von ihr zu erfahren, wie das eine oder andere Gericht zubereitet und abgeschmeckt werden sollte.
Telefon hat es damals nur in wenigen Haushalten gegeben und weder wir noch Äla hatten eines. Den erforderlichen Erfahrungsaustausch per Briefpost oder Telegramm zu erledigen wäre auf jeden Fall sehr umständlich gewesen und es hätte neben der unzumutbaren Vorausplanun auch viel zu lange gedauert, bis das per schriftlicher Anweisung zuzubereitende Essen auf den Tisch gekommen wäre. Mit dem Fahrrad ist das schneller gegangen.
Die von Mutter gewählte Strategie und die damit verfolgte Absicht lag auf der Hand: Sie konnte sich bei Äla und Vater lieb Kind machen, ganz nebenbei frische Luft schnappen, etwas Vernünftiges lernen und Interesse am ohnehin Unvermeidlichen – sprich am Kochen – zeigen. Es schien ihr auch recht bald klar geworden zu sein, dass Liebe vor allem durch den Magen geht. Äla wiederum – wie hätte es anders sein können – fühlte sich geschmeichelt und war in diesen Dingen deshalb immer sofort und auf der Stelle kooperativ. Konnte sie doch auf diese Weise ihren Lieblingssohn indirekt verwöhnen helfen!
Räba und Hafalòab
Ein ganz besonders erwähnenswertes Ergebnis dieser Anstrengungen ist ein von Äla eigentlich nur in der kalten Jahreszeit zubereitetes Gericht, das mir so gut geschmeckt hat, dass ich es auch heute noch gerne zubereite und für uns und unsere Gäste nachkoche.
Die Rede ist von „Räba und Hafaloab“, als Beilage zu Krustenbraten vom Schwein mit Rippchen – ebenfalls vom Schwein – und das Ganze gedacht für zehn bis zwölf Hungrige. Dieses Gericht wird aus einfachen Zutaten und ohne jeden Firlefanz gemacht. Zum „Hafaloab“ möchte ich in aller Bescheidenheit bemerken, dass keine der mir bekannten Variationen – und es gibt im Vorarlberger Unterland davon viele verschiedene Macharten – auch nur im Entferntesten so gut schmeckt wie die von meiner Großmutter Äla geerbte, weil diese vermutlich gerade wegen ihrer Einfachheit die beste von allen ist!
Als Hafaloab bezeichnet man einen Kloß, der wie ein großes Grießnockerl aussieht. Im fertigen Zustand ist er oval etwa acht bis zehn Zentimeter lang und fünf bis sechs Zentimeter dick. Von mir aus auch etwas kleiner, darauf kommt es nicht an.
Gemacht wird der Hafaloab, indem man in einem großen Weidling - wir kochen für zehn bis zwölf Personen - je eine nicht zu kleine Tasse glattes Weizenmehl und Weizengrieß mit zwei gleich großen Tassen Maisgrieß unter Zugabe einer kräftigen Prise Salz gründlich vermischt. Die Hälfte der fertigen Teigmischung besteht also aus Maisgrieß. Abhängig davon, ob man sogenanntes Riebelgrieß, also weißes oder gelbes Maisgrieß verwendet, bekommt der Hafaloab seine Farbe. Ich nehme immer weißes, damit ich keine gelben Klöße bekomme. Nachdem alles gründlich vermischt ist, gibt man bei dieser Menge je nach Gusto ein knappes Achtel Butter oder ein kleines Achtel Olivenöl dazu. Verfechter einer schlanken Figur können sich an dieser Stelle auch ein wenig zurückhalten.
Nun wird mit schon vorbereitetem, kochend heißem Wasser nach und nach angegossen und – aufgepasst: Es braucht unerwartet viel davon. Vorsorglicherweise sollten auf jeden Fall etwa zwei Liter parat sein, und zwar kochend heißes Wasser! Ein großes Malheur wäre es aber, wenn zu viel Wasser angegossen würde, weil sich der Kloß dann – selbst wenn es gelänge, ihn einigermaßen in Form zu bringen – in seine Bestandteile auflöste, sobald er dem siedenden Wasser übergeben worden wäre.
Vielleicht sollte man sich – als vorsichtiger Koch – doch lieber die Zeit nehmen und es an dieser Stelle mit einem Probekloß versuchen. Falls der Teig zu weich geworden ist, weil man beim Zugeben von heißem Wasser doch etwas zu großzügig war, könnte man unter Umständen die Sache durch Zugabe von ein, zwei Löffeln Weizengrieß zu retten versuchen, indem man dieses unter die Masse mischt, gut umrührt und eine Zeit lang nachquellen lässt. Ich war noch nie gezwungen, das auszuprobieren, aber ich denke, dass ein solcher Rettungsversuch durchaus erfolgversprechend sein könnte.
Während des Angießens wird die sehr heiß werdende Masse mit einem großen Vorlegelöffel umgerührt. Der Löffel kann später zusammen mit einem zweiten zum Formen der Klöße verwendet werden. So macht man sich die Hände nicht schmutzig. Nun wird so lange heißes Wasser zugegossen, bis ein matschiger, sehr weicher Teig entstanden ist. Die richtige Konsistenz hat der Teig dann, wenn er so weich ist, dass er kaum mit den Händen geformt werden könnte. Außerdem ist er in diesem Zustand ohnehin extrem heiß. Deshalb verwende ich zwei Vorlegelöffel, von denen ich einen schon zum Rühren des Teiges gebraucht habe. Solche Löffel sind zum Formen von großen Nockerln sehr gut geeignet.
Von Vorteil ist es, wenn man früh genug daran gedacht hat, in einem tiefen und breiten Topf unter Zugabe einer kräftigen Prise Salz, Wasser zum Wallen oder lieber doch nur zum Simmern zu bringen. Es darf auf keinen Fall kochen! Wenn es das Kücheninventar ermöglicht, kann man für die in unserem Fall vorgeschlagene Menge gleich zwei Töpfe aufstellen, damit der ganze Teig auf einmal verarbeitet werden kann. Die Menge reicht schließlich für zehn bis zwölf Personen! Sollte es ohnehin schon so weit sein, kann man jetzt mit dem Formen des ersten Hafalòabs beginnen. Man nimmt die beiden Vorlegelöffel in seine Hände und taucht sie – nicht die Hände – in kaltes Wasser. Das sollte man immer machen, bevor man den nächsten Kloß aus der Teigmasse zu stechen beabsichtigt. Er löst sich dann leichter vom Löffel, sobald dieser mit dem heißen Wasser im vorbereiteten Topf Bekanntschaft gemacht hat. Jetzt sticht man also mit einem der beiden Löffel eine entsprechend große Menge Teig aus der Masse und formt unter Zuhilfenahme des zweiten Löffels einen Kloß.
Wer schon mal einem Fernsehkoch bei der Produktion von Grießnockerln zugeschaut hat, weiß, wie das geht. Nur die ganz großen Köche nehmen dazu ihre bloßen Hände, weil das mehr Eindruck macht und große Kochkunst, gepaart mit viel Fachwissen und Liebe zum Detail signalisiert. Spätestens nach dem zwanzigsten Mal klappt das auch bei jedem Hobbykoch.
Sobald man also auf einem der beiden Löffel einen Kloß liegen hat, dessen Anblick wirklich Grund zur Freude gibt, kann man ihn vorsichtig ins heiße Wasser setzen, das nicht mehr kocht, aber hoffentlich immer noch vor sich hin simmert. Man versucht ihn nun vorsichtig und unter leichtem Rütteln vom Löffel zu lösen. Dieses Prozedere wird solange wiederholt, bis alle Klöße im Topf Platz gefunden haben, ohne sich ins Gehege zu kommen. Klöße haben nämlich noch nie Freude daran gehabt, zusammengepfercht wie Sardinen in einer Dose vor sich hin sieden müssen. Nun lässt man die Klöße etwa zwanzig Minuten ziehen, es darf auch ein bisschen länger sein, das ist nicht so heikel. Wichtig ist, dass das Wasser nur simmert. Es sollte nicht mehr wallen.
In dieser Phase kochen die Klöße ein bisschen ab, will heißen, sie verlieren an der Oberfläche etwas Grieß, das sich am Boden des Topfes sammelt. Das ist durchaus in Ordnung und kein Fehler. Sobald die Kochzeit abgelaufen ist, bewegt man mit dem Vorlegelöffel die frei schwimmenden Klöße ganz vorsichtig etwas hin und her, um dem einen oder anderen „Schläfer“ am Boden des Topfes beim Auftauchen behilflich zu sein. Auch ein kleiner Seitenhieb ist in dieser Phase manchmal vonnöten. Man spürt sofort, ob die Klöße eine schöne Festigkeit haben. Sobald man den ersten Kloß auf einem Teller liegen hat, macht man die sogenannte „Gabelprobe“.
Die Gabelprobe ist eine Erfindung von mir. Mit ihr wird geprüft, ob die Klöße gelungen sind und ihre höchste Perfektionsstufe erreicht haben. Zur Erklärung Folgendes: Man nehme eine Gabel in die Hand, steche sie vorsichtig in die Mitte parallel zur Längsachse des Kloßes, halte diesen fest, ohne sich die Finger zu verbrennen, und drehe die Gabel am Griff ansatzweise um ihre eigene Achse. Wenn der Kloß nun dem auf ihn einwirkenden sanften Druck dergestalt nachgibt, dass er ohne weitere Kollateralschäden in zwei, höchstens drei Teile auseinanderbricht, ist das Werk geglückt.