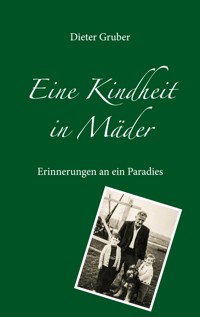
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieter Gruber ist schon über siebzig Jahre alt, als er sich in Gedanken auf den Weg in seine Vergangenheit macht. Ziel der Reise ist die Zeit seiner Kindheit, die er Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Hard am Bodensee und in Mäder, einer ländlichen Gemeinde im Vorarlberger Vorderland, verbracht hat. Dort trifft er alle wieder: seine Eltern und Großeltern, seinen Bruder, seine Verwandten und seine Spielgefährten von damals. Er begegnet den Tieren, die ihm so viel bedeutet haben, besucht die Häuser und Plätze seiner Kindheit und erinnert sich an unzählige Geschichten und Abenteuer, die diese Jahre prägten. Es sind wahrhaft paradiesische Welten, von denen Gruber hier erzählt, und seine Geschichten lassen beim Leser Bilder aus der eigenen Kindheit aufsteigen, die schon längst vergessen waren. Ein berührendes, fröhliches, ein Mut machendes Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Onkel Arnold
Inhalt
Vorwort
Der Weg ins gelobte Land
Meine Kinderjahre bei den Großeltern
Tättì
Meine erste Zigarre
Socken oder Fußlappen
Tättìs Lebensphilosophie und der rote Kapuziner
René, der Franzosenbub
Tättì und der Männerchor
Mit dem Pferdefuhrwerk von Mäder nach Hard
Tättì, der Landwirt und Müller
Unser Bauernhof
Das Bauernhaus, der Stall und seine Bewohner
Unsere Geburtenstation im Stall
Der Stier und die Brückenwaage
Unser Hausschwein, Vielfraß und Allesfresser
Das Leben mit den Kühen
Das Nagelbrett
Die Jauchegrube oder „da Bschüttikaschta“
Meine Tante Lore
Fassanstich im „Mòschtkäär“
Die Sandgrube vulgo „d´Sandgruab“
Großmammas Küche
„D`Schtuba“, unser Wohnzimmer
Zurück im Stall
Rohmilch zur Gesichtspflege
Butter und „suuri Milk“
Großmamma und das Federvieh
Der Hühnermord
Vom toten Huhn zum Festmahl
Der Misthaufen
Das Leben auf dem Bauernhof
Großmamma und der Autounfall
Holder, Holder und nochmals Holder
Großmamma, die Kräuterhexe
Waldarbeiten am Kummenberg
Onkel Rinaldo baut sein Haus
Im Steinbruch am „Pocksberg“
Onkel Eduard und Tante Lina
Onkel Alwin
Von den Tieren und Menschen auf dem Bauernhof
Mais und Kartoffeln oder „Riebl“ und „Hòerdòepfl“
Großmammas Sterneküche
Pflug und Egge
Erntezeit
Mein Freund „Ponso“
Der Kampf mit dem Kartoffelkäfer
Äpfel, Birnen und Früchtebrot
DerBirnbaum und seine „Hutzili“
Ponsos Tod
Die Heuernte oder Onkel Arnold, der Cowboy
Der Stich mit der Heugabel und der Beinahegenickbruch
Die Pferdebremse und der Huftritt
Der Motorradunfall
Schweinezucht und Rodeo
Cowboy und Indianer
Der Kampf mit dem Schäferhund
Tätti als Naturkundelehrer
Der Hütebub
Schlusswort
Anhang: Tante Lores Käsfladenrezept
Über den Autor
Vorwort
Gerade einmal siebzig Jahre alt geworden und im achten Lebensjahrzehnt angekommen, befinde ich mich bereits seit längerem im Herbst meines Lebens. Alles, was ich brauche, habe ich. Was ich nicht habe, brauche ich auch nicht. Der Lebensabschnitt, in dem ich mich nun schon seit einiger Zeit befinde, fühlt sich für mich nicht wie der Herbst des Lebens an, ganz im Gegenteil, ich empfinde ihn eher als einen warmen, wunderbaren Indianersommer mit all der ihm eigenen Farbenpracht und Sinnlichkeit. Für mich ist es eine Zeit der Ernte. Es ist meine ganz persönliche Zeit, in der ich gelernt habe, in mich hinein zu hören. Eine Zeit ohne Hektik und frei von Verpflichtungen, eine Zeit, in der ich mir Zeit für Muße nehmen kann. Eine Zeit, in der ich nichts mehr erleben muss, weil ich in meinem bisherigen Leben schon alles, was mir wichtig erschienen ist, gemacht habe. Es ist eine Zeit, in der ich das Gefühl habe, in meiner Mitte oder am Ziel angekommen zu sein, und es ist vor allem eine Zeit, in der ich die tiefe Befriedigung verspüre, mein ganzes Leben lang nie weggeschaut oder etwas akzeptiert oder gemacht zu haben, das nicht zu mir gepasst hätte und gegen meine Überzeugung war. Es ist ganz allein meine Zeit.
Kürzlich war ein alter Schulfreund mit seiner Frau bei uns zu Besuch. Wir hatten gemeinsam mit ihnen und zwei Freunden von uns einen sehr schönen, unterhaltsamen und recht gemütlichen Abend. Ich koche gelegentlich sehr gerne, es hat auch diesmal allen geschmeckt und sie haben sich wohl gefühlt. Alle haben mit Begeisterung mein Fischgericht genossen, das ich aus selbst gefangenem Meeresfisch zubereitet habe.
Ich bin mir fast sicher, dass es an den anschließenden Gesprächen gelegen hat und dass letztendlich sie die Ursache dafür waren, dass in mir immer wieder Erinnerungen an meine Kindheit hochgekommen sind. Mein Schulfreund war es schließlich, denke ich, der den Anstoß dazu gegeben hat, dass mich die Erinnerungen an diese längst vergangene Zeit nicht mehr losgelassen haben und ich an einem der darauffolgenden Tage plötzlich Lust in mir verspürt habe, meine Kindheitserinnerungen in einem Büchlein niederzuschreiben. Und genau damit will ich jetzt beginnen.
Bregenz, im Jänner 2018
Der Weg ins gelobte Land
Die Beziehung meiner Mutter zu meinen Großeltern war zwar sehr eng, aber nicht innig. Wahrscheinlich haben wir zu Hause eine andere Form von Beziehung auch nie kennen gelernt. Als Kind habe ich körperliche Nähe und Herumgeschmuse überhaupt nicht vermisst. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Meine Mutter schien es schon für einen Ausdruck von Zärtlichkeit zu halten, wenn sie ihr baumwollenes Taschentuch hervorgeholt hat und dieses, durchaus auch in Gegenwart anderer Leute, ausgiebig bespuckte, um dann uns Kindern mit dem solcherart befeuchteten Tuch irgendeine mit imaginärem Schmutz verunreinigte Stelle im Gesicht zu reinigen.
Natürlich hasste ich derartige Zärtlichkeiten und ich habe heute noch den Geruch ihrer auf meiner Wange verriebenen Spucke in der Nase, wenn ich daran denke. Wie gesagt, der Umgang meiner Eltern mit mir war für mich durchaus in Ordnung und ich hätte daran nie auch nur das Geringste auszusetzen gehabt. Von spontanen Umarmungen und zärtlichen Küsschen wäre ich vermutlich ohnehin nur irritiert gewesen und ich hätte mich an solche Liebkosungen wahrscheinlich erst gewöhnen müssen. Ich war zufrieden damit, dass es zu Hause zwischen den Eltern so gut wie nie Streit oder gar handfeste Auseinandersetzungen gegeben hat.
Ausschlaggebend für meine weitere Entwicklung war – und da bin ich mir auch heute noch absolut sicher –, dass es mir gelungen ist, mich unter ausgiebigem Protestgeheul so nachhaltig gegen den Besuch des Kindergartens zu wehren, dass ich davon befreit worden bin. Gleich nach dem erstmaligen Betreten der ungewohnten Räumlichkeiten an der Hand meiner Mutter war nämlich mein erster Eindruck, dass ich fortan mein bisher selbstbestimmtes und noch so junges Leben in grenzenloser Freiheit gegen das Dasein in einem engen Gefängnis voller vorgefertigter Spielsachen tauschen sollte. Ich wäre mir vorgekommen wie ein Affe im Zoo und das wollte ich auf keinen Fall sein!
Dieser erfolgreiche Kampf für das Leben in Freiheit hatte zwangsläufig zur Folge, dass ich fortan immer zu Hause bleiben konnte, wenn die gleichaltrigen Kinder zur Freude ihrer Mütter den Vormittag im Kindergarten verbringen mussten. Vermutlich war das auch mit ein Grund dafür, warum Mutter mich und meinen kleinen Bruder Rinaldo, wann immer es ging, auf ihr Fahrrad gepackt hat und mit mir auf dem Gepäckträger und meinem jüngeren Bruder in einem Kindersitz hinterm Lenker in das etwa zwanzig Kilometer entfernte Mäder gefahren ist aus, dem sie stammte. So war sie uns doch immer wieder ein paar Tage oder gar Wochen los, wusste uns in besten Händen und konnte den noch jungen Ehestand mit Vater genießen.
Meine Kinderjahre bei den Großeltern
Mäder war in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts ein Sechshundert-Seelen-Dorf, in dem meine Großeltern einen kleinen Bauernhof und eine Kornmühle betrieben haben. Die Fahrt mit dem Fahrrad von Hard nach Mäder war eine recht ansprechende und gewissermaßen auch sportliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die damaligen Straßen doch sehr zu wünschen übrig ließen. Sie waren häufig nur geschottert und holprig. Nicht etwa „geteert“, wie wir dazu gesagt haben, sobald sie asphaltiert waren. Die wenigsten Straßen waren damals geteert und die Fahrräder jener Zeit waren als andere als Hightech-Geräte.
Zu allem Überdruss hat am Vormittag der Wind im Rheintal – als Landwind vom Oberland kommend – Richtung Süden zum See hinuntergeblasen. Weil Mutter meistens am Vormittag nach Mäder aufbrach, hatte sie auf dem Fahrrad deshalb immer Gegenwind. Sie hätte ja auch am Nachmittag mit dem Wind im Rücken losfahren können, aber dann hätte sie bei den Großeltern übernachten müssen und die Chance, nach dem Mittagessen trotz Gegenwind irgendwann wieder zu Hause in Hard zu sein, wäre ungenutzt verstrichen. Weil es die Natur aber schon immer so vorgesehen hatte, hat sich der Wind am Nachmittag wieder in den so genannten Seewind verwandelt und konstant in Richtung Norden geblasen. Ich glaube, dass man sich auch heute noch auf diese Regelmäßigkeit verlassen kann. Für Mutter hatte die Mühsal schließlich auch etwas Gutes und sie gewöhnte sich im Laufe der Zeit an Gegenwind, was ihr in späteren Jahren zugutegekommen ist.
In Mäder angekommen, es war meistens um die Mittagszeit, hat uns Mutter zusammen mit zwei großen Taschen den Großeltern übergeben, damit wir ein paar Wochen Luftveränderung erhalten konnten. Die beiden Taschen waren vollgestopft mit Kleidung und Unterwäsche. Schuhwerk brauchten wir nicht und passende Gummistiefel hatte Mutter in vorsorglicher Weise schon seit unserer frühesten Kindheit vor Ort deponiert. Ich bekam jedes Jahr ein neues Paar und mein Bruder durfte die von mir ausgetretenen und damit bereits deutlich bequemer gewordenen Stiefel so lange weitertragen, bis sie auch ihm zu klein geworden waren. Nachdem sich Mutter beim Mittagessen gestärkt hatte, bestieg sie meistens wieder ihr Fahrrad und machte sich auf den Heimweg. Natürlich mit Seewind im Gesicht, wie immer am Nachmittag. Das schien ihr aber nichts auszumachen. Es ist schon mal vorgekommen, dass sie auch über Nacht blieb und erst am nächsten Morgen wieder abgefahren ist. So hatte sie auf der Heimfahrt den Wind von hinten und musste weniger in die Pedale treten. Ich wundere mich heute noch, dass das immer geklappt hat. Schließlich hatten weder wir zu Hause noch meine Großeltern ein Telefon. Ein Telegramm wäre natürlich möglich gewesen und man hätte sich damit anmelden können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Mutter immer unangemeldet gekommen ist. Dieser Angewohnheit ist sie ihr Leben lang treu geblieben.
Mutter ist auch nie der Meinung gewesen, sich für einen Besuch anmelden zu müssen. Sie ist immer davon ausgegangen, dass sich ohnehin jeder freuen würde, auch wenn er sie ungewollt zu sehen bekäme. Woher sie diese Überzeugung genommen hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Selbst ich habe Jahrzehnte gebraucht, um sie diesbezüglich zum Nachdenken zu bewegen. Ich sehe sie heute noch vor mir, wie sich völliges Unverständnis in ihrem Gesicht breit gemacht hat, als ich sie viele Jahre später einmal darauf angesprochen und mit meinen diesbezüglichen Vorstellungen und dem mir vorschwebenden Regelwerk konfrontiert habe.
Obwohl ich den Großeltern nie auch nur das Geringste angemerkt habe, empfinde ich es im Rückblick eigentlich als eine Zumutung, dass Mutter den beiden bei all der Arbeit, welche die Landwirtschaft mit sich brachte, noch zwei Enkel, die betreut und versorgt werden mussten, umgehängt hat!
Mutter war, obwohl sparsam, überhaupt nicht knauserig. Im Sommer und im Herbst verkaufte sie ab und zu Gemüse aus unserem Garten an einen Greisler in der Nähe. Es gab Zeiten da wuchs davon mehr, als wir zu essen imstande gewesen sind. Wenn dann ihre Haushaltskasse wieder einmal ein bisschen besser gefüllt war, konnte es vorkommen, dass wir im Winter komfortabler gereist sind. Wir fuhren dann mit dem Bus nach Bregenz und anschließend mit dem Zug nach Götzis. Meine Mutter stammte, wie schon gesagt, aus Mäder und die dortigen Eingeborenen, bei denen ich einen großen Teil meiner Kindheit verbracht habe, nannten diesen Ort „Gätzìs“. Ich bin weder Sprachwissenschaftler noch Dialektforscher, aber nun, da ich noch am Beginn meiner Schilderungen stehe und vorhabe, den einen oder anderen Dialektausdruck zum Unterstreichen der Authentizität meiner Geschichten zu verwenden, möchte ich nicht versäumen, dem Leser wenigstens ein paar umgangssprachliche Hinweise zu geben. Sie sollen dem besseren Verständnis für den doch ziemlich einzigartigen, von meinen Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen und den sonstigen Anverwandten und Spielkameraden gesprochenen Mäderer Dialekt dienen. Die Besonderheit dieses Dialekts ist mir schon als Kind aufgefallen. So habe ich schnell herausgehört, dass man in Mäder, im Unterschied zu den südlich des Kummenbergs – also zum Beispiel im Raum Feldkirch – gesprochenen Varianten, die Vokale „o“ „e“ und „i“ praktisch nie geschlossen, sondern offen ausgesprochen und breit betont hat. Vor allem wenn ein Wort mit „i“ endete, war das sehr gut zu hören. Zum besseren Verständnis habe ich deshalb die generell und im allgemeinen offen auszusprechenden Vokale „o“, „e“ und „i“ in diesem Büchlein in allen Mundartbeispielen durch „ò“, „ä“ und „ì“ ersetzt.
Ich will versuchen, dies an Hand zweier oder dreier Beispiele zu erklären. So sagt man zum Beispiel in Mäder zu einem Huhn „Hänna“. Diese Bezeichnung wird auch im Plural verwendet und der Hühnergarten ist deshalb der „Hännagaarta“. In Feldkirch dagegen würde man zum Federvieh immer „Henna“ sagen. Das gilt in Feldkirch ebenso wie in Mäder für Singular und Plural gleichermaßen. Ein Bewohner Feldkirchs aber spräche das „e“ immer streng geschlossen aus. Einer der markantesten und ganz besonders von meiner Mutter am häufigsten gebrauchten Sätze war „Ääs gäär ì nìd!“ Dieser Satz ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein geschlossenes „ì“ ausgesprochen wird. Mutter wollte mit diesem Satz ausdrücken, dass ihr etwas missfalle, sie das gar nicht wolle oder sogar hasse. Das ihr solcherart innewohnende Gefühl hat sie noch zusätzlich mit ihrem unnachahmlichen Gesichtsausdruck unterstrichen. Keine Sorge, ich bin gleich mit meinem Ausflug fertig, aber diese Erfahrung aus meiner Kindheit erscheint mir zu wichtig und so will ich noch ein, zwei Beispiele loswerden.
Auch der von meiner Mutter oft mit erhobenem Zeigefinger ausgesprochene Satz: „Ääs ka ì d’r sääga!“ ist ein gutes Beispiel für das geschlossen gesprochene „i“ und er klingt mir heute noch in den Ohren. Wir Buben haben ihn als wörtlich ausgesprochene Drohung im Verlauf unserer Kindheit sehr oft zu hören bekommen. Soweit, so gut!
Zurück zu unserer Ankunft am Bahnhof in Götzis. Wie Tättí, mein Großvater erfahren hatte, dass wir ausgerechnet zu einer bestimmten Zeit und gerade mit diesem Zug ankommen würden, ist mir heute noch ein Rätsel. Tatsächlich ist er aber eines Tages im Winter mit dem Pferdeschlitten am „Gätzn’r Baahòf“ – gemeint ist der Bahnhof in Götzis – gestanden und hat auf uns gewartet. Das war vielleicht eine Überraschung! Es war klirrend kalt und die Sonne strahlte vom Himmel, als wollte sie uns begrüßen. Wir stiegen auf den Schlitten, wickelten uns in die auf der Bank liegenden Decken und los ging’s. Die kleinen Schellen am Kummet bimmelten rhythmisch, sobald sich Susi ins Geschirr legte und zu ziehen begann. Susi war eine Haflingerstute und die Nachfolgerin von Lisa, der Norikerin. Die Landschaft war tief verschneit und man konnte hören, wie der Schnee unter den eisernen Kufen des Schlittens knirschte. Links und rechts von der Straße standen die schneebedeckten Bäume. Obwohl wir keinen Windhauch gespürt haben, wurde der Schnee immer wieder von den Ästen heruntergeweht. Millionen winziger Schneekristalle zerstoben dann im Wind und glitzerten in der Sonne. Dem Pferd schienen weder die Kälte noch der Schnee etwas auszumachen und wenn es schnaubte, konnte man seinen Atem in der kalten Luft sehen. Sobald wir das Bahnhofsgelände verlassen hatten und auf der Straße nach Mäder angekommen waren, warf sich Susi gleich so ins Geschirr, dass sie von Tättì immerfort gezügelt werden musste. Das ging fast die halbe Strecke so, bis auf der rechten Straßenseite das „Gasthaus Rose“ in Sicht kam. Beim Gasthaus angekommen, blieb Susi, ohne dass ihr Tättì irgendetwas zugerufen hätte, ganz von alleine stehen. Der Grund dafür ist uns schnell klar geworden. Tättì drückte mir die lederne Zugleine in die Hand und sprang vom Schlitten. Dann öffnete er die Tür zum Gasthaus und rief laut „Rosa!“. So hieß die Wirtin. Gleich drauf kam er zurück, stieg auf den Bock des Schlittens und nahm die Zugleine wieder an sich. Kaum hatte er sich niedergesetzt, tauchte auch schon die Wirtin mit einer Scheibe hartem Brot in der Hand auf. Sie ging schnurstracks auf das Pferd zu und steckte ihm das Brot ins Maul. Susi begann sofort zu fressen und war noch gar nicht richtig fertig damit, als sie sich schon wieder kraftvoll ins Geschirr legte. Tättì winkte der Wirtin noch schnell ein Dankeschön. Dann zog er gleich die Zügel etwas an, weil das Pferd frisch gestärkt schon wieder drauflos traben wollte. Unsretwegen hätte es sich nicht so beeilen müssen, weil wir die schöne Schlittenfahrt genossen haben. Vielleicht wollte es auch nur so rasch wie möglich zurück in den warmen Stall. Diese Schlittenfahrt gehört zu meinen schönsten Erlebnissen.
Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass uns Tättì einmal an einem warmen, sonnigen Tag im Sommer mit dem Landauer – dem „Rennwaaga“ – vom Bahnhof abgeholt hat. Der Landauer war ein leichtes, immerhin schon gefedertes Gefährt mit einem Kutschbock und hölzernen Speichenrädern, auf denen eiserne Reifen aufgezogen waren. Ich durfte neben Tättì auf dem Kutschbock sitzen und Mutter saß mit meinem kleinen Bruder auf der Bank dahinter. Zur damaligen Zeit waren fast alle Straßen noch geschottert und nicht geteert. Man kann sich vorstellen, wie holprig solche Fahrten trotz der Federung gewesen sind. Aber es war viel schöner, als zu Fuß zu gehen. Auch auf dieser Fahrt kamen wir am „Gasthaus Rose“ vorbei und ich war schon gespannt darauf, wie sich Susi diesmal verhalten würde. Letztes Mal waren wir ja noch auf einem Pferdeschlitten gesessen. Alles verlief genau gleich wie im Winter. Beim Gasthaus angekommen, blieb das Pferd stehen, schnaubte ein paarmal und wartete auf seinen Leckerbissen! Nachdem Susi von Rosa, der Wirtin, eine Scheibe hartes Brot bekommen hatte, setzte sie, ohne auf irgendein Kommando zu warten, die Fahrt fort und trabte gemütlich mit uns nach Hause. Die Schlittenfahrt und die Fahrt mit dem Landauer, dem „Rennwaga“, wie Tättì dieses Gefährt immer genannt hat, sind für mich unvergessliche Erlebnisse geblieben!
Tättì
Tättì, Jahrgang 1896, war für mich zeitlebens ein Vorbild. Als ich im Dezember 1947 geboren wurde, befand er sich schon am Beginn seines sechsten Lebensjahrzehnts. Ich war sein erster Enkel und gleichzeitig der älteste Neffe meiner beiden Onkel und ihrer Schwestern Irmgard und Lore. Das war wohl auch ein Grund dafür, dass ich immer schon und ganz unausgesprochen eine besondere Stellung bei der Verwandtschaft mütterlicherseits gehabt habe. Übrigens, zu ihrem Vater haben meine Mutter und ihre Geschwister „Tättì“ gesagt. Wir Kinder sind nie aufgefordert worden, zu unserem Großvater „Opa“ und zu unserer Großmutter „Oma“ zu sagen. Sie waren für uns immer „Tättì“ und „Großmamma“.
Tättì war von mittelgroßer, eher hagerer Gestalt. Er ist im ersten Weltkrieg am rechten Oberarm schwer verwundet worden und als Kriegsinvalide wieder nach Hause zurückgekehrt. Während des Italienfeldzugs war er schon als ganz junger Soldat von einem Granatsplitter getroffen worden. Der Splitter war knapp unter seiner Achsel in den Oberarm eingedrungen und hat großen Schaden angerichtet. Seither waren sein rechter Arm und vor allem die rechte Hand kaum mehr zu gebrauchen, weil die Finger unbeweglich und steif gewesen sind. Alle vier Finger und der Daumen hatten sich zum Handteller hin zusammengezogen. Tättìs rechte Hand war somit zwar nicht zu einer Faust geballt, aber er konnte sie nicht mehr öffnen und deshalb auch nichts greifen. Die Hand selbst und auch der größte Teil des rechten Armes waren schlecht durchblutet und nahezu ohne Gefühl. An seinem ganzen rechten Arm war der extreme Muskelschwund deutlich zu erkennen und im Winter hatte Tättì oft sehr unter der Kälte zu leiden.
Die Arbeit in der Landwirtschaft und in seiner Mühle konnte Tättì also nur mit einem Arm und seiner linken Hand bewerkstelligen. Um wenigstens ein bisschen Halt zu haben, hat er am rechten Unterarm immer eine Manschette aus festem Leder getragen. Ein Orthopädieschuhmacher hatte sie ihm gemacht und sie reichte von der Handwurzel bis eine knappe Handbreit unter seinen Ellbogen. Zur Verstärkung hatte er eine Metallschiene eingearbeitet. Die Manschette ließ sich mit einem starken Schnürsenkel zuziehen. Der Orthopädieschuhmacher hatte beidseits der Öffnung, die an die Außenseite von Tättìs Unterarm zu liegen kam, Schnürhaken angebracht. Solche Schnürhaken findet man auch heute noch manchmal bei älteren Schuhmodellen im alpenländischen Raum. Tättì konnte seine Manschette über die ganze Länge öffnen und nachdem er seinen Unterarm hineingelegt hatte, war es ihm sogar möglich, sie mit seiner linken Hand und ohne fremde Hilfe selbst zuziehen. Den überständigen Teil des Schnürsenkels steckte er, nachdem er ihn fest angezogen, hatte am oberen Ende hinter den ledernen Manschettenrand.
Tättì hatte graublaue Augen und sein sonnengegerbtes Gesicht mit der schmalen Nase, die einen leichten Höcker hatte, war sehr markant geschnitten. Unter seiner Nase trug er einen schmalen grauen Oberlippenbart, der so aussah wie jener, den wir von Charly Chaplin kennen. Ich habe Tättì, seit ich denken kann, nur grauhaarig gesehen. Sein Haar war ziemlich widerborstig. Trotzdem schaffte es Großmamma jeden Morgen, nachdem sie den Kamm ordentlich nass gemacht hatte, ihm auf der linken Seite einen schnurgeraden Scheitel zu verpassen. Dann kämmte sie sein Haar ein wenig nach vorne, um es gleich darauf mit einer schon tausend Mal gemachten und immer gleichen Bewegung nach hinten umzulegen, und zwar so, dass über seinem Haaransatz jedes Mal eine kunstvolle Tolle entstanden ist.
Einmal wöchentlich kam Onkel Arnold ins Haus, um Tättì mit dem Rasiermesser den Bart abzukratzen. Das Procedere hat immer in der großen Stube mit dem Kachelofen – der „Schtùba“ – stattgefunden. Ich weiß auch heute noch genau, an welcher Stelle auf dem Wohnzimmerschrank die kleine Schachtel mit dem Rasiermesser gelegen hat. Ich bin wirklich froh, dass es dank meiner Tante Lore gelungen ist, den alten „Schtùbakaschta“ aus Fichtenholz zu retten! So ist er schließlich bei mir zu Hause gelandet und ich konnte für ihn einen Platz in unserer Wohnung finden, wo er noch heute steht. Ich bin beileibe kein Nostalgiker, aber wenn ich daran denke, dass Großmamma diesen Kasten als Hochzeitsgeschenk mit in die Ehe gebracht hatte und dass sie dieses schon damals nicht mehr neue Möbel von einer wohlmeinenden Tante bekommen hatte, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Man stelle sich vor, was man alles zu hören bekäme, wenn dieser alte „Schtùbakaschta“ plötzlich reden könnte und anfinge, aus dem Nähkästchen zu plaudern!
Tättì hat jahraus jahrein immer bunte Flanellhemden getragen. Natürlich gab es Anlässe, derentwegen er von Großmamma genötigt worden ist, auch einmal ein weißes Hemd zu tragen, aber auch dann musste der Kragen immer weit offenstehen und die Hemdsärmel mussten wie immer hochgekrempelt sein. Am rechten Unterarm rollte er den Ärmel selbst hoch, beim linken musste ihm immer jemand behilflich sein. Dafür war in der Regel Großmamma zuständig und das geschah eigentlich immer schon im Zuge der morgendlichen Haarpflege. Über seinem Hemd trug er meistens ein schwarzes Gilet, das nie zugeknöpft sein durfte, und wenn er aus dem Haus ging, setzte er fast immer seine Schieberkappe auf. An seine Klamotten stellte Tättì überhaupt keine Ansprüche. Die Beinkleider bestanden immer aus einer Blaumannhose, es sei denn, dass er am Sonntag unter die Leute gegangen ist, was natürlich – wenn auch nicht allzu oft – schon einmal vorkommen konnte. Dann hat er auch Hosen aus besserem Tuch getragen. Meistens ging er dann ins nahe gelegene Gasthaus Krone auf ein Bier. Es ist auch vorgekommen, dass er dem Gasthaus Schäfle einen Besuch abgestattet hat. Das „Schòòeflì“, wie die Einheimischen dazu gesagt haben, ist von seinem Schwager Hann, mit bürgerlichem Namen Johann Kilga, bewirtschaftet worden. Hann war mit Tättìs Schwägerin, einer Schwester Großmammas – „Bäsì Anna“ genannt – verheiratet. In solchen Fällen verlangte Großmamma, dass er seine dunkelgraue Stoffhose anzog. In diesem Punkt war Widerspruch zwecklos.
Tättì hat es meistens vorgezogen, in das näher gelegene Gasthaus Krone – „ì d’Kròna“ – zu gehen, und obwohl ich nicht oft im „Schòòeflì“ gewesen bin, weiß ich noch sehr gut, wie die Gaststube ausgesehen hat. Vor allem habe ich noch die heimelige Atmosphäre in guter Erinnerung. Dieses Gefühl hat sich bei mir gleich eingestellt, sobald Hann für mich eine Flasche Himbeerlimonade gebracht und für Tättì ein Glas Bier auf den Tisch gestellt hatte. Wenn ich mit Tättì und den Gästen an einem Tisch sitzen durfte und die Rauchschwaden unter der niedrigen Decke und über dem Stimmengewirr gehangen sind, habe ich mich sauwohl gefühlt.
An Sonntagen hat sich Tättì auch schon mal eine „Virginier“ gegönnt, eine lange, dünne Zigarre, die so gestunken hat, dass ich mich auch heute noch gut daran erinnern kann. Bevor er sie ansteckte, musste er aus dem Mundstück einen dünnen Halm herausziehen. Wozu der gut gewesen sein soll, ist mir bis heute ein Rätsel. Er drückte ihn jedenfalls immer mir in die Hand, damit ich etwas zum Spielen hatte.
Tättì war Pfeifenraucher. Seine Pfeife hat so ausgesehen wie jene von Lehrer Lämpel, dem armen Lehrer aus „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch. Das Mundstück hatte die gleiche Farbe wie die schönen Schachfiguren meines Vaters. Die waren aus hellem und dunklen Büffelhorn gemacht.
Wichtig schien es ihm zu sein, dass der Hosenbund seiner Beinkleider prinzipiell und natürlich auch bei seinen Ausgehhosen immer weit über seine Hüften gereicht hat. So musste er den braunen Ledergürtel nicht durch die dafür vorgesehen Schlaufen am Hosenbund ziehen. Er konnte ihn ganz einfach ein Stück unterhalb um den Bauch schnallen. Warum er sich ausgerechnet für diese Technik entschieden hat und was sie für einen Vorteil bot, weiß ich nicht. Vielleicht machte er das auch nur deshalb, weil ihm seine rechte Hand beim Einfädeln des Gürtels in die Schlaufen wenig geholfen hätte. Er schaffte das jedenfalls alleine und ohne fremde Hilfe. Zum Andrücken des Gürtels war die rechte Hand ja noch zu gebrauchen. Das hat zwar ein bisschen kurios ausgesehen, aber ich habe ihn nie anders gesehen. Seinen baumwollenen Tabaksbeutel, in dem er den Pfeifentabak aufbewahrt hat, konnte er so in jeder beliebigen Position hinter den Lederriemen klemmen, ohne auf die Schlaufen am Bund achten zu müssen. Vielleicht war das der tiefere Grund.
Meine erste Zigarre
Jetzt fällt mir gerade noch eine dazu passende Geschichte ein, die ich an dieser Stelle erzählen möchte. Maiskolben kennt wahrscheinlich jeder und jeder weiß vermutlich, dass diese, solange sie nicht geerntet sind und noch an den Stängeln hängen von den Hüllblättern eingeschlossen sind. Aus diesen Hüllblättern stehen am Kolbenende die bis zu zwanzig Zentimeter langen Griffel der Fruchtknoten hervor. Sie trocknen im Zuge der Reifung und werden dunkelbraun. Für uns waren diese Griffel immer schon der Türkenbart – oder „da Türkabaart“ –, weil man bei uns zu Mais „Türken“ gesagt hat. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorstellen zu können, dass wir Kinder gemeint haben, diesen „Türkabaart“ wie Tabak verwenden zu können. So ist er uns dann zum Rauchen als durchaus geeignet erschienen. Also zogen wir beim Hüten der Kühe aus den kurz vor der Ernte stehenden Maisstauden mit den schon gelben und trockenen Hüllblättern kurzerhand ein paar Handvoll dieses „Tabaks“ heraus und setzten uns damit unter einen Baum. Schon zu Hause hatten wir in weiser Voraussicht ein Zeitungsblatt der „Vorarlberger Nachrichten“ vom Vortag und in einem kleinen Döschen Mehlpapp – so nannten wir diesen selbst gemachten Kleister aus Wasser und Mehl – hergerichtet. Nun haben wir den „Türkabaart“ zwischen den flachen Händen etwas in die Länge gerollt und dann in ein Stück Zeitungspapier eingewickelt. Jetzt brauchten wir noch unseren Mehlpapp, um das am Rand ein wenig übereinander gelegte Zeitungspapier zusammenzukleben. Dann hieß es ein bisschen zuwarten, bis der Kleister angezogen hatte, und schon konnten wir unsere manchmal etwas dick geratene Zigarette der Marke „VN“ anzünden. Das hat ganz gut funktioniert, aber nach drei oder höchstens vier Zügen war wieder Schluss mit der Pafferei, weil dieser Tobak dank des Zeitungspapiers so gut gebrannt hat, dass oft die ganze Zigarette Feuer fing. Das hat uns aber nicht daran gehindert, es immer wieder zu versuchen. Weil es so gut geschmeckt hat, zumindest haben wir uns das eingeredet, und weil dieser Rohstoff jederzeit kostenlos und leicht zu beschaffen war, haben wir das auch einmal zu Hause in der Tenne gemacht. Dabei sind wir von Tättì überrascht worden. Er erklärte uns, dass wir auf keinen Fall in der Tenne rauchen dürften. Er meinte, dass das viel zu gefährlich sei, und sagte noch, dass das Rauchen von „Türkabaart“ ohnehin ungesund sei. Kurzerhand nahm er uns mit in die Küche und setzte sich an den Küchentisch. Wir beide mussten auf der Eckbank Platz nehmen. Dann meinte er, wir sollten nicht dieses elende Zeug, sondern lieber „äppas Gschieds“, also etwas Gescheites, rauchen, griff in seine Brusttasche und gab jedem von uns eine seiner langen Zigarren der Marke „Virginier“. Wir Buben hatten ja schon oft genug beobachten können, wie Tättì sie fachkundig vorbereitete, bevor er mit dem Rauchen begonnen hat. Also haben wir zuerst den Halm aus dem Mundstück gezogen. Dann nahmen wir sie erwartungsvoll in den Mund. Tättì steckte sie uns eigenhändig an und wir begannen, heftig daran zu saugen. Wir zogen so heftig dran, dass sich am Zigarrenende bald eine ordentliche Glut gebildet hatte. Im Gesicht meines kleinen Bruders konnte ich gleich das typische Grinsen sehen, das er immer aufgesetzt hat, wenn ihm etwas gefiel. Nachdem wir den ersten Zug genommen hatten, steckte sich auch Tättì eine Zigarre an. So saßen wir alle drei am Tisch und zogen an unseren Zigarren. Weil wir so heftig daran gezogen haben, dass sie richtig qualmten, ist der in unsere Münder gelangende Rauch geradezu heiß geworden. Ich glaube mich daran erinnern zu können, dass meinem Bruder nach nicht einmal einer Viertelstunde das Grinsen vergangen war und wir beide ziemlich gleichzeitig die Zigarren in den Aschenbecher gelegt haben und aufs Plumpsklo gerannt sind. Wir haben uns hundeelend gefühlt und furchtbar schlecht war uns auch. Im Plumpsklo angekommen nahmen wir gleich den





























