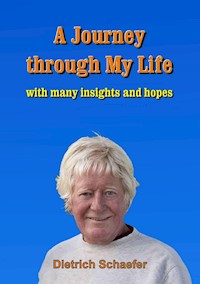7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit seiner Autobiografie präsentiert Dietrich Schaefer ein Leben auf See. Beginnend mit der von der Flucht aus Ostpreußen geprägten Kindheit über die Flüchtlingsproblematik im Nachkriegsdeutschland, zeichnet er mit Humor und vielen schillernden Eindrücken seine Karriere in der deutschen Handelsmarine — vom Schiffsjungen zum Kapitän. Mit Begeisterung lässt er den Leser an den Reisen um die Welt, speziell auf der Süd-, Nordamerika- und später auf der Indonesien-Route teilhaben, vermittelt in zahlreichen Exkursen Wissenswertes über Land und Leute sowie Geschichtliches. Er verbindet dabei historische Hintergründe mit aktueller Tagespolitik aus drei Jahrzehnten Seefahrt. Dietrich Schaefer hat jedoch auch ein ungeheureres Maß an Kreativität in sich, das ihn ständig dazu treibt, Neues zu probieren — aber Zeiten und Umstände verhinderten dies immer wieder. Letztlich schafft er jedoch den Absprung von der See und macht sich mit einer neuen, erfolgreichen Geschäftsidee selbstständig. Bis seine Firma schwarze Zahlen schreibt dauert es aber eine Weile und es muss viel Lehrgeld gezahlt werden. Diese zweite Hälfte seines Lebens schildert die Anfänge der Existenzgründung, zahlreiche geschäftliche Husarenstücke und gipfelt im Verkauf seiner florierenden Firma, die auch heute noch eine Institution ist. Die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz, in diesem prall gefüllten Abenteurerleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dietrich Schaefer
Eine Wanderung durch mein Leben
mit vielen Erkenntnissen und Hoffnungen
Copyright: © 2014 Dietrich Schaefer
Lektorat: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Mein erstes Leben
Kapitel 1
Januar 1938 bis Oktober 1944: Unbeschwerte Zeit zu Hause
Kapitel 2
Oktober 1944 bis Mai 1945: Ende des Zweiten Weltkrieges
Kapitel 3
Mai 1945 bis Mai 1955: Karlshof, Lübeck, Schule
Kapitel 4
Mai 1955 bis Juli 1959: Schiffsjungenschule, Passat, einige andere Schiffe
Kapitel 5
September 1959 bis März 1961, Seefahrtschule Lübeck, Erwerb des Offizierspatents
Kapitel 6
1961 bis 1964 als 3. und 2. Offizier bei HAPAG
Kapitel 7
Kapitänspatent in Lübeck
Kapitel 8
Juli 1965 bis August 1979
Kapitel 9
Mein zweites Leben
Kapitel 10
1985 bis 2004 und die Hochzeit mit Püppi
Ein Exkurs besonderer Art
Dass Du, meine liebe Püppi, es schon nahezu vier Jahrzehnte mit mir ausgehalten hast, werde ich wohl nie verstehen. Mit Deinem sonnigen Gemüt und Deinem Verständnis hast Du auch die dunkelsten Momente in meinem Leben immer wieder in einen Freudentag verwandelt. Ich danke Dir dafür.
Die folgenden Seiten widme ich meinen Eltern.
Vorwort
Man möge Nachsicht mit mir zeigen. Im Oktober 1944, als wir unser Gut verlassen mussten, war ich noch nicht einmal sieben Jahre alt. Meine Schwester war schon ein Teenager im ersten Jahr, meine beiden älteren Brüder befanden sich auf dem Weg dorthin. Die Erinnerungen und Empfindungen meiner Eltern, meiner Geschwister und mir werden sich dadurch wahrscheinlich ein wenig voneinander unterscheiden.
In den frühen Kindheitsjahren erschien Wofkas kleiner Hügel wie ein mittlerer Berg, die gemütlich dahinfließende Angerapp wurde zu einem reißenden Fluss, mein Ivan verwandelte sich in ein Pferd, so groß wie das trojanische. Manches kleine Elternhaus wirkte wie ein großes Anwesen. Mit zunehmendem Alter gewinnt aber die Wirklichkeit wieder die Oberhand.
Die Schilderungen meines Streifzuges sind authentisch, ungeschminkt und realistisch, mit einigen falschen und kostspieligen, allerdings auch richtigen und glücklichen Entscheidungen, die eben zu meinem Leben gehören. Die eingestreuten Exkurse sind real, die große Hitlerfiktion ist jedoch nur ein verspäteter Traum von mir, der leider nie verwirklicht werden konnte.
Dietrich Schaefer
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben.
Alexander von Humboldt
Kapitel 1
Januar 1938 bis Oktober 1944: Unbeschwerte Zeit zu Hause
Ich kann mich eigentlich noch ganz gut an meine ersten Lebensjahre in einem schönen Zuhause in Ostpreußen (heute: Oblast Kaliningrad) erinnern. Unser Gut lag zwischen Insterburg (jetzt Tschernjachowska) und Gumbinnen (heute auf Russisch: Gusev). An meine Taufe kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, ich war damals noch nicht einmal ein Jahr alt. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses besondere Ereignis für meine Eltern, meine drei älteren Geschwister und die übrige Verwandtschaft schon etwa 72 Jahre zurückliegt, kann ich es kaum glauben. Zurückblickend, mich an dieses oder jenes in meinem Leben erinnernd, komme ich zu dem Ergebnis, dass ich bis heute ein sehr interessantes, ereignisreiches und letztlich ein erfolgreiches Leben mit absoluten Tiefen aber auch wunderbaren Höhen hatte. Ich habe lange überlegt, ob ich einen Streifzug durch mein Leben mit Abstechern und Exkursen, die mit mir nur bedingt zu tun haben, aufschreiben sollte. Ich werde es versuchen — Schritt für Schritt.
Meine Eltern hatten schon drei wohlgeratene Kinder: Eine Tochter mit dem schönen Namen Helene. Sie war und ist immer noch die große Schwester; Erich und Hans waren meine Brüder. Zuletzt erblickte ich den endlosen, weiten Himmel über unserem Ostpreußen, das Nesthäkchen Dietrich, wie man Spätlinge damals nannte und wohl auch heute noch nennt. Übrigens: Der Begriff Nesthäkchen wird von meiner großen Schwester bei passenden oder auch unpassenden Gelegenheiten immer noch als Speerspitze gegen mich, ihren jüngsten Bruder, eingesetzt.
Einmal im Sommer, ich glaube es war 1941, hatte die Große mir mein noch junges Leben gerettet. Und das kam so: Dicht an unserem Gut lief die Angerapp vorbei, ein Flüsschen mittlerer Größe. Dort hatte unsere Familie eine Badestelle, zu der wir häufig in der Sommerzeit spazierten, um uns abzukühlen. Wir alle planschten und spielten im Fluss, der mir natürlich, ich war erst etwa 1.000 Tage alt, wie ein gewaltiger Strom vorkam. Doch versuchen wollte ich es auch. Also ging ich voller Hochachtung auf Zehenspitzen sehr vorsichtig ins Wasser. Interessanterweise habe ich mir diese Körperhaltung beim Baden bis heute noch nicht abgewöhnen können. Machen das eigentlich alle Menschen? Da mir die Großen mit ihrer Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und gegenseitigem Bespritzen nicht sonderlich Spaß machten, zog ich es vor, mir ein eigenes Plätzchen zu suchen. Plötzlich, ich fühlte mich wie auf einer sinkenden Wolke, verlor ich den Boden unter meinen Füßen und verschwand in einem tiefen Loch des Bachgrunds. Das Wasser schlug über mir zusammen. Ich hörte den gellenden Schrei meiner Schwester; sie packte mich und zog mich wieder zurück ans Ufer. Schwesterlein, das werde ich dir nie vergessen. Natürlich wurde ich aufs Schärfste von meiner Mutter verwarnt, und zwar mit der Aufforderung, nie wieder etwas auf eigene Faust an unserer Badestelle zu unternehmen. „Ja Mutti, ich will es nie wieder tun“, war meine Antwort. Heute würde so ein Stöpsel eher sagen: „Du hättest ja besser aufpassen können, dann wäre das nicht passiert.“
Irgendwann einmal waren unsere Eltern eingeladen und deshalb mehrere Stunden nicht zu Hause. Erich und Hans war es wohl ein wenig langweilig geworden. Also machten die beiden, sie mögen damals sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, eine Entdeckungstour über unseren Hof. Es gab dort Ställe für Kühe, Pferde, Schweine und Hühner, auch eine Schmiede, eine Scheune fürs Korn und Stroh und natürlich auch unser Wohnhaus und die sogenannten Insthäuser für die Angestellten und deren Familien. Das waren Blöcke, unterteilt in vielleicht acht bis zehn Wohnungen, ich würde sie als Vorläufer der heutigen Reihenhäuser bezeichnen. Dann gab es wohl noch ein oder zwei weitere kleine Häuschen, die zu unserem Hof gehörten.
Meine beiden Brüder bewaffneten sich mit einem leichten Luftgewehr, um den Ratten, von denen es im Schweinestall eine ganze Menge gab, den Garaus zu machen. Neben dem Schweinestall befand sich eine Garage, in der unser großer Mercedes untergebracht war. Da zu dieser Zeit wegen des Krieges das Benzin für die Zivilbevölkerung rationiert war, fuhren meine Eltern damals mit unserem kleinen Fiat.
Der Schweinestall war ein alter Holzbau mit vielen Spinnweben. Mäuse und Ratten lebten dort in Eintracht zusammen. Ab und zu ging mein Vater auf Rattenjagd. Ich habe dunkel in Erinnerung, dass er nie Erfolg hatte, die Ratten komplett zu liquidieren, es waren einfach zu viele und die erwachsenen Ratten einfach zu fleißig beim Fortpflanzen. Sie vermehrten sich in einem Tempo, dass man einfach nicht hinterher kam, um die in meinen Augen abstoßenden Kreaturen ins Jenseits zu befördern. Erklären kann ich es nicht und meine beiden Brüder wahrscheinlich auch nicht — an dem Tag war alles anders. Die beiden warteten und warteten, aber keine Ratte erschien. Welche Enttäuschung, hatten sie doch vor es unserem Vater gleichzutun und Herr über diese Plage zu werden.
Nach langer Wartezeit gewannen bei Erich und Hans offensichtlich Enttäuschung und Langeweile die Oberhand. Sie suchten nach einem anderen Betätigungsfeld. Dieses war schnell gefunden, denn zu damaliger Zeit hatte doch jeder Junge allerhand interessante Dinge in seinen Hosentaschen. Sieh da, was war denn das? Hans fand in seinen unendlich tiefen Hosentaschen eine Schachtel Streichhölzer. (Wahrscheinlich stammten die noch von der letzten Rauchparty, auf der Zigaretten aus getrockneten, zusammengerollten Kastanienblättern gepafft wurden). Da gab es doch gar keine Frage mehr — die Spinnweben warteten doch geradezu darauf angesteckt zu werden. Aber ob sie auch wirklich brennen? Das musste natürlich ausprobiert werden. Na klar, als Mensch muss man schließlich Erfahrungen sammeln und das schon so früh wie möglich. Ohne sie kann ein Mensch nicht erfahren werden. Das ist heute noch genauso wie früher. Sie sammelten also ihre Erfahrungen und stellten fest: Spinnweben brennen wirklich. Das war so, wie sie es schon vermutet hatten, aber der praktische Versuch ist eben allemal besser. Es entwickelte sich zur Freude aller zu einem wahren Feuerwerk. Die Schweine quiekten in allen Tonlagen und hüpften wie toll in ihren Gattern herum. Es ist nie geklärt worden, ob es nun wirklich Freude oder die Angst vor einem unerwarteten Grillfest war.
Gott sei Dank kamen in diesem Augenblick meine Eltern wieder nach Hause. Vorgewarnt durch die große Schwester, sahen sie das drohende Unheil. Ich weiß nicht mehr, ob die beiden Brandstifter erst eine Tracht Prügel erhielten oder erst das aufkeimende Feuer erstickt wurde. Es flossen auf jeden Fall viele Tränen, die in Verbindung mit einigen Eimern Wasser halfen, das noch junge Feuer zu löschen. Wie sagt man doch gleich? Ende gut, alles gut.
Zwei Erfahrungen konnten an diesem Tag gemacht werden: Spinnweben brennen tatsächlich und Tränen zum richtigen Moment am richtigen Platz ersparen sogar die Feuerwehr.
Wie viele Zimmer das Wohnhaus auf unserem Gutshof hatte, weiß ich nicht mehr so genau, das ist auch nicht so wichtig. Es gab aber in unserem Haus das sogenannte Große Zimmer. Es wurde nur zu besonderen Anlässen geöffnet und genutzt. Weihnachten stand dabei an erster Stelle. Taufen und Geburtstage — wir waren immerhin vier Kinder — wurden dort ebenfalls abgehalten. Ab und an fanden dort auch größere Gesellschaften statt. Ja, es war schon ein ganz besonderer Raum, den wir, wenn es nicht anders ging, nur auf Zehenspitzen und mit einem schlechten Gewissen durchquerten. Abgeschlossen war dieses Heiligtum nicht. Die Ausstrahlung von etwas ganz Besonderem hatte dieser Raum aber in jedem Fall.
Einmal im Jahr kam Tante Adda, sie war Schneiderin, Krankenschwester, Trösterin, Zuhörerin und Ratgeberin für alle Lebenslagen und Belange in einer Person. Sie war eine tolle Frau — für uns Kinder jedoch uralt, obgleich sie sicherlich noch nicht über 60 war. Das ganze Jahr war sie unterwegs; bei uns half sie meistens im Sommer, vor allem beim Strümpfestopfen, Bettwäsche reparieren, Knöpfe annähen, Bügeln und vielen anderen Arbeiten im Haushalt. Sie mochte das Landleben, und wir mochten sie. Es war immer große Trauer angesagt, wenn sie uns nach einigen Wochen wieder verließ.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass sie sich, wenn sie draußen an der Luft war, sehr oft mit ihrem Taschentuch die Tränen trocknete. Damals dachte ich immer, dass sie weinen würde. Das war es aber nicht. Ihre Augen waren zu trocken, also produzierten ihre Tränendrüsen zusätzliche Augenflüssigkeit. Aber leider zu viel, sodass die Augen häufig tränten und das vor allem, wenn es windig und kühl war. Damals verstand ich das nicht, heute habe ich dasselbe Problem.
Wir hatten einen sehr großen, schönen Apfelbaum im Garten. Ich kann mich noch an eine Ernte erinnern, lauter wundervolle rotbackige Äpfel mit dem schönen Namen Cox Pomona, da entdeckte ich am nächsten Morgen ganz oben im abgeernteten Baum einen wunderschönen, großen, roten Apfel. Ich lief zu meinem Vater, teilte ihm meine Entdeckung mit und erzeugte bei ihm nur Kopfschütteln. Er glaubte mir nicht. Ich war zwar keine Spielernatur, dennoch forderte ich meinen Vater auf, mit mir eine Wette abzuschließen. Gesagt, getan. — Rückblickend denke ich, dass das kein Zufall war. Vielleicht war es eine Gelegenheit für meinen Vater die Aufmerksamkeit seiner Kinder zu prüfen.
„Um was wetten wir?“, fragte mein Vater.
„Um den vergessenen Apfel“, war meine spontane Antwort — bescheiden für heutige Verhältnisse.
Wir schritten also zum Platz des Geschehens. Der Apfel war dort, so wie ich ihn gesehen hatte. Mein Vater hatte die Wette verloren. Und das Schönste war: Ich durfte in den Baum klettern und mir meinen Apfel selber pflücken. Ein spanischer Torero hätte nicht stolzer sein können.
Die Winter waren hart in Ostpreußen, sehr lang, mit viel Schnee und sehr tiefen Temperaturen, aber die Luft war im Allgemeinen trocken und meistens klar. Wir hatten von der Verwaltung eine polnische Mutter mit ihrem Sohn zugeteilt bekommen. Sie bewohnten eines der kleinen Häuser, die ich zuvor erwähnte. Sie hieß Luba und ihr Sohn hörte auf den Namen Wofka. Er mochte damals so um die 15 Jahre alt gewesen sein. Es waren nette und fleißige Leute. Von unserem Hof ging ein leichter Abhang in den sogenannten Grund. Für mich war es ein langer, steiler Berg. Rodeln auf dem Abhang war angesagt. Wofka hatte sich am Abend zuvor einen ganz einfachen, geflochtenen Korb präpariert, indem er ihn am Vorabend in etwa 20 Zentimeter tiefes Wasser stellte und einfrieren ließ. Am Morgen schnitt er seinen Korb aus dem Eis heraus und hatte nun einen Rundschlitten mit dickem Eisboden. Er setzte sich so gut es ging in seinen selbst gefertigten Schlitten und startete seine Abfahrt. So richtig klappte es aber nicht, weil viel zu viel Schnee auf der Abfahrt lag. Er gab aber nicht auf und startete immer wieder aufs Neue. Er wusste offensichtlich genau was er wollte, denn allmählich bildete sich Eis auf der Bahn. Wofka wurde schneller und schneller. Wir vier Kinder staunten, denn seine Geschwindigkeit wurde immer rasanter. Dazu kam noch, dass er sein Gefährt weder steuern noch irgendwie beeinflussen konnte. Er drehte sich noch zusätzlich wie ein Brummkreisel und freute sich des Lebens. Ich kann mich nicht erinnern, dass auch ich mit seinem Drehschlitten gefahren wäre, und von meinen größeren Geschwistern kann ich auch nur berichten, dass sie mit den richtigen Schlitten in Bezug auf Geschwindigkeit immer das Nachsehen hatten.
Allerdings: Helene ließ sich doch überreden, dieses Abenteuer einzugehen. Ganz hell sind noch in meiner Erinnerung ihre fliegenden Zöpfe und der Aufschrei, als sie gerade mächtig in Fahrt kam und ein dummes Huhn die Eisbahn kreuzen wollte. Die Federn flogen, das Blut spritzte und der weiße Schnee verfärbte sich rot. Wenn es damals schon bei uns auf dem Land ausgeklügelte Verkehrsregeln gegeben hätte — das Huhn könnte vielleicht noch leben. Erkenntnis: Auch mit einfachen Dingen kann man viel Spaß haben, sie können aber auch schnell zu einer tödlichen Waffe werden.
Da wir weit entfernt von Dörfern oder gar Städten auf unserem Hof lebten, hatten unsere Eltern für die älteren Kinder eine Hauslehrerin engagiert. Ihr Name war Schröder, Fräulein Schröder. Das war ihr sehr wichtig. Ich schätze, dass sie um die 50 Jahre alt war. Im Nachhinein möchte ich fast behaupten, dass sie die Anrede Fräulein so lange wie möglich erhalten und pflegen wollte, um zu signalisieren, dass sie noch unverheiratet war. Heute würde man wahrscheinlich erstaunt angeschaut, wenn nicht gescholten werden, wenn man es wagen würde, eine ausgewachsene Frau mit Fräulein anzusprechen. Ich glaube, dass die heutige Entwicklung aber folgerichtig ist.
Fräulein Schröder war eine strenge, aber gerechte Lehrerin. Ihr Stöckchen, wie sie es selber nannte, saß zum Leidwesen meiner Geschwister ziemlich locker. Sie versuchte alles, um aus ihnen Goethes, Einsteins, Kants und Adam Rieses zu machen. Inwieweit es ihr gelungen ist, sollte das spätere Leben zeigen.
Eines Tages hatten meine Eltern Besuch von einem befreundeten Ehepaar. Ich glaube, sie kamen aus Gumbinnen, etwa elf Kilometer entfernt von unserem Gut. Gumbinnen war ein kleines Kreisstädtchen mit vielleicht 30.000 Einwohnern. Das Ehepaar war zum Nachmittagskaffee eingeladen. Im Anschluss daran wurde noch ein wenig geplaudert, oder plachandert, wie man damals in Ostpreußen sagte. Man saß in gemütlicher Runde und wir Kinder waren auch dabei. Bevor der Besuch ankam, nannte meine Mutter die Besucherin unbedachterweise in Anwesenheit von uns Kindern Zweizentnerliebreiz. Das war vielleicht etwas übertrieben, aber sie war schon eine sehr stattliche Dame. Während wir also so in netter Runde zusammensaßen sagte mein Vater zu Helene: „Geh doch mal zu Tante Martha und sei ein wenig lieb zu ihr.“ Mein Schwesterchen sah Tante Martha an, wandte sich dann zu meinem Vater und sagte: „Die Tante ist mir zu fett.“ Die Gesichter der Erwachsenen erstarrten. Es könnte sein, dass wir Kinder diese kleine Episode ganz lustig fanden. Wir lachten hinter vorgehaltener Hand. Der Besuch dauerte dann nicht mehr sehr lange, Onkel und Tante hatten es plötzlich recht eilig wieder nach Hause zu kommen. Meines Wissens nach war durch diese klare Aussage die Freundschaft um einige Grade erkaltet.
Man kann sich schon wundern, was Kinder anrichten können. Ungewollt und ohne böse Absicht, nur weil sie die unverblümte Wahrheit sagen. Wenn ich heute so darüber nachdenke, wäre es sicher nicht verkehrt, wenn die einen oder anderen Erwachsenen in ihrer Ehrlichkeit wieder zu Kindern werden würden. Vor allem wäre dies für viele Politiker empfehlenswert. Ist Ehrlichkeit denn wirklich so schwer zu lernen oder zu praktizieren? Ist die Wahrheit zu sagen um so vieles schwerer? Muss ja wohl, sonst würde es nicht so wenig verbreitet sein.
Auch damals gab es schon Wunschzettel oder jedenfalls Wünsche an den Weihnachtsmann. Die Große wünschte sich eine Puppe, Erich wünschte sich etwas Technisches — er bekam dann eine kleine Dampfmaschine, die er heute noch hat — mein Bruder Hans, dem man damals schon nachsagte, dass er sich eines Tages für das Militär entscheiden würde, wünschte sich das oben schon erwähnte Luftgewehr.
Ich, der nach der ostpreußischen Erbfolge das Gut übernehmen sollte, wünschte mir einen Puppenwagen, natürlich mit Puppe. Wie erfreut und stolz ich war, als der Weihnachtsmann meinen Wunsch tatsächlich erfüllte, kann sich bestimmt jeder vorstellen. Was sich meine Eltern bei diesem doch etwas merkwürdigen Wunsch eines Jungen gedacht haben mögen, ist nicht überliefert worden. Darüber gab es meines Wissens auch keine weiteren Diskussionen. Mir ist diesbezüglich nie etwas zu Ohren gekommen. Jahre später, da wurde schon dann und wann über meine Entgleisung gesprochen, aber nie mit ernstem Hintergrund. Eines weiß ich genau: einem Psychiater, auch Seelendoktor genannt, wurde ich jedenfalls nicht vorgestellt.
Es machte mir große Freude mit Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzung mein Baby über unseren Hof zu jagen. Ob ich damals den verklärten Gesichtsausdruck einer jungen, glücklichen Mutter zur Schau trug, ist leider nicht bekannt. Meine Eltern ließen mich Mutter und Kind spielen, denn sie ahnten schon, dass ich diesen Irrweg wahrscheinlich bald wieder verlassen würde. So kam es dann auch. Im Sommer war dieses Spiel zu Ende. Der Junge wurde ohne Psychiater geheilt? Komisch, damals heilte die Natur solche Krankheiten. Könnte man meine Freundinnen aus der Vergangenheit fragen, wäre die eindeutige Antwort: „Der Junge ist okay, er spielte schon immer gerne mit Puppen.“
Wie viele Pferde wir auf unserem Gut hatten, kann ich heute nicht mehr sagen, vielleicht so um die 20, denn Landwirtschaft ohne sie war damals nicht denkbar. Sie waren treue Begleiter auf jedem Gut. Jedes Kind besaß ein eigenes Pferd, die alle der großen Pferdefamilie angehörten. Es waren keine schlanken Reitpferde, sondern ganz normale Ackergäule, wie alle anderen auch. Meins war ein Rappe mit einem weißen Fleck auf der rechten Hinterbacke. Auch wenn ich in den frühen 40ern noch sehr klein war, so durfte ich doch auch ab und zu auf meinem Iwan reiten. Es war ein erhabenes Gefühl für mich, die Welt von oben zu sehen. Die Ausritte mit uns Kindern auf dem breiten Rücken unserer Pferde waren immer ein großes Vergnügen und sicher nicht nur für uns, sondern auch für unsere Pferde. Ganz besonders genossen wir unsere sonntäglichen Schlittenfahrten im Winter, die uns über weiße Felder und zugefrorene Teiche führten.
Hanne war die Seniorin und eine schon recht betagte Pferdedame. Sie wurde nur noch zum täglichen Abtransport der Milch zur nächsten Molkerei eingesetzt, die nur ein paar Kilometer von unserem Gut entfernt war. Hanne hatte ihr Leben lang treu gedient. Sie bekam ihr Gnadenbrot und die täglichen Milchfahrten betrachtete sie hoffentlich als kleine Abwechslung in ihrem Lebensabend. Einmal durfte auch ich Hanne mit dem Milchwagen im Schlepp befehligen. Es machte viel Spaß. Leider endete der Spaß bei dieser Fahrt jedoch sehr schnell, als ich die Zügel einmal zu hart nach rechts zog und sich der Wagen samt Milchkannen mit mir als verantwortlichem Kutscher bedenklich zur Seite neigte und um Haaresbreite umgekippt wäre. Oh, oh, klein Dietrich, da hast du aber Glück gehabt. Was für ein Theater hätte es gegeben, falls es tatsächlich zum Umsturz des Gefährts gekommen wäre. Die gesamte Milch eines Tages hätte sich auf der Straße ausgebreitet.
Ich versuchte schon immer in meinem Leben auch negativen Ereignissen noch etwas Positives abzugewinnen. Was ich damit meine? Für unser Gut hätte es doch ein außerirdisches Ereignis bedeuten können, denn wir hätten dann ab sofort die Milchstraße unser Eigen nennen können und nicht wie der Rest der Menschheit nur eine gemeinsame hoch oben im Universum gehabt. Wer auch immer schützend seine Hand über mich und das Gefährt gehalten hatte, ich dankte ihm von Herzen — trotz des Verlustes der eigenen Milchstraße.
Wenn das Getreide im Juli reif war, gemäht und eingefahren werden musste, wurde jede Hand gebraucht. Heute übernehmen riesige Mähdrescher große Teile dieses gesamten Prozesses, mit nur einem Fahrer an Bord. Die gewaltigen Maschinen machen drei Dinge: Schneiden, Dreschen, Pusten. Mit dem Pusten meine ich einen Rüssel, der mit Luftdruck das gedroschene Korn auf einen mitfahrenden Hänger befördert. Dieser wird dann in regelmäßigen Abständen von einer Zugmaschine abgeholt. Damals, in den 30er, 40er-Jahren, wurde das Korn noch von mehreren Männern mit der Sense geschnitten. Tagelang — kaum zeigte sich die Sonne im Osten über dem Horizont — ging es aufs Feld. Erst abends, wenn die Sonne im Westen als blutroter Ball wieder verschwand, legte man die Sense wieder aus der Hand. Das war Knochenarbeit.
Es gab aber auch recht fröhliche Momente, zum Beispiel wenn wir Jungs die kleinen, grauen Feldmäuse unter den Korngarben einfingen, um sie dann den Frauen unter die Röcke zu werfen. War das ein Spaß, dem Gekreische der Frauen und Gepiepse der Mäuse zuzuhören. Da kam wirklich Freude auf.
Exkurs Anfang
Viele Menschen sehen, dass die Sonne morgens im Osten auf- und abends im Westen untergeht. Wie kommt das eigentlich? Erlauben sie mir eine kurze Bemerkung, es soll keine Belehrung werden.
Die Sonne ist der weitaus größte Himmelskörper innerhalb unseres Sonnensystems, zu dem auch unsere Erde gehört. Sie ist, wie wir alle wissen, unsere Wärme-, Licht- und Energiespenderin. Eine wunderbare, Leben spendende Einrichtung, die man eigentlich jeden Morgen mit einem Dankgebet begrüßen müsste — ich tue es zwar auch nicht, aber verdient hätte sie es, vor allem anderen.
Wie die meisten Himmelskörper ist auch unsere Erde rund. Sie dreht sich von Westen nach Osten in 23 Stunden und 56 Minuten einmal um sich selbst. Das tut sie wahrscheinlich seit ihrer Entstehung. Man stelle sich vor, sie würde sich eines Tages entgegen aller Naturgesetze einfach nicht mehr weiterdrehen. Die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Erde dreht, beträgt gemessen am Äquator knapp 1.660 Kilometer pro Stunde. Ein wahnsinniges Tempo, wenn man bedenkt, dass die Schallgeschwindigkeit bei einer Lufttemperatur von +20 Grad nur um die 1.234 Kilometer pro Stunde beträgt. Würde es zu diesem angenommenen Stopp tatsächlich kommen, hätte das apokalyptische Folgen. Nur zwei Beispiele möchte ich hier anführen: Das Wasser aller Ozeane, Seen und Flüsse würde in Sekundenschnelle mit unvorstellbarer Kraft alles auf unserer Erde komplett überschwemmen und zerstören. Alle Gebäude und Städte, ob klein oder groß, würden völlig zerstört werden. Städte und Brücken würden untergehen. Das Leben auf der Erde wäre ausgelöscht.
Exkurs Ende
Fortschrittliche Gutsbesitzer hatten auch in den 30er-Jahren schon Maschinen zum Schneiden des Getreides. Das war damals höchster technischer Standard. Die geschnittenen Halme wurden nach dem Schnitt zu handlichen Garben zusammengebunden und auf dem Feld in Reih und Glied zu kleinen Hocken fein säuberlich aufgestellt, um die Halme und Ähren trocknen zu lassen. Das dauerte einige Tage und dann war es soweit: Das Korn wurde eingefahren. Da mussten dann alle rann, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau. Alle verfügbaren Leiterwagen mit jeweils zwei vorgespannten Pferden wurden zum Einfahren des Getreides eingesetzt. Mein Pferd Iwan war natürlich auch dabei. Zwei Erntehelfer waren auf den Wagen und warteten auf die Getreidegarben, die ihnen vom Bodenpersonal mit Forken auf die Wagen geworfen wurden. Eine anstrengende Arbeit war das, vor allem an heißen Sommertagen. Garbe für Garbe landete so auf den Wagen. Aus meiner Sicht wuchs die Ladung turmhoch bis in den Himmel, so gewaltig erschienen mir die voll beladenen Leiterwagen. Zur weiteren Bearbeitung verließen die fahrenden Getreideberge die Felder, um dann in der Scheune gedroschen zu werden.
Der Zweite Weltkrieg begann im September 1939, erst mit Polen, dann mit Frankreich und England und im Jahre 1941 begann der Einmarsch in Russland. Wir erlebten es dadurch, dass in gewissen Zeitabständen Truppenteile auf unserem Gut stationiert wurden, um auf ihrem Weg nach Osten eine Ruhepause einzulegen. Das war natürlich für uns Kinder immer eine aufregende Zeit. Die vielen Panzer, Geschütze, Lastkraftwagen und anderes Kriegsgerät machten auf uns einen riesigen Eindruck. Die Soldaten erzählten uns Erlebnishungrigen spannende Geschichten, die sie vielleicht schon an der Westfront erlebt oder von Kameraden gehört hatten und als eigene Geschichten weitergaben.
Unsere Große, sie war 1943 schon elf Jahre alt, interessierte sich mehr für gut aussehende junge Soldaten, bevorzugte allerdings eher die Offiziersdienstgrade. Die kleinen Mädchen sind wohl so. Ich denke, da hat sich im Laufe der Zeit nicht viel geändert. Wir Jungs erkundeten natürlich die Technik und ließen uns diese von den Soldaten erklären. Fräulein Schröder hatte dann immer eine schwere Zeit, denn die Schulmittagspause wurde dadurch selten eingehalten; alle fanden es interessanter und viel aufregender bei den rastenden Soldaten zu sein. Die Schrödersche machte sich dann auf den Weg, um ihre drei Schüler zu suchen. Es war viel Arbeit für sie, oft auch ohne Erfolg, denn die Soldaten versteckten die Ausreißer gerne und machten aus der ernsten Angelegenheit für Fräulein Schröder, eine spaßige für sich und meine Geschwister. Fräulein Schröder ließ es sich nach langer aber dann doch erfolgreicher Suche nicht nehmen, sich mit ihrem Stöckchen zu bewaffnen, um die Ausreißer für ihre Entgleisungen zu bestrafen. Da ich noch nicht schulpflichtig war, wurde ich Gott sei Dank bei dieser schmerzhaften Strafaktion nicht mit einbezogen.
Die Zeit verging und es musste so im Sommer 1944 gewesen sein, als meine Eltern die Order bekamen, sogenannte Panzergräben quer durch unsere Felder zu ziehen. Kolonnen von Arbeitern erschienen recht bald auf unseren Feldern, bewaffnet mit Hacke und Schaufel, um die Erde aufzuwühlen. Die Gräben waren so um die drei Meter breit und konisch nach unten zulaufend um die drei Meter tief. Ich kann mir heute vorstellen, dass die später vorrückenden russischen Panzer diese Gräben kaum bemerkt haben, so gewaltig waren ihre Kampfmaschinen und so mickrig die gebauten Gräben, um den Feind auf seinem Marsch nach Westen aufzuhalten. Hatten da wirklich ernst zu nehmende Entscheidungsträger gehofft, die russische Armee auf diese Art aufzuhalten?
Der Krieg kam immer näher. Bei Ostwind konnte man schon dann und wann fernes Grummeln und Kanonendonner der nahenden Front hören. Ein wichtiges Ziel der russischen Armee war das Erreichen und Vereinnahmen Königsbergs beziehungsweise Pillaus, einem nahezu eisfreien Ostseehafen vor Königsberg. Mein Vater schaffte ein Radio an, um die neuesten Nachrichten über die Kriegsereignisse an allen Fronten zu hören. Sie waren von der deutschen Propaganda sehr stark geschönt. Dass sich die Schlinge um Deutschland immer enger zog, konnte man jedoch schon heraushören. Ab und zu hörten und sahen wir auch schon russische Flugzeuge, die nach Westen flogen. Es wurde jeden Tag beängstigender. Von Zeit zu Zeit fielen Bomben auf unser Land, manchmal auch in das Flüsschen Angerapp. Warum das so war, konnten sich die Erwachsenen nicht erklären. Unsere Gegend war nun weiß Gott kein strategisches oder industriell wichtiges Gebiet. Vielleicht hatten die Flugzeugführer aber auch nur vergessen einzelne Bomben in den Zielgebieten abzuwerfen. Das taten sie dann auf ihrem Heimflug nach Osten. Jedenfalls wurde es immer ungemütlicher. Ich kann mich noch erinnern, dass wir Kinder unseren Vater manchmal baten, die Flugzeuge winkend an unserem Gut vorbeizuleiten. Wenn wieder einmal eine Bombe in der Angerapp gelandet war, watete die schon oben erwähnte Luba tapfer und gottesfürchtig mit ihrer zu einem Beutel umgewandelten Schürze durch den Fluss, um die toten Fische einzusammeln, deren Schwimmblasen durch den Druck der detonierten Bomben zerrissen worden waren.
Dann, am 19. Oktober 1944, bekamen wir die Aufforderung unser Gut innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Nun war es soweit — das war das Ende unserer Zeit in unserem Zuhause. Unsere Mutter hatte als Zwölfjährige 1917 während des Ersten Weltkrieges schon einmal eine Flucht vor den Russen miterleben müssen. Dadurch lagen bei unserer Flucht 1944 schon kleine Erfahrungen vor. Die Familie kam damals bis Pommern, blieb dort ein paar Monate und konnte dann wieder zurück in ihre Heimat. Mit dem Gedanken wieder nach Hause zu kommen, war die damalige Flucht mit unserer jetzigen im Jahre 1944 nur schlecht zu vergleichen. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg Flieger bei der kaiserlichen Luftwaffe und hatte im eigentlichen Sinne noch keine Flucht miterlebt.
Exkurs Anfang
Eine Geschichte zwischendurch, die für unsere Familie tragisch endete: Unser Vater hatte 1914 beim preußischen Heer während einer dienstlichen Reitstunde einen sehr ernsten Reitunfall — er erlitt einen Schädelbruch. Die Spätfolge waren wiederkehrende und immer ernstere Herzbeschwerden. Im Laufe der Jahre besserte sich sein Zustand, unser Vater konnte sogar seinen Dienst während des Ersten Weltkrieges wieder aufnehmen. Seine Ärzte rieten ihm damals einen Antrag auf Frühpensionierung zu stellen, weil sich sein durch den Dienstunfall hervorgerufenes Herzleiden mit zunehmendem Alter verschlimmern würde. Mein Vater lehnte das ab, weil er der Auffassung war, wirtschaftlich so gestellt zu sein, dass er eine vom Steuerzahler bezahlte Rente letztlich nicht benötigen würde.
Im Jahre 1945 nach der Flucht in Lübeck angekommen, lebte dieses Thema wieder auf, weil es unserer sechsköpfigen Familie, wie vielen anderen Familien auch, ausgesprochen miserabel ging. Nach unserem Aufenthalt in der Siedlung Karlshof, die zu Lübeck gehörte, wurden wir notdürftig in Lübeck in zwei Zimmern zur Untermiete untergebracht. Mein Vater war arbeitslos, herzkrank und die Verantwortung für die Familie verschlechterte zusehends seinen Gesundheitszustand. Es wurden Briefe an die damaligen Behörden geschrieben, die mit Schreiben früherer Kameraden und Ärzten belegt waren. Die Bitte meines Vaters auf nachträgliche Aktivierung der aus dem Reitunfall wohl berechtigten Pension, wurde mit der sinngemäßen Begründung abgelehnt, dass damals kein Antrag gestellt worden war. Der Schlusssatz aus einem der Briefe, den unser Vater 1951 an das Lübecker Versorgungsamt schrieb: „Ich bitte zu berücksichtigen, dass meine frühere Zurückhaltung auf verstehenden Motiven beruhte, da ich den schwer erschütterten Staat (nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg) nicht durch Ansprüche belasten wollte, auf die ich durch meine damalige, gute wirtschaftliche Lage nicht angewiesen gewesen wäre.“
Meine persönliche Auffassung zu diesem Ereignis: Wer würde heute einen berechtigten Pensionsanspruch nicht wahrnehmen, nur weil er sich im Moment in einer guten wirtschaftlichen Lage befindet? Zwischen dem damaligen und dem heutigen Versorgungsdenken liegen leider Welten.
Exkurs Ende
Der Aufruf, bis spätestens zum 20. Oktober 1944 Haus und Hof zu verlassen und die Flucht anzutreten, war ein schwerer Schlag für alle, die zu unserem Hof gehörten: Unsere Eltern, Fräulein Schröder, unser Kutscher Paul, zwei Hausmädchen — eine davon hieß Frieda Schmidke, den Namen der zweiten habe ich vergessen — und die vielen Landarbeiter mit ihren Familien. Unser Hund Biene, ein Deutsch-Drahthaar, machte auch einen leicht irritierten Eindruck. Die Landarbeiter-Familien waren für sich selbst verantwortlich. Nicht alle wollten den Hof verlassen. Wie ich später erfuhr, haben die meisten von ihnen ein sehr trauriges und teilweise schnelles Ende gefunden. Man hörte von Erschießungen, Vergewaltigungen und Verschleppungen nach Sibirien.
Es wurde entschieden, einen unserer Leiterwagen, der noch bis vor wenigen Wochen für das Einfahren des Getreides genutzt worden war, von vier Pferden ziehen zu lassen. Mein alter Iwan war leider nicht dabei. Auf diesen Wagen wurde nun in äußerster Hektik alles geladen, was meinen Eltern, meinen Geschwistern und allen anderen Mitfahrern wichtig erschien. Außerdem wurde unser großer Mercedes Benz mit allen Wertsachen wie Silber, Goldbestecken, Jagdwaffen, Geldkassette und Schmuck beladen. In den kleinen zweisitzigen Fiat wurde auch noch dieses oder jenes verstaut. Ihn sollte, angehängt an unseren Treckwagen, unsere Mutter steuern. Mutter hatte zwar einen Führerschein, aber sie war bis dahin nie alleine mit einem Auto gefahren, geschweige denn mittels einer starken Kette von einem Pferdewagen gezogen worden.
Mein Vater hatte auch daran gedacht teures, altes Tafelgeschirr und verschiedene andere ihm wichtig erscheinende Dinge, denen die feuchte Erde nichts anhaben konnte, in unserem Garten neben einer großen Eiche zu vergraben. Alles wurde fein verpackt und mit Öl getränkten Tüchern eingewickelt. Das sollte genügen, weil meine Eltern ja der Meinung waren, dass wir bald wieder nach Hause kommen würden. Wie wir heute wissen, war diese Annahme leider falsch. Pferde, Kühe, Schweine, Geflügel und sonstige Haustiere wurden in die Freiheit entlassen, mit der sie vorerst nichts anfangen konnten. Dann verabschiedeten wir uns von unseren Mitarbeitern und deren Familien. Wo Luba und ihr Wofka geblieben waren, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Bei den Erwachsenen war das Abschiednehmen natürlich dramatisch. Auch uns Kinder überkam dieses Gefühl, wir wurden einfach mitgerissen, auch wenn wir den absoluten Ernst sicherlich nicht so empfanden wie die Erwachsenen.
Am 20. Oktober um die Mittagszeit verließen wir endgültig unseren Hof. Wir waren eine stattliche Formation. Unser Treck bestand aus mehreren Fahrzeugen: Der große Mercedes mit unserem Vater und uns vier Geschwistern, dann der eigentliche Treckwagen mit Paul, unserem polnischen Kutscher, den zwei Hausmädchen und Fräulein Schröder. Das Schlusslicht bildete der an den Treckwagen angekettete kleine Fiat mit meiner Mutter als Fahrerin. Das war allerdings nur eine Momentaufnahme, denn schon nach wenigen Kilometern fuhr meine Mutter den ihr anvertrauten Fiat gegen einen Baum, der ihr leider im Weg stand. Kurz entschieden wurde der Wagen am Straßenrand stehen gelassen. Das war der erste Rückschlag. Gemessen an der Aufgabe eines ganzen Gutes wurde dieser Verlust wahrscheinlich relativ leicht verkraftet. Meine Mutter wechselte auf den Treckwagen und so konnte die Fahrt weitergehen. Unser nächstes Ziel, das Gut meines Onkels und Bruder meines Vaters, war etwa zehn Kilometer von unserem Gut entfernt.
Exkurs Anfang
Unser Vater hatte drei Brüder. Zwei waren im Ersten Weltkrieg gefallen — verdammter Krieg. Wie viel unvorstellbares Leid haben Menschen weltweit durch Kriege ertragen müssen! Im 20. Jahrhundert bis heute (2013) hat es weltweit mehr als 200 kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, an denen etwa 120 Staaten beteiligt waren und teilweise immer noch sind. 50 dieser Kriege sind heute noch aktiv. Was muss eigentlich noch passieren, bis die Menschheit vernünftig wird? Nehmen wir einmal an, dass von der gesamten Weltbevölkerung, die im Jahre 2013 bei gut sieben Milliarden liegt, vielleicht 0.5 Promille kriegslüstern sind. Das mögen nicht mehr als dreieinhalb Millionen sein. Ich erhebe keinen Anspruch, dass diese angenommenen Zahlen stimmen, aber eines möchte ich behaupten: dass der weitaus größte Teil der Erdbevölkerung in Frieden und Sicherheit leben möchte. Warum lässt sich dieser Teil immer wieder von Wenigen als Kanonenfutter verheizen? Gerne würde ich die Antwort hören. In Gedanken mache ich jetzt eine Umfrage bei allen Menschen auf dieser Erde: „Bist Du gegen oder für Kriege?“ Die Antwort würde sicher eindeutig sein: Die angenommenen Zahlen stehen oben.
Es sind immer die anderen, die andere in den Krieg schicken und für sich sterben lassen. Am Lübecker Holstentor gibt es über dem Rundbogen, unter dem früher die Straße aus westlicher Richtung in die Stadt führte, eine wunderbar philosophische Inschrift. Sie prangt auch heute noch in großen, goldenen Buchstaben über dem Torbogen:
CONCORDIA DOMI, FORIS PAX DRINNEN EINTRACHT, DRAUSSEN FRIEDEN
Wunschvorstellung und Empfehlung zugleich, beides ist vorstellbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die USA als selbst ernannte Weltpolizei damit hervorgetan, sich unter humanitärem Vorwand überall dort militärisch einzumischen, wo es für die eigenen Interessen sinnvoll erschien. Die Amerikaner unterliegen einem Trugschluss: Sie sind der festen Überzeugung, dass sie überall auf der Welt willkommen sind. Das Gegenteil ist der Fall — auch wenn Herr Obama, amerikanischer Präsident von 2008 bis voraussichtlich 2016, kürzlich meinte, dass die Amerikaner in der ganzen Welt geliebt werden. Es liegt wohl im menschlichen Wesen andere ohne Rücksicht auf Verluste zu missionieren und die eigene Meinung als allgemein selig machende zu verbreiten, auch dann, wenn es nur mit Gewalt geschehen kann.
Ich muss hier etwas richtig stellen: Ich meine damit nicht den amerikanischen Bürger (siehe die angenommenen 0.5 Promille), ich meine damit die amerikanische Außenpolitik. Diese ist eine Bedrohung für die Menschheit und könnte eines Tages in einer Katastrophe enden. Es kann doch nicht sein, dass jeder Staat mit Ausnahme von Costa Rica und einigen wirklich kleineren sogenannten Staaten, seiner Größe entsprechend, hochgerüstet sein muss. Es ist erst recht kaum zu verstehen, dass auch die ärmsten Staaten hochgerüstet sind, das Volk aber in Armut leben muss. Viele dieser Staaten erhalten gigantische Summen Entwicklungshilfe und es sieht so aus, als wäre es den Geberländern egal, wofür die Gelder eingesetzt werden. Nein, es wird den Geberländern wahrscheinlich nicht egal sein, denn mit dem Geld werden andererseits wieder Waffen in den Industrieländern gekauft. Dieser Kreislauf muss eines Tages, am besten heute, unterbrochen werden. In vielen dieser Länder gibt es immer wieder Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Hurrikans, Tsunamis und viele andere Ereignisse, bei denen Hunderttausende Menschen sterben. Immer wieder werden weltweit riesige Summen »erbettelt«, weil die jeweiligen Regierungen nicht vorsorgen und lieber immense Summen in die Rüstung stecken. Für die Behebung der Auswirkungen von Katastrophen und gegen den Hunger im eigenen Land steht wie immer kein Geld zur Verfügung. Meiner Ansicht nach müsste diesem Verhalten ein Riegel vorgeschoben werden, indem zum Beispiel die UNO jeden Staat verpflichten müsste, für solche Notfälle Rücklagen zu bilden oder bei der UNO einen bestimmten Prozentsatz des Bruttosozialprodukts in einen gemeinsamen Topf einzuzahlen. Ein schöner Gedanke, wenn man davon ausgehen könnte, dass die Vereinten Nationen die Macht hätten, diesen Gedanken auch umzusetzen. Da die UNO diese Macht wahrscheinlich aber dank der herrschenden Mehrheitsverhältnisse nicht besitzt, wird dieser Gedanke wohl für die nächste Zeit eine schöne Vorstellung bleiben. Würde man seitens der UNO jedoch Hilfen von der Einzahlung eines jeden Landes abhängig machen, könnte das vielleicht ein vernünftiger Ansatz sein.
Es ist kein Geheimnis, warum immer wieder Kriege ausgelöst werden. Die Gründe sind vielfältiger Natur. Wahrscheinlich sind wir Menschen doch nicht so intelligent wie wir uns sehen, denn das unvorstellbare Leid, das bei allen Kriegen verursacht wird, scheint nach wie vor niemanden davon abzuschrecken sie zu führen. Beispiele dafür gibt es genug. Auch Hitler hatte die irre Idee mit seinem raumgreifenden Eroberungskrieg ein Tausendjähriges Reich zu formen. Was daraus wurde ist hinlänglich bekannt.
Exkurs Ende
Mir fällt in diesem Zusammenhang ein, dass Fräulein Schröder, sie saß ja mit auf dem Treckwagen, plötzlich einen Verzweiflungsschrei ausstieß und unter Tränen jammerte, dass sie ihr Hitlerbild vergessen habe. Der Treck, der nun schon durch die Attacke meiner Mutter auf die starke Eiche etwas geschrumpft war, hielt an, um ihr Unglück zu beraten. Mein geduldiger Vater bot ihr kurzerhand an mit dem Auto zurückzufahren, um das vergessene Bild zu holen. Eine groteske Situation. Zum einen das dramatische Ereignis unsere Heimat verlassen zu müssen und Haus und Hof mit aller Habe zu verlieren, zum anderen der aberwitzige Wunsch das Bild eines gescheiterten Diktators, um nicht zu sagen des größten Verbrechers im vergangenen Jahrhundert, vor den sowjetischen Truppen zu retten. Spricht man mit Zeitzeugen, waren eigentlich alle dagegen. Man muss sich fragen, wer Hitler denn nun gewählt hat, wenn alle dagegen waren? Wahr ist, dass Hitler weitgehend legal an die Macht gekommen ist.
Nach einiger Zeit holten wir den Treckwagen wieder ein. Mein Vater übergab der überglücklichen Besitzerin das Bild. Sie schloss es in die Arme und drückte es voller Inbrunst an ihre Brust. Konnte das wahr sein? Heute bin ich überzeugt davon, dass die Schrödersche damals den größten Teil der reichsdeutschen Bevölkerung mit dieser leidenschaftlichen Geste repräsentierte. Das Hitlerbild half uns Kindern und unserem Vater noch einmal unseren Hof zu sehen. Wann und wo uns Fräulein Schröder auf unserer Flucht verließ, kann ich heute nicht mehr sagen.
Kapitel 2
Oktober 1944 bis Mai 1945: Ende des Zweiten Weltkrieges
Unser erstes Ziel wurde noch am selben Tag erreicht. Dort gab es zwei Kinder: unsere Cousine und unseren Cousin, die wir längere Zeit nicht gesehen hatten. Uns machte es viel Spaß wieder einmal mit ihnen zu spielen. Heute allerdings würde ich sagen, dass wir den Ernst der Situation damals noch nicht begriffen hatten, mit all den Folgen, die ein verlorener Krieg mit sich bringt. Wir Kinder waren unbeschwert von jeglichen Sorgen, denen unsere Eltern ausgesetzt waren. Aber so sind nun einmal Kinder, und das ist auch gut so, denn nicht sie, sondern die Erwachsenen haben alles versucht, Deutschland in einen Trümmerhaufen mit unendlich vielen Toten und Verletzten zu verwandeln. So war es für uns Kinder eine besondere und recht interessante Unterbrechung.
Es gab immer wieder Meldungen, dass die russischen Truppen sehr schnell nach Westen vordrangen. Warum? Die deutschen Truppen waren ausgeblutet, verbraucht und hoffnungslos aufgrund der vielen Verluste an der Ostfront. Aus den Wortfetzen während der Unterhaltungen der Erwachsenen konnten wir Kinder schon entnehmen, dass die Lage ernst war, und wir in nächster Zeit weiterziehen mussten.
Wie lange wir uns noch auf dem Gut meines Onkels aufhielten, kann ich nicht mehr genau sagen. Aber wenn ich heute zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich zu lange war.
Am Abreisetag hörten wir wieder einen Verzweiflungsschrei, diesmal von unserer Mutter: „Wir haben den Beutel mit den Strümpfen für die ganze Familie vergessen.“ Da wurde nicht lange diskutiert, ein Fuhrwerk mit einem Pferd davor angespannt und ab ging die Post, mit meiner Mutter und dem Kutscher ging es zurück. Nach knapp drei Stunden erreichten sie unseren Hof, auf dem schon deutsche Truppen eingezogen waren — diesmal allerdings auf ihrem Weg nach Westen, begleitet von Gedanken, dass der Krieg wohl verloren würde — im Gegensatz zu den deutschen Truppenbewegungen in den Jahren 1942/1943 von West nach Ost, damals begleitet von der Überzeugung, dass die Deutschen diesen Krieg gewinnen würden. Welch ein Trugschluss!
Der Beutel mit unseren Strümpfen war schnell gefunden, dann aber kreuzte der Obergockel, unser Haushahn, den Weg meiner Mutter. Kurz entschlossen fragte meine Mutter einen Offizier, ob es wohl möglich wäre, dieses kapitale Federvieh zu erlegen. Der Angesprochene zögerte nicht lange, zückte seine Pistole und — kaum zu glauben — er benötigte fünf Schüsse, um den Vogel zu erlegen. Ob die vier Fehltreffer nun für den Hahn auf seinem Fluchtweg sprachen oder gegen die Schießkunst des Schützen, soll hier nicht näher beleuchtet werden. Jedenfalls, praktisch wie unsere Mutter immer war, wurde der Gockel eingepackt, auf den Wagen gelegt, und die Fahrt ging zurück zum Gut meines Onkels.
Nun erhebt sich aber noch eine andere Frage: Wurde der Hahn aus Mitleid erschossen, um ihm ein Leben unter sowjetischen Soldaten und späterer kommunistischer Zwangsherrschaft zu ersparen oder sollte das Tierchen lieber in unserem Kochtopf verschwinden statt den deutschen oder den sowjetischen Soldaten als Festschmaus zu dienen? Wie dem auch sei, meine Mutter hatte das Richtige getan. Somit war es unsere Mutter, die als Letzte unseren Hof gesehen hatte.
Wir hätten bei dem hoffnungslosen Kriegsverlauf besser überhaupt keine größeren Aufenthalte machen sollen. Alle zugänglichen Informationen, die man überhaupt erhalten konnte, klangen dagegen immer noch positiv und recht siegessicher. Allerdings musste man unterscheiden, denn viele offizielle Meldungen basierten auf Falschmeldungen der obersten Heeresleitung oder auf Nichtmeldungen, die dann zu Gerüchten mutierten. Wie kann es auch anders sein? Hätte man die Bevölkerung mit der Wahrheit versorgt, hätte die Flucht aus Ostpreußen schon drei bis vier Monate früher beginnen müssen. Vielen Menschen wäre dann unsägliches Leid erspart geblieben. Im Gegenteil, es gab Fluchtverbote, die erst im letzten Moment aufgehoben wurden, dann war es aber in vielen Fällen schon zu spät. Die Walze der Sowjetarmee überrollte die Menschen.
Ich kann mich nicht mehr an die Rede von Dr. Joseph Goebbels erinnern, der in der Nazi-Zeit als Propagandaminister unter Hitler agierte, aber natürlich habe ich darüber gelesen. Unter anderem fragte er die Massen am 18.02.1943 im Berliner Sportpalast: „Wollt Ihr den totalen Krieg?“ Es befanden sich Tausende Zuhörer in dem Sportpalast. Bei dieser Frage sprangen die Menschen wie elektrisiert auf, machten den Hitlergruß und grölten: „Ja, das wollen wir!“, oder Ähnliches. Anschließend wurde das Deutschlandlied gesungen. Entsprach dieses traurige Theater dem Wunsch des deutschen Volkes? Ich mag es nicht glauben. Aber diese Frage mit der anschließenden Antwort ging um die Welt. Besonders verankerten sich diese Frage und die deutliche Antwort in den Köpfen der Alliierten Truppen.
Jedenfalls verließen wir den Hof meines Onkels nach einiger Zeit wieder, um unsere Flucht weiter nach Westen fortzusetzen. Wir wurden oft von Flugzeugen überflogen, Panzer kreuzten unsere Wege. Wir sahen tote oder auch verletzte Zivilisten und Soldaten am Straßenrand. Daran konnte man erkennen, dass wir hier und dort durch Gebiete zogen, in denen schon Kriegshandlungen stattgefunden haben mussten. — Kein gutes Gefühl.
Die genauen Stationen kann ich heute nicht mehr nennen. Aber ganz genau kann ich mich noch an gute Freunde in Pommern erinnern, bei denen wir auch eine ganze Zeit unterkamen.
Exkurs Anfang
Es war schon eine dramatische Zeit. Hinter uns waren die sowjetischen Truppen, über die wir viele Grausamkeiten hörten, die sich in den Kampfgebieten abgespielt haben sollten. Das wurde uns immer wieder auf den verschiedensten Wegen übermittelt. Immer begleitet von entsprechenden Bemerkungen, wie schlimm sich die sowjetischen Soldaten in den wiedergewonnenen Gebieten oder auf deutschem Boden verhalten würden. Ich finde, dass die Klagelaute nicht objektiv waren und auch bis heute nicht sind. Denn wer hat den Zweiten Weltkrieg begonnen? Die Polen? Die Engländer? Die Franzosen? Die Holländer? Die Belgier? Die Sowjetunion? Die Amerikaner? Nein, allein die DEUTSCHEN! Wer hat in den ersten Jahren ohne viel Umstände Zivilisten in den besetzten Gebieten erschossen? Die Deutschen! Wer hat Millionen von Juden und andere Gruppen maschinell ermordet, besser gesagt, vergast? Die Deutschen! Dieses ist keine Nestbeschmutzung, dieses sind reale Fragen und entsprechende Antworten. Heute noch, knapp 65 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, werden von vielen Deutschen immer wieder die endlosen Bombardements der deutschen Städte durch die Alliierten beklagt. Warum eigentlich? Wenn die Deutschen ebenfalls die Möglichkeit gehabt hätten — und wer glaubt, die Nazis hätten es nicht getan, der irrt — der verkennt die Tatsachen. Die Luftwaffe hätte doch allzu gerne englische Städte in Schutt und Asche gelegt, wenn sie es gekonnt hätte.
Exkurs Ende
Es wurde ein sehr kalter Winter 1944/1945. Es gab keine Heizung in unserem Auto, in dem wir vier Kinder mit meinem Vater fuhren. Wir waren immer einige Stunden vor unserem Leiterwagen, auf dem meine Mutter mit Paul und Frieda, das zweite Hausmädchen hatte sich mittlerweile von uns verabschiedet, alles taten, um schnell voranzukommen. Die Straßen waren zum Teil vereist, Schneewehen machten uns das Vorwärtskommen schwer.
Unsere Mutter hatte uns Kindern das Stricken beigebracht. Zum einen, um uns irgendwie zu beschäftigen, zum anderen, damit unsere Finger nicht erfroren. Ich werde es nie vergessen: „Eins rechts, eins links, eins fallen lassen.“ Das muss wohl das einfachste Strickmuster sein. Jedenfalls haben wir alle es sehr schnell begriffen. Ich glaube, es war eine sehr erfolgreiche Therapie gegen Kälte und Langeweile.
Es war eisig kalt, aber meine Mutter und die beiden anderen, nicht zu vergessen unser Hund, die Biene, mussten doch noch viel mehr ausgehalten haben, denn sie saßen ungeschützt auf dem Leiterwagen. Wir in unserem Auto waren, wie schon gesagt, immer einige Stunden schneller als unserer Mutter, um schon ein Quartier vorzubereiten. Ort und Adresse waren vorher verabredet worden.
Es war immer eine Angstpartie, wenn die erwartete Ankunftszeit überschritten wurde. Im Nachhinein bewundere ich meine Mutter sehr. Sie war während unserer Flucht um die 40 Jahre alt. Damals gab es natürlich kein mobiles Telefon, um sich über die aktuellen Ereignisse auszutauschen (nur zum Verständnis für die Jüngeren, die sich heute ein Leben ohne EMail, Handy, Facebook und so weiter nicht mehr vorstellen können).
Ich habe nach dem Ende des Krieges sehr viel über die Flucht aus dem Osten gelesen, Filme gesehen und Erzählungen der Älteren gelauscht. Jeder von den Flüchtlingen hatte seinen eigenen Weg, jeder hatte seine ganz individuellen Erlebnisse und Probleme. Und doch ähnelten sich alle Erlebnisse mehr oder weniger. Aber alle hatten eins gemeinsam: die Angst, zwischen die Fronten zu geraten — denn dann gab es kein Entkommen — oder von den Sowjets überrannt zu werden oder auch ganz einfach zu verhungern oder zu erfrieren. Wenn ich unseren Treck mit den vielen anderen Schicksalen vergleiche, ging es uns noch sehr, sehr gut. Wie unser Vater immer wieder Benzin für das Auto beschaffen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber irgendwie habe ich so eine Ahnung, dass mein Vater ein tolles Sesam-öffne-dich-Schreiben von irgendeiner Behörde erhalten hatte, welches uns letzten Endes hier und dort sehr hilfreich war. Dazu gehörte sicher auch, dass die damaligen Entscheidungsträger unser Auto nicht konfiszierten. Das kommt mir heute noch wie ein kleines Wunder vor. Weiterhin empfinde ich es heute als sehr weise von meinem Vater, dass wir nicht den Fluchtweg über das Frische Haff und die zugefrorene Ostsee genommen hatten. Dort sind Tausende Flüchtlinge mit ihren Treckwagen, manche nur mit einem beladenen Kinderwagen, mit Mann und Maus eingebrochen und elendig im eiskalten Wasser ertrunken. Es gibt Schätzungen, die von 300.000 toten Flüchtlingen sprechen — nur bei dieser einen Fluchtroute.
Ich erwähnte ja schon, dass meine Mutter im Ersten Weltkrieg von ihrem Gut, dass nach ihrer Heirat mit unserem Vater auch unsere Heimat geworden war, vor den Russen flüchten musste. Dort, wo wir jetzt landeten, war genau der Hof, auf dem meine Mutter 1917 als Kind auch schon Zuflucht gesucht hatte und darauf wartete, nach Kriegsende wieder nach Hause zu kommen. Es gibt immer wieder merkwürdige Dinge im Leben. Damals war dieser Ort in Pommern der Endpunkt ihrer Flucht nach Westen. Dieses Mal sollte es leider nur eine Durchgangsstation werden. Wer ahnte schon, dass wir im Ganzen so um die 1.000 Kilometer bis Lübeck, unserer Endstation, zurücklegen würden?
Es sprach sich sehr schnell herum, dass trotz aller Wunderwaffen, der Krieg verloren gehen würde beziehungsweise eigentlich schon verloren war. Wir hörten von den großen Städten und deren gewaltigen Bombardements mit unendlich vielen Toten und Verletzten.
Exkurs Anfang
Wenn ich mir heute, 2013, Bilder dieser damaligen Trümmerhaufen ansehe, dann die heutigen Städte besuche, fällt es mir schwer zu glauben, dass vor gut 65 Jahren große Teile dieser Städte in Schutt und Asche lagen. So war Köln bis zu 70% zerstört, Hamburg bis zu 54%, Kiel, Lübeck, Dresden und Bremen nicht minder. Es kommt mir wirklich wie ein Wunder vor, aber im Wiederaufbau des Landes haben die Deutschen große Dinge vollbracht. Ich lebe heute in Hamburg und empfinde diese Stadt als eine der schönsten Großstädte Deutschlands. Der Wille zum Aufbau nicht nur der Häuser, nein, auch der Infrastruktur und der Industrie nach dem verlorenen Krieg war den Deutschen nach den vergangenen dramatischen Jahren nicht verloren gegangen. Im Gegenteil: sie hatten wieder Hoffnung; Hoffnung auf ein besseres Leben, Hoffnung auf Freiheit, Hoffnung auf Frieden. Damals, in den Jahren nach dem Krieg, wurde der Begriff Deutsches Wirtschaftswunder erfunden und zu einem sehr positiven Begriff über die Deutschen weltweit bekannt, denn die Welt konnte miterleben, wie ein geschundenes, demoralisiertes Volk wieder auf die Beine kam und das Land wieder aufbaute. Mit einer Portion Sarkasmus unterlegt, könnte man den Wiederaufbau auch relativieren. Die Deutschen hatten eben im Laufe der Vergangenheit die nötigen Erfahrungen gesammelt, um den Wiederaufbau nach einem verlorenen Krieg zu organisieren. Ich bin überzeugt, dass der Rest der Welt den Deutschen einen gewissen Respekt zugestehen musste und dies auch wohl gerne, vielleicht aber auch nicht so gerne, tat. Ja, ich weiß — die Marschallhilfe. Die war gut und nötig, aber der Wille zum Wiederaufbau war mindestens genauso viel wert. Hinzu kam der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft: freies Unternehmertum, verbunden mit wirtschaftlicher Leistung und gesichertem sozialen Fortschritt. Auch bin ich ziemlich sicher, dass der Wiederaufbau nicht nur in Westdeutschland, sondern auch im übrigen Europa als ein starkes Bollwerk gegen die Sowjetunion entstehen sollte, um zu verhindern, dass sich der Kommunismus bis zum Ostatlantik ausbreiten konnte. Eine recht kluge Taktik der USA, um letzten Endes auch sich selbst zu schützen. Der sogenannte Kalte Krieg zwischen Ost und West entwickelte sich in den 50er-, 60er-, 70er- und 80er-Jahren zu einem recht sensiblen Verhältnis zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt und hätte sehr schnell ganz Europa wieder zu einem Schlachtfeld werden lassen können. Konstellationen für eine solche Entwicklung gab es genug. Die Ostzone (Ostdeutschland), später die DDR, blieb dabei allerdings auf der Strecke. Hier herrschte die Sowjetunion, wie in der Bundesrepublik die Alliierten (USA, Großbritannien, Frankreich). Nur mit einem großen Unterschied: In Westdeutschland wurde aufgebaut, in Ostdeutschland wurde abgebaut. Dort wurden die noch existierenden Fabrikanlagen demontiert und in die Sowjetunion abtransportiert, um dort wieder aufgebaut zu werden. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, verschwand in der UDSSR. Natürlich gab es in der DDR keine Marschallhilfe. Diese Umstände, gekoppelt mit dem Kommunismus, ließen die DDR bis zu ihrem Ende im November 1989 nie richtig aus ihrem Nachkriegselend herauskommen.
Exkurs Ende
Eine weitere große Pause machten wir in Zaren in Mecklenburg. Hier hatten Freunde ein schönes Gut. Ich glaube, man nannte diese gewaltigen Güter damals Rittergüter. Das Haus, nein, das Anwesen sehe ich heute immer noch in meinen Rückwärtsgedanken wie ein schlossähnliches, ehrwürdiges Gebäude, umgeben von einem riesigen Wald, der für uns Kinder natürlich unermessliche Gelegenheiten für die interessantesten Spiele bot. Ein wunderbarer See mit den verschiedensten Wasservögeln gehörte ebenfalls zu dem Gut. Es war ein Paradies. Auch unsere Freunde wollten Wertsachen im Wald vergraben, wobei wir so weit wie möglich helfen wollten. Ich kann mich erinnern, dass auch einige Kisten im See versenkt werden sollten.
Der Frühling 1945 war mittlerweile angebrochen, der See war wieder eisfrei, die Pflanzen und Bäume atmeten tief durch und entfalteten ihr Grün, so wie jedes Jahr. Der Waldboden und Eis tauten allmählich auf und so konnten unsere Freunde tatsächlich noch einige Wertsachen im See versenken und im Wald vergraben. Entsprechende Zeichnungen wurden angelegt. Es war recht spannend für uns Kinder.
Aber was half’s, wir zogen weiter. Also wurde nach einer schönen Zeit in Zaren wieder angespannt. Das nächste große Etappenziel sollte Lübeck sein. Auf unserer Fahrt dorthin, ich glaube, dass wir ungefähr vier Tage unterwegs waren, konnten wir immer wieder deutsche Soldaten mit ihren Fahrzeugen und Flakgeschützen beobachten, die, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, keinen allzu geordneten Eindruck mehr machten. Man konnte meinen, dass es nur noch ein einziges Ziel zu geben schien: Lass’ mich nur irgendwie mit dem Leben davonkommen. Hitler hat sich am 30.4.1945 erschossen, der Krieg ist so oder so verloren, das ist das Ende.
Kurz vor Selmsdorf, wenige Kilometer vor Lübeck, hörten wir in der Ferne Flugzeuglärm, der rasch näher kam. Ich erinnere mich noch sehr gut, die Landstraße trennte einen Fichtenwald. Dort parkte eine deutsche Militärkolonne. Mein Vater versuchte uns da irgendwie hindurchzubekommen. Dieses gelang leider nicht, wir blieben mitten in dieser Kolonne hängen. Was tun? Meine Eltern hatten gar keine Zeit, sich Gedanken zu machen, denn plötzlich flogen mehrere englische Tiefflieger über uns hinweg und feuerten aus allen Rohren. So nahe hatten wir den Krieg bis zu diesem Moment noch nicht erlebt. Meine Eltern nahmen uns Kinder unter die Arme und wir flüchteten in das Fichtenwäldchen. Unaufhörlich knatterten die Maschinengewehre und Bordkanonen. An deutsche Gegenwehr kann ich mich nicht erinnern, aber wahrscheinlich war ich noch zu klein, um das deutsche von dem englischen Geknalle zu unterscheiden.
Ungefähr nach 15 Minuten brach eine unheimliche Stille aus, allerdings immer wieder unterbrochen durch Kommandos der Soldaten und die Schreie der Verletzten. Der Angriff war vorbei. Unsere Familie, Paul, Frieda und die Biene waren nicht verletzt. Wir alle hatten Gott sei Dank den Angriff unverletzt und gesund überstanden.
Sehr langsam wagten wir uns wieder Schritt für Schritt zurück zu unserem Treck. Auf dem Weg dorthin kamen wir immer wieder an toten Soldaten, an schwer verletzten, jammernden und weinenden Jungen, zum Teil Kindern in Uniform vorbei. Es war grausam. Von Weitem sahen wir schon Flammen. Sie stammten von unserem Treck. Als wir näherkamen, konnten wir erkennen, dass der Mercedes lichterloh brannte, dass zwei von unseren vier Pferden tot und unser Treckwagen von mehreren Einschüssen gezeichnet war.
Besonders schlimm empfanden wir Kinder die toten Pferde. Unsere Eltern kümmerten sich um das brennende Auto mit den Wertsachen an Bord. Ich habe meinen Vater nie vorher, nie hinterher weinen sehen, doch bei diesem Anblick kamen ihm die Tränen. Aber er fasste sich schnell wieder und klaubte alles aus dem Auto, was er nur greifen konnte: Silber, Gold, Jagdgewehre, die Geldkassette und andere Wertsachen wurden gerettet, immer unter Lebensgefahr, denn ich vermute, dass mein Vater auch Munition mit eingeladen hatte. Aber vielleicht war diese auch schon explodiert, das weiß ich nicht mehr.
Die Jagdgewehre waren dahin, und mein Vater ließ sie dort liegen. Was sollte er auch anderes machen? Bei näherer Untersuchung der Geldkassette stellte mein Vater fest, dass diese nur noch Asche enthielt. Mit dieser Erkenntnis waren wir nun innerhalb von ein bis zwei Stunden auch finanziell total ruiniert. Dieser dramatische Tag war der 6. Mai 1945.
Exkurs Anfang
Am 7. Mai 1945 war der Krieg in Europa gottlob zu Ende. Deutschland kapitulierte bedingungslos. Dies war für die Deutsche Wehrmacht und überhaupt für das deutsche Volk ein recht unehrenhaftes Ende des Krieges, aber ich glaube, dass die Deutschen zum Teil auch diesen Krieg wenig ehrenhaft begonnen und geführt hatten. Der große Makel war und bleibt die Vernichtung ganzer Volksgruppen. Bis dahin waren die Deutschen für mich kultivierte und zivilisierte Menschen, aber der Holocaust ist unentschuldbar. Dass sich dann die ganze Welt von Deutschland abwendete und einige Staaten noch im letzten Moment den Krieg gegen uns erklärten, wundert mich nicht. Deutschland hatte es nicht anders verdient.
Kriege hat es leider immer gegeben, die Menschen haben sich nie vertragen und das wird wahrscheinlich auch nie anders werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen einen ehrenvolleren Waffenstillstand hätten erreichen können, wenn die Nazis nicht diesem Wahn verfallen wären, auf verbrecherische Art und Weise ganze Volksgruppen zu vernichten. Es ist ihnen nicht vollends gelungen. Millionen sind diesem systematischen Menschen-Vernichtungs-Wahnsinn zum Opfer gefallen. Man liest und hört immer wieder, dass es sich um sechs Millionen gehandelt hat. Nie wird man die wirkliche Zahl der Opfer korrekt wiedergeben können. Aber eins muss sich in die Hirne der kommenden Generationen für immer eingraben: Auch nur ein Opfer auf diese Art umgebracht, ist ohne Zweifel eines zu viel. Ein Staat, der solches tut, muss bestraft werden. Jedenfalls ist das meine unumstößliche Meinung. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass die Deutschen das Büßerhemd von Generation zu Generation Schritt für Schritt ablegen sollten. Die Generation von heute und morgen kann man nicht mehr zur Verantwortung ziehen und die folgenden Generationen schon gar nicht, denn nicht sie, sondern deren Eltern waren schuld, dass es soweit kommen konnte. Die Deutschen dürfen nicht vergessen und alle kommenden Generationen müssen wissen, welche Gräueltaten in Deutschland während der Nazizeit geschehen sind. Erinnern: Ja. — Zur Verantwortung ziehen: Nein.
Exkurs Ende
Ich habe in Erinnerung, dass wir am nächsten Tag mit unserem Treck, der nach dem Desaster des Vortages nur noch aus dem Leiterwagen und zwei Pferden bestand, Richtung Lübeck weiterzogen. Dort kamen wir am nächsten Tag an. Mein Vater hatte vor durch Lübeck zu fahren, um dann, warum weiß ich nicht, weiter nach Kassel zu ziehen. Dieses gelang nicht, denn die einzige Brücke, eine Hubbrücke, war nach oben gezogen und von englischen Soldaten bewacht. Es war kein Weiterkommen möglich. Es wurde ganz einfach durch die Engländer verboten, weiter nach Westen beziehungsweise nach Süden zu ziehen. Also warteten wir vor der Brücke, in der Hoffnung, dass die Durchfahrt irgendwann wieder freigegeben würde. Dieses fand erst einmal nicht statt.
Ab dem Tag wurde die Stadt für die Siegermächte — das weiß ich nicht mehr so ganz genau — aber ganz bestimmt auch für die polnischen und russischen Zwangsarbeiter und wahrscheinlich auch noch für andere Gruppen zum Plündern freigegeben. Für uns spielte es sich wie folgt ab: Wir standen also in unserer Warteposition, sehr dicht vor einem alten Hafenschuppen, den es 2008 immer noch gab. Da erschien eine Gruppe von fünf bis sechs ziemlich betrunkenen Polen, gerade in der Lage Fahrrad zu fahren. Sie hatten mehrere Fahrräder dabei und fuhren nun geradeaus auf den Schuppen los, bis sie dagegen krachten und die Vorderräder sich verbogen. Sie johlten und lachten und hatten einen Riesenspaß. Ich kann das heute verstehen, war doch ihr, ich möchte fast sagen, Sklavendasein zu Ende. Nun kamen die vor Freude und Alkohol taumelnden Herren zu unserem Wagen und wollten sich dessen bemächtigen. Ich