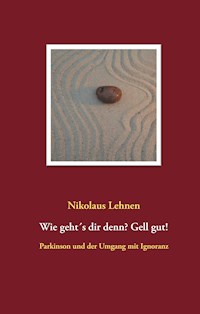Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eingefroren (wegen Morbus Parkinson): Das Rasierwerkzeug in meiner zitternden Hand nähert sich bedrohlich meinem Gesicht. Und kurz bevor sich die scharfe Klinge in meiner Haut verhakt, verharre ich unbeweglich vor dem Spiegel. In dem aufsteigenden Wasserdampf, der sich wie Raureif auf dem Spiegel niederschlägt, sehe ich meine Kindheit, meine Jugendzeit und meine Erwachsenenzeit. Und ich erkenne mein Segelschiff, ein Zufluchtsort, um der Strenge der Erzieher zu widerstehen, Prüfungen zu durchstehen und bedrohliche Ereignisse zu überstehen. Inmitten eines Meeres unter südlicher Sonne kommt eine Eiszeit über mich und mein Schiff. Dann nimmt mich das Licht eines Leuchtfeuers in seinen Bann... Bann, das Nest, wo meine Wiege stand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Es war ein nebelverhangener Februarmorgen des Jahres 2010. Mein Hausarzt, besorgt über das unkontrollierbare Zittern meiner linken Körperhälfte, hatte mich an einen hiesigen Neurologen überwiesen. Eigentlich hatte ich keinen Grund, besonders beunruhigt zu sein. Ich kannte das Zittern von meiner Mutter. Aber da war sie schon im hohen Alter, als man bei ihr einen nicht näher beschriebenen essentiellen Tremor diagnostizierte. Na ja, dachte ich, wird wohl nicht so schlimm sein; das Zittern bei ihr kam oft unverhofft und es verschwand meistens so schnell, wie es aufgetreten war. Halb so wild also. Sicherlich ist die große Anspannung der Auslöser für mein unbremsbares Herumflattern an diesem Morgen. Daran knüpfte ich meine Hoffnung.
Der Neurologe untersuchte mich auf eine Weise, wie ich eine medizinische Untersuchung nie zuvor erlebt hatte. Er bat mich, die Hände über meinen Kopf zu heben, und zwar so, dass sich meine beiden Handrücken berührten. Dann musste ich meine Hände hin- und herdrehen – er nannte dies den „Glühbirneneindrehgriff“. Und ich spürte stechende Schmerzen in meinen Handgelenken bei dieser Übung. Dann ließ er mich mit dem Daumen den Zeigefinger berühren. Dabei handelt es sich um den Pinzettengriff. Aber weder meine Fingerkuppen noch meine Fingerspitzen konnten sich berühren. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich schon seit einiger Zeit extrem lästige Probleme beim Ergreifen von kleinen Münzen – dem Wechselgeld – an Supermarktkassen verspürte. Der Neurologe arbeitete eine Reihe von Untersuchungen routinemäßig ab. Gegen Ende der Prozedur bat er mich, ein paar Schritte zu gehen. Dabei kam es zu meiner Überraschung gar nicht darauf an, ob ich schnell oder langsam, geradeaus oder im Zickzack ging. Er beobachtete meine Arme, während ich in seinem Behandlungszimmer hin- und herging, und notierte: Linker Arm schwingt beim Gehen nicht mit. Es folgte eine Reihe weiterer Tests mit dem Ergenbis einer wenig efreulichen Diagnose: Morbus Parkinson.
Seit dieser Erstdiagnose sind fast sechs Jahre vergangen. Die Symptome unterliegen einer sehr starken Schwankung und verbessern oder verschlechtern sich je nach medikamentöser Behandlung. Heute weiß ich, welche Substanzen eine gute Wirkung zeigen, obgleich sie stetig in ihrer Dosis erhöht werden. Ich habe aber auch erfahren müssen, welche Substanzen eine verheerende Wirkung mit schlimmen Nebenwirkungen bei mir auslösen. Erstaunlicherweise reagiert fast jeder Mensch, der an Parkinson erkrankt ist, unterschiedlich auf die verschriebenen Medikamente. In vielen Gesprächen mit anderen Erkrankten durfte ich erfahren, dass manche Menschen hervorragende Ergebnisse verzeichnen konnten, während andere, so wie auch ich, mit dem gleichen Wirkstoff beinahe vom Leben in den Tod befördert wurden. Spätestens nach solch irritierenden Erlebnissen wird man hellhörig und liest die Medikamenten-Beipackzettel sehr intensiv, hinterfragt, wägt ab und tauscht Erfahrungen aus.
Heute weiß ich, dass eine Ursache, an Parkinson zu erkranken, der unwiderrufliche Untergang der „Substantia Nigra“ ist, eines Kernkomplexes ganz oben im Mittelhirn, der durch einen hohen Gehalt an Melanin und Eisen dunkel gefärbt erscheint. Ein Ausfall oder auch ein Untergang des dopaminergen Systems führt zum Wegfall der Hemmung anderer Bestandteile des Schaltkreises und damit zu dem Symptom des Morbus Parkinson.
Bei mir verdächtige ich den langsamen Abbau meines Dopamin produzierenden Systems. Noch nie zuvor habe ich jemals über diese Erkrankung etwas gehört und so kam es, dass ich völlig ahnungslos beim ersten Aufsuchen eines Neurologen zum allerersten Mal von diesem – für geregelte Bewegungsabläufe so unendlich wichtigen – Organ namens Substantia Nigra etwas erfuhr. Die Neuigkeiten waren verwirrend. Die medizinischen Ausdrücke waren mir völlig fremd und die von dem Arzt behutsam überbrachte Diagnose erschreckte mich sehr. Langsam begriff ich, dass ganz plötzlich ein immer gegenwärtiger Lehrmeister die Herrschaft über mich an sich gerissen hat, der meine Bewegungen beherrscht, der entscheidet, wie ich mich zu bewegen habe und wann ich mich überhaupt nicht zu bewegen habe. „Herr Parkinson“ ist sehr streng. Er weckt mich auf, wenn ich endlich durchschlafen möchte nach ewig langer durchwachter Nacht. Wenn er will, lässt er meine Beine wild um sich treten und meine Arme ziellos um sich schlagen.
Und oft zeigt mir mein gnadenloser Begleiter, was geht und was nicht. Er hat die völlige Kontrolle über meine Mobilität, meine Befindlichkeiten und über meine Verhaltensweisen übernommen und beherrscht zunehmend meine Gefühlswelt. Jetzt glaube ich die Tücken und die Bösartigkeiten des „Herrn Parkinson“ erkannt zu haben und wage mich mit diesem Buch auf einen Segeltörn durch die Gezeiten meiner Kindheit, meiner Jugend und meines Erwachsenenalters. Ich wähle mir dafür ein Schiff als Metapher, das Ebbe und Flut, Sturm und Flaute, Angst und Mut, Hoffnungslosigkeit und Hoffnung in einem fiktiven Logbuch festhält, um die einzelnen Stationen meines bisherigen Lebens anzupeilen.
Für Maria, Kerstin, Carolin, Michael, Jeffrey, Nils, Marie, Noah und Julian
Michael, danke für Deine kreative Bildgestaltung.
Ingrid, Dir danke ich ganz besonders für Deine geduldige Korrekturarbeit und Beratung.
Allen Freunden vielen lieben Dank für Euren mutmachenden Zuspruch, ohne den dieses Buch niemals zustande gekommen wäre.
INHALT
Spiegelbild
Stalldunst
Logbucheintrag
Der Trucker
Herren und Knechte
Logbucheintrag
Lausbuben
Kalter Krieg
Sommerwind
Der Marschbefehl
Logbucheintrag
Der Schleifer
Ausgemustert
Auf dem Vulkan
Logbucheintrag
Junge Familie
Logbucheintrag
Die Metamorphose
Ikarus
Ziemlich tolle Freunde
Der Wert der Arbeit
Das Millenium
Logbucheintrag
Flaschenpost
Der Terminator
Logbucheintrag
Flaschenpost
Logbucheintrag
Flaschenpost
Einleitung
Meine Geschichte ist ein Rückblick auf meine Kindheit, Jugend- und Erwachsenenzeit, die immer wieder, eigentlich seit ich lesen kann, sehr stark beeinflusst war von Seefahrern und deren abenteuerlichen Entdeckungen, aber auch von ihren Irrfahrten durch unerforschte Wasserwüsten und unbekannte Inselwelten.
Sie nimmt den Leser als Besatzungsmitglied an Bord meines Seglers „James P. Rigor“ mit auf Törns durch ein Meer gewaltiger Stürme mit monsterhaften Brechern, die alles von Menschen Erschaffene vernichtend zerschmettern und in Stücke zerbersten lassen.
Die Geschichte führt durch Ozeane voller Gefühle, deren Abgründe und endlose Tiefen alles in ihren schrecklichen Sog einsaugen und jegliches Auftauchen aus bodenlosem Abgrund vereiteln.
Dann wieder wähne ich mich wonnig im warmen Sand liegend, entspannt auf heißer weißer Düne am einsamen Strand, von schattenspendenden Palmen gesäumt. Und ich lese das Lied von Odysseus, dem mächtigen Herrscher von Ithaka und Bezwinger Trojas. Mit tiefer Freude und Zufriedenheit verschlinge ich die Verse Homers, in denen er kundig die mutigen Taten des Odysseus besingt.
Ich ahne die Qualen der Seefahrer, dem verführerischen Gesang der Sirenen zu widerstehen und den Freuden der hemmungslosen Lust zu entsagen. Den schwachen Freunden hatte Odysseus mit Wachs das Gehör versiegelt und so vernahm keiner der Getreuen den flehenden Ruf der Nymphen. Und sie verspürten nicht das Verlangen nach körperlichen Wonnen und die unselige Gier nach Schätzen und Reichtum. Sie wurden verschont. Odysseus aber verzichtete auf das taubmachende Wachs und ließ sich an den Mast seines Schiffes binden, um den verführerischen Gesang der Sirenen vernehmen zu können, der viele Seefahrer schon angelockt und ins Verderben gestürzt hatte.
Dann spüre ich den Drang nach Seelenfrieden und Freiheit und den Zwang, mein Wissen über die Befindlichkeiten von Menschen zu vertiefen.
Spiegelbild
Mein Blick heute Morgen in den Rasierspiegel gibt mir zu denken. Was ich sehe, ist eine ziemlich zerklüftete Landschaft mit kargem Bewuchs und ausgedörrtem Gestrüpp unterhalb meiner Nase. Eine ausgetrocknete Gegend, von gelegentlichen Niederschlägen heimgesucht. Die herbeigesehnte Regendusche verdunstet schnell. Der aus der Landschaft aufsteigende Nebel macht meine Brille beschlagen. Zwischen meinen Augenbrauen tun sich tiefe Furchen auf. Sie gleichen geologischen Verwerfungen. Ein Erdzeitalter, das sich in meinem Gesicht widerspiegelt. Aber was ich erblicke, ist ein Trugbild. Alles erscheint seitenverkehrt. Mein fragender Blick in die diesigen Tiefen des Spiegels bleibt unbeantwortet.
Genauso gut könnte ich in einen tiefen, ausgetrockneten Brunnenschacht schauen. Kein Mond und kein einziger Stern würden aus dem verkrusteten Schlamm im tiefen Brunnenschacht flimmernd ihre Gegenwart am nächtlichen Himmel verraten. Das eingefangene Licht ist erloschen. Die Sonne hat sich das Wasser eingefordert und ihr am Himmel gleißendes Licht ist ebenfalls im ausgetrockneten Schlamm erstickt. Der Brunnenboden gibt keine Antworten; es ist ein blinder Brunnen, der den hinabfallenden Kiesel nicht ahnt. Nur der Aufschlag des Steines bestätigt, kaum vernehmbar, seine Ankunft. Doch ein widerhallendes „Plop“, das von dem Dürstenden sehnsuchtsvoll erhoffte Zeichen für frisches Quellwasser einer rettenden Oase, bleibt aus.
Mein zitterndes Spiegelbild gleicht den zitternden Bewegungen eines Seismografen. Das Beben nimmt kein Ende. Nichts kann den Tremor meiner Hände beruhigen. Das Rasierzeug bleibt unbenutzt. Der üblicherweise notwendige Alaunstift als Blutstiller auch.
Mein Blick heftet sich an den Blick meines Gegenübers und so verharren wir lange regungslos.
Meine Gedanken gehen auf Wanderschaft in längst vergangene Zeiten und zweifellos träume ich einen wiederkehrenden Tagtraum.
Stalldunst
Und wieder brüte ich als zwölfjähriger Junge, brav, so wie man es von mir verlangt, über meinen lästigen und äußerst widerwärtigen Hausaufgaben. Das sind quälende Latein-Deklinationstabellen, Übersetzungen und tückische Algebra-Logarithmen. Die wiederholt vor der gesamten Schulklasse vorgetragenen Drohungen der liebenswert schrulligen Lateinlehrerin schallen nachhaltig in meinen Ohren und bohren sich tief in meine Hirnwindungen ein: „Ich sehe schwarz für dich!“ Diese warnende und sicher gut gemeinte Verkündung soll mich aus meiner Lern-Lethargie herausreißen und mich auf den Pfad des schulischen Ehrgeizes bringen. Ich aber habe eine große Abneigung gegen „ehrgeizig sein“, also baue ich eine Wand des Widerstands auf. Eine feste, unüberwindbare Barriere gegen das Wesen des rücksichtslosen Strebertums. Das ist nämlich meine Auslegung dieser für mich äußerst verabscheuungswürdigen Auffassung von eifrigem Lernwillen. Einige andere Schüler aus meinem Jahrgang legen einen Lerneifer vor, der, da bin ich mir ganz sicher, den Eifer und Ehrgeiz ihrer Eltern widerspiegelt. Ich sehe in ihnen „bedauernswerte Geschöpfe“, dem Ansehen der Familie geopfert. Die Verkündung der Lehrerin wird zur Verkündigung, diese zur Verheißung. Ihre unheilvolle Verheißung aber wird zum schrecklichen Credo meiner arbeitsgeplagten Mutter. Sie sorgt sich sehr und hat Angst um meine Zukunft. Sie sah sich stets als „chancenlos, etwas aus sich zu machen“. Es war ihre Passion bis zu ihrem letzten Atemzug, mich zu dem machen zu wollen, was ihr verwehrt blieb – nämlich zu einem Lehrer. Und ihre Litanei ergießt sich gleich einem nimmer versiegenden Wasserfall über mich:
„Bub, lern, sonst wirst du mit Schippe und Hacke im Graben arbeiten müssen! Willst du das?“
Für sie war die Vorstellung, mich mit Schippe und Hacke in schweren Arbeitsklamotten und Gummistiefeln in einem Graben schuften zu sehen, geradezu grauenvoll.
„Was werden die Nachbarn sagen? Und erst die Verwandtschaft! Mein Gott, diese Schande! Was tust du mir an? Mit was habe ich diese Schmach verdient?“
Sie hätte lieber sterben wollen, als „so etwas“ zu erleben. Und ich wäre einer der Sargnägel gewesen, der an ihrem Leid mit Schuld trüge.
Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, was an der Tätigkeit eines Bauarbeiters, Waldarbeiters oder Gleisbauarbeiters derart schändlich und abscheulich ist, dass allein die Vorstellung, einen Arbeiter als Sohn zu haben, zur kollektiven Scham der gesamten Familie hochstilisiert wird. Klar, sie will nur mein Bestes, und zweifellos meint sie es gut mit mir.
Ich aber sitze an dem mit einem Wachstuch bedeckten Küchentisch, der beladen ist mit einer höllisch lärmenden Milchzentrifuge, fettigem Melkgeschirr und übervollen Rahmtöpfen. Dazwischen meine Vokabelhefte; und ich hantiere mit Schreibzeug und Radiergummi. Selbstverständlich gebe ich, wie immer, mein Bestes. Wenigstens bilde ich mir das ein! Denn es hat keinen Zweck, wiederholt die alten Vokabeln aufzusagen, die ich längst auswendig aus dem Effeff nur so herunterrattern kann. Halbe Leistung ist ein Zeichen von Faulheit oder auch Unlust. Beide Verhaltensweisen sind in unserem Hause nicht geduldet. Die Eltern, auch die Großeltern, so sie im gleichen Haushalt leben, sind strenge Erzieher und wir, die Kinder, deren widerborstiger, aber ganz und gar zweckloser Widerstand gebrochen werden muss, um uns zu „anständigen“ Menschen zurechtzubiegen, sind zwar die Gedemütigten, aber wir verstehen ihre Motive, uns gleichzuschalten, gut, so wie sie selbst von ihren Eltern und anderern Autoritäten geformt und verbogen worden sind, um dem Menschenbild des voranschreitenden Nationalsozialismus zu entsprechen. Die abverlangten Leistungen gleichen denen der Erwachsenen. Fehler werden nicht verziehen und hier darf nichts verkommen. Denn wer etwas verkommen lässt, ist selbst schon eine „verkommene Kreatur“. Nein, Fehler werden nicht verziehen. Jede Aufgabe, jede Arbeit unterliegt dem Ziel der Vollkommenheit und der absolut vollkommenen Vollendung. Die Urteile sind hart. Was falsch ist, bestimmen die Erwachsenen. „Es war schon immer so und so bleibt es auch. Basta!“ Diese Haltung der Eltern stört mich und schon früh regt sich in mir Widerstand gegen diese Machtausübung über mich. Ich entwickle Strategien, wie ich meinen eigenen Willen durchsetzen kann, indem ich zwar die aufgetragenen Aufgaben meistens zufriedenstellend erledige, aber mit meinen eigenen Methoden. Die eingeforderten Ergebnisse und Resultate zu liefern, gelingt mir aber leider nicht immer. So führt die Handhabung von landwirtschaftlichem Gerät oft zu völlig desaströsen Ergebnissen. Wenn ich die Sense zum wiederholten Male stumpf statt scharf gedengelt habe und sich deswegen das Gras wegduckt, also sich nicht schneiden lässt und ich auch noch zu allem Überfluss die Spitze des Sensenblattes in den Boden ramme und dabei der Holzschaft des Sensenwurfs zersplittert…, dann Gnade mir Gott! Flucht aus dem Acker oder aus der Heuwiese macht überhaupt keinen Sinn! Am Abend wird der Schuldspruch über meine Unfähigkeiten und Schandtaten urteilend über mich kommen und über mich richten. Die väterliche Strenge ähnelt einem apokalyptischen Bergrutsch, einem Alptraum gleich. In solchen Momenten wird mir die Strenge meines Vaters offenbart und ich verstehe seine Wesensart. Seine Jugend war bestimmt von herrischen Befehlen und Anordnungen, denen er sich als Melker-Lehrling auf einem landwirtschaftlichen Rittergut „derer von Jeinsen“ zu unterwerfen hatte. Trotz der auf dem Rittergut herrschenden Strenge war er zeitlebens stolz auf seine dort verbrachte Zeit und der Beruf als „Schweizer“ erfüllte ihn mit großer Genugtuung. Er übernahm auch gewisse Wesensmerkmale seiner Meister und Herren. Er lernte viel, er sammelte Erfahrung und auch die Fähigkeit, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Er bewies Überlegenheit und stolze Erhabenheit gegenüber Anfeindungen. Eine gelungene Adaption. Entweder du bist Herr oder du bist Knecht, entweder Herrin oder Magd.
Da ich nicht Herr sein kann, bin ich also Knecht.
„Kind sein“ wird nicht geduldet.
Das kindliche Dasein wird beherrscht und gelenkt von sorgenvollen Ermahnungen, knappen Anweisungen, strengen Befehlen und gefährlichen Drohungen, wobei ich die Ermahnung meistens, aber nicht immer als „sorgenvoll“ und mit einer „ängstlichen Vorahnung“ meines künftigen totalen Scheiterns empfinde. Ich aber wehre mich gegen diese aussichtslose Perspektive und versuche alles für mich Mögliche, den bedrohlichen Vorhersagen meiner Erzieher zu widersprechen, um ihnen mit meinen Talenten das Gegenteil ihrer Weissagungen zu beweisen. Also ist es Pflicht, die aufgetragenen Arbeiten nicht nur gerne, sondern auch sofort und vor allem sorgfältig zu verrichten. Gelingt das, dann kommt verhaltenes Lob. Nicht gerade überschwänglich, aber gerade so viel, dass ich den Stolz meiner Eltern über die Leistung von uns Kindern erkenne. Zuviel Lob verderbe den Charakter, sagen sie. Da werden wenig Worte gemacht und doch sind die verhaltenen Gesten der Anerkennung zu erkennen.
„Der trägt mir schon einen Zentner Frucht auf den Speicher.“ Oder: „Du müsstest mal sehen, wie der mir den vollen Kartoffelsack auf die Schulter wirft. Der kann das!“
Diese meine Leistungen anerkennenden Worte und Gesten müssen genügen. Die Wohlgefälligkeit dieser Worte jedoch bezieht sich nicht immer auf meine vollbrachte Glanztat, sondern auf die Resultate der strengen Erziehung und untermauert die Fähigkeiten des „Herrn“ und Erziehers und keineswegs die Leistung des „Knechtes“ und Zöglings. So ist mein kindliches Empfinden. Ich bin angespannt und oftmals furchtsam ob der Unberechenbarkeit und der empfundenen Ungerechtigkeiten der Erwachsenen in meinem Umfeld, aber ich habe auch meine Tricks, die mir helfen, die strengen Erwachsenen zu überlisten. Denn ich darf ihnen nicht trauen; davon bin ich überzeugt. Dann träume ich mit offenen Augen meinen Abenteuern entgegen und entfliehe dem häuslichen Treiben.
Gedämpftes Kettenrasseln aus unserem Kuhstall lässt mich aufhorchen; das Melken der Kühe ist beendet. Das Vieh legt sich schwerfällig, mit den Vorderbeinen einknickend, nieder ins frische Stroh, um genüsslich das tagsüber aufgenommene Futter und den in ihrem Pansen vorverdauten Nahrungsbrei nun in Ruhe hochzuwürgen und nochmals zu zerkauen. Danach werden sie die zerkleinerte Nahrung erneut verschlucken und der eigentlichen Verdauung zuführen. Sie käuen wieder und genießen die Ruhe im Stall. Ihr Stoffwechsel ist gut und das Ergebnis ihrer Verdauung ist unmissverständlich vernehmbar. Das Brodeln und Zischen in ihren Bäuchen entlädt sich dann in geräuschvollen, nach Methangas duftenden, warmen Winden; und das beruhigt den Bauern sehr. Oh ja, er freut sich über jeden Furz seiner Tiere. Ein schlechter Stoffwechsel führt zur Aufblähung des Kuhpansens; die einzige Rettung ist ein Überdruckventil, das durch die Bauchdecke direkt in den Pansen gestoßen wird, damit das unter Überdruck stehende Verdauungsgas entweichen kann. Dann wird es zischen und spritzen, dass die Wände des Stalls von grünem Brei nur so triefen. Die Kuh ist gerettet. Die unerträgliche Anspannung weicht aus den ängstlichen Gesichtern der Anwesenden. Die Sorge, eine Kuh zu verlieren, ist gebannt; jetzt wird der Schuldige ermittelt werden. Der Tierarzt erkennt an der grünen, von der Wand triefenden Pampe, dass taufrischer Klee die Ursache der Blähung war. Mein zaghafter Versuch, den Ausbruch meiner Herde in ein Kleefeld nahe unserer Grasweide zu verleugnen, scheitert erbärmlich. Die Anwesenheit des Tierarztes mildert den Zorn des Vaters; seine Beschimpfungen halten sich in Grenzen.
Gleich werde ich abgehört werden und die gelernten Vokabeln aufsagen müssen. Die Tortur beginnt. Die Bedrohung ist auf ihrem Weg:
„Kannst du alles? Kann ich dich abhören?“
„Ja, es geht, doch, ich glaub schon, dass ich´s kann“, erwidere ich etwas unsicher, aber mit der Hoffnung, dass es wieder mal zur Zufriedenheit meiner Mutter klappen wird.
Der Lärm der Milchzentrifuge auf dem Küchentisch ist ohrenbetäubend und nervtötend.
Dazwischen die kaum vernehmbaren Wortfetzen meiner Mutter beim Abhören meiner Vokabeln.
„Warum sind deine Hausaufgaben noch nicht fertig? Hast du wieder mal geträumt? Hast du für deine Klavierstunde genug geübt?“
Die Fragen nehmen kein Ende. Und ich habe keine Antworten. Nein, im Gegensatz zu dem Tagesablauf unserer Kühe ist dieser Tag für mich noch nicht zu Ende. Es wird, wie meistens, spät werden. Frisches Stroh muss noch in den Stall, um es am Morgen nach dem Ausmisten dem Vieh unterzustreuen. Ebenso ist noch frisches Heu für die morgendliche Fütterung vorzubereiten. Dann ist endlich auch der Feierabend für die Menschen da.
Jetzt kann ich noch etwas in meine Bücher schauen, in der Hoffnung, dass ich das, was ich jetzt noch lerne, auch morgen noch weiß. Nach spätestens sechs Stunden werde ich geweckt, denn ich muss mit hinaus auf den Acker und Mais aufladen. Das Vieh braucht Grünfutter. Es ist noch dunkel und der Mais ist von einer dünnen Raureifschicht überzogen und eiskalt. Die Haut meiner Hände wird von dem ätzenden Saft der Maisstrünke aufgerissen und als Hautfetzen eingefordert. Wer jemals Bündel von geschnittenen Maisstangen aufsammeln und verladen musste, der weiß von den messerscharfen Blatträndern und den blutenden Schnittwunden an seinen Händen zu erzählen. Endlich ist die Fuhre daheim im Hof. Etwas Melkfett, von Mutter auf die wunden Finger geschmiert, lindert den Schmerz. Am östlichen Himmel erscheint schwaches Morgenlicht, es dämmert. Bald muss ich zur Schule. Jetzt noch mal kurz in die Vokabeln geschaut, während ich mein Frühstücksbrot verzehre.
Dann schweift mein Blick weg von den Schulsachen. Und meine angstvoll befrachteten Gedanken segeln wieder fort an den imaginären Ort meiner Zuflucht: mein Schiff auf hoher See.
Und ich blicke aus dem Küchenfenster, hinaus auf die Felder gleich hinter unserem Haus. Wogendes, saftiges Gras auf bald zu mähenden Wiesen glitzert in der Morgensonne. Etwas weiter entfernt liegt einer unserer Äcker, beladen mit kleinwüchsiger Wintergerste, deren Fruchtbeutel gelbliche Wolken von Blütenstaub über die sich im leisen Frühsommerwind wiegenden Halme und Ähren verbreiten. An einigen Stellen hat der fast immerwährende Westwind, der sich manchmal zum Sturm erhebt, die Halme schon niedergedrückt. Aber Ihre Staubbeutel leeren sich und die vom Wind verwehten Pollen erfüllen ihre einzig für sie bestimmte Aufgabe: Sie befruchten die Narben der Fruchtstände. Dem scheinbar tauben Korn wird Leben eingehaucht und prachtvolles Getreide gedeiht und wächst auf dem kargen Boden.
Dass das Getreide trotz der mageren Böden so schön und voll auf dem Halm steht, hat eine Ursache: „Dem Ackergrund muss nachgeholfen werden, er ist zu mager!“, sagen sie, und wir, mein Vater und ich, mischen in einer Ecke unserer Scheune Tonnen von neuartigen künstlichen Düngemitteln. Man benutzt dafür die für meine Begriffe etwas seltsame Bezeichnung „Kunstdünger“. Was ist Kunst am künstlichen Dünger? Stickstoff, Phosphat, Kalium, Schwefel, Calcium, Magnesium, Ammoniak, Superphosphat, Doppelsuperphosphat und Triplesuperphosphat, Ammoniumnitrat und viele weitere organische und anorganische Verbindungen! Die hochgiftigen Stäube der Wachstumsbeschleuniger gemischt mit den noch um ein Vielfaches giftigeren Stäuben der Unkrautvernichtungsmittel – man nennt sie Pflanzenschutzmittel – verstopfen mir die Nase und verkleben meine Bronchien. Übelkeit und schmerzende Hustenanfälle bis zum Erbrechen sind die unausbleiblichen Folgen. Auf den Tüten sind Warnhinweise zu lesen, und aufgedruckte Totenkopfsymbole signalisieren die Gefährlichkeit der Inhalte. Trotzdem sorgen wir uns nicht um unsere Gesundheit; der Einsatz und das Einbringen der Düngemittel in die Erde haben Vorrang.
„Wie gefährlich ist das Zeug denn, kann man davon sterben?“ So frage ich immer wieder, denn mir machen der Aufdruck auf den Düngertüten und der beißende, stechende Geruch Angst.
„Mach´ dir keine Sorgen, wir schlucken das Pulver ja nicht. Schaufle weiter und pass auf, dass es keine Klumpen gibt.“
Beim Einfüllen des nun gemischten Kunstdüngers in die vorher entleerten Tüten gleicht der Innenraum der Scheune einer Staubhöhle. Ich versuche meinen Atem anzuhalten, um so wenig wie möglich von dem Staubgemisch zu inhalieren. Irgendwann muss ich aber weiteratmen und der ätzende Staub verbrennt mir die Nasenschleimhaut. Aber es gibt kein Entrinnen; das wertvolle Düngergemisch muss in die Tüten. Wehe dem Bauern, Gärtner oder Landschaftspfleger, der bei dieser grauenvollen Arbeit keine Schutzmaske anlegt und dann seine verstopfte und ausgetrocknete Kehle mit einem Bier labt! So mancher rechtschaffene Mann hat wegen seiner Sorglosigkeit dabei sein allerletztes Bier genossen. „Der hätte halt nichts trinken dürfen, vor allem keinen Alkohol. Ist selber schuld.“
Also binden wir uns ein Taschentuch über Mund und Nase oder ziehen uns die um den Hals gebundenen Schweißtücher etwas höher, sodass Mund und Nase zumindest ein wenig vor dem giftigen Gemisch geschützt sind. Das geht so lange gut, bis das schützende Tuch vom feuchten Atem und dem am Tuch haftenden Düngerstaub völlig verkrustet ist. Dann muss es weg, weil man ansonsten keine Atemluft mehr bekommt; und du ziehst mit tiefen Zügen den schweren, hochgiftigen Staub in deine Lunge. Wir wissen nicht, dass unsere Lungen das Zeug nie wieder freigeben können. Einmal drin, wird es für immer gebunkert. Schwere Hustenanfälle vermögen es nicht, den Dreck auszuwerfen. Man hört, dass sich schmerzende Stiche in der Lunge und Schwindelanfälle bei der ländlichen Bevölkerung und besonders bei den Bauern häufen. Kritische Meinungen über die Anwendung und den Einsatz von künstlichem Dünger sind selten zu vernehmen und der „Eisenbahn-Landwirt“, eine Fachzeitschrift des Eisenbahn-Sozialverbandes, preist den Einsatz von Dünger, um die Erträge zu steigern. Von sogenannten gartenverträglichen Pflanzenschutzmitteln oder gar mechanischer Schädlingsabwehr ist noch lange nicht die Rede und wird erst einige Dekaden später durch ein neues Umweltbewusstsein, nicht zuletzt angestachelt durch schockierende audiovisuelle Berichte über nie dagewesene Krankheiten und Missbildungen bei Mensch und Tier, in das Bewusstsein der Menschen rücken. Jetzt aber gilt es, die Erträge zu steigern, ohne Rücksicht auf eventuelle noch unbekannte Gefahren für die Gesundheit. Die Bevölkerung wächst stetig und der Bedarf an Nahrungsmitteln ist groß.
Meinungsverschiedenheiten und die daraus folgenden Wortgeplänkel über die – nach der festen Überzeugung meines Vaters – mehr oder weniger guten Fähigkeiten einiger einheimischer Bauern machen ihn nicht bei allen beliebt in unserem Dorf, und manch böswilliger Scherz wird ausgeheckt, um ihn seiner auswärtigen Herkunft wegen zu diffamieren. Er weiß sich zu wehren und seine Titulierungen sind wenig schmeichelhaft, doch oft nicht völlig unzutreffend. Er ist kein Schmeichler, beansprucht das Recht des Wissenden und duldet keinen Widerspruch. Selten nur kann man ihn von einer gegenteiligen Meinung überzeugen. Da muss es schon ein Vertreter der Obrigkeit sein. Die wenigsten Einheimischen haben, zumindest zu jener Zeit, die geringste Ahnung von der Heimat meines Vaters, der Vulkaneifel. Sie kennen weder die demografische noch die ökologische und ökonomische Struktur dieser Region unseres Landes. Die wenigsten wissen, dass die Eifel schon in den frühen Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts einen touristischen Aufschwung erlebt hat. Rheinländer lieben es, an den Vulkanseen, den Maaren – auch als „Augen der Eifel“ bezeichnet ihre Wochenenden zu verbringen. Sie lieben die sagenumwobenen Burgen und reden stolz von den längst untergegangenen Kreuzrittern und deren zweifelhaft ruhmreichen Taten im Namen des Christentums. Und sie sind stolz auf ihren „Nürburgring“. Er ist ein Magnet für Liebhaber des Motor-Rennsports und sie lassen ihr Geld in den Hotels und Gaststätten der Gegend um die Rennstrecke. Das Tal der Ahr im nördlichen Bereich der Eifel birgt unschätzbare Reichtümer in seinen Kellern und die Rotweinlagen in den Steilhängen erfordern alpine Kletterkünste von den Winzern.
Die meisten Menschen der Westpfalz waren schon immer sesshafte und ortsgebundene Handwerker oder Monteure, die ihren Lebensunterhalt für ihre Familien im nahen Saarland teils unter damaliger französischer Okkupation oder in der Rheinebene verdienten. Oder sie waren ehrbare, stolze Bauern mit eigenen, aber durch Erbteilung immer kleiner werdenden Anbauflächen. Gar mancher sah sich durch anhaltende Kriege und Elend gezwungen auszuwandern. Es ist ein stolzes, aber wenig weltoffenes, zuweilen sogar weltfremdes Volk, denn die Bauern können ihrer Scholle niemals entfliehen und oft endet ihr Horizont an den Gemarkungsgrenzen ihres Heimatdorfes, in dem sie leben und arbeiten, oder in den umliegenden Orten – der Liebsten wegen. Wie könnten sie jemals für einen Tag nur ihre bäuerliche Arbeit und Verantwortung für ihr Vieh vernachlässigen? Bist du Bauer, hast du am Abend dein Vieh zu versorgen und deine Kühe zu melken! Ein Schinder, der das Vieh mit vollen Eutern vor Schmerz brüllen lässt!
Sie sind Bergarbeiter oder Stahlkocher, entreißen dem Berg die Kohle, schmelzen Erz und formen Gusseisen. Das Land ist im Aufschwung und die Wirtschaft floriert. Die Stahlbarone benötigen Rohstoffe, und die Autos verlassen im Minutentakt die Produktionshallen. Technische Revolution soll die harte Arbeit der Menschen erleichtern, aber oft, viel zu oft, ersetzt eine Maschine den Menschen. Man stellt den Menschen frei! Aber Menschen freizustellen bedeutet Arbeitslosigkeit. Nur wenn ein technischer Fehler den Produktionsprozess zum Erliegen bringt, dann müssen wieder Menschen eingreifen. Die Störung muss schnell und effizient beseitigt werden.
„Los, an die Arbeit, die giftigen Dämpfe werden dich schon nicht umbringen. Da müsste ich schon längst tot sein! So schnell stirbt man nicht!“
Der Vorarbeiter erhält die Anweisungen von seinem Vorgesetzten, der wiederum von seinem Abteilungsleiter. Vorgaben müssen um jeden Preis erfüllt werden. Ziele müssen schnell und vor allem kostengünstig erreicht werden. Widerspruch wird nicht geduldet. Wer widerspricht, ist ein Querkopf. Querulanten werden bei der nächstbesten Gelegenheit freigesetzt, also entlassen, meistens fristlos, je nach Schwere der Aufmüpfigkeit. Und die Gewerkschaften verbuchen einen nie dagewesenen Zulauf.
Ich höre, wie man an den Stammtischen der damals noch zahlreichen Dorfschänken über sogenannte Parteibuchinhaber lästert, die es angeblich vortrefflich verstünden, ihr Fähnchen immer nach der gerade aktuellen Windrichtung auszurichten. Das sei opportun und könnte, die „richtige Parteibuchfarbe“ vorausgesetzt, durchaus einmal zum eigenen Vorteil gereichen. Der Besitz des richtigen Parteibuches sei außerordentlich behilflich bei der Besetzung lukrativer Stellen für Staatsbedienstete in den Kreisverwaltungen, den Landesämtern und auch in den Bundesämtern, sagt man. Der gehobene Beamtenadel sei auf jeden Fall zu pflegen; ansonsten wisse man nie, was alles passieren könnte. Für mich sind solche, oft lautstark vorgetragenen Stammtischdebatten ziemlich widerliche Dispute – herausgeplärrt von Proleten und Denunzianten – die nicht selten in Pöbeleien und sogar Schlägereien ausarten.
Als Junge muss ich erfahren, wie Menschen in hohen Ämtern oft selbstgerecht nach der Prämisse leben, dass sich ein Volk der Hierarchie der Staatsgewalt beugen müsse, um Ruhe im Land zu haben. Darin ist man sich einig! Die Streitigkeiten werden beigelegt und man sucht sich einen anderen Gegner, am liebsten einen „Auswärtigen“. Nur wenige trauen sich, öffentlich eine andere Meinung als die allgemein gültige zu vertreten, und werden dadurch zu „Nestbeschmutzern“ und zu jenen, „die nicht mit den Wölfen heulen“, abgestempelt. Mich verstört solches Gebaren und ich frage mich: „Was ist das, was da auf dem Misthaufen unserer nicht gerade ruhmreichen Vergangenheit gedeiht?“ Ich frage auch im Kreise der Freunde meiner Familie und meiner Verwandtschaft, doch die Reaktionen sind sehr bedrohlich:
„Du dummer Bub, halt´s Maul, du hast doch keine Ahnung vom Leben, es war nicht alles schlecht im Hitlerreich, und was er für sein Volk getan hat…! Nicht wahr, du dummes Bürschlein, was weißt du denn schon? Dir gehört eine Tracht Prügel und sonst nichts! Und überhaupt, was redest du da, wer hat dir denn die Flausen in den Kopf gesetzt?“
Auf solche Zurechtweisungen, herausgespuckt mit vor Zorn weit aufgerissenen Augen und gefletschten Zähnen, die mir in dieser für mich völlig ausweglosen Lage wie aufgepflanzte Bajonette erscheinen, reagiere ich sehr empfindlich, denn ich lese Geschichtsbücher und glaube den Zusammenhang zwischen dem immer noch verherrlichenden Propagandageschwätz und den äußerst unrühmlichen Geschehnissen des Dritten Reiches zu verstehen. Dass fast sechzehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weiterhin noch Nationalsozialisten, zwar als solche nicht offiziell benannt und auch nicht bekannt, Einfluss auf meine noch etwas kindlich-naive, aber schon fast jugendliche Weltanschauung auszuüben versuchen, macht mich richtig wütend. In meiner Ohnmacht, etwas gegen diese Gesinnungen unternehmen zu können, erschaffe ich mir ein ziemlich drastisches Sinnbild, eine Metapher:
„Unkraut gedeiht prächtig auf faulendem Kompost.“
Ich beobachte und bemerke, wie man sich mit einem spöttischfreundlichen Zuzwinkern gegenseitig die Ehre abschneidet und sich der im Stillen ausgeheckten Verhöhnungen und Possen bedient.
Ich bemerke, wie mein Vater darunter leidet und ich leide mit ihm.
Er ist ein stolzer Sohn der Eifel, aufgewachsen in einer ehemaligen, aber längst untergegangenen Getreidemühle mit einem zweischlächtigen Antriebsrad, das mit dem Wasser aus einem nahe gelegenen Vulkansee, dem Ulmener Maar, angetrieben wurde.
Ich lausche gerne den Erzählungen von Onkel Antonius, Vaters Bruder, um das Mühlenwesen. So durfte in der Mühle auf keinen Fall geraucht oder mit offenem Feuer hantiert werden. Der hochexplosive Mehlstaub hätte eine fürchterliche Verpuffung auslösen können. Es gab auch so gut wie keine metallenen Gegenstände im Kernbereich der Mühle, also in ihrem Herzen, der Transmission und dem Mahlwerk. Alle Bauteile, von dem tragenden Gebälk über die vielfältigen Zahnräder, waren aus Holz und miteinander verzapft oder verkeilt. Ein majestätisches Bauwerk.
Der Mühlenbetrieb wurde in den Kindertagen meines Vaters modernisiert. Statt der Energie aus Wasserkraft kam bald elektrischer Strom zum Einsatz als Antriebsenergie. Neue Mühlen entstanden und die Rentabilität althergebrachter Mühlentechnik unterlag der Effizienz der Neuzeit. Vorbei auch die uralten Rechte der Müllerzunft. Die Mühle verfiel durch „Feindeshand“ und wurde zur Ruine. Den Niedergang und somit den Verlust der Mühle als die Heimstatt seiner Kindheit hat Vater niemals überwunden. Landwirtschaft und der Betrieb eines Holzfuhrgeschäftes, um das begehrte Baumaterial aus den von den Siegern geplünderten Wäldern von seinem Heimatort zu den Verladestationen wie der Stadt Cochem an der Mosel oder Wittlich mit einem Eisenbahn-Knotenpunkt zu transportieren, sicherten das Überleben seiner Familie. Aus der Mühle verbannt und von den damaligen Besatzungsmächten geknechtet, war harte Schufterei unter der Fremdherrschaft die Normalität und mein Vater als ältester Sohn in seiner Familie entwickelte eine Zähigkeit wie kein anderer.
Hierzu eine kleine Anmerkung aus dem Prospekt „Ulmener Mühlenwanderweg“:
„… sichten wir erstmals den Ulmener Bach und die Lehnen-Mühle, allerdings im neuen Kleid aus den Jahren 1984/85, mit früher oft wechselnden Namen am Fuß des Kappenbergs. Sie ruht auf den Fundamenten der alten Talmühle, die um 1540 von den Ulmener Herren der Kurkölner Fraktion gegründet wurde…“
Manch törichte und üble Verleumdung, der sich mein Vater viele Jahre später immer wieder ausgesetzt sieht, kränkt ihn sehr, aber er hält seinen Zorn, vor Ärger vibrierend, zurück. Der Ort seines Wirkens ist nicht seine Heimat. Und er vermisst die Eifel und die Mosel bei Cochem, seine Muttersprache und sein ehemaliges soziales Umfeld sehr. Das bewirkt einen Stau von unbändiger Wut, und dann öffnen sich die Schleusen und ein Unwetter bahnt sich seinen Weg. Das Gewitter entlädt sich wie ein Hagelsturm, und so schnell, wie es über uns kommt, ist es auch schon vorbei. Die Luft ist gereinigt und die dunklen Wolken, die so schwer auf meinem Gemüt lasten, verziehen sich. Die Sonne blinzelt durch die Regenperlen, die tränengleich von den Zweigen der Bäume tropfen.
Lange betrachte ich durch das Küchenfenster, was da draußen geschieht, und bin kaum bei der Sache und wenig an Hausaufgaben interessiert. Dann spüre ich beglückt wieder die Wärme des Windes auf meiner Haut, wenn ich mit meinem Vater über das Land fahren darf. Ich sitze vor ihm auf dem Tank seines Motorrads und genieße jenen unvergleichbaren Geruch meiner frühen Kindheit, der getragen ist vom süßen Bukett der blühenden Rapsfelder oder den herb-würzigen Duftschwaden der frisch gepflügten Ackerböden und dem durchdringenden rauchigen Aroma der im morgendlichen Herbstnebel vor sich hin kokelnden Kartoffelkrauthaufen. Unvergleichlich, dieser Duft! Ich sauge die vertraut streng riechenden Ausdünstungs-Winde wiederkäuender Kühe im feuchtwarmen, dunstigen Stall in meine Lunge und genieße den süßen Wohlgeruch, der dem sich langsam füllenden Melkeimer entströmt. Unser Schäferhund Rex und die zahlreichen namenlosen Katzen harren erwartungsvoll in der Nähe meiner melkenden Mutter aus, um den ersten vollen Becher mit frischer Milch zu bekommen. Sie schlürfen gemeinsam die körperwarme Kuhmilch aus einer Schale. Unter den Tieren herrscht Frieden. Und ihr Frieden überträgt sich auf die Familie.
Wonnig kapsele ich mich in diesen Kokon einer zwar strengen und harten, aber auch wohlbehüteten Kinderzeit ein. Ich darf mich wohlfühlen. Ach, wäre es doch immer so! Denn ich weiß die Zeichen zu deuten und ich begreife: Mit „Kindsein“ beginnt das Leben. Das Kind ahnt die Mühen der Jugend schon bald. Statt eines fehlenden dörflichen Kindergartens heißt es schon früh, viel zu früh, die zugeteilten Arbeiten und Aufgaben zu verrichten. Heu rupfen, Kuhstall und Schweinekoben ausmisten, Futterkessel auffüllen und einheizen, Tiere füttern und mit Trinkwasser versorgen. Die vollen Eimer sind schwer und die kindlichen Hände bekommen schmerzende Schwielen.
Täglich, in den Herbstferien, mit den Kühen gleich nach dem morgendlichen Melken den ganzen langen Tag hinaus auf die „offenen“ Weiden, denen das Grummet schon entnommen ist und die somit allen Viehhaltern frei zugänglich sind. Und wehe, wenn plötzlich eines meiner Rindviecher den Schwanz steil nach oben richtet! Denn du weißt schon, dass dann die ganze Herde wild davonstieben wird. Natürlich suchen sie sich meistens das angrenzende Dickrübenfeld oder einen nahegelegenen, noch nicht abgeernteten Maisacker aus, um sich darin auszutoben. Das endet meistens in einer Katastrophe von zertrampeltem Rübenfeld oder niedergewalztem Mais. Die Ernte ist futsch.
Am Abend dann, wenn das halbe Dorf darüber Gewissheit hat, wessen blöde Kühe die Verwüstungen angerichtet haben und welcher „Hornochse“ von Hütejunge nicht fähig ist, seine Kühe ordentlich zu hüten, so wie es sich gehört, bricht ein Zornesgewitter los und die Beschimpfungen kommen wie Donnerschläge; niemand kann die Wut des zornigen Vaters besänftigen, und die derben Beschimpfungen und Drohungen schmerzen mehr als die Prügelhiebe. Sie hinterlassen furchtbare Striemen; weniger auf dem Rücken, dafür mehr auf der empfindlichen Kinderseele.
Und abermals schweift mein Blick in die Ferne. Meine mit Schwermut beladenen Gedanken segeln fort und wieder befinde ich mich in meinem nur kurz unterbrochenen Tagtraum. Und ich sehne mich nach einem Meer von endloser Weite und nach meinem Schiff, einem kleinen hölzernen Segelschiff, meiner James P. Rigor.
Ich nehme einen Platz ein in den Abenteuern und den Heldensagen, in welche ich mich zu jeder sich bietenden Gelegenheit flüchte. Ich lese viel zu jener Zeit und ich lese intensiv. Die Namen und Geschichten nehmen Gestalt an. Figuren werden lebendig, ich hoffe und bange mit den Menschen an Bord ihrer Schiffe, ich fürchte den Zorn des blitzeschleudernden Zeus und des die Schiffe versenkenden Poseidon. Ich lebe die Abenteuer, die ich lese, und ich kann mich begeistern und auch fürchten.
Logbucheintrag
Schiffstyp:
Einmastsegler
Besatzung:
Skipper und Smutje in Personalunion
Proviant:
Back aufgefüllt und Wasserfässer gebunkert für 10 Tage
Position:
Pueblo de la Bandera ° 19′ 32″ N, 7° 30′ 36″ O
Leinen los!
Mein Schiff ist zu Wasser gelassen. Mit einem Schwall Seewasser aus der Pütz auf die Planken des Oberdecks hat es seine Taufe erhalten auf den Namen
James P. Rigor
Und es hat seinen ersten Probelauf bestanden, zwar mit gerefften Segeln und auf Lee gestellten Rahen, und ich bin mir sicher, dass der gewaltige Druck des Wassers auf die Querbalken zwischen den Bordwänden meinem Schiffsrumpf nichts anhaben kann. Die Spanten stemmen sich ächzend in ihren Verzapfungen gegen die anschlagenden Wellen, doch sie halten. Es dringt kein Wasser ein. Der Rumpf ist stark und ich bin beruhigt. Im Gegensatz zu mir zeigt die Substanz meines Segelschiffes keinerlei Anzeichen von Schwäche. Seine Planken halten dicht und der Mast sitzt, von Vorstag und Achterstag in Position gehalten, fest und unverrückbar in seiner Mastspur auf dem Kielschwein. Es wird mich mit Gottes Hilfe über die weite See tragen, von einem zufälligen zu einem anderen ungewissen Ziel. Dessen bin ich mir gewiss.
Ich spüre meine Stärke, mein Mut kehrt zurück und ich versetze mich in meine herbeigesehnte Traumwelt.