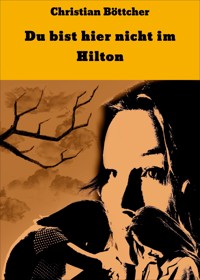4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch schildert meine Erlebnisse während der Zeit, in der ich fast alles mitnahm, was die Diagnose "Bi-Polar" zu bieten hat: Ich war mehrere Male der König der Welt und traf Polizeipräsidenten und Illuminaten. Andererseits war ich auch einige Male ans Bett gefesselt worden und bekam Spritzen, die Pferde umhauen. Meine Welt drehte sich um Geheimdienstagenten, Drogen und den richtigen Ort, um mich umzubringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christian Böttcher
Einmal das volle Programm, bitte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Gefangen
2. Alles in Ordnung
3. Der Spaß kann beginnen
4. Eine geile und unbeschwerte Zeit
5. Katerstimmung macht sich breit
6. Ein Wochenende, das alles veränderte
7. Was geschieht mit mir?
8. Ein tiefes Loch tut sich auf
9. Mit einem langen Atem wird es besser
10. Bewegende Wochen und keine Ruhe
11. Weit weg und wenig Hoffnung
12. Ruhe nach und vor dem Sturm
13. Es geht noch schlimmer
14. Das falsche Urlaubsziel
15. Angst
16. Nichts geht mehr
17. Schöne Orte
18. Es kann manchmal auch lustig zugehen
19. Von Groschen und Horizonten
Impressum neobooks
1. Gefangen
Mühlhausen, geschlossene Psychiatrie im März 2002. Hinter mir wurden gerade zwei Türen verschlossen. Das dritte Jahr in Folge hatte ich es geschafft einzufahren. Eine Tatsache, die ich in den Wochen zuvor unbedingt vermeiden wollte. Ich lag mit meinen 25 Jahren zum wiederholten Mal am Boden, fühlte mich jedoch großartig.
Draußen leuchteten die Sterne in der Dunkelheit und meine zukünftigen Mitpatienten schliefen bereits. Ich setzte mich auf die Terrasse, die Gitterstäbe vor mir. Als ich gerade Platz nahm und mir eine Zigarette anzündete, fing es an zu schneien. Eine Ruhe lag über dem Haus 22, und da ich mich so phantastisch fühlte, genoss ich die Stimmung. Dass ich gerade angeschnallt auf einer Trage im Krankenwagen und in Polizeibegleitung über die Autobahn gefegt war, spielte in diesem Moment keine Rolle. Laut richterlichem Beschluss sollte ich die nächsten sechs Wochen hier verbringen. Es handelte sich um eine Zwangseinweisung.
Der vergangene Monat war aufregend. Von Todesangst bis unerschöpflicher Euphorie hatte ich alles erlebt. Doch warum befand ich mich schon wieder hinter Gittern?
Erst einmal schneite es im März und ich kam zur Ruhe. Die folgenden Wochen sollten jedoch nicht einfach werden. Mich erwarteten Ex-Stasi Mitarbeiter, ein Heimkind, das scharf auf meine Sachen war, Insassen von diversen Gefängnissen, Alkoholiker und Russen, die sich für Mafiaangehörige hielten.
In einem Vierbettzimmer, welches das Pflegepersonal durch eine Glasscheibe beobachten konnte, legte ich mich schließlich schlafen. Neben mir lag ein Patient, der Stimmen hörte. Mein Zustand lag „über dem Strich“. Mir ging es daher wunderbar, als ich am nächsten Morgen aufwachte.
In dem harten Umfeld konnte ich mich anfangs Dank der guten Laune behaupten. Mulmig wurde es nur einmal, als jemand beim Aufwachen an meinen Hals fasste. Es sollte sich nur um einen harmlosen Scherz handeln. Ich fand das nicht so witzig, unmittelbar nach dem Öffnen meiner Augen eine Person zu sehen, die sich über mich beugte und nach meinen Hals griff.
Die Tage vergingen langsam. Doch zusammen brachten wir die Zeit irgendwie herum. Wir tranken unseren mitgebrachten Kaffee, redeten und lachten viel. Die Abende auf der Terrasse hatten etwas für sich. Wir unterhielten uns über Geschichte, auch über die Relativitätstheorie und ihre Daseinsberechtigung oder über die besten Haushalttipps gegen Gelenkschmerzen. Die Gesprächsthemen drehten sich um Zigaretten, Sport, Nazis oder die Brüste der Ergotherapeutin. Ein Schachspiel stand im Raucherraum aufgebaut und ich spielte besser als sonst. Einmal bestellten wir alle Pizza.
Es gab witzige Momente, als wir zum Beispiel einer hübschen Pflegerin eine tote Maus in einer Schachtel überbrachten. Statt laut „Igitt“ zu sagen, blieb sie jedoch beim Anblick des toten Tieres ganz gelassen und strafte uns mit einem Blick, der signalisierte „Na und, was kommt als Nächstes?“. Mein Vater schenkte bei einem Besuch einem „Mitstreiter“ ein Autogramm von Udo Lindenberg, worüber der sich riesig freute.
Ich fühlte mich oft blendend unterhalten, doch bald merkte ich, dass manche Einiges auf dem Kerbholz hatten und nicht ganz „ohne“ waren. Ein Mitpatient zog mehrmals meine Anziehsachen an, ein anderer zerstörte die Kopfhörer meines Walkmans.
An verschiedene Leute und das Eingesperrtsein konnte ich mich schwer gewöhnen. Es war mein dritter Aufenthalt in der Geschlossenen, doch so hart kam mir der Alltag noch nie vor. Vielleicht lag dies auch daran, dass ich zunehmend grundlose Ängste bekam.
Für so eine Art Umgebung war ich irgendwie nicht geschaffen. Irgendwann sagte ich aus Protest nichts mehr, auch weil ich dachte, dass so die Stimmen im Kopf meines Bettnachbarn verschwinden würden.
Dies fiel auch gleich der Ärztin auf, als sie sich zu uns Rauchern setzte. Mit Hilfe von Kopfbewegungen und Zeichensprache verständigte ich mich mit ihr. Sie schaute sich die ganze Sache keine Viertelstunde an. Ich wurde ans Bett gefesselt. Um mich herum befanden sich viele Menschen, als ich eine Spritze gesetzt bekam. Die hätte auch ein Pferd umgehauen.
Die folgende Woche verbrachte ich fast nur im Bett. Ich war unfähig aufzustehen. Zu den Mahlzeiten schleppte ich mich, ansonsten drehte ich mich von einer Seite auf die andere. Ab und zu verlor ich das Bewusstsein, immer unter den Augen des Pflegepersonals. Ein Leidensgenosse mit einem lustigen T-Shirt saß oft an meinem Bett und munterte mich auf. Eine Krankenschwester ging mit mir einmal vor die Tür. Ich konnte mich kaum bewegen und kam mir wie ein Hund beim Gassigehen vor. Die Spritze hatte mich buchstäblich K.O. geschlagen.
Als es etwas besser ging, schrieb ich Briefe. Insgesamt acht schickte ich los, an das Amts-, Landes- und Bundesverfassungsgericht, meinen Abgeordneten, den Ministerpräsidenten, die Russische Botschaft und noch ein paar mehr. Die letzten Jahre war ich häufig in der geschlossenen Psychiatrie gewesen. Ich wollte aus dem Kreislauf herauskommen und auch meine Betreuerin endlich los werden. In meinem Leben war irgendetwas schiefgelaufen, schließlich hatte ich einst studiert, besaß Kumpels und eine Freundin.
Ziemlich bald erhielt ich eine Reaktion auf die Briefe. Ein Anwalt und eine Richterin vom Landesgericht kamen. Erst unterhielten sie sich mit der Ärztin, dann mit mir. Die Richterin meinte: „Wie kann einer solche Briefe schreiben und dann hier drinnen sitzen?“ Sie blätterte in einer dicken Akte. Ich hatte keinem etwas getan oder ein Verbrechen begangen, sondern war einfach nur ab und zu ein bisschen zu gut drauf.
Wie ein Wasserfall redete ich über eine Stunde. Vor allen Dingen fühlte ich mich ungerecht behandelt. Die Tatsache, dass ich zum wiederholten Mal zwangseingewiesen wurde, hatte meinem Inneren einen solch schweren Schlag versetzt, dass ich langsam Angst bekam, dass es ewig so weitergehen würde.
Ich musste irgendwie eine Chance bekommen und vor allen Dingen die Möglichkeit erhalten, Mühlhausen vorzeitig verlassen zu dürfen. Es geschah etwas, was ungewöhnlich war: Ich durfte am nächsten Tag gehen, mit dem Versprechen mich in der Klinik meiner Heimatstadt ambulant medikamentös behandeln zu lassen.
Die Geschlossene hatte ich nach drei Wochen geschafft. Ich war endlich frei. Das vorzeitige Gehen nahm ich ab da als Geschenk und Ansporn an, dass es möglichst nicht wieder so weit kommt, dass ich mehrere Wochen hinter Gittern zubringen müsste.
Vom Personal wurde ich bei der Herausgabe meiner persönlichen Sachen gefragt, ob ich es überhaupt nach Hause schaffe. Mit einer inneren Überzeugung schüttelte ich die zweifelnden Blicke ab. Meinen letzten Kaffee ließ ich den Schwestern, was die nicht sonderlich freute: „Der ist sowieso bald leergetrunken.“
Andere Patienten verabschiedeten sich. Einer fragte: „Wie hast Du das nur hinbekommen?“ Er wünschte mir alles Gute. Andere, die auch mit richterlichem Beschluss da waren, konnten es nicht glauben und dachten, ich veralbere sie, als meine gepackte Tasche vor dem Eingang stand.
Ein Pfleger, 58 Jahre alt, schloss mir die Türen auf. Den willst Du nie wieder treffen, schwor ich mir. Er sagte „Tschüss“ und nicht „Auf Wiedersehen“ Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber ich glaubte einen Hauch von Anerkennung in seinen Augen zu sehen. Die letzten Jahre hatte ich mit diesem Mann immer einmal wieder zu tun gehabt. Hoffentlich war es diesmal das letzte Mal.
Mit 40 Euro in der Tasche bestellte ich ein Taxi, das mich zum Bahnhof fuhr. Immer noch sehr gut drauf unterhielt ich während der anschließenden Zugfahrt das halbe Abteil. Nach einer Weile zog ich meine Schuhe aus und legte meine Füße auf den gegenüberliegenden Sitz. Stolz und doch nachdenklich schaute ich aus dem Fenster. Die vorbeiziehende Landschaft brachte mich heimwärts.
Zu Hause angekommen ging ich in den Sexshop, kaufte mir Whiskey und eine große Sonnenbrille. Ich genoss es, mich frei bewegen zu können. Abends hörte ich schöne Musik und sog die Ruhe auf.
Am nächsten Tag besuchte ich wie versprochen die Klinik und erhielt dort Ciatyl. Mir gefiel der Name, hatte ich mich in der Vergangenheit oft als Agent gefühlt und verband mit dem Medikament die CIA. Eine gut aussehende Ärztin mit langen schwarzen Haaren jagte mir die Spritze in meinen Po. Unmittelbar danach spürte ich die Wirkung. Das Zeug dämpfte meine Euphorie. Wie ein flüssiger Stein durchdrang das Medikament meinen Körper. Mein Gehirn fuhr herunter.
Das darauffolgende Wochenende verbrachte ich mit Johnny Walker. Schon früh gegen 10 Uhr ging ich mit müden Schritten auf Beschaffung. Mein Vater sagte irgendwann zu mir: „Das ist doch nicht die Lösung.“ Dabei schaute er traurig. Doch ich brauchte das Zeug, denn der gute Zustand ließ immer mehr nach.
Wenigstens kam ich endlich zur Ruhe. Viel Druck und eine tonnenschwere Last fielen von meinen Schultern. Die vergangenen Jahre hatten es wirklich in sich gehabt und kosteten viel Kraft.
Das Schlimmste lag zum Glück hinter mir.
2. Alles in Ordnung
Wie konnte es soweit kommen? Als ich 18 Jahre alt wurde, lag die Zukunft rosig vor mir. Führerschein, erstes Auto und Abitur waren die vorherrschenden Themen im Jahr 1995.
Bis dahin verlief alles sehr geradlinig in meinem Leben, was auch an den guten Voraussetzungen lag. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass mich meine Eltern gut erzogen haben. Meine Mutter gab mir viel Liebe und Zuwendung, wur-de aber auch mal streng, wenn es sein musste. Mein Vater war hart, gerecht und achtete sehr auf die Charakterbildung. Auch er liebte sein einziges Kind, hatte aber Probleme mir dies zu zeigen.
Beide achteten immer darauf, dass ich mich höflich verhielt und zum Beispiel Nachbarn stets grüßte. Ich wuchs in einem intakten Elternhaus auf, mit Besuchen bei den Großeltern, schönen Weihnachtsfesten und Geburtstagen. Mein Vater war gelernter Schlosser, meine Mutter hatte Kinderkrankenschwester gelernt. Wir wohnten in der Nähe vom Bahnhof in einem Altbauviertel, wo überwiegend Arbeiter und Angestellte lebten. Ehrlichkeit und gegenseitiger Respekt wurden in meiner Familie großgeschrieben.
Ich durchlief den üblichen Werdegang, erst den Kindergarten, später die Grundschule und das Gymnasium bis zum Abitur. Die Schule fiel mir immer leicht, was zur Folge hatte, dass ich weniger lernte. Du schaffst es ja sowieso, dachte ich. Das Abitur schloss ich mit 3,0 ab. Es hätte viel besser sein können. In die jeweiligen Klassen war ich immer integriert und hatte meine Freunde. Nach Schulschluss spielten wir meist Fußball, später dann Videospiele und Autoquartett. In den Sommermonaten ging es oft mit unseren Fahrrädern ins Bad.
Sportlich habe ich mich auch betätigt. Ich war gar nicht einmal so schlecht im Basketball. Tennis spielte ich im Verein, richtig mit Punktspielen. Ich war mit 14 sogar Clubmeister in meiner Altersklasse. Diese Zeit ist mir bis heute in sehr guter Erinnerung geblieben, weil ich mit meinen Kumpels viel Zeit auf der Tennisanlage verbrachte und wir uns gut verstanden haben.
Meine erste richtige Freundin lernte ich mit 15 kennen. Von ihr bekam ich auch meinen ersten Kuss. Leider fand am darauffolgenden Tag ein wichtiges Spiel mit der Tennismannschaft um die Thüringenmeisterschaft statt. Sonst ziemlich ehrgeizig, war ich an diesem Tag wie weggetreten. Ich hatte immer noch weiche Knie. Wir verloren auch insgesamt das Spiel. Unser Kapitän, der meinen Schwarm kannte, zeigte Verständnis, sagte aber immer wieder den Namen des Mädchens und schüttelte den Kopf.
Die Schulzeit bedeutete eine unbeschwerte Zeit, auch auf dem Gymnasium. Mein bester Freund war der Frauenschwarm der Schule. Anderthalb Jahre führte ich eine Beziehung mit einem Mädchen aus meiner Klassenstufe. Wir verstanden uns alle prächtig, viele bekamen ihr erstes Auto, wir fingen an abends wegzugehen, hatten eine regelmäßige Skatrunde.
Und doch muss es einen Grund haben, warum ich das alles wegwarf, die Liebe meiner Eltern, den Freundeskreis, meine Freundin, den Sport.
Mit 18 brach ich aus. Ich begann Drogen zu nehmen.
3. Der Spaß kann beginnen
Es begann alles recht harmlos. Kurz nach der bestandenen Führerscheinprüfung probierte ich meinen ersten Joint. Das war deshalb noch harmlos, weil das in diesem Alter viele tun. Ich kam mir jedenfalls ziemlich cool vor.
Bedenkenlos wäre es auch geblieben, wenn ich nur mal probiert hätte. Aber ich fand Gefallen daran. Zum Glück machte ich kurz darauf mein Abitur. Viel länger hätte die Schule nicht dauern dürfen. Ich weiß nicht, ob ich sonst meinen Abschluss geschafft hätte.
Den Sommer 1995 habe ich in guter Erinnerung. Wir fühlten uns erwachsen. Meine Eltern schenkten mir ein Auto. Es war ein alter Ford Escort, babyblau.
Und doch spürte ich, dass ich meine damaligen Klassenkameraden nicht mehr lange um mich haben würde. Ich schaute mich nach einem neuen Freundeskreis um, auch weil die Leute aus meiner Jahrgangsstufe eben nicht kifften. Ich war jung und wollte was erleben. Ein normales und „langweiliges“ Leben kam für mich nicht in Frage. Es fehlte irgendetwas, deshalb suchte ich neue Freunde, die nicht in meiner Klasse waren.
Nach dem Abitur begann im Juli 1995 erst einmal mein Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. Er sollte zwölf Monate dauern. Am Anfang kiffte ich ab und zu, am Ende der Armeezeit war ich passionierter Grasraucher.
Bei der Bundeswehr kann sich jeder aussuchen, was er nach Dienstschluss tut. Das Vernünftigste ist, man macht gar nichts, spielt Karten, sieht fern oder liest. Dann gibt es welche, die Alkohol trinken, vornehmlich Bier. Manche schafften sogar zu zweit oder dritt einen Kasten am Abend. Es wurde auch manchmal auf Befehl gefeiert.
Mir schmeckte damals noch kein Bier, also bildete ich mich im Marihuanarauchen weiter. Es gab genügend Kandidaten, die wie ich gerne kifften. Ich lernte neue Sitten und Bräuche kennen. Die Joints wurden länger. Ich war jung und brauchte kein Geld. Ich war zwar Soldat, trotzdem ließ ich ein gewisses Grad an Reife vermissen.
Bundeswehr kann schön sein, man lernt ständig neue Leute kennen und trifft interessante Menschen. Alles hält zusammen. Kameradschaft wird einem schon in der Grundausbildung vermittelt. Kameradschaft hieß auch, dass man sich abends, wenn die Vorgesetzten nicht mehr da waren, in kleiner Runde versammelte, um laut Musik zu hören und die Drogen wirken zu lassen. Wir rauchten manchmal auch eine Bong in der Mittagspause.
Damals war alles noch lustig, es sollte aber schon bald düsterer und bitterer Ernst werden. Dass ich zur Sucht neige, wusste ich damals noch nicht. Ich lernte leider auch beim Bund, größere Mengen Marihuana oder Haschisch zu kaufen und damit auch mal alleine „einen durchzuziehen“.
Die Armeezeit riss ich ohne Probleme ab. Gehorsam war ich. Respekt vor meinen Vorgesetzten und Kameraden hatte ich auch.Nach der Grundausbildung bei der Luftwaffe ließ ich mich heimatnah versetzen, sodass ich nach Dienstschluss auch mal zu Hause übernachten konnte. Das nutzte ich und fuhr oft hin und her.
In meinem Wohnort lernte ich mit der Zeit durch Kumpels und Bekannte immer mehr neue Leute kennen. Nach und nach bildete sich ein Freundeskreis für mich heraus. Wir wurden schließlich eine feste gemischte Clique, die ca. 20 Leute umfasste. Sie sollten meine Begleiter für die nächsten Jahre werden. Das grenzenlose Vergnügen und die Freiheit, die ich anstrebte, hatte ich bald zu Genüge, denn allmählich gelangte ich auch in die örtliche Drogenszene, was enorme Vorteile mit sich brachte. Denn dadurch kannte ich jetzt Dealer.
Bald konnte ich richtig loslegen. Die Tage als Soldat waren inzwi-schen überschaubar geworden. Gegen Ende der Dienstzeit hatte ich ziemlich viel Urlaub übrig und durch eine freiwillige Verlängerung auf zwölf Monate Grundwehrdienst, welche sehr gut bezahlt wurde, auch ein bisschen Kohle. Hinzu kam das üppige Entlassungsgeld.
Der Sommer 1996 begann für mich im Mai mit drei Wochen Freizeit und sturmfreier Bude. Ich wohnte damals noch zu Hause. In der Zeit lernte ich, was es heißt Kiffer zu sein.
Ein Freund sagte irgendwann: „Ihr hättet, anstatt alles hier zu kaufen, nach Amsterdam einkaufen gehen müssen.“ Eine neue Droge zu entdecken hat was für sich. Ich lernte den Film „Pulp Fiction“ kennen und zog dabei meine ersten Eimer. Eimer? Das ist eine abgetrennte Cola-Mehrwegflasche in einem Wischeimer, auf der Flasche ist ein Aufsatz, da kommt das Haschisch hinein, der Aufsatz wird angezündet, die Flasche hochgezogen, im Inneren ist der Rauch, den man dann einatmet. Ballert mehr weg als ein Joint.
Meine sturmfreie Bude war immer voll, bis auf den letzten Abend, da kam dann doch noch ein Kumpel mit einem Film vorbei. Wir gingen schließlich in eine Bar. Als Ergebnis meines Urlaubes stand unter dem Strich fest, dass ich nun endgültig auf den Geschmack gekommen war.
Ein richtiger Kiffer raucht am Tag sein Gramm Gras oder Shit weg, bei einem Grammpreis von damals 15 Mark ein kleines Problem. Ich brauchte nicht lange, um am Tag mein Gramm zu rauchen. Der Marihuanakonsum ist eine Abhängigkeit, allerdings nicht körperlich wie beim Heroin, sondern eine psychische Abhängigkeit. Auf Deutsch: Es macht so viel Spaß, dass man es am liebsten jeden Tag tun würde. Über die Schädlichkeit des Rauchens und die Sucht nach dem Zeug machte ich mir damals keine Gedanken. Damals redeten wir uns Dinge ein, wie: „Ja, in Holland ist es legal, da rauchen es die Bankangestellten in der Mittagspause. Kiffen ist viel cooler als Alkohol, wo man nur aggressiv wird. Gras wird sogar als Medikament eingesetzt, wenn jemand Schmerzen hat.“ Heute sehe ich Grasrauchen kritischer.
Jedenfalls hatte ich in den folgenden zweieinhalb Jahren keine zehn rauchfreien Tage. Ich sah mich jedoch nicht als Abhängiger, sondern als jemand, der etwas erleben wollte. Mit Kiffen wurde jede Tätigkeit schöner, das Einschlafen, das Unterhalten, der Sex, das Nachdenken, das Essen und sogar das Autofahren.
Ein Nachteil der Illegalität war, dass man immer aufpassen musste, nicht erwischt zu werden. Wir taten zwar keinem was, trotzdem wurden wir dem kriminellen Milieu zugeordnet. Die Beschaffung und der Besitz von Haschisch ist strafbar. Wie habe ich das erste Mal Amsterdam genossen, wo ich in aller Ruhe in einem Café mir eine Tüte in aller Öffentlichkeit drehte und mit einem Freund rauchte.
Überhaupt, das erste Mal Amsterdam war geil. Wir hatten uns spontan entschlossen und waren zu zweit in einem Opel Astra unterwegs. Wir schliefen in einer Jugendherberge mitten im Rotlichtviertel. Hier standen käufliche Frauen in Schaufenstern. Am ersten Abend saßen wir in einer Kneipe, an der Wand hing ein Fernseher, dort lief irgendein Sexfilm. Die Bedienung des Coffee-Shops sagte nur zu meiner Tüte: „That's very big.“ Er lachte dabei.
Auf dem Rückweg hatte ich dann nur noch Schiss an der Grenze. Schließlich war ich noch Angehöriger der Bundeswehr. Ich nahm nicht viel mit nach Deutschland. Eigenbedarf lautete das magische Wort. Wir entschlossen uns nicht über die Autobahn, sondern Landstraße zu fahren. Auch ein paar Kilometer hinter der Grenze musste man noch Angst haben angehalten zu werden, was ärgerlich gewesen wäre. Nicht unbedingt in materieller Hinsicht, sondern weil die eingekauften Sachen ziemlich gut waren.
Wir fuhren durch mehrere kleine Orte, es zog sich alles nervenaufreibend hin. Der Blick war laufend in den Rückspiegel auf die Autos gerichtet. Handelte es sich um einen Opel, konnten uns vielleicht Zivilpolizisten folgen. Verfahren wäre auch nicht unbedingt förderlich gewesen.
Ich studierte eifrig die Karte. Mit dem Auto und unserem fremden Kennzeichen fielen wir bestimmt auf. Aber das wären wir auch auf der Autobahn, wo die Drogenfahndung entlang der Grenze stand und Autos herauszog. Bei einer späteren Fahrt nach Amsterdam ist uns das sogar auf der Hinfahrt passiert. Irgendwann löste sich jedoch die Anspannung. Wir hatten es geschafft. Unser gutes Gras konnten wir ungestraft über die Grenze nehmen. „Silver Haze“ und „Shiva“ rauchte ich die nächste Zeit.
Im Juni brachen die letzten Tage der Bundeswehrzeit an. Mit den Leuten vom Bund erlebte ich in den letzten Tagen eine unbeschwerte Zeit. Wir waren Abgänger. Es galt für uns ein gelockertes Kasernenleben. Dann kam der letzte Tag. Mit einem Autokorso fuhren wir durch das Kasernengelände bis zur Autobahn. Bundeswehr ade. Am Abend schaute ich mit einem meiner besten Freunde das Halbfinalspiel der EM 1996 Deutschland-England, welches die Deutschen im Elfmeterschießen gewannen.
Ich hatte nun bis Oktober Zeit. Dann begann mein Studium. Fatal war die Tatsache, dass mit 18 oder 19 mein Traumberuf immer noch nicht feststand. Meine Bewerbungen als Staatsbediensteter wurden allesamt abgelehnt. Ich gab mir damit auch keine große Mühe. Einen geeigneten und interessanten Studiengang zu finden, stellte sich als schwierig heraus. Schließlich wählte ich Volkswirtschaftslehre. Meine Interessen lagen jedoch woanders. Parties feiern, Drogen nehmen und Freunde treffen kann man leider nicht studieren.
Meine freie Zeit gestaltete sich sehr ereignisreich. Bis zum Studienanfang jedenfalls hatte ich Speed gezogen, meine erste Ecstasy-Pille geschmissen und LSD probiert.
4. Eine geile und unbeschwerte Zeit
Kurz nach der Bundeswehrzeit bestand der Alltag aus Freunde treffen, Kino, weggehen, Basketball spielen, Leute besuchen und kiffen. Ich gelangte in neue Kreise und lernte neue Dealerwohnungen kennen. Manche wurden sehr gut frequentiert. Da saßen dann die Leute, warteten auf ihr Zeug, unterhielten sich oder testeten die Drogen. Ein Treffpunkt wurde mal ausgehebelt, weil den Nachbarn das ständige Kommen und Gehen komisch vorkam.
So aufstrebend mein Leben war, dauerte es nicht lange bis zur ersten richtigen Technoparty und den damit verbundenen Drogen. Umfelde prägen ganz schön. Und damals war ich recht labil. Es gab ja durchaus Leute, die auf Parties gingen und nichts nahmen. Bis zur Party eines Technomagazins in Arnstadt ging ich vorwiegend in Discos, Studentencafés oder Jugendclubs. Das war alles wie Spielen im Sandkasten. In Arnstadt wurde es dann ernst. Im Juli 1996 nahm ich das erste Mal LSD.
Die Party fand an einem Samstag im Sommer auf einem stillgelegten Bahnhofsgelände statt. Mit einem Kumpel schmiss ich einen „Miraculix“. Verführt wurde ich mit den Worten: „Ich habe keine Lust, den alleine zu nehmen.“ Neugierig stieg ich auf das Angebot ein.