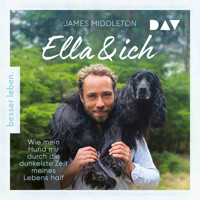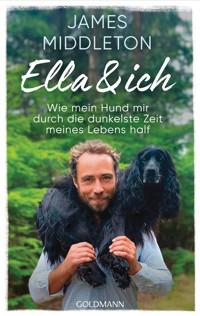
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kate Middletons Bruder erzählt von der außergewöhnliche Beziehung zu seiner Hündin Ella
»Ella und ich« erzählt von der außergewöhnlichen Verbindung zwischen James Middleton und seiner geliebten ersten Hündin Ella. Von ihrem ersten Kennenlernen, als James gerade zwanzig Jahre alt war, über ihre vielen Expeditionen, von schottischen Berghängen bis hin zu königlichen Hochzeiten, ist ihre Reise von Liebe, Loyalität und unerwarteten Schicksalsschlägen geprägt. Ella, die gut erzogene und treue Gefährtin, begleitete James viele Jahre und spielte sogar eine entscheidende Rolle bei der ersten Begegnung mit seiner zukünftigen Frau Alizee.
Jenseits der glamourösen Fassade des gesellschaftlichen Engagements und der unternehmerischen Erfolge verbirgt sich ein zutiefst persönlicher Bericht über James' Kampf gegen Depressionen. Durch bedingungslose Liebe entpuppt sich Ella als intuitive Freundin, die James' Stimmungen liest und ihm in seinen dunkelsten Stunden Trost spendet, zum Katalysator für seine Heilungsreise wird und ihm hilft, all das Gute in seinem Leben und seiner Zukunft zu sehen.
Berührend, ehrlich und lebensbejahend ist »Ella und ich« sowohl zutiefst berührend als auch wunderbar herzerwärmend. Eine Liebeserklärung an den besten Freund des Menschen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
In »Ella und ich« erzählt James Middleton von der außergewöhnlichen Verbindung zu seiner geliebten ersten Hündin Ella. Von ihrer ersten Begegnung zu ihren gemeinsamen Abenteuern – von schottischen Berghängen bis hin zu königlichen Hochzeiten – ist ihre Reise geprägt von Liebe, Loyalität und unerwarteten Herausforderungen.
Denn hinter der glamourösen Fassade seines gesellschaftlichen Engagements und unternehmerischen Erfolgs verbirgt sich James’ persönlicher Kampf gegen Depressionen. In diesen dunklen Zeiten wird Ella zu seiner intuitiven Freundin, die seine Stimmungen erkennt und ihm Trost spendet. Schließlich wird sie sogar zum Auslöser seiner Heilungsreise und hilft ihm, das Gute in seinem Leben und seiner Zukunft zu sehen.
Autor
James Middleton ist Unternehmer und Hundeliebhaber. Prinzessin Kates Bruder ist stolzer Botschafter der Wohltätigkeitsorganisation »Pets As Therapy« und arbeitet ehrenamtlich für die »Guide Dogs for the Blind Association« und den »Dogs Trust«. Auf seinem Instagram-Kanal @jmidy folgen ihm über 350 000 Fans. Seine Hündin Ella war viele Jahre seine treue Begleiterin und spielte sogar eine entscheidende Rolle bei James’ erster Begegnung mit seiner zukünftigen Frau Alizée. Er lebt mit seiner Familie in der britischen Grafschaft Berkshire, westlich von London.
James Middleton
in Zusammenarbeit mit Frances Hardy
Ella und ich
Wie mein Hund mir durch die dunkelste Zeit meines Lebens half
Aus dem Englischen von Anu Katariina Lindemann
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Meet Ella bei Octopus, London.
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von dem Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe Oktober 2025
Copyright © 2024 James Middleton
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Tatjana Barinov
Umschlag: UNO Werbeagentur, München nach einer Vorlage von Rachael Shone unter Verwendung von Bildmaterial von Alizée Middleton
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
LG ∙ CB
ISBN 978-3-641-33816-9V001
www.goldmann-verlag.de
Pour Alizée, ma femme chérie.
Für Inigo, du hast Ella nie kennengelernt, aber sie wusste, dass es dich gibt – schon bevor wir das wussten.
Und natürlich für Zulu, Inka, Luna, Mabel, Nala und Isla.
Inhalt
Prolog Meine dunkelste Nacht
Kapitel eins Kein Wesen ist zu klein
Kapitel zwei Ein winziges, blindes Bündel
Kapitel drei Ein Publikum von zwei Milliarden
Kapitel vier Neugeborene und ein Schicksalsschlag in Bucklebury
Kapitel fünf Ellas königlicher Rundgang
Kapitel sechs Mein Weg in den Abgrund
Kapitel sieben Ein Funken Hoffnung in der Dunkelheit
Kapitel acht Eine weihnachtliche Offenbarung
Kapitel neun Ella spielt Amor
Kapitel zehn Die heilende Kraft von Hunden
Kapitel elf Der Segen eines Vaters … und ein Heiratsantrag
Kapitel zwölf Ein Highland Loch-down … und ein eigenes Zuhause
Kapitel dreizehn Lieben und in Ehren halten
Kapitel vierzehn Neue Weiden
Kapitel fünfzehn Trauer, die zu tief ist, um sie in Worte zu fassen
Kapitel sechzehn Ein endgültiger Abschied … und ein Neuanfang
Kapitel siebzehn In liebevoller Erinnerung
Danksagung
Prolog Meine dunkelste Nacht
Jegliche Farbe ist aus meinem Leben gewichen. Ich existiere in einer schwarz-weißen Welt, die frei von Emotionen und Gefühlen ist. Ständig bin ich unruhig. Wenn ich irgendwohin gehe – zur Arbeit, zu einer Party, ins Kino – fühle ich mich gezwungen, kurz darauf wieder zu verschwinden. Doch selbst wenn ich das tue, fühle ich mich immer noch verloren. Ich bin ziellos, gehe auf und ab.
Von dieser ständigen Unruhe gibt es keine Pause. Es ist fast unmöglich, dieses Gefühl des Unbehagens zu beschreiben. Allerdings ist es weniger ein Gefühl als vielmehr das Fehlen von Gefühlen. Eine permanente Leere in meinem Inneren. Ich habe weder ein Ziel noch eine Richtung, kann weder Vergnügen, noch Aufregung oder Vorfreude empfinden.
In meinem Kopf höre ich ein ständiges Geräusch wie bei einem Radio, das sich nicht richtig einstellen lässt. Ein nervtötendes Knistern und Summen. Sobald ich das empfindliche Gleichgewicht gefunden habe und der Lärm nachlässt, reicht bereits das kleinste Zucken eines Muskels, um es wieder auszulösen. Es gibt kein Entkommen.
Ich bin hin- und hergerissen. Am liebsten würde ich den ganzen Tag im Bett bleiben, aber mein Herz rast dermaßen schnell, dass ich das Gefühl habe, dass es in meiner Brust zerspringen wird. Während ich da liege, ist es, als würde mir jemand ins Gesicht schreien, und die einzige Möglichkeit, diese Stimme zum Schweigen zu bringen, ist aufzustehen.
Aber auch wenn ich das tue, gibt es keinen Ort, an den ich fliehen kann, keine Pause vom schnellen Klopfen meines Herzens, dem Angriff auf meine Sinne.
Das Leben ist nicht mehr lebenswert, ich bin selbstmordgefährdet. Ich denke über verschiedene Möglichkeiten des Sterbens nach, damit ich endlich aus dieser schwindelerregenden Achterbahn aussteigen kann, die mich an den Rand des Wahnsinns treibt.
Ich kann nicht schlafen, weil sich mein Geist in Aufruhr befindet. Die Schlaflosigkeit ist beängstigend, ich bin völlig erschöpft.
Ich fühle mich missverstanden, ich bin ein absoluter Versager. Dieses Gefühl der Wertlosigkeit und Verzweiflung, der Isolation und Einsamkeit würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen. Ich glaube, ich werde noch verrückt.
Und doch weiß ich, dass ich privilegiert bin. Zudem habe ich das Glück, eine liebevolle und eng verbundene Familie zu haben – meine Eltern, meine Schwestern Catherine und Pippa sowie ihre Ehemänner William und James. Aber ich stoße alle weg, reagiere nicht auf ihre Anrufe, E-Mails werden ignoriert, Einladungen nicht beachtet. Ich verstecke mich hinter einer doppelt verriegelten Tür und bin für niemanden erreichbar.
In einer trostlosen Novembernacht im Jahr 2017 erreiche ich meinen Tiefpunkt. Es ist circa zwei Uhr morgens und ich kann nicht schlafen. Seit Tagen habe ich kaum etwas zu mir genommen, und wenn ich doch etwas esse, dann verstopft es meinen Hals und ich muss würgen. Ich laufe durch die Wohnung, in der ich allein lebe. Die vier Wände, die mich einsperren, scheinen immer näher zu kommen. Ich habe das Gefühl zu ersticken, verzweifelt ringe ich nach Luft.
Am liebsten würde ich nach draußen gehen, aber ich fürchte mich davor, auf der Straße auf irgendwelche Nachtschwärmer zu treffen.
Oben an meiner Treppe befindet sich eine Luke, die zu einem Flachdach führt, auf dem sich die Wassertanks befinden. Einmal ging ich raus, um ein Problem mit dem Warmwasser zu beheben. In glücklicheren Zeiten bin ich durch diese Öffnung im Dach rausgeklettert und habe den Sonnenuntergang über der atemberaubenden Skyline von London beobachtet oder mir das Feuerwerk über dem Fluss angesehen.
Heute will ich vor mir selbst fliehen, also ziehe ich die Teleskopleiter aus, klettere hoch und schwinge mich aufs Dach.
Ich stehe einfach nur da und blicke auf London. Vor mir liegt unsere majestätische Hauptstadt – glitzernde Lichter, charakteristische Gebäude, die langsam mäandernde Themse –, aber jetzt gerade sehe ich ihre Schönheit nicht.
Ich gehe auf und ab, aber es gibt keine Atempause von dieser Qual in meinem Kopf. Dunkle Gedanken bedrängen mich. Was kann ich nur tun, damit das endlich aufhört?
Ich denke darüber nach, vom Dach zu springen. Wer würde mich wohl finden? Ein vorbeifahrender Taxifahrer? Ein Nachbar?
Könnte es als ein tragischer Unfall ausgelegt werden, wenn ich springe? Auf diese Weise würde meiner Familie, auch wenn sie natürlich verzweifelt trauern würde, die Qual des Wissens erspart bleiben, dass ich mein Leben selbst beendet habe.
Während ich auf und ab gehe, schaue ich durch das Dachfenster hinunter und sehe die mich sanft anblickenden Augen meines Spaniels Ella, die zu mir aufschaut. Genauso wie ich, ist auch sie die ganze Nacht wach. Sie spürt meinen seltsamen, aufgewühlten Gemütszustand. Allerdings kann sie die Leiter nicht hochklettern, das würde ich aber auch nicht wollen. Es ist zu gefährlich auf dem ungeschützten Dach ohne Geländer. Aber Ella steht am Fuße der Leiter und fleht mich mit ihrem Blick an herunterzukommen.
Ich mache ein paar Schritte, schaue wieder nach unten. Meine geliebte Ella ist immer noch da. Empfinden Hunde eigentlich jemals Verzweiflung, frage ich mich, oder ist das eine seltsame Fehlfunktion des menschlichen Geistes? Dann stelle ich mir mein Leben ohne sie vor, diese Gedanken lassen mich innehalten.
Was würde Ella ohne mich tun? Sie verlässt sich auf mich und ich mich auf sie. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit.
Ich gehe wieder auf und ab, für eine Stunde oder so, aber finde keinen Trost in der frischen Luft. Das Unbehagen, das ich verspüre, ist so viel schlimmer als der körperliche Schmerz. Es hört einfach nicht auf und wird auch nicht schwächer. Lautlos verzerrt es die Person, die ich bin. Es ist eine Zerstörung des Geistes.
Ich blicke wieder die Leiter hinunter. Ella hat sich nicht bewegt. Mit ihren braunen Augen starrt sie mich immer noch aufmerksam, gefühlvoll und flehend an, und als ich sie wieder ansehe, wird es in meinem Kopf allmählich ruhiger. In dem Moment weiß ich, dass ich nicht springen werde. Was würde mit Ella passieren, wenn ich sterbe? Wie lange würde sie allein in der Wohnung warten, bis jemand sie findet?
Ich habe sie schon von ganzem Herzen geliebt, seitdem sie ein winziger, blinder, neugeborener Welpe war. Sie war meine Gefährtin, Hoffnung, Unterstützung in meinen dunkelsten Tagen. Bedingungslos und treu hat sie mich immer geliebt. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, liegt sie neben mir auf dem Bett, begleitet mich durch die trostlosen Stunden vor der Morgendämmerung.
Selbst wenn ich das Gefühl hatte, dass die Mühen des Lebens den Aufwand nicht wert sind, bin ich trotzdem immer mit ihr spazieren gegangen und habe sie gefüttert. Sie gibt mir einen Sinn, einen Grund zu leben.
Wie kann ich überhaupt darüber nachdenken, sie jetzt allein zu lassen? Was würde sie denn ohne mich tun?
Plötzlich merke ich, dass ich in der kalten Winterluft zittere, denn ich trage nur einen Pyjama. Es ist, als ob für eine Sekunde die Realität eingedrungen wäre. Ich ziehe mich vom Rand zurück, klettere langsam die Leiter hinunter und streichle über Ellas seidenweiches Köpfchen.
Sie ist der Grund, warum ich diesen fatalen Sprung nicht mache. Sie ist Ella, die Hündin, die mir das Leben gerettet hat.
Kapitel eins Kein Wesen ist zu klein
Ich habe Tiere schon immer als angenehmere Gefährten empfunden als Menschen. Als Kind habe ich Tom, unseren Familienkater, in einen Weidenkorb auf mein Fahrrad gesetzt und bin mit ihm zu den Dorfläden geradelt.
Ich habe Eier zum Ausbrüten in unseren Trockenschrank gelegt und die kleinen Küken dann liebevoll in meinen Händen gehalten, sie mit Mais gefüttert, bis sie zu einer Schar gackernder Hühner herangewachsen waren.
Mein erstes Haustier, ein Hamster namens Hammy, begleitete mich überallhin in meiner Tasche. Er flüchtete ständig und huschte hinter den Kühlschrank oder in die Speisekammer, bis mein leidgeprüfter Vater es irgendwann satthatte, andauernd Rettungsaktionen zu starten, und mich anflehte, Hammy im Käfig zu lassen.
Als Hammy starb – meine erste, niederschmetternde Begegnung mit der Sterblichkeit –, bettelte ich um einen Ersatz. Auf dem Heimweg von einem Dorffest, wo sie Hamster für 50 Pence verkauften, flehte ich meine Mutter um Geld an, damit ich mir ein Pärchen kaufen konnte – einen Bruder und eine Schwester, die Freunde sein sollten.
Ich kann mich immer noch an den schmeichelnden Tonfall erinnern, den ich benutzte. »Bitte, bitte, kann ich sie haben, Mum?« Ich hatte ja auch schon den Käfig und das Futter, argumentierte ich. Also gab meine Mutter schließlich nach. »Ja, du kannst sie haben«, seufzte sie leicht entnervt.
Also radelte ich atemlos vor lauter Aufregung zu dem Volksfest zurück und suchte mir die Geschwister aus, ein Mädchen und einen Jungen (oder zumindest glaubte ich das), die den Platz meines verstorbenen Hamsters einnehmen sollten.
Tatsächlich hatte ich in meiner begeisterten Vorfreude und vor lauter Aufregung etwas übersehen: Die »Hamster«, so stellte sich heraus, waren in Wirklichkeit Meerschweinchen und darüber hinaus beide Männchen. Ich nannte sie Max und Harry.
Aber meine unendlich geduldigen Eltern akzeptierten unsere unerwarteten Nagetier-Adoptivkinder, wir besorgten einen größeren Käfig, und sie lebten sich in Bucklebury, unserem Familienhaus in Berkshire, gut ein. Als ich sieben Jahre alt war, gab es noch mal Zuwachs, und das Kaninchen Jess gesellte sich dazu.
Jess und ich bauten eine vertrauensvolle Beziehung auf. Ich brachte ihr bei, sich hinzuhocken und sitzen zu bleiben, und sie lernte, ihren Namen zu erkennen und darauf zu reagieren. Sie lief sogar an der Leine und hoppelte neben mir her, wenn ich zu den Geschäften ging. Für diesen außerordentlichen Gehorsam belohnte ich sie mit einer Karotte. Diese frühen Begleiter brachten mir bei, Tiere immer besser zu verstehen. Ich schloss sie zunehmend in mein Herz und mein Mitgefühl weitete sich auf das gesamte Tierreich aus.
Eine sterbende Maus, die sich im Schwimmbad der Schule abzappelte? Ohne zu zögern, würde ich ins Wasser springen, um sie rauszuholen. Wenn sich ein Vogel den Flügel brach, würde ich ihn pflegen, ihn im Trockenschrank wärmen, ihn mit einer Pipette füttern und zur nächstgelegenen Tierschutzorganisation bringen. Kein Tier – so verzweifelt es auch sein mochte – wurde im Stich gelassen. Kein krankes Wesen war zu viel Mühe.
Tatsächlich wurde es in meiner Schule St Andrew’s in Pangbourne zu meiner Mission, jedes Lebewesen in Not zu retten: Käfer, die auf den Rücken gefallen waren und sich nun abstrampelten, wurden von mir sanft wieder auf die Beine gestellt; und Spinnen, die aus Badewannen herausgeholt wurden, ließ ich in Holzhaufen frei, wo sie wieder nach Maden und Fliegen suchen konnten.
Heute denke ich, dass meine Lehrer wegen meinen karitativen Rettungsaktionen ziemlich genervt gewesen sein müssen, besonders wenn langwierige Verhandlungen mit Tierschutzorganisationen die Folge waren. Wie viele unterkühlte Mäuse konnte die RSPCA – die königliche Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeiten an Tieren – aufnehmen? Wie viele sterbende Amseln? Unnötig zu erwähnen, dass ich mit allen Personen, die dort arbeiteten, per Du war.
Meine Schwestern Catherine und Pippa sind fünf beziehungsweise drei Jahre älter als ich. Mit drei starken Frauen aufzuwachsen, gab mir immer das Gefühl, als hätte ich drei Mütter, und ich konnte mich stets auf den Rat von Catherine und Pippa verlassen.
Sie haben mich nie nur als ihren kleinen Bruder abgetan, der ihrer Aufmerksamkeit nicht würdig war. Im Gegenteil – sie ließen mich an ihren Spielen teilnehmen und nahmen mich in ihren Freundeskreis auf, das tun sie bis heute. Während wir zusammen zur Schule gingen, machten sie ständig einen ziemlichen Wirbel um mich und berichteten hinterher unseren Eltern von meinen vielen (kleinen) Vergehen – mehr aus Sorge, als dass sie mich verpetzt hätten.
Für mein ordentliches Äußeres war ich nie bekannt. Wenn ich von einem Spaziergang mit einem geliehenen Hund zurückkehrte, steckte mein Hemd nicht in der Hose, meine Hände waren mit Schlamm verschmiert, und in meinen Haaren hatte sich Gestrüpp verfangen. Ich wurde gemaßregelt und erhielt einen negativen Eintrag. Diese sammelten sich bei mir an und konnten nur durch gute Einträge aufgehoben werden. Natürlich schafften es Catherine und Pippa, die beide vorbildliche Schülerinnen waren, ihr ganzes Schulleben hindurch, keinen einzigen vermerkten Fehler zu machen, aber ich sammelte in jedem Schuljahr eine ganze Menge davon.
Das System funktionierte folgendermaßen: Da schlechte Einträge durch gute ausgeglichen wurden, schien es, als würde jedes Lob, das meine Schwestern erhielten, durch mein Fehlverhalten zunichtegemacht werden.
Während die weiblichen Middletons also dafür gelobt wurden, dass sie den Lehrern halfen – sie öffneten Türen und trugen Bücher für sie – machte ich all ihre guten Taten zunichte, indem ich zum Beispiel durch den Korridor rannte, anstatt zu gehen, weil ich mal wieder zu spät zum Unterricht kam. (Zwei schlechte Einträge zum Preis von einem.) Und während Catherine und Pippa im Diktat immer die volle Punktzahl und für Aufsätze Bestnoten erhielten, hinkte ich in beiden Fällen hinterher und sammelte stattdessen eine Menge Einträge für meine unterdurchschnittlichen schulischen Leistungen.
Das Endergebnis war, dass die Middletons am Ende eines jeden Trimesters, wenn die Einträge – positive und negative – für jede Familie zusammengezählt wurden, keinen besonderen Eindruck schinden konnten.
In meinen Zeugnissen wurden meine schulischen Defizite festgehalten, aber es gab immer auch eine trockene Randbemerkung, eine sanfte Anspielung auf meine Affinität zum Tierreich.
Wenn James bei seiner Schulausbildung doch nur genauso viel Einsatz zeigen könnte wie bei seinem Engagement für Tiere … schrieben meine Lehrer seufzend.
Aber ich war gar nicht absichtlich undiszipliniert, sondern einfach nur ein bisschen schelmisch. Einer meiner Lehrer, Mr. Outram, besaß einen Golden Retriever; ein anderer, Mr. Embury, einen Pudel. Ich wollte unbedingt mit beiden Hunden Gassi gehen und dachte, dass man mir mein Verantwortungsbewusstsein und meine Hilfsbereitschaft bestimmt hoch anrechnen würde.
Das Problem war jedoch, dass ich immer zu spät zum Unterricht kam, weil ich so sehr in meine Abenteuer mit den Hunden im Wald vertieft war, sodass ich einfach vergaß, nach der Pause rechtzeitig zurückzukommen.
Erst wenn ich die Glocke läuten hörte, würde ich atemlos, mit einem schmutzigen Hund im Schlepptau, zurückhetzen. Aber ich war bereit, mich dem unvermeidlichen negativen Eintrag zu stellen. Trotzdem hielten mich die Lehrer für vertrauenswürdig genug, um mich ihre Hunde wieder ausführen zu lassen, und das stärkte mein Selbstvertrauen.
Ich glänzte damit, und in meinem letzten Jahr erhielt ich sogar den sogenannten »Headmaster’s Prize« – eine Auszeichnung, die einem gutmütigen Jungen verliehen wurde, der zwar niemals mühelos mit einer Reihe guter Prüfungsergebnisse an die Universität gehen würde, aber dafür sein Leben riskiert, um ein sterbendes Tier nicht im Stich zu lassen.
In schulischer Hinsicht hinkte ich jedoch jämmerlich hinterher. Deshalb versuchte ich, verzweifelt diesen Mangel wieder wettzumachen, indem ich als verantwortungsbewusst angesehen wurde. Denn die Wahrheit war, dass ich, solange ich mich nicht beweisen konnte, auch nie den eigenen Hund haben würde, nachdem ich mich so sehnte.
Bis ich einen eigenen Hund kriegen würde, war jedes andere Tier nur ein Ersatz. Aber ich machte das Beste aus der Zeit mit den Tieren, die mir anvertraut wurden. Und ich verfeinerte meine Fähigkeiten als potenzieller Hundetrainer an meinem Kaninchen.
Manchmal kam mir der Gedanke, dass ich als Tier bestimmt glücklicher wäre. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich mich als Vierjähriger sogar hingehockt habe, um das Katzenfutter aus dem Napf, der auf dem Boden stand, zu essen. (Dafür erhielt ich eine heftige Standpauke.)
Ich bettelte meine Eltern ständig um einen Hund an. Sie waren dagegen, aber ich gab mein Bestes, um mich für andere Hundebesitzer unentbehrlich zu machen, und bot meine Hilfe zum Gassigehen an, wann immer ich gebraucht wurde.
Ich freundete mich mit jedem Hund im Dorf an. Als unsere Nachbarn wegzogen und ihren Rottweiler mitnahmen – ein riesiges, sabberndes Tier, mit dem ich furchtlos in ihrer Küche rang –, war ich untröstlich. Bis neue Nachbarn mit zwei liebenswerten schwarzen Labradoren einzogen, die meine neuen Spielkameraden wurden.
Ich vergötterte Gibson, die britische Bulldogge meiner Großeltern. Wenn wir sie besuchten, würde ich ins Haus stürmen, die alten Leute würde ich dabei kaum zur Kenntnis nehmen, sondern sofort mit dem Hund zu einer Drachenflug-Expedition oder zu einem Angelausflug davoneilen.
Dass ein Hund ein treuer Begleiter werden konnte, eigentlich eine Erweiterung von mir selbst, wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, als ich die Fünf Freunde-Bücher las. Ich schloss George und ihren Mischling Timmy ins Herz – ein Hund, so treu, klug und liebevoll, dass zwischen ihnen eine unzertrennliche Bindung entstand.
In dieser Fantasiewelt konnte ein Vierbeiner sein Kind zum Internat begleiten. In meiner realen Welt würde das nie passieren, aber ich konnte es mir zumindest wünschen und hoffen.
Da ich ein paar Jahre jünger als meine Schwestern bin, ging ich noch zur Prep School (eine Privatschule, die auf das College vorbereitet), als sie ihren Abschluss für das Marlborough College machten. Und jedes Mal, wenn ich zu einem ihrer Sportwettkämpfe mitgeschleppt wurde, schlich ich mich heimlich davon und bettelte die Frau des Schulleiters an, mit ihrem wunderschön gepflegten Bobtail einen Spaziergang über das Gelände machen zu dürfen.
Diese harmlos klingenden Spaziergänge eskalierten allerdings in Abenteuer im Fünf Freunde-Stil (obwohl es sich in unserem Fall eher um ein unerschrockenes Duo handelte). Beim Schlusspfiff, als meine Schwestern triumphierend oder enttäuscht von ihren sportlichen Leistungen das Spielfeld verließen, tauchte aus einem nahe gelegenen Wäldchen eine schmutzige, schlammbefleckte Gestalt auf – halb Mensch, halb Hund –, nachdem wir in der letzten Stunde achtlos durch Pfützen und Bäche gelaufen waren.
An den Ausdruck amüsierter Verzweiflung auf dem Gesicht der Frau des Schulleiters kann ich mich noch genau erinnern. »Oh James«, würde sie seufzen und ihren preisgekrönten Hund in Empfang nehmen. »Ich glaube, ihr braucht jetzt beide ein Bad.«
Inzwischen war aus meinem Verlangen nach einem eigenen Hund eine schmerzende Sehnsucht geworden. Ich wollte einen Begleiter bei meinen Abenteuern. Jemanden, der mich in traurigen Zeiten tröstete. Ich sehnte mich nach einem Freund, der mich bedingungslos liebte – ohne mich zu verurteilen oder sich über mich lustig zu machen. Weil ich ein ungewöhnlicher Junge war. Sosehr ich mich auch bemühte, ich konnte mich einfach nicht für Fußball begeistern – weder fürs Zuschauen noch fürs Spielen – und würde lieber an einem Traktor herumbasteln, als einem Ball hinterherzurennen.
Meine größte Leidenschaft waren Tiere, von meiner frühesten Kindheit an. Wenn ich nicht Legastheniker und mein Geist kein brodelnder Kessel voller unruhiger Energie gewesen wäre, was es mir fast unmöglich machte, mich auf Schulaufgaben zu konzentrieren, dann wäre ich gerne Tierarzt geworden. Aber ich wusste, dass ich das nie schaffen würde.
Eigentlich ist es ironisch, dass meine Eltern schließlich meinem ständigen Bitten nach einem eigenen Hund nachgaben, als ich dreizehn war und kurz davor stand, aufs Internat zu gehen. Zu meiner unendlichen Freude kam Tilly, ein Golden-Retriever-Welpe, zu uns, und obwohl sie ein Familienhund war, war es keine große Überraschung, dass sie eher »mein« Hund wurde. Dieses übermütige Energiebündel mit der feuchten Nase war alles, wonach ich mich je gesehnt und was ich mir je gewünscht hatte. Und doch kam sie ausgerechnet dann, als ich unser Zuhause verließ.
Als ich ihr Köpfchen mit dem seidenweichen, goldfarbenen Fell streichelte und mich unter Tränen von ihr verabschiedete, bevor ich zu meinem ersten Tag am Marlborough College aufbrach, war ich unendlich traurig.
In der Schule hatte ich Heimweh – die Sehnsucht manifestierte sich als körperlicher Schmerz. Ich fieberte dem Wochenende entgegen, wenn ich wieder in Bucklebury sein und Tilly in meine ausgestreckten Arme springen würde.
In diesen ersten Tagen im Internat fühlte ich mich verloren. Ich vermisste meine Freunde, die ich in der Prep School kennengelernt hatte und die meine Exzentrizitäten, meine obsessive Tierliebe und mein Desinteresse gegenüber Fußballergebnissen akzeptierten und verstanden.
Außerdem musste ich in Marlborough ganz von vorne anfangen. Keiner wusste etwas von den Macken des etwas zu dürren Middleton-Jungen, der im Gefolge seiner beiden perfekten großen Schwestern gekommen war.
Man ging davon aus, dass ich in sportlicher Hinsicht genauso talentiert war wie sie, und ich wurde automatisch in die erste Rugby-Mannschaft der Schule gesteckt. In meinem Debütspiel wurde ich allerdings so spektakulär geschlagen, dass ich anschließend sofort in eine viel niedrigere Liga zurückgestuft wurde. Kommentare wie »Bist du wirklich ein Middleton?« hallten durch die Umkleidekabine und übers Spielfeld. Solche Sprüche nahm ich mir sehr zu Herzen, und mein Selbstvertrauen – das während der Prep School noch ganz gut gewesen war – schwand in dieser intoleranten Umgebung.
Weil ich sensibel und verletzlich war, war ich auch ein leichtes Ziel für Hänseleien und Spott. Es gibt einen schmalen Grat zwischen gut gelaunten Scherzen und Mobbing, und ich möchte mich nicht als Opfer darstellen, aber ich glaube, dass mich einige der Jungen fertigmachen wollten.
Im riesigen Speisesaal von Marlborough mussten wir unsere Tabletts – beladen mit Besteck, Geschirr und Wasserglas – nach dem Essen zu einem Fließband bringen. Hin und wieder war jemand unvorsichtig und stolperte, worauf der Inhalt seines Tabletts durch die Luft flog. Das Krachen, wenn Teller, Schüsseln, Messer und Gabeln auf den Boden fielen, hallte in dem höhlenartigen Raum wider.
Bei einem Mittagessen stellte mir, als ich gerade mein Tablett zurückbrachte, ein älterer Junge absichtlich ein Bein, und ich flog mit dem Kopf voran darüber, knallte auf den Boden, mein Tablett segelte durch die Luft und fiel dann krachend zu Boden. Im Saal brach sarkastischer Applaus aus, und alle Köpfe drehten sich, um zu sehen, wer der Tollpatsch gewesen war.
Mit hochrotem Kopf sammelte ich alles zusammen und machte mich dann schnell aus dem Staub. Ich war gedemütigt – so wie es mein Peiniger beabsichtigt hatte. Ich kannte den Jungen. Er hatte Pippa daten wollen, aber sie hatte ihm einen Korb gegeben. Dies war seine Art, sich zu rächen. Es gab jedoch einen Trost: Ich wusste, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte und ohne ihn viel besser dran war.
Heute frage ich mich, ob mich mein übergroßer Wollblazer wohl auch zur Zielscheibe gemacht hat. Ich war ein schmächtiger Junge, der durch ein Kleidungsstück, das mehrere Nummern zu groß war, noch zwergenhafter aussah. Meine Mutter hatte mir den Blazer gekauft, damit ich noch »hineinwachsen« könnte. Tatsächlich trug ich ihn jedoch bis zur sechsten Klasse, bis er so eng wie eine Wursthaut war. Und eines Morgens saß ich in der Kapelle, eingehüllt in dieses riesige Kleidungsstück.
Der Gottesdienst schritt voran und wir kamen zum Gebet. Während ich auf der Kirchenbank saß, den Kopf in innerer Einkehr gesenkt, wurde die Stille plötzlich durch ein schrilles und eindringliches Piepen durchbrochen.
Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, wo der Lärm herkam: aus der Tasche meines Blazers! Ein Witzbold hatte einen Wecker reingetan, und da er genau wusste, wann die stillen Gebete beginnen würden, hatte er den Wecker so gestellt, dass dieser genau dann losgehen würde. Und um es noch schlimmer zu machen, hatte er die Taschenöffnung zugepinnt, sodass ich mich erst recht abmühen musste, um den Wecker herauszuholen und den Alarm auszuschalten.
Ich war völlig fertig. Entsetzt sah der Kaplan zu mir herüber. Alle Leute in der Kapelle drehten sich zu mir um und starrten mich an.
Natürlich war es nicht meine Schuld, aber ich wurde trotzdem dafür bestraft: ein rosa Verweis – eine Verwarnung für das schlimmste Vergehen – wurde ausgestellt, und ich musste um sieben Uhr morgens eine Meile zum Wedgwood Stone laufen, der zum Gedenken an Allen Wedgwood so genannt wird, der 1915 in Gallipoli getötet wurde.
Aber eigentlich war diese Strafe überhaupt nicht schlimm für mich. Ich genoss sogar den frühmorgendlichen Lauf an der frischen Luft. Später schloss ich Freundschaften, indem ich Schüler, die einen rosa Verweis bekommen hatten, bei ihren frühmorgendlichen Laufrunden zum Denkmal begleitete. Einfach nur so aus Spaß. Tatsächlich hat mich das zu der widerstandsfähigen Person gemacht, die ich heute bin.
Aber in diesen frühen Jahren, als ich noch dabei war, mich zurechtzufinden, war ich oft unglücklich, und mein Trost – wenn Tilly nicht bei mir war – waren Spaziergänge mit den Hunden eines Lehrers – dem braunen Labrador Maddie und Owen, einem Border Collie. Wann immer ich Zeit hatte, klopfte ich an sein Küchenfenster und bettelte, mit den Hunden spazieren gehen zu dürfen. Sie waren meine Begleiter bei den fantastischen, imaginären Abenteuern, die ich mir ausdachte.
Die Hunde begannen, mich immer mehr zu mögen, und folgten mir überallhin. Wenn ich dazu gezwungen wurde, bei einem Fußballspiel mitzumachen, stürmte Maddie voller Hoffnung mit einem Stock im Maul auf das Spielfeld und direkt auf mich zu, um dann dort stehen zu bleiben. Sie ignorierte den Spott der anderen Jungen und wartete darauf, dass ich den Stock werfen würde.
Also würde ich das Spiel unterbrechen, um den Stock zu werfen, was mich bei meinen Mannschaftskollegen nie besonders beliebt machte, die nur gewinnen wollten. Und es gab Schulregeln, gegen die ich auch ganz offenkundig verstieß, weil ich Owen dazu ermutigte, mir ins Internat zu folgen. Ich hoffte sogar, dass man ihn nicht vermissen würde, wenn er sich nachts am Fußende meines Bettes zusammenrollte. Aber natürlich wurde er vermisst und wir bekamen beide eine scharfe Verwarnung.
Es war 2001, das Ende der Weihnachtsferien meines ersten Internatsjahres, und meine Mutter, Pippa und ich hatten uns aufgemacht, damit ich mir die Haare schneiden lassen konnte und um mir Turnschuhe fürs neue Schuljahr zu kaufen, als ich mir den Knöchel brach – unglamouröserweise, indem ich von einem erhöhten Bordstein in einem Parkhaus stolperte.
Meine Mutter und Pippa warteten im Wagen, während ich auf Mums Bitte hin die Parkgebühr bezahlen wollte. Ich rannte zur Parkuhr, schätzte die Höhe des Bordsteins falsch ein und knickte mit dem Fuß um. Danach humpelte ich zurück zum Auto.
Weder meine Mutter noch meine Schwester zeigten besonders viel Mitgefühl, als ich mich während der Fahrt ständig über die Schmerzen beklagte – bis wir nach Hause kamen und ich meine Socke auszog, um einen dunkelvioletten Bluterguss zu enthüllen, der sich über meinen ganzen Fuß ausgebreitet hatte. Nachdem sie mich an dem Abend ins Krankenhaus gefahren hatte, brach meine arme Mutter in Tränen aus, als auf der Röntgenaufnahme deutlich wurde, dass der Fuß gebrochen war.
»Es tut mir ja so leid, dass ich gar kein Mitgefühl für dich hatte«, entschuldigte sie sich und machte sich bereits Sorgen, wie schwierig es für mich sein würde, auf Krücken in der Schule zurechtzukommen. Aber tatsächlich war es dann sogar noch schlimmer, weil die Krücken von einem Mitschüler geklaut wurden, sodass ich herumhüpfen musste, bis schließlich ein Lehrer eingriff und sie für mich zurückholte.
Das Leben – stellte ich mit jugendlicher Resignation fest – war nicht fair, aber ich lernte Mitgefühl und Sensibilität und bot Mobbern die Stirn, die andere Jungen schikanierten.
Unsere Schule ermutigte uns, furchtlos zu sein. Es gab viele abenteuerlustige Malburianer: Frank Bickerton, ein Absolvent zur Wende des 20. Jahrhunderts, war ein Arktisforscher, Schatzsucher, Soldat, Luftfahrer, Unternehmer und Filmemacher.
Dann gab es noch Dr. David Pratt, dessen unschätzbarer Beitrag zur transarktischen Expedition im Jahr 1955 ihm eine Polar-Medaille einbrachte. Näher an meiner Zeit waren der Entdecker und Schriftsteller Redmond O’Hanlon aus den sechziger Jahren und der Bergsteiger Jake Meyer, der jüngste Brite, der den Mount Everest bestiegen hat.
Ich würde mir nicht anmaßen, mich mit einer dieser angesehenen Persönlichkeiten zu vergleichen, aber ich kann sagen, dass ich mir während der Schulzeit einige »Fähigkeiten« aneignete, wie zum Beispiel: als Handwerker oder nächtlicher Entdecker, und ich war ziemlich gut darin, mich unauffällig aus dem Staub zu machen.
Während einer Stunde in Design und Technologie klaute ich einen Schraubenzieher und benutzte ihn später, um die Sicherheitsschlösser an den Fenstern unseres Schlafsaals aufzuschrauben. Dann kam mir eine Idee: Ich würde eine Strickleiter basteln.
Ich kam auf einen kühnen – und etwas heiklen – Plan, um die nötigen Materialien aus dem Design-und-Technologie-Lagerraum zu beschaffen. Ich baute einen zusammenklappbaren Gartenschirm (ein völlig legitimes Projekt für eine Prüfung) mit vielen Flaschenzügen und Seilen und bat um etwas mehr Seil als nötig, damit ich den Rest für die Leiter benutzen konnte.
Nachdem ich das überschüssige Seil in meinem Rucksack aus der Werkstatt geschmuggelt hatte, machte ich mich an die Arbeit, es zu knüpfen und zu binden, damit es das Gewicht eines heranwachsenden Jungen tragen konnte.
Mein Plan war, es nachts aus dem offenen Fenster hängen zu lassen, damit jeder im Schlafsaal – mit Ausnahme der Person, die ausgewählt wurde, um dazubleiben und Wache zu halten – einen Nachtspaziergang machen konnte.
Mehrere Wochen lang schafften wir das ziemlich erfolgreich, ohne dabei erwischt zu werden. Allerdings war ich als Einziger dazu in der Lage, Maddie und Owen zu beruhigen und sie dazu zu bringen, wieder still zu sein, wenn sie bei unserer »Flucht« anfingen zu bellen.
Leider muss ich sagen, dass wir auf diesen nächtlichen Spaziergängen nichts Verruchtes anstellten – wir wanderten im Schutz der Dunkelheit einfach nur durch Wälder und Felder, und das war aufregend genug. Aber zwangsläufig wurden wir eines Nachts schließlich doch entdeckt. Panisch rief uns unser Beobachtungsposten an und teilte uns mit, dass es eine Bettenkontrolle geben würde, also rannten wir alle zurück, kletterten die Strickleiter hoch und warfen uns auf unsere Matratzen, bevor der Lehrer vorbeikam, um seine Runden zu drehen.
Aber in unserer Eile, durch das Fenster zurückzuklettern, vergaß der letzte Junge, die Strickleiter wieder hochzuziehen, und am nächsten Morgen fiel das einem Lehrer auf.
»Wo kommt diese Leiter her?«, fragte er uns.
»Nun, ich habe sie gemacht, Sir«, gestand ich, gab aber nur das Nötigste preis.
Daraufhin wurde ich für ein paar Tage suspendiert, aber eigentlich gab es keine richtige Strafe: Meine Eltern machten gerade Urlaub und ich konnte nicht nach Hause geschickt werden.
Heute, als Erwachsener, erkenne ich den liebenswürdigen kleinen Schlingel, der ich war. Ich versuchte immer, aus dem Klassenzimmer auszubüxen, in dem ich mich gefangen fühlte.
Ich hasste es, drinnen eingesperrt zu sein. Lernen war mir ein Gräuel und das geschriebene Wort war für mich verwirrend, sogar beunruhigend. Worte hüpften und verschwammen auf der Seite. Wenn ich an der Reihe war, im Unterricht etwas vorzulesen, hatten meine Versuche keine Ähnlichkeit mit den gedruckten Sätzen vor mir. Ich erinnere mich noch an das Gelächter im Raum, wenn ich Wörter falsch vorlas und über die Aussprache stolperte. Wenn ich vor meiner Unfähigkeit kapitulierte, die Buchstaben zu entschlüsseln, und buchstäblich eine Geschichte erfand.
Ich war ein Außenseiter. Und obwohl ich die Fußballergebnisse verfolgte und mich dazu zwang, die Namen von Trainern und Spielern zu lernen, hatte ich Angst davor, mich dem Smalltalk meiner Klassenkameraden anzuschließen, weil ich befürchtete, dass sie meine Bemühungen durchschauen und sich über meine Dummheit lustig machen würden.
Meine Interessen unterschieden sich auch von denen der anderen. Während die meisten Jungen ihre Wände mit Postern von Fußballmannschaften oder Mädchen im Bikini beklebten, hingen an meinen Wänden Bilder von Landrovern und Motoren. Ich hortete alte Autoteile und radelte zur örtlichen Werkstatt, um aufmerksam dabei zuzuschauen, wie der Mechaniker an den schmierigen Maschinen herumbastelte.
Diese Vorlieben entfremdeten mich noch mehr von meinen Klassenkameraden. Aber Hunde haben mich nie verurteilt. Meine Mutter fragte mich immer wieder, ob ich nicht Freunde übers Wochenende mit nach Hause bringen wollte. Aber ehrlich gesagt wollte ich nur Tilly sehen.
Wenn meine Mutter mich an den Freitagen, an denen wir nach Hause durften, mit dem Auto von der Schule abholte, hatte sie immer viele Fragen darüber, wie meine Woche gewesen war. Aber ich ignorierte das und fragte stattdessen nach unserer Hündin Tilly. Was hatte sie gemacht? Hatte sie mich vermisst? Ich würde zu Tilly in den Kofferraum springen, die Fahrt neben ihr verbringen und während der ganzen Heimfahrt mit ihr reden.
Während meiner Teenagerjahre blühen meine beiden Vorlieben auf – Hunde und alles, was mechanisch ist. Einige Wochen, bevor ich achtzehn werde, im Frühjahr 2005, fragt mich mein Vater, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich darf wählen: entweder einen kleinen gebrauchten Peugeot 206 oder einen heruntergekommenen alten Traktor. Einen Traktor? Ja, tief in seinem Inneren weiß er, dass ich mich für diese skurrile Option entscheiden werde – und das tue ich dann auch.
Also fahren wir nach Devon. Es ist so ein richtiger Vater-Sohn-Roadtrip, und wir machen uns bereits im Morgengrauen auf den Weg, um den Bauernhof zu finden, auf dem das geschätzte alte Gerät zum Verkauf angeboten wird.
Als wir dort ankommen, ist der Besitzer – ein kräftiger, robust aussehender Kerl – den Tränen nahe. Schweren Herzens trennt er sich von seinem rostigen alten Traktor und erklärt uns, dass er ihn bereits besessen hat, als er noch ganz neu war. Der Papierstapel, den er uns dann reicht, dokumentiert seine gesamte Servicehistorie. Der Traktor hat auch noch sein originales Nummernschild. Und obwohl er dringend eine neue Lackierung braucht, springt er sofort an. Der Motor hat ein schönes Schnurren.
Dad und ich laden ihn auf den Anhänger. Als wir zurück nach Berkshire fahren, durch die Gassen mit den strahlenden Wildblumen, denke ich, wie begeistert ich von meinem Geschenk bin. Catherine und Pippa bekamen wunderschönen Schmuck, als sie achtzehn wurden. Ich bekomme einen Traktor und beschließe, ihm Ehre zu erweisen, indem ich ihn beziehungsweise sie, Tilly nenne – nach unserem geliebten Hund.
Die Restaurierung von Tilly wird zu einem Projekt – und natürlich ist ihre Namensvetterin, der Golden Retriever Tilly, dabei meine ständige Begleiterin. Ich baue ihr ein kleines Podest, auf dem sie sicher sitzen kann, und wir tuckern durch die Straßen. Tilly sitzt gemütlich auf ihrem Platz und erregt das amüsierte Interesse der Passanten, als wir an ihnen vorbeifahren.
Tilly ist ein gutmütiger Hund, treu und freundlich. Sie hat mich seit der Kindheit, über die Jugend bis an die Schwelle zum Erwachsensein begleitet. Als ich meinen ersten zaghaften Ausflug in die Dating-Welt unternehme, ist sie da und vertreibt unangenehme Schweigeminuten. Sie besitzt das Talent, immer mit einem Tennisball aufzutauchen, wenn es eine Gesprächspause gibt, und sie verschafft mir eine Ausrede, um auf dem Land spazieren zu gehen, um Händchen zu halten und um einen ersten Kuss zu bekommen.
Aber sie ist ein Hund der Middleton-Familie und ehrlich gesagt wünsche ich mir nichts sehnlicher als einen eigenen Hund.
Währenddessen schneide ich in der Schule bei meinen Abschlussprüfungen dermaßen schlecht ab – unter anderem stelle ich einen demütigenden Schulrekord auf, indem ich vier Mal durch Chemie falle –, dass ich meine arme Mutter zum Weinen bringe. Dad sagt, dass meine teure Ausbildung »rausgeschmissenes Geld« war.
Ich mache daraufhin ein »Gap Year« – ein Jahr Pause von meiner Schulausbildung – aber meins ist nicht vollgestopft mit Reisen und horizonterweiternden Abenteuern, so wie das bei anderen Schülern der Fall ist. Während sie die Zeit nutzen, um durch Costa Rica oder die Antarktis zu wandern oder um als Freiwillige in den peruanischen Anden oder in fernen afrikanischen Dörfern zu arbeiten, verbringe ich sechs Monate in einem College in London und quäle mich durch A-Level-Wiederholungsprüfungen.
Der einzige Lichtblick in dieser dunklen Zeit der staubigen Klassenzimmer, des Schuftens und Paukens – ich habe so oft Wiederholungsprüfungen gemacht, dass ich den Lehrstoff inzwischen praktisch auswendig kann – ist Tilly.
Sie liebt es, mit mir in den alten Routemaster-Bus zu steigen, auf das offene Ende zu springen und dort neben mir zu stehen und ihre Pfote zu geben, wenn Fahrgäste ein- und aussteigen. Es ist eine ihrer liebenswerten Eigenschaften: Sie legt ihre Pfote auf deine Hand, so als würde sie sie schütteln.
Die Leute geben ihr Leckerlis. Wenn sie sie auf ihrer Nase balanciert, dann wirft sie sie auf Befehl in die Luft und fängt sie dann mit dem Maul auf. Das ist ihr Partytrick. Dafür bekommt sie unheimlich viele Leckerbissen.
Wir versuchen es auch mit der U-Bahn, aber es ist eine Herausforderung, sie die Rolltreppe hoch- und runterzutragen – sie ist ein großer, schwerer Hund –, also kehren wir zum Bus zurück oder suchen U-Bahn-Stationen mit Treppen, damit sie meine Schulkameradin am College sein kann.
Wir Schüler sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Einige – so wie ich – müssen Wiederholungsprüfungen ablegen, und andere wurden bereits von der Schule verwiesen, daher ist unser Lehrer froh, dass wir überhaupt auftauchen, und erlaubt deshalb auch die Anwesenheit eines Hundes.
An dem Tag, an dem Tilly in Bucklebury verschwindet, wird mir erst so richtig bewusst, wie wichtig sie mir ist. Es ist Bonfire Night und sie hat Angst vor dem Feuerwerk. Wir besuchen eine Ausstellung in unserem Dorf, lassen sie zu Hause, aber vergessen das Fenster im Erdgeschoss, das leicht geöffnet ist.
Als wir zurückkehren, ist Tilly verschwunden. Vor lauter Angst setzt mein Herz einen Schlag aus. Die ganze Nacht fahre ich herum, halte an, suche sie mit einer Taschenlampe, rufe ihren Namen. Ein Gefühl von Panik und Verlust erfasst mich. Alle möglichen Gedanken schießen mir durch den Kopf: Was, wenn sie jemand mitgenommen hat oder sie von einem Auto angefahren wurde? Das flaue Gefühl in meinem Magen verschwindet einfach nicht.
Aber als ich in den frühen Morgenstunden erschöpft und völlig aufgelöst nach Hause zurückkehre, ist Tilly da. Jemand hat sie gefunden und zurückgebracht. Sie läuft auf mich zu, zittert immer noch vor lauter Nervosität. Ich zittere auch. »Ich werde dich nie wieder aus den Augen lassen«, verspreche ich ihr und vergrabe mein Gesicht in ihrem Fell.
Dieses Gefühl, dass wir sie durch einen Moment unvorsichtiger Unaufmerksamkeit hätten verlieren können, schärft mein Verantwortungsbewusstsein: Wenn ich mal meinen eigenen Hund habe, werde ich ihn so lieben wie Eltern ihre Kinder.
Dann, als sich der Sommer dem Ende zuneigt, ist Tilly zu unserer Freude schwanger. Und ich werde einen ihrer Welpen bekommen! Es wurde mir versprochen. Ich kann das Lächeln nicht unterdrücken, das auf meinen Lippen erscheint, wenn ich daran denke. Es gibt sogar zwei Gründe zum Feiern, denn ich habe es auch endlich an die Universität von Edinburgh geschafft – allerdings nur um Haaresbreite, mit den Mindestnoten.
Dann kommt der vernichtende Schlag. Tilly verliert ihren Wurf. Drei Welpen werden tot geboren und der vierte ist so schwach und winzig, dass er nicht lange überlebt. Die Trauer – für Tilly und für mich, weil mir der Welpe genommen wurde, nach dem ich mich so gesehnt hatte – wirft ihren Schatten, als ich nach Schottland fahre. Aber der Gedanke an einen eigenen Hund nimmt bereits Gestalt an: Ich werde nach einem anderen Welpen suchen und endlich meinen lange ersehnten Begleiter bekommen.
Ich sitze im Gebrauchtwagen meiner Schwester, er ist vollgestopft mit Utensilien des Studentenlebens: Bettdecken, Lautsprecher, Becher und Geschirr, abgenutzte Reisetaschen. Noch bevor ich überhaupt in meinem Studentenzimmer angekommen bin, entdeckt mich Nick, der während der Schulzeit mein bester Freund war, und kommt lachend auf mich zugestürzt. »Also bist du doch noch hergekommen? Wie hast du das denn hingekriegt?« Er kann es gar nicht glauben, dass ich es tatsächlich geschafft habe.
Im nächsten Semester besuche ich gelegentlich Vorlesungen, lasse mich jedoch immer leicht ablenken. Zum Beispiel halte ich in einer Buchhandlung, um einen Kaffee zu trinken, und vertrödle dann Stunden damit, Ideen für eigene Firmen in mein Notizbuch zu kritzeln (wie Mum und Dad, die ihr Unternehmen Party Pieces in ihrer Küche gegründet haben, bin ich von Natur aus ein Unternehmer), und plötzlich merke ich, dass ich die Vorlesung verpasst habe.
Ich vermisse Tilly so sehr, dass ich manchmal nach Hause fahre, um sie für einen Besuch in Schottland abzuholen. Im Dunkeln schmuggle ich sie dann durch den Eingang meines Studentenwohnheims oder warte, bis die netteren Sicherheitsleute Dienst haben, die ich dann anbettle, bei meiner Besucherin ein Auge zuzudrücken.
Aber meinen Eltern gegenüber ist es nicht fair, sich den Familienhund ständig spontan auszuleihen, und ich bin mir sicher – entgegen aller Präzedenzfälle und Regeln –, dass ich mich an der Uni um meinen eigenen Welpen kümmern kann. Ich muss nur den richtigen finden.
Kapitel zwei Ein winziges, blindes Bündel
Für mich ist es kaum eine Überraschung, dass ich für ein Studium ungeeignet bin, aber meine Eltern – die davon überzeugt sind, dass ein Hochschulabschluss die einzige Option für mich ist – müssen noch davon überzeugt werden, dass mein Schicksal woanders liegt.
Aber trotz aller Vorbehalte werde ich für die Zeit, die ich in Edinburgh verbracht habe, ewig dankbar sein, weil ich dank Ben, einem Freund aus der Uni, meine geliebte Hündin Ella gefunden habe.
Bens Bruder Luke lebt auf Islay, der südlichsten Insel der Inneren Hebriden, und es gibt viele Freitagabende, an denen wir mit der Fähre zu seinem Haus an diesen schönen und abgelegenen Ort fahren.
Dort treffe ich Lukes schwarzen Cockerspaniel Zulu, einen Hund mit solch einem tollen Charakter und so viel Unsinn im Kopf, dass er mich sofort verzaubert. Zulu besitzt alle Talente eines routinierten Schauspielers. Wenn er deine Aufmerksamkeit erregen will, wird er so tun, als hätte er seine Pfote verletzt, und wird überzeugend humpeln. Dann wird er, in der Minute, in der du ihm den Rücken kehrst, losrennen. Seine Pfote ist wie durch ein Wunder plötzlich wieder gesund.
Noch nie zuvor habe ich Working Cocker Spaniel (Cockerspaniel, die in der Arbeitslinie gezüchtet wurden) kennengelernt, und bei diesen Ausflügen auf die Insel, in der Gesellschaft von Zulu, komme ich zu dem Entschluss, dass diese Rasse genau die richtige für mich ist. Sie sind unbekümmert, anhänglich und sprühen geradezu vor rastloser Energie. Sie haben auch die passende Größe, um sie auf den Arm zu nehmen, wenn man sie tragen muss. Und sie sehnen sich nach der Aufmerksamkeit, die ich ihnen schenken möchte.
Unnötig zu sagen, dass ich immer, wenn Luke und seine Frau mal übers Wochenende wegfahren wollen, der Erste in der Warteschlange bin, der auf ihren Hund aufpassen möchte.
»Wenn Zulu jemals Welpen bekommt, hätte ich gerne einen«, sage ich zu ihnen. Daraufhin erzählen sie mir, dass das bereits passiert sei – mit Mabel, einem zitronenfarbenen Cockerspaniel. Dank eines glücklichen Zufalls gehört Mabel den Eltern eines von Pippas Freunden.
Meine Schwester war ebenfalls an der University of Edinburgh, deshalb sind solche zufälligen »Zusammenstöße« unserer Welten nicht selten, aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, dass es Schicksal ist, einen von Mabels Welpen zu bekommen.
Aber ich muss zuerst noch beweisen, dass ich würdig bin, um einen der Welpen zu bekommen. Dass ich eine verantwortungsbewusste, liebevolle und engagierte Person bin, ein lebenslanger Begleiter für einen Hund. Also mache ich den ersten zaghaften Anruf.
»Hallo, hier spricht James, Pippa Middletons Bruder. Ich habe gehört, dass Sie einen Wurf Welpen haben. Ich wäre sehr an einem der Hunde interessiert.«
Auf dem Papier sehe ich allerdings nicht gut aus. Ich bin noch Student und ein »normales« Studentenleben beinhaltet, dass man so lange draußen bleiben kann, wie man will. Dass man wegfahren kann, wenn man Lust dazu hat und dass man bis spät in die Nacht feiern geht. Keine guten Voraussetzungen, wenn es darum geht, einem Hund die Stabilität und Ruhe geben zu wollen, die er braucht. Aber ich bin bereit, eigentlich freue ich mich sogar darauf, auf all diese Freiheiten zu verzichten, um endlich ein Hundepapa zu werden.
Mabels Besitzer sind einverstanden, dass ich mal vorbeikomme und den Wurf kennenlerne. Also fahre ich an die schottische Grenze, um sie zu besuchen. Mabel begrüßt mich an der Tür, sie ist anscheinend genauso aufgeregt, mir ihre Welpen zu zeigen, wie ich es bin, sie zu sehen. Ich will ein Weibchen haben – es wäre wundervoll, eines Tages mit ihr zu züchten. Und da ist sie. Ella.
Der Name passt. Seit Monaten kreist er mir bereits in meinem Kopf herum, wie eine Zauberformel. Mir gefällt die Kürze und das trällernde »a« am Ende. Ich kann mir vorstellen, ihr den Namen zuzurufen, und er passt gut zu ihr. Ich halte sie in meinen Armen, dieses winzige, zappelnde, blinde Bündel, und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Sie ist die Richtige für mich. Nenne es Instinkt, wenn du möchtest, aber dieses verletzliche, kleine Hündchen mit dem pechschwarzen Fell zieht mich sofort in seinen Bann. Von der Sekunde an, in der ich sie in meinen Armen halte, bin ich verliebt.
Ich denke an all die Warnungen, dass ein Hund mein Leben einschränken wird, aber ich weiß, ohne jeden Zweifel, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Sie wird eine Befreiung sein, der Beginn eines neuen Lebens, in dem ich die Freiheit habe, ich selbst zu sein.
Aber unser gemeinsames Schicksal ist noch nicht besiegelt, ich werde weiter befragt, meine Entschlusskraft wird geprüft. Und Ella ist noch zu jung, um ihre Mutter jetzt schon zu verlassen. Werde ich in ein paar Wochen wiederkommen, um sie wiederzusehen? Natürlich.
Drei Wochen später komme ich wieder. Ellas Charaktereigenschaften beginnen allmählich zum Vorschein zu kommen. Ihre Geschwister liegen aneinandergekuschelt auf dem Boden. Sie läuft herum, furchtlos, allein. Ich hebe sie hoch, streichle sie und sie schläft in meinen Armen ein.
Mir fällt ein, dass noch eine Tasse Tee auf dem Tisch auf mich wartet. Aber ich wage es nicht, meine Hand danach auszustrecken, weil ich sie nicht stören will. Das kleinste Zucken eines Muskels könnte sie aufwecken. Ich lasse sie weiterschlafen, bin glücklich, dass sie bei mir so zufrieden und entspannt ist.