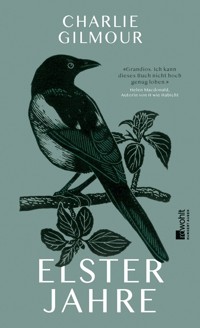
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
An einem Frühlingstag fällt ein Elsterjunges aus seinem Nest und in Charlie Gilmours Leben – es ist der Beginn einer bewegenden Liebesgeschichte zwischen Mensch und Tier. Charlie und seine Freundin Yana päppeln das Küken auf, das anfangs nicht weniger anspruchsvoll ist als ein eigenes Baby: Es wacht bei Sonnenaufgang schreiend auf, muss alle zwanzig Minuten gefüttert werden, trägt aber leider keine Windel. Doch nicht nur im Haus sorgt die kleine Elster für Chaos. Während Charlie sich liebevoll kümmert, gerät er mehr und mehr über sich selbst ins Grübeln, und schließlich stellt er sich lange verdrängten Fragen: Wer hat mich mehr geprägt: mein biologischer Vater oder der, der mich großgezogen hat? Kann ich Verantwortung für ein Baby übernehmen, obwohl ich kaum in der Lage bin, mich um mich selbst zu kümmern? Charlie nimmt wieder Kontakt zu seinem leiblichen Vater auf, der früher selbst einmal eine Dohle großgezogen hat. Haben die beiden doch mehr gemein als lange angenommen? Was, wenn er dazu bestimmt ist, die Fehler seiner Vaters zu wiederholen? Über all dem wird seine Beziehung zu dem Vogelwaisen immer enger. Irgendwann wird er sich jedoch von ihm trennen müssen. Doch die Elster denkt gar nicht daran, ihn zu verlassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
David Gilmour
Gilmour_Elsterjahre_satzfertig_MS
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Olga
Ein Auge, das den Vater verspottet, und verachtet, der Mutter zu gehorchen,
das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen.
Die Sprüche Salomos 30,17
Prolog
Irgendwo im Südosten Londons stürzt eine flugunfähige junge Elster zu Boden.
Von unten ist schwer zu erkennen, wo genau sie herausgefallen ist. Ihr Nest könnte hoch oben in einer der Platanen sein, die diese vom Lastwagenverkehr ramponierte Straße säumen, eine hinter einem Schleier aus grünen Blättern verborgene buschige Laube. Oder es könnte irgendwo im Gewirr der hier überall stehenden, vielfach ausgedienten Lagerhallen versteckt sein, ein vertracktes Gebilde aus Stöckchen und Matsch auf Wellblech und Asbest. Elstern bauen ihre Wohnungen in der Nähe von unseren, sichtbar zwar, aber außer Reichweite. Eine Elsterstadt, auf die unsrige aufgesetzt.
Es ist eine raue, vom Menschen arg misshandelte Gegend, in der dieser Vogel verfrüht gelandet ist. Reihenweise warten Wagen mit zusammengeschobenen Motorhauben und zersplitterten Windschutzscheiben vor dem nahegelegenen Autofriedhof auf ihre Verschrottung. Illegal entsorgte Kühlschränke und Müllsäcke versperren als unbewegliche Felsblöcke die Bürgersteige. Pfützen aus öl- und benzinverseuchtem Frühlingsregen schillern purpurfarben, und darüber steigen Rauchschwaden aus den Schornsteinen einer riesigen, rund um die Uhr arbeitenden Müllverbrennungsanlage. Lastwagen donnern wie Gewitterwolken vorbei, und die Fußballfans vom Millwall FC brüllen fanatisch. Die einzigen Tiere, die ich dort jemals gesichtet habe, sind Pitbulls und Ratten. Etwas weiter entfernt, bei der Müllkippe, gibt es allerdings Möwen- und Taubenschwärme und dazu ein Raubvogelgeschwader, schnittig wie Düsenjäger, das von dem Entsorgungsunternehmen dazu angestellt ist, die anderen Vögel zu vertreiben.
Die Werkstatt meiner Freundin Yana befindet sich gleich um die Ecke in einem maroden Fabrikgebäude am Rand des Schrottplatzes. Dies ist eine Gegend, wo die Stadt noch voller Geheimnisse und Überraschungen ist, doch selten sind sie süß und flauschig. In der einen Woche entdeckt die Polizei bei einer Razzia in einem benachbarten Lagerhaus eine Cannabisplantage, in der nächsten gestohlene Motorräder; ein Freund öffnet einen seit langem herrenlosen Container, vollgestopft mit Jetskis; ein Typ, mit dem ich vor einiger Zeit eine Gefängniszelle teilte, behauptete stolz, er habe hier abgesägte menschliche Glieder entsorgt. Es ist der letzte Platz auf der Erde, wo ich etwas so Dotterweiches und Vogelknochenzerbrechliches wie ein junges Vögelchen erwartet hätte.
Das Geschöpf trippelt im Rinnstein umher, taumelt zum Bordstein wie ein die Gasse entlangtorkelnder Betrunkener. Elstern verlassen ihr Heim viel zu früh – lange bevor sie wirklich fliegen oder richtig für sich selbst sorgen können. Noch Wochen, nachdem sie ihr Nest verlassen haben, sind sie für Nahrung, Schutz und auch für die Erziehung auf ihre Eltern angewiesen. Doch die Eltern dieses Vogels sind nirgendwo zu sehen. Weder füttern noch beobachten oder bewachen sie ihn; keine Warnrufe erklingen, als sich ein großer Spitzenprädator mit stahlkappenverstärkten Stiefelschritten nähert. Was nicht heißt, dass seine Eltern nicht in der Nähe sein könnten. Es muss auch kein unglücklicher Zufall sein, dass dieser Vogel sich auf dem Erdboden befindet. Falls das Futter knapp war, könnte eine grausame Lageeinschätzung stattgefunden haben – mit dem Ergebnis, dass die Familie nur dann den Lüften erhalten bleibt, wenn sie den Kümmerling aufgibt.
Jetzt bewegt der Vogel sich nicht mehr. Er hockt im Rinnstein, zittert vor Flüssigkeitsmangel und vielleicht auch vor Angst. Wenn die Natur ihren gewohnten Lauf nimmt, wird er wahrscheinlich noch vor Ende des Tages sterben. Das beängstigende menschliche Wesen, groß wie ein Baumstamm, nähert sich, schwankt, zögert, und dann wird mit leisem Rascheln die Welt des Vogels schwarz.
Gut dreihundert Kilometer weiter westlich und drei Jahrzehnte früher stürzte eine junge Dohle aus ihrem Nest im Turm einer Dorfkirche. Mit ihren stahlgrauen Federn, dem gelben Schnabel und einem verletzten Flügel schleppte sie sich auf dem Fußboden entlang. Dohlen und Elstern gehören zur selben Familie, den Rabenvögeln. Alles Aasfresser. Irgendjemand, vielleicht der Pfarrer, hat den verletzten jungen Vogel gefunden, in eine Schachtel gesetzt und zu einer Dorfbewohnerin, einer Hobbyheilerin gebracht. Von dort fand die Dohle ihren Weg in die Hände des Mannes, der mein Vater werden sollte. Die Elster findet ihren Weg zu mir.
STOPPELFEDERN
1
Yana stellt die Pappschachtel mit ihrem kostbaren Inhalt sehr sanft auf den Fußboden unseres Schlafzimmers. Ihre Schwester habe das Geschöpf am Morgen gefunden, erklärt sie, es aufgehoben und zu ihnen in die Werkstatt gebracht. Zwischen Hämmern und Bohren hätten sie es mit lebendigen Raupen aus dem Laden für Anglerbedarf gefüttert. Die Raupen würden beißen, fährt Yana sachlich fort, deshalb müsse man die Köpfe mit einer Zange oder dem Fingernagel ein bisschen zerdrücken, ehe man sie in den Schnabel des Vogels schiebt. Sie klappt die Schachtel auf.
Ein schwarzweißer Flaumball von der Größe einer Kinderfaust hat sich in einer Ecke zusammengekauert. Er sieht tot aus. Er riecht tot. Ich schnalze mit der Zunge, und sein eines Augenlid öffnet sich flatternd. Das Auge ist metallisch blau.
Ich versuche, im Geiste alles aufzurufen, was ich über Elstern weiß. Als Erstes fällt mir der Kinderabzählreim One for Sorrow ein und dann, dass meine Mutter auf der Farm, wo ich aufgewachsen bin, jede Elster, die ihr in den Blick kam, gewissenhaft grüßte, um das Unglück, das diese Vögel angeblich bringen, abzuwehren. Sicher ist sicher, denke ich und berühre meine Schläfe mit der Hand, während ich in die Schachtel spähe. Yana sagt, es seien kluge Vögel – sehr kluge, so wie alle Mitglieder der Rabenfamilie –, auch wenn ich mich zu erinnern meine, dass sie von vielen Menschen nicht gemocht werden, aus Gründen, die ich nie ganz verstanden habe. Angeblich sollen sie Singvogelbabys fressen und Umgang mit dem Teufel pflegen. Und es heißt, sie besäßen ein Piratenauge für gestohlene Schätze – nach einem verlorenen Ehering solle man also im nächstgelegenen Elsternest suchen. Außer dass ich sie grüße, wüsste ich nicht, was mit ihr anzustellen wäre. Ich habe mich früher als Kind schon reichlich hilflos um verletzte Tiere gekümmert, es zumindest versucht: Geschöpfe, die Katzen anschleppten, halbtote Eichhörnchen, Vögel, die sich ihr Hirn an Fensterscheiben ziemlich zermatscht hatten. Egal, was man unternimmt, irgendwie scheinen alle schließlich am gleichen Ort zu enden: in einem Schuhkarton in einem nicht sehr tiefen Grab. Selbst gesunde Tiere hatten in meiner Obhut nicht allzu viel Glück. Schuldbewusst denke ich an die wunderschönen weißen Tauben, die wir vor Jahren hatten und die meine Großmutter, meine Mutter und ich pastellrosa einfärbten und auf der Farm freiließen – worauf sie prompt vom Fuchs verschlungen wurden, als wären sie Zuckerwatte. Von daher fürchte ich, dass ich, wenn ich diesen kleinen Flaumball gefunden hätte, versucht gewesen wäre, ihn im Rinnstein seinem Schicksal zu überlassen. Ich weiß nicht, was wir für ihn tun können, außer womöglich sein Leiden zu verlängern.
Vom Vogel blicke ich zu Yana. Sie trägt wie üblich ihre Arbeitskleidung, einen dunkelblauen, farbbeklecksten Overall und schwere Stiefel. Ihre hellbraunen Haare sind auf eine präzise, strenge Weise mit Klammern festgesteckt, was ihre hohen, ausgeprägten Wangenknochen noch stärker betont. Sie hantiert schon mit der Kneifzange. Ich sehe zu, wie sie mit dem Metallschnabel nach einer sich windenden gelben Raupe schnappt und ihren Kopf einklemmt. Bleicher Glibber tritt an beiden Enden des Unglückswesens aus, während Yana mit der Zange verführerisch vor dem Elsterbaby herumwedelt. Das ist bezeichnend für Yana. Sobald sie etwas Beschädigtes entdeckt, muss sie es aufheben und reparieren. Ich vermute, dass sie selbst so eine Art Elster ist; nicht direkt eine Diebin, aber mit Sicherheit eine Sammlerin gefundener Schätze. Sie hat immer einen Schraubenzieher dabei und überlegt selten zweimal, ob sie weggeworfene Leuchtkörper, Marmorplatten oder gewaltige Säcke voller Krempel, den sie am Themseufer gefunden hat, zu uns nach Hause schleppen soll.
Unsere Wohnung ist voll von Dingen, die sie selbst gebastelt oder repariert hat: angefangen von Regalen über Becher und Messer bis hin zu den Stühlen, auf denen wir sitzen, und den Hosen, die ich trage. Besondere Freude bereitet es ihr, Dinge an die Decke zu hängen. Im Wohnzimmer klimpert jedes Mal, wenn große Fahrzeuge vorbeifahren, ein Kronleuchter, den sie aus spitzen gläsernen Stalagtiten gefertigt hat, und eine Skulptur aus Bambus, Kordel und hängenden Ranken über unserem Bett hat unser Zimmer in einen Dschungel verwandelt. Sie führt ihre Neigung zum Selbermachen darauf zurück, dass sie mit fünf Geschwistern in einer lebhaften Migrantenfamilie aufgewachsen ist. Ihre Eltern flohen mit ihren Kindern und allem, was sie sonst noch tragen konnten, aus der Ukraine nach Schweden, kurz bevor hinter ihnen die Sowjetunion zusammenbrach. Es war insgesamt eine chaotische Situation, und wer das Talent besaß, selbst für seine Kleidung und auch für sein Vergnügen zu sorgen, war eindeutig im Vorteil.
Ich habe Yana vor zwei Jahren auf einer Party in einer stillgelegten Autowaschanlage kennengelernt. Mit wasserstoffblonden Haaren und dämonisch rotem Augen-Make-up tauchte sie hinter einem Betonpfeiler auf und hatte mich mit nur einem kurzen Blick am Haken. Später nahm sie mich mit in ihre Wohnung und zeigte mir ihre Albinoschlange, ihre Orchideenmantis und ihre Sammlung eigenhändig hergestellter Messer. Nicht lange danach sind wir zusammengezogen und waren schnell verlobt. Es ging alles derart schnell, dass ich eigentlich nicht genau weiß, wie ich an diesen Punkt gelangt bin. Gelegentlich fühle ich mich ein bisschen wie eines ihrer aufgelesenen Objekte. Jedenfalls habe ich mir nie vorgestellt, dass ich mich in meinen Zwanzigern schon fest niederlassen würde. Ich hatte doch eben noch einen rasierten Schädel und zerschrammte Knöchel und steuerte geradewegs auf einen Absturz zu. Und jetzt scheine ich mich kurz vor der Heirat und mitten im Nestbau zu befinden.
Manchmal bin ich überzeugt, dass ich die ganze Geschichte nur träume, und ich bräuchte nur aufzuwachen, und alles wäre verschwunden. Zu anderen Zeiten scheint das Gegenteil wahr zu sein: dass ich nach einem langen, erschöpfenden Albtraum allmählich wieder das Bewusstsein erlange. Ich weiß nicht, ob es Yanas Bereitschaft, sich um alles Beschädigte zu kümmern, ist, die mich für sie attraktiv gemacht hat – irgendwie bezweifle ich das. Aber mit Sicherheit gehören ihre Stärke, ihre Stabilität und ihre Unverwundbarkeit zu den Eigenschaften, die sie für mich anziehend gemacht haben.
Nun ist dieser Pechvogel bei uns gelandet. Ein Traumwesen, das Yanas sterbende Raupe argwöhnisch aus ihrer Ecke in der Pappschachtel betrachtet. Jetzt sind ihre beiden Augen geöffnet. Blau. Ich wusste nicht, dass die Augen einer jungen Elster blau sind. Alle Elstern, die ich bisher beobachtet habe, wenn sie auf Bäumen krächzten oder am Straßenrand Kadaver auseinanderrissen, müssen erwachsen gewesen sein, ihre Augen glitzerten in der Farbe von Obsidian. Während die Augen dieses Vogels ganz und gar unverschlossen sind, bleibt sein scharfer schwarzer Schnabel hartnäckig geschlossen, sosehr Yana ihn auch zu locken versucht. Sie murmelt etwas, das wie «blöde Elster» klingt, und legt ihre kleine Zange weg. In mir keimt der Verdacht, dass die Reparatur dieses angeschlagenen kleinen Vogels selbst ihre heilenden Kräfte übersteigen wird.
«Kann sich nicht jemand anders darum kümmern?», sage ich. «Ein Tierarzt zum Beispiel?»
Yana verdreht die Augen, als hätte ich gerade vorgeschlagen, wegen einer Glühbirne den Elektriker zu bestellen. Was, ehrlich gesagt, haargenau das ist, was ich machen würde – der Glühbirne zuliebe. Wenn Yana Ordnung repräsentiert, dann bin ich Chaos. In meinen Händen scheinen die Dinge auseinanderzufallen, und dieser Vogel ist viel zu zerbrechlich.
Yana wedelt mich beiseite und greift wieder zur Zange. Sie zerdrückt eine neue Raupe und startet den nächsten Versuch bei der Elster, diesmal, indem sie komische hohe, zirpende Laute ausstößt und mit ihrem Metallschnabel klackert – genauso wie es eine Elstermutter in der freien Natur machen würde, behauptet sie. In einem plötzlichen Anfall von Energie springt der Schnabel auf, und der Vogel beginnt wie ein kochender Wasserkessel zu pfeifen. Yana lässt die Raupe in den leuchtend rosafarbenen Schlund des Vogels fallen, und mit einem einzigen Schluck ist sie verschwunden. Offensichtlich steckt noch Leben in dem Geschöpf.
Yana reicht mir eine Raupe aus dem Plastikgefäß in ihrer Werkzeugtasche. «Du bist dran», sagt sie, und die Raupe ruckelt, gelb und leicht behaart, quer über meine Handfläche, wie ein abgeschnittener Zeh, der noch zuckt. Ich zerquetsche den Kopf mit der Zange, und dann spiele ich Mutter. Wie eine verlässliche Kuckucksuhr reißt der Vogel den Schnabel weit auf. Seine Zerbrechlichkeit macht mir Angst. Knochenporzellan mit einer Federboa. Zitternd schiebe ich die sich reflexhaft windende Raupe in seinen Schnabel und warte, dass er mampft, doch der Vogel schreit einfach weiter, und die Raupe rollt wieder raus.
«Du musst sie richtig reinschieben», sagt Yana und sticht mit dem Zeigefinger in die Luft.
Ich lege die Zange weg. Ich kann solch ein hartes Metallgerät nicht bei etwas derart Weichem und Zartem benutzen. Stattdessen schiebe ich die Raupe mit der Fingerspitze an den Rand der schwarzen Vogelkehle. Das Gekreische des Vogels wird heftiger und verwandelt sich dann zu einer Art koboldhaftem Mhhmm-Mhhmm, während die Peristaltik einsetzt und den Wurm nach unten befördert. Aber der Vogel hört noch nicht auf. Ich spüre, wie die starken ringförmigen Muskeln seiner Speiseröhre konvulsivisch gegen meine Fingerspitze pressen, während er versucht, mich ebenfalls zu verschlucken. Rasch ziehe ich die Hand zurück. Der Vogel zirpt, steckt den Kopf seitlich neben seinen Flügel und schläft wieder ein.
«Und nun?», frage ich.
«Mehr Würmer besorgen», erwidert Yana. «Ich glaube, wir müssen ihn alle zwanzig Minuten füttern, und wir haben schon bald keine mehr.»
2
In den nächsten Tagen versuche ich, so gut ich kann, die Elster in der Schachtel zu ignorieren. Mehr denn je bin ich überzeugt, dass ihr ein früher Tod bestimmt ist. Yana hat irgendeinen Parasiten entdeckt, der in ihrem Hals wohnt. Sie hat regelmäßig Krämpfe – entsetzliche, herzzerreißende Anfälle, bei denen sie sich auf die Seite wirft und zuckt wie ein unter Strom gesetzter Frosch. Yanas Problem, beschließe ich. Sie schluchzt, wenn ein Anfall kommt, und lässt mit der Fingerspitze Wasser in die Ecke des Schnabels tropfen, was den Vogel irgendwie wiederbelebt, auch wenn die nächste Attacke nie weit zu sein scheint. Ich vermute, dass dies auch der Grund war, weswegen er aus dem Nest geworfen wurde. Vögel wissen, wann ein Junges aus ihrer Brut die Aufzucht nicht lohnt. Und auch ich schreibe das kleine Geschöpf ab. Es hat keinen Zweck, sein Herz an etwas zu hängen, das nicht bei einem bleiben wird.
Außerdem habe ich den leisen Verdacht, dass Yana aus mir den Elstervater zu machen gedenkt. Was wahrscheinlich nur natürlich ist. Yana ist Bühnenbildnerin und häufig tagelang unterwegs. Während ich ein unterbeschäftigter Schriftsteller bin und das Haus in letzter Zeit überhaupt nur noch sehr selten verlasse. Bunkermentalität – trotzdem scheint es der Außenwelt gelungen zu sein, sich Eingang zu verschaffen. Falls das Geschöpf überlebt, wird die Rolle des obersten Wurmzerquetschers am Ende wohl unvermeidlich mir zufallen. Und sollte die Elster diese turbulente erste Strecke schaffen, wird sie ganz zweifellos eine Menge Fürsorge benötigen, ehe sie wieder in die Freiheit entlassen werden kann. Sie ist nicht einmal in der Lage, selbst für ihr Futter zu sorgen; und Fliegen erscheint wie ein ferner Traum. Wer weiß, wie lange es dauern wird, bis sie es lernt.
Ich versuche, mich desinteressiert zu geben, wenn Yana sich um das Geschöpf kümmert, auch wenn es mir schwerfällt, kalt zu bleiben. Sie hat ihre liebe Mühe damit, seinen Magen auch nur halbwegs gefüllt zu halten. Sie tötet unentwegt Würmer, rollt warmes Lammgehacktes in winzige Elsterfleischklößchen, weicht Hundekuchen in warmem Wasser auf und schiebt alles in den Vogel. Mir ist nicht klar, woher sie weiß, wie man all das macht, aber offenbar funktioniert es. Das Überleben der Elster scheint allerdings weiterhin sehr ungewiss – sie ist kaum kräftig genug, um das winzige Gewicht ihres eigenen Köpfchens zu tragen, und sie zittert und krampft immer noch fürchterlich – aber unter Yanas schützenden Fittichen nimmt die Häufigkeit der Anfälle allmählich ab. Die blauen Augen des Vogels bleiben länger offen, und sie folgen Yana und mir hungrig durchs Zimmer.
Ein paar Tage später passiert das Unvermeidliche. Yanas Agent ruft an, es habe sich kurzfristig ein lukrativer Auftrag ergeben – in Paris. Yana wischt sich den Fleischsaft von den Händen, zieht den Reißverschluss ihres Overalls hoch und ist, die Werkzeugtasche über der Schulter, einen Elsterlidschlag später schon aus der Tür. In einer Woche zurück, sagt sie beim Gehen.
Ich starre auf den Vogel. Der Vogel starrt unverwandt zurück, legt den Kopf schief, sodass er mich mit seiner schwarzen, stecknadelgroßen Pupille zielgenau im Blick hat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hinter diesen hellen Edelsteinaugen eine Intelligenz lauert – eine Intelligenz, die mich genauso intensiv erforscht, wie ich den Vogel. Ich habe mich noch nie von einem Tier so angeschaut gefühlt. Mir kommen Bedenken, ob das hier gutgehen wird. Ich bin unbeholfen, zerstreut und ein notorischer Verantwortungsverweigerer. Und die Elster ist zügig dabei, ebenso fordernd und unvernünftig zu werden wie ein kleines Kind im Süßwarenladen – ist aber trotzdem noch so verletzlich wie Zuckerwatte.
Allein mit dem Vogel, setze ich mich an den Computer und versuche, mehr darüber herauszufinden, was man mit einem solchen Geschöpf anzustellen hat. Viel Glück habe ich nicht. Es gibt da draußen eine Menge praktischer Informationen, aber auf den ersten Blick scheint es sich eher um das Vernichten von Elstern zu drehen als um ihre Erhaltung. In Schädlingsbekämpfungsblogs und Foren von Luftgewehrliebhabern gibt es ellenlange Diskussionen darüber, wie man diese Vögel ködert und erschießt oder einfängt. Hobbyjäger locken sie mit Fleischstückchen in ihren Höfen und ballern ihnen dann mit Bleischrot das Gehirn weg. Sie posten Angeberfotos von ihrer Beute: erwachsene Elstern, auf den Boden geworfen wie verölte Lumpen, die schillernden Federn noch feucht von Blut. Angesichts des Hasses, auf den ich im Netz stoße, nehme ich auf der Stelle Partei für die Elster.
Im Grunde begreife ich nicht, wieso sie derart gehasst werden. So wie die Leute ihnen unterstellen, sie würden Singvögel ermorden, klingt es, als seien die Elstern höchstpersönlich für den Kollaps des Ökosystems verantwortlich. Zwar trifft es offenbar tatsächlich zu, dass Elstern opportunistische Räuber sind, die manchmal die Eier und die Jungen anderer Vögel fressen – aber wieso werden dann Turmfalken, Bussarde, Sperlingsfalken, Eulen, Katzen und, vor allem, Menschen nicht mit derselben Inbrunst gehasst und gejagt? Je mehr ich mich in die angeblichen Verbrechen von Elstern vertiefe, desto unsinniger kommt mir das Ganze vor. Sie sollen Augen, Zunge und Anus von Lämmern herausreißen. Unter ihrer Zunge trügen sie einen Fleck aus Teufelsblut. Als einzige unter sämtlichen Vögeln hätten sie sich geweigert, Christus zu beweinen. Und wie verrückt hätten sie von der Takelage der Arche Noah hinuntergekeckert, während Zivilisationen versanken. Allein das englische Wort für Elster, magpie, als solches scheint mit uralter Verachtung belastet. Es leitet sich vom altenglischen mag her, einem abfälligen Begriff für Klatschweib, als Anspielung auf das lärmige Geschnatter des Vogels, obwohl doch eher die Elstern selbst Opfer des Klatsches sind. Vielleicht hat der Hass, den die Menschen ihnen gegenüber hegen, ja etwas mit den ihnen unterstellten übernatürlichen Kräften zu tun. Elstern sollen Schicksalsvögel sein, die Glück und Pech bringen. Sie können die Zukunft voraussagen, sie wissen Bescheid über Tod und Geburt. Jeder Engländer kennt den Kinderreim One for sorrow … in irgendeiner Version. Auf Deutsch lautet er etwa: Eine Elster bringt Kummer, zwei bringen Freude, drei eine Hochzeit, vier eine Geburt, fünf Silber, sechs Gold und sieben den Teufel höchstpersönlich.
All das ist sehr interessant, aber wirklich nützlich ist es im Moment nicht. Also greife ich zum Telefon, rufe stattdessen meine Großmutter an und bitte sie um Rat. In ihrem ausgesprochen abwechslungsreichen Leben war sie unter anderem Soldatin in der Roten Armee des Großen Vorsitzenden, Ansagerin bei Radio Peking, Übersetzerin für die staatliche chinesische Propagandaabteilung und – am unvorstellbarsten für alle, die sie kennen – Rektorin einer Dorfschule in Devon. Sie hatte mehr Ehemänner, als ich namentlich nennen könnte, und die einzige Konstante in ihrem Leben scheinen Tiere zu sein. Sie hat Hausgänse und Ziegen gehalten, Staffordshire-Bullterrier gezüchtet, ein Schoßäffchen besessen, das gern heimlich in den Kaffee der Leute pinkelte. Und dann war da jener Spatz, den sie, als eine Art kommunistischer Doktor Dolittle, vermutlich unter großem persönlichem Risiko während Maos Kampagne gegen die Vögel rettete. Mit der schwachsinnigen Spatzen-Zerschmetter-Kampagne wollte man die gesamte Art auslöschen, um zu verhindern, dass die Ernte an diebische Schnäbel verlorenging. Die Spatzen wurden in die Luft gescheucht und mit Trommeln, Rasseln und Knallkörpern so lange dort oben gehalten, bis sie vor Erschöpfung abstürzten. Berge sterbender Spatzen lagen wie Schneeverwehungen in den Straßen Pekings. Und eines dieser Wesen sammelte meine Großmutter auf und fütterte es heimlich. Sie ist selbst ein zäher alter Vogel – der Kerl, der sie am Tag der Rentenauszahlung überfallen wollte, täte mir leid –, aber auch ein treu sorgender.
«Eine Elster?», quiekt sie. «Wofür willst du so einer das Leben retten? Grässliche Kreaturen. Warum ertränkst du sie nicht lieber?»
Oh, denke ich. Ich bin ahnungslos über eines der vielen irrationalen Hassobjekte meiner Großmutter gestolpert, und das sind offenbar häufig Tiere. Sie scheint sich eine ihrer privaten Logik von Gut und Böse unterworfene Welt der Natur konstruiert zu haben, die, von außen betrachtet, nicht unbedingt immer sehr einleuchtend ist. Die fette, einäugige Ratte, die unter den Dielen ihres Wintergartens herumraschelt, ist eine Quelle großen Vergnügens, aber die Ringeltauben, die fröhlich von einem Ast im Nachbargarten gurren, sind böse. Und das scheinen auch die Elstern zu sein. Ich höre mir an, dass das Paar mit seinem Nest in dem Baum oberhalb ihres kleinen Cottages in einer ruhigen Ecke Nordlondons sie mit seinem wüsten Keckern in den Wahnsinn treibe. Sie hat die beiden in Verdacht, ihr kleines Rotkehlchen fressen zu wollen, und möchte wissen, ob ich ihr eine Pistole besorgen könne, am liebsten eine mit Schalldämpfer.
Als Nächstes versuche ich es bei meiner Mum und hoffe auf mehr Glück, während ich es läuten lasse. Sie ist im hausgemachten Zoo meiner Großmutter aufgewachsen, und so, wie sie davon erzählte, klang es, als sei sie generell für die anderen Bewohner verantwortlich gewesen. Jedes Mal, wenn Blodwin, die Ziege, ausriss, um sich an den Blumenbeeten der Dorfbewohner gütlich zu tun, war sie es, die losziehen und sie wieder einfangen musste. Wenn zwischen den übellaunigen Gänsen die Federn flogen, wurde sie raus auf den Hof geschickt, um sie mit viel Schreien und Armewedeln auseinanderzutreiben. Als einzige Tochter einer Schulleiterin und eines überarbeiteten kommunistischen Journalisten in einem Haus mitten im Nirgendwo war sie wahrscheinlich sogar froh über die Gesellschaft. Trotzdem kaufte sie später, sobald sie genügend Geld gespart hatte, für einen Spottpreis ein wildes Pony von irischen fahrenden Leuten und ritt so schnell und so lange wie möglich fort von diesem Zoo.
Sie lacht, als ich ihr von dem Rat ihrer Mutter berichte.
«Die Person, mit der du eigentlich darüber reden solltest, ist dein Vater», sagt sie. «Das heißt, dein biologischer Vater. Er hatte auch einen zahmen Vogel. Allerdings keine Elster; ich glaube, es war eine Dohle – aber gehören die nicht zur selben Familie? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Gedicht darüber geschrieben hat. Und irgendwo gibt es, glaube ich, auch ein Foto.»
Das ist nicht unbedingt die gewünschte Antwort und außerdem keine besonders willkommene Information, auch wenn ich leise Zweifel habe, ob ich ihr glauben kann. Es ist nur ein weiteres seltsam phantastisches Detail, das ich dem verwirrenden und widersprüchlichen Porträt des Mannes hinzufügen kann, der mir das Leben schenkte und sich dann davonmachte. Das meiste, was ich über meinen biologischen Vater weiß, kommt aus zweiter Hand: von meiner Mum und aus dem Internet. Ich könnte nicht sagen, wie er seinen Tee gern trinkt oder welche Art Musik er mag, aber ich kann einige verbürgte Daten und Stationen seines Lebens nennen, allerdings kaum mehr, als auf seiner Wikipedia-Seite zu finden sind. Heathcote Williams, geb. 1941, Hausbesetzer, Schriftsteller, Schauspieler, Alkoholiker, Dichter, Anarchist, Zauberer, Revolutionär und ehemaliger Eton-Schüler. Eine wild gelockte Ikone des radikalen Sechziger-Jahre-Underground, deren Stücke und Essays auf der Strömung von psychedelischem Sex segelten. Aus der Ferne hat Heathcote für mich immer wie jemand gewirkt, der, besessen von einem machtvollen Zauber, fähig ist, nach Lust und Laune Regeln zu brechen. Einmal hat er mehrere Straßen in Westlondon unter seine Kontrolle gebracht, die besetzten Häuser für Obdachlose geöffnet und anschließend die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erklärt, allerdings – wenn die Geschichte stimmt – nicht, ohne sich vorher selbst zum Bürgermeister gekrönt zu haben. Er muss etwas von einem Gentleman-Dieb gehabt haben, jedenfalls benutzte er einmal sein betörendes Talent, um bei Harrods ein komplettes Weihnachtszubehör zu stehlen, mit Truthahn und allem Drum und Dran. Er konnte mit brennenden Fackeln jonglieren, sogar Feuer schlucken, was er aber nicht mehr macht, seit er sich vor der Haustür einer Freundin selbst entzündete. Als leidenschaftlicher Tierliebhaber hat er einmal in die eigene Hand geschissen und einen holländischen Performancekünstler, der vorhatte, mit einer lebendigen Gans zu kopulieren, mit seinen Exkrementen beworfen, um sich dann mit der Gans davonzumachen. Ein Meister des Verschwindens, verdrückte er sich, als ich sechs Monate alt war, mitten in der Nacht, ohne Vorankündigung und ohne Erklärung. Und, wie jener Pirat mit dem Papagei, besaß er eine zahme Dohle, die auf seiner Schulter mit ihm herumzog – warum auch nicht.
Ich dränge meine Mum, mir mehr über Heathcotes Beziehung zu seiner Dohle zu erzählen, aber sie bleibt vage. Sie glaubt, den Vogel habe er gehabt, kurz bevor sie ihn vor fast dreißig Jahren kennenlernte und mich bekam. Das verortet die Dohle immerhin nach Port Eliot, dem stattlichen Anwesen in Cornwall, wo Heathcote auf Einladung seines alten Schulfreunds Lord Peregrine Eliot mehr als ein Jahrzehnt lebte. Meine Mum und ich wohnten für kurze Zeit ebenfalls dort, in dem Cottage eines Schweinebauern, das Heathcote von Peregrine überlassen worden war – eine glückliche Familie unter Bäumen im Wald, zumindest so lange, bis Heathcote zusammenbrach.
«Ja, Port Eliot. Das stimmt, glaube ich», sagt meine Mum. Als sie damals auf der Bildfläche erschien, habe Peregrine, wie sie sich erinnert, ständig wenig nett gewitzelt, da habe Heathcote sich wohl einen neuen «dreckigen Vogel» zum Spielen beschafft.
«Aber ärger dich nicht», sagt sie, als könnte sie durch die Leitung hören, wie ich die Nase krausziehe. «Lies doch mal das Gedicht. Oder, noch besser, frag Heathcote.»
Weder lese ich das Gedicht noch frage ich Heathcote. Es gab eine Zeit, da hätte mich solch eine überraschende Koinzidenz gefreut. Ich hätte sie als Beweis unserer Verbindung begriffen. Und als Gelegenheit, einander näherzukommen. Aber ich habe mich zu oft verbrannt, um solche Überlegungen ernsthaft in Betracht zu ziehen. Jedes Mal, wenn ich die Hand nach Heathcote ausstreckte, löste er sich in Rauch auf. Zum ersten Mal, als ich zwölf war, dann mit siebzehn und dann mit zwanzig, und jedes Verschwinden war schlimmer als das davor. Nach alledem habe ich mir geschworen, nie mehr die Hand nach ihm auszustrecken. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich meine Lektion wirklich gelernt habe, denn erst neulich habe ich ihm eine Einladung zu meiner und Yanas Hochzeit geschickt und hege seitdem die kindliche Hoffnung, er werde vielleicht kommen. In letzter Zeit verkehren wir per E-Mail, aber unser Verhältnis ist kompliziert, um das mindeste zu sagen. Wir kommunizieren, aber wirklich miteinander reden tun wir nicht. Es gibt Gesten von ihm: Er schickt mir seine neuen Bücher mit Gedichten, unterzeichnet seine Karten mit «Dad» und einem Kuss, als sei er überzeugt, damit könne er auf magische Weise die letzten siebenundzwanzig Jahre seiner Abwesenheit überschreiben, ohne dass Entschuldigungen oder schwierige Erklärungen nötig wären. Ich meinerseits scheine vollkommen unfähig zu sein, meine Gefühle ihm gegenüber auszudrücken. Wir stecken beide fest. Und die Kluft zwischen seiner Version der Realität und der meinigen ist himmelschreiend. Vielleicht war er ja ein perfekter Vater für seine Dohle, aber ich werde den Teufel tun, ihn um elterlichen Rat zu bitten.
Stattdessen wende ich meine Aufmerksamkeit wieder der Elster zu. Sie scheint es nicht übelzunehmen, dass ich keine brauchbaren Informationen zutage gefördert habe. Alles, was sie interessiert, sind Würmer, und sie scheint bereit, mich ebenso als deren Lieferanten zu akzeptieren wie Yana. Sie ist ein Bündel Appetit, ein Baby, um das ich meines Wissens nicht gebeten habe, eines, das sich von einem Ast in mein Schlafzimmer gestürzt hat.
3
Wie die Elster sind auch meine Mutter und ich im Frühjahr zu Boden gestürzt. Es geschah in der Nacht: ein leiser Stoß in der Dunkelheit, und unser Nest lag in Scherben. Heathcote hat nie richtig erklärt, was ihn dazu veranlasste; warum er verschwand und warum er danach so vollkommen durchdrehte. Nach Aussage meiner Mum kam es aus dem Nichts, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wie etwas, das unsichtbar im Blut lauert. Hier folgt, was ich von unserer Geschichte weiß; das meiste stammt von ihr.
Polly, meine Mum, war sechsundzwanzig, als sie Heathcote kennenlernte. Mit sechzehn war sie von zu Hause fortgegangen, nach London gezogen, hatte eine Reihe hoffnungslos klingender Freunde gehabt und eine Stelle in einem der großen Verlagshäuser ergattert, was in den Achtzigern eine erstaunliche Leistung war für eine Frau ohne Studium und Verbindungen, ganz zu schweigen von Oxbridge-Abschlüssen, die zu erwähnen ihre Kollegen sich offenbar nie verkneifen konnten. Heathcote war einer der Autoren, die sie zu betreuen hatte. In den Sechzigern war er ein vielversprechender junger Dramatiker und eine bekannte Figur der Gegenkultur mit einer kleinen Fangemeinde. Harold Pinter war einer von ihnen. Doch dann verschwand er vom Radar, wie es scheint, für Jahre. Mit Whale Nation (deutsch «Kontinent der Wale») – einem Gedicht in Buchlänge, das die Schönheit der Wale besingt und ihre traurige Lage beklagt – kehrte er in die Öffentlichkeit zurück, und meine Mum war verantwortlich für die Werbung.
Die professionellen Treffen der beiden wurden bald alles andere als professionell: Er ließ Silberdollars aus der Zuckerdose auftauchen, zeigte ihr Taschenspielertricks und versprach, ihr Jonglieren beizubringen. Sie machten lange Spaziergänge, und er schickte ihr Zauberkunststückchen per Post. Bald schon bestand er darauf, dass sie ihn, wann immer er von seinem Domizil in Cornwall anreiste, frühmorgens vom Nachtzug abholte, worauf sie dann stundenlang im Great Western Hotel frühstückten. Heathcote war viel älter als sie, weit in den Vierzigern, aber das schien keine Rolle zu spielen. Er war auf charmante Weise kindlich: spitzbübisch, verspielt und komisch. Sie genoss es, mit ihm zusammen zu sein, und sie schienen immer mehr Zeit miteinander zu verbringen.
Es gab ein oder zwei ungemütliche Momente während ihres langen und unsicheren Liebeswerbens. Trotz aller Briefe und ausgedehnter Frühstücksgespräche fand Heathcote irgendwie nicht die Gelegenheit, zu erwähnen, dass er eine Familie hatte. Er sei, erklärte er meiner Mum, ein Eremit. Und so war es eine ziemliche Überraschung, als Heathcotes Töchter China und Lily sowie deren Mutter Diana bei einer Lesung von Whale Nation im National Theatre aufkreuzten – umso mehr, als Heathcote als Reaktion darauf aus dem Saal rannte und mit einem Taxi verschwand. Das hätte vielleicht ein Warnzeichen sein sollen. Aber zu der Zeit waren er und meine Mum noch nicht einmal ein Paar, und später, als sie es dann waren, versicherte er ihr, er habe seit Jahren nicht mehr mit Diana zusammengelebt. Sie wohnte in Oxford mit den Kindern, er allein in Cornwall. Er log also nicht, als er sagte, er sei ein Eremit, aber er rückte auch nicht mit der ganzen Wahrheit heraus.
Nach dem unerwarteten Erfolg von Whale Nation kehrte Heathcote in seine «Mansarde», wie er es nannte, in Cornwall zurück. Er wollte ein weiteres Buch zu Ende bringen: Falling for a Dolphin (deutsch: «Delphin»). Dabei handelt es sich um einen Liebesbrief an einen wilden Großen Tümmler, mit dem er wochenlang in der Irischen See zusammen geschwommen war. Es muss eine erstaunliche Beziehung gewesen sein, eine weitere magische Episode in Heathcotes Leben. Er war damals immer ins Wasser gewatet, hatte das Gesicht in den Ozean getaucht, laut «Delphin!» ins Salzwasser gerufen – und das Geschöpf erschien, ein dreieinhalb Meter langer fühlender Torpedo, der ihn auf seinem Rücken in verlassene Buchten trug, wo er nach Fischen tauchte und seinen Fang mit Heathcote teilte. In das epische Gedicht hätten sich seine Gefühle für sie eingeschlichen, erzählte er später meiner Mum, und es war dann auf der Werbetour für dieses Buch, im Winter 1988, als sie schließlich richtig zusammenkamen. Und im Frühling des folgenden Jahres war meine Mum schwanger mit mir.
Heathcote hatte schon eine Familie, und meine Mum war ziemlich jung. Aber Heathcote hatte ausnahmsweise einmal eine vernünftige Einsicht.
«Man kann nicht wegen eines falschen Zeitpunkts bestraft werden», sagte er. «Irgendwann hätten wir sowieso ein Kind bekommen.»
Der Chef meiner Mutter rief sie in sein Büro, als er hörte, sie wolle das Baby behalten.
«Ich möchte Ihnen einfach gratulieren», sagte er mit sensationell unpassender Zuversicht. «Heathcote wird der wunderbarste Vater sein.»
Port Eliot war nicht ganz die Einsiedlerklause, die er meiner Mum vorgeflunkert hatte. In Wirklichkeit stand ihm ein gesamter Flügel des stattlichen Herrenhauses aus dem 12. Jahrhundert seines Freunds Peregrine zur Verfügung, und die dortige Haushälterin brachte ihm täglich eine warme Mahlzeit an die Tür. Heathcote lebte inmitten eines Labyrinths aus Büchern, Papieren und ausgeschnittenen Zeitungsartikeln, arbeitete tagsüber wie besessen an seinen minuziös recherchierten Gedichten und schlief nachts auf einem Lager aus schmuddeligem Bettzeug. Viel zu beschäftigt, um zur Toilette zu gehen, füllte er alles an Gefäßen, was ihm in die Quere kam, mit seiner Pisse. Als das Baby unterwegs war, begann er, mit meiner Mum das alte Cottage des Schweinebauern im Wald einzurichten. Sie legten einen Brunnen an, pflanzten einen Walnussbaum und taten ihr Bestes, um das Häuschen in ein gemütliches Nest zu verwandeln. Meine Mum ließ ihre sämtlichen Möbel und Bücher hinschaffen. Wir würden dort, dachte sie, eine ganze Weile leben.
Abgesehen vom aristokratischen Schmutz war es wohl eine goldene Zeit für sie. Es muss ein Vergnügen gewesen sein mit Heathcote als Partner, faszinierend und lustig. Falling for a Dolphin würde demnächst auf Lesereise gehen, weswegen meine Mum überall im Land schicke Hotels für sie beide buchte. Wenn sie in London waren, schmissen sie Partys in der Wohnung meiner Mum, und als sie im achten Monat war, fuhr Heathcote mit ihr nach Irland, damit sie den Tümmler kennenlernte. Mit Guinness und Whisky abgefüllt, bat er sie, ihn zu heiraten. In vino veritas, erklärte er, als sie ihm vorwarf, betrunken zu sein. Wahr oder nicht, jedenfalls kam es irgendwie nie dazu.
In meinen ersten sechs Monaten war Heathcote, wie prognostiziert, offenbar wirklich ein wunderbarer Vater. Wenn ich morgens aufwachte, war er es, der aufstand und sich um mich kümmerte, während meine Mum weiterschlief. Und lange bevor Bio-Lebensmittel Mode wurden, war er fest entschlossen, das Baby chemiefrei zu ernähren. Beide fanden sogar irgendwie die Zeit und die Energie zu schreiben. Meine Mum arbeitete inzwischen nicht mehr im Verlag, sondern war im Begriff, Journalistin zu werden. Heathcote machte weiter mit seinen Gedichten, marschierte jeden Tag nach Port Eliot, um dort in seinem Papierlabyrinth wie wild zu schreiben. Manchmal kam er mit einem Fasan zurück, den ihm Jäger geschenkt hatten, und meine Mum pulte dann die Schrotkugeln aus dem Fleisch und pürierte es für mich. Vielleicht wusste nur Heathcote, wie fragil das ganze Arrangement war. Nach außen hin wirkte alles perfekt; bis es das dann auf einmal nicht mehr war.
Eines Nachmittags in jenem Frühling saßen er und meine Mum – ich lag neben ihnen – auf einem lebendigen Teppich aus Hasenglöckchen im Wald. «Das ist mehr, als ich verdiene», sagte Heathcote – und er muss es genauso gemeint haben, denn am nächsten Tag war er fort.
An dem Morgen, der alles änderte, wurde meine Mum von meinem Weinen geweckt. Heathcotes Seite im Bett war leer und kalt, und er war eindeutig nicht bei mir. Unten im Erdgeschoss und im Hof war er auch nicht. Eine nächtliche Flucht hatte stattgefunden. Lautlos wie eine Eule war Heathcote im Wald verschwunden und hatte ebenso wenig Spuren hinterlassen wie ein Vogel bei einem offenen Fenster.
Wie sich herausstellte, war er nicht sehr weit geflohen – kaum zwei Kilometer durch den Wald bis zum großen Haus –, aber er hätte sich genauso gut in die Baumwipfel verziehen können. Er war außer Reichweite.
«Er hat einen Nervenzusammenbruch, und er möchte euch nicht sehen», sagte Lord Eliot, als meine Mum ihn aufspürte. «Sie können doch nicht erwarten, dass er für immer Mama Bär, Papa Bär und Baby Bär spielt.»
Nachdem sie mehrere Male vergeblich durch die Hasenglöckchen zum Herrenhaus marschiert war, gelang es ihr endlich, sich heimlich hineinzuschleichen. Heathcote war tatsächlich ziemlich wirr. Seine Augen waren blutunterlaufen und finster, seine Haare wilder denn je.
«Ich bin krank», wiederholte er immer wieder. «Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank.»
Meine Mum streckte mich ihm hin.
«Das ist deine Medizin», sagte sie.
«Ich bin krank», wiederholte Heathcote. «Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank.»
Wir wurden aus dem Haus gejagt. Sie konnte nur erraten, was geschehen war. Heathcote scheint nie auf die Idee gekommen zu sein, er schulde ihr irgendeine Erklärung. Die folgenden Monate waren hart. Meine Mum wusste nicht, wohin sie sich wenden sollte. Sie versuchte es im Haus ihrer Eltern in Devon, aber dort konnten wir nicht lange bleiben, also zogen wir zurück nach Port Eliot.
Unterdessen hatte Heathcote sich aus dem großen Haus verabschiedet, und wir zogen wieder als Familie in das Cottage ein. Heathcote und meine Mum bemühten sich, miteinander zurechtzukommen, doch es war, als bestünde Heathcote aus zwei Personen. Im direkten Umgang war er liebevoll – und fühlte sich schrecklich schuldig. Aber kaum fuhr meine Mum aus Arbeitsgründen nach London, legte er den Schalter um, rief sie an und beschimpfte sie auf wüste Art und Weise.
Er schien beschlossen zu haben, dass es in seinem Leben nicht gleichzeitig Platz für Gedichte und eine Familie gab. Und so begann er, Letztere hinauszudrängen. Ständig zitierte er einen bestimmten Satz, den bekannten Ausspruch des Schriftstellers Cyril Connolly: «Es gibt keinen elenderen Feind guter Kunst als einen Kinderwagen im Flur.»
Irgendwann wurde alles zu viel. Meine Mum zog endgültig wieder nach London. Heathcote blieb in Cornwall. Sie wusste, dass der Traum von einer Familie gestorben war – wollte aber, dass ihr Kind zumindest mit beiden Eltern Umgang hatte.
«Eines Tages werde ich ihn mir anschauen», sagte Heathcote bei ihrem letzten persönlichen Treffen. «Eines Tages. Wenn es mir bessergeht. Das würde mir gefallen.»
Unnötig zu erwähnen, dass dieser Tag sehr lange auf sich warten ließ. Genau gesagt, ein Jahrzehnt. Nach dem Zerbrechen der Beziehung schnitt Heathcote mich und meine Mum aus seinem Leben heraus wie ein Krebsgeschwür. Er kam nicht zu Besuch, schrieb nicht, schickte nie eine Geburtstagskarte. Falls ich jemals irgendwelche konkreten Erinnerungen an ihn hatte – ein braunes Augenpaar dicht über meiner Wiege, eine tiefe Stimme, den tröstlichen Duft vertrauter Haut –, dann verstummten sie allmählich.
4
In meinem eigenen Nest wird die Baby-Elster im Laufe der Woche immer lebendiger. Seit ich allein mit dem Vogel bin, entwickelt sich ein seltsamer Tagesrhythmus. Mit der Morgendämmerung beginnt das Kreischen. Ich ermorde einen Wurm. Zwanzig Minuten später erneutes Kreischen. Weitere enthauptete Würmer, rohes Gehacktes und grauenhaft klebriges Hundefutter. Ich entferne den Matsch unter meinen Fingernägeln, setze mich an meinen Computer, um zu schreiben, und das Kreischen fängt schon wieder an. Seit Yana fort ist, tanze ich nach der Pfeife der Elster und werde dabei selbst immer mehr zu einem Vogel. Ich fange Fliegen aus der Luft und suche draußen nach Maden. Ich renne raus und rein und befördere Spinnen, Raupen und Asseln in den Tod. So geht es bis zum Dunkelwerden. Ich schaffe es nicht, irgendetwas zu erledigen, kann kaum das Haus verlassen und bin, noch bevor die Woche zu Ende ist, irgendwie vollkommen erschöpft.
Als habe sie meine Verwandlung zum Vogelvater begriffen, sperrt die Elster, sobald sie mich in der Nähe ihrer Schachtel erspäht, ihren roten Schlund auf, der fast wie eine Schusswunde aussieht. Selbst der Klang meiner Stimme reicht, damit sie losschreit. Gebannt sehe ich zu, wie sie sich Hunderte winziger Lebewesen einverleibt, um aus breiiger, strukturloser Masse Haut, Muskeln, Knochen, komplizierte Federn und scharfe Krallen zu bauen. Ich überlege inzwischen sogar, ob sie sich noch an ihr Leben in den Bäumen erinnert, an ihre Eltern mit den Lakritzaugen und den scharfen, schwarzen Schnäbeln, die in Zirp- und Krächzlauten mit ihr sprachen.
Lange bevor die Woche ohne Yana vorüber ist, entwächst das Geschöpf seiner Schachtel. Es scharrt energisch an ihren Wänden, verlangt, dass ich es herausnehme, damit es mit tapsenden Schritten und unbeholfenen Hopsern die Welt unseres Schlafzimmers erforschen kann. Kopflastig und unter ständiger Gefahr, umzukippen, rennt es auf seinen dünnen Beinchen umher und untersucht verlockende Steckdosen und verschlungene Elektrokabel. Es kackt überall hin.
Ich folge der Elster mit neuen Augen, bemerke plötzlich die Steck- und Sicherheitsnadeln, die auf dem Boden herumliegen, weil Yana vor ihrer Abreise gerade an ihrem Hochzeitskleid nähte, sehe die Tube mit Sekundenkleber auf ihrem Nachttisch und das Jagdmesser auf meinem. Aus der Vogelelternperspektive betrachtet, ist unser Zimmer – genauer gesagt, unsere ganze Wohnung – eine tödliche Falle. Es gibt da Dinge, die ein Vogel in Freiheit normalerweise nicht fürchten muss. Elektrizität. Türen, die einen zermalmen können. Eine Toilettenschüssel, in der man ertrinken kann. Was passiert, wenn ein neugieriger Schnabel sich im Toaster verklemmt? Vögel scheinen generell besonders empfindlich auf Dämpfe und Sauerstoffmangel zu reagieren, weswegen man einst Kanarienvögel in die Bergwerke mitnahm. Aus dem Internet erfahre ich, dass Reinigungsprodukte, Spraydosen und Gase, die teflonbeschichtete Pfannen absondern, samt und sonders tödlich für Vögel sind. Doch auch andere Dinge, die ich, anders als Bleichmittel, gedankenlos herumliegen lasse, scheinen lebensbedrohlich zu sein: Bestimmte Zimmerpflanzen, Avocados, Zwiebeln, Knoblauch, Pilze, getrocknete Bohnen und Schokolade sind allesamt potenzielle Mörder – zumindest für üblichere Käfigvögel wie Papageien und Kakadus.
Während die Elster auf dem Fußboden herumtrippelt, entsteht in mir der Wunsch, mich mit jemandem auszutauschen, der verlässliche Erfahrung mit der Aufzucht eines Vogels wie diesem hat. Ich gehe die Namen in meinem Telefon durch und überlege, wen ich anrufen könnte, aber bei meinen Kontakten wimmelt es nicht gerade von Elsterbesitzern. Die einzige Person, die mir einfällt, ist Heathcote, und selbst bei ihm habe ich so meine Zweifel. Je mehr Zeit ich mit dieser Elster verbringe, desto weniger glaube ich an die Existenz von Heathcotes Dohle. Die Elster bedeutet eine Menge Arbeit. Chaos. Lärm. Ständiges Füttern. Bei einer Dohle wäre es vermutlich nicht viel anders. Immerhin gehören sie zur selben Familie: den Corviden oder Rabenvögeln. Heathcote war ja nicht einmal seinem eigenen Nachwuchs gewachsen. Wie er für einen Vogel hätte sorgen können, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Die Dohle ist ein Rätsel. Aber vielleicht ist sie auch ein Schlüssel.
Eher zögerlich gehe ich zu dem Regal, in dem Heathcotes Bücher und Pamphlete stehen. Da ist sein erstes Buch, The Speakers, das er schrieb, als seine Teenagerjahre gerade erst hinter ihm lagen und er sich in das unsichere Leben der Redner in der Speakers Corner vom Hyde Park vertieft hatte. Es ist ein Reportagestück, halb George Orwell, halb Jean Genet, unerschrocken in seiner Darstellung von Drogenkonsum, psychischer Erkrankung, Obdachlosigkeit und Sex. Als es 1964 erschien, wurde es von der Kritik gefeiert – lobende Worte, etwa von Anthony Burgess, William Burroughs und Harold Pinter, zieren den Einband –, aber wie das meiste von Heathcotes Werk und wie Heathcote selbst scheint es seitdem in der Versenkung verschwunden zu sein. Ich wandere mit den Fingern an den Werken entlang, vorbei an der Dreiergruppe von Naturgedichten in Buchlänge – Whale Nation, Falling for a Dolphin und Sacred Elephant (deutsch: «Elefanten») –, die etwa zum Zeitpunkt meiner Geburt für einen weiteren Überraschungserfolg sorgte. Diese drei standen, solange ich denken kann, überall wo ich gewohnt habe, in meinem Regal. Zumindest eines war ein Geschenk von Heathcote. Seine schiefe Handschrift füllt die innere Umschlagseite von Falling for a Dolphin: Er erzählt mir da, wie er meine Mum zum Schwimmen mit dem Tümmler mitnahm, als sie mit mir schwanger war. Der Tümmler benutzte seinen Ultraschall, um ihren Bauch abzuhorchen, und war deshalb das erste Wesen, das mich wahrnahm. Diese Widmung ist wie ein Brief aus der Vergangenheit, und er macht mir seit jeher zu schaffen. Wie konnte ein solch offensichtliches Glück einfach verschwinden?
Im Regal folgen Heathcotes jüngere Werke. Mit denen tue ich mich schwer. Die meisten hat er mir geschickt, seit wir vor etwa einem Jahr wieder Kontakt aufgenommen haben. Schmale Gedichtbände, die mit der Post kommen und die zu lesen ich anscheinend nicht in der Lage bin. Ich versuche es, aber meine Augen rutschen einfach von der Seite, und ich muss aufgeben. Deshalb bin ich bis jetzt auch nicht auf sein Gedicht über die Dohle gestoßen. Ich weiß nicht, warum ich so allergisch auf Heathcotes neuere Gedichte reagiere. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht die Worte sind, die ich mir von ihm erhoffe. Wahrscheinlich hat es auch gar nichts damit zu tun, dass sie mir nicht sonderlich gelungen erscheinen. Mit dieser Einschätzung bin ich übrigens nicht allein. Die Pinters und Burroughs von heute stehen mit Sicherheit nicht Schlange, um Heathcotes im Selbstverlag erschienene Ergüsse über Diogenes von Sinope zu preisen.
Ich finde das Dohlengedicht in einem schmalen blauen Taschenbuch mit dem Titel Forbidden Fruit: Meditations on Science, Technology, and Natural History. Es ist, wie ich feststelle, das erste Mal, dass ich dieses Buch aufschlage. «Being Kept by a Jackdaw» versteckt sich zwischen Gedichten über Bienen und Kapitalismus, Wespenhonig und den Falklandkrieg, Alan Turings Selbstmord und die Ausbeutung von Arbeitern, die heute in chinesischen Fabriken Computer zusammenbauen. Diesmal rutschen meine Augen nicht von der Seite. Das Dohlengedicht ist aussagestark, sinnlich und unerwartet zärtlich. Es beginnt damit, dass Heathcote auf einem ländlichen Jahrmarkt vom süßen Duft der Rainfarnpfannkuchen, die auf einem Grill rösten, in ein Zelt gelockt wird. Darinnen entdeckt er Vögel: Stapel hölzerner Käfige mit verletzten Vögeln. Ein Rabe namens Aubrey hypnotisiert ihn mit seinem Starren, und plötzlich fällt ihm wieder ein, wie er als Kind träumte, er habe eine Dohle zum Freund. In diesem Zelt erwacht sein Knabentraum zum Leben. Ich muss das Gedicht mehrmals lesen, bis ich mich ihm ganz überlassen kann. Dann setze ich mich auf den Boden neben die Elster und falle durch die Seiten in die Welt des alten Mannes.
5
Die Federn des Raben legen sich, als er auf der Stange seine Haltung ändert, übereinander wie Schuppen aus Karbonstahl. Es ist etwas Schlangenhaftes in der Art, wie er den Neuankömmling mit seinem stechenden Blick erstarren lässt – eine Kobra oder eine Muräne, die ihre Beute hypnotisiert. Mit winzigen Kopfbewegungen erfasst der Rabe Heathcote, registriert jede Einzelheit, von den zerfransten Enden seiner Schnürsenkel und den Lederflicken an seinen Ellbogen bis zum Dreck unter seinen Fingernägeln und dem vogelnestartig abstehenden wilden Haarschopf. Und darüber hinaus nimmt er ihn in Frequenzen und Aspekten wahr, die menschliches Begreifen übersteigen. Heathcotes schmale Lippen sind in stummer Ehrfurcht geöffnet: Der Vogel ist makellos, gottähnlich, eine lebendig gewordene obsidianschwarze Ikone.





























