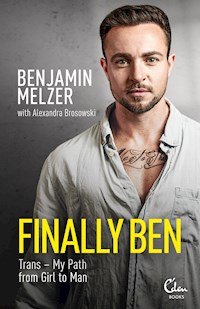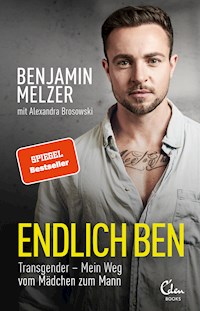
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Benjamin war nicht immer Benjamin, denn er wurde vermeintlich als Mädchen geboren. Von frühster Kindheit an spürt er, dass er sich in seinem eigenen Körper falsch fühlt und tut alles um sich frei zu entfalten. In der Pubertät wird die Situation schlimmer und von Tag zu Tag fühlt er sich mehr gefangen. Dann die Erkenntnis. Mit 18 Jahren sieht er zum ersten Mal einen trans* Mann. Ein Schlüsselmoment. Ben hat endlich Antworten auf all seine Fragen und Gefühle. Ben ist ein Mann. Nach einer Hormonbehandlung und 14 Operationen ist Benjamin "endlich Ben". Sein sportliches Talent setzt er nun als Fitness-Coach und Model ein. Er schafft es bis auf das Cover des Lifestyle-Magazins »Men's Health« – als erster trans* Mann überhaupt. Benjamin Melzer spricht unverblümt über seinen schmerzhaften Weg, misslungene Operationen, seelische Tiefs und wie er sich wieder an die Oberfläche kämpfte. Als Motivator möchte er mit seiner Geschichte anderen Betroffenen und Eltern von Transkindern Mut machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ein paar Worte vorab
»Ich bin es. Max!« (1987–2005)
Kraftquelle Sport und ein fieser Stachel
Erste Lieben
Lesbisch oder was?
Ich lass es richtig krachen
Die Lunte brennt
»Ich kann nicht mehr!« (2005–2010)
Familienscherben
Der Tag der Entscheidung
Mein Plan G (2010–2014)
Step 1: Auf zum Seelenklempner!
Step 2: Nervenaufreibendes Genehmigungsverfahren
Step 3: Hormone – Segen und Fluch
Step 4: Tschüs, Yvonne!
Steps 5, 6 … 17: Der OP-Marathon
Endlich Ben! (2014–2020)
Let’s talk about sex!
Mein neues Leben als Mann
Vom Küchenverkäufer zum Covermodel
Medienrausch – Medienkater
Haariges Geschäft
Totalschaden
Mein Engel
Mensch Ben
Eure Fragen – Meine Antworten
Operationen/Klinik
Penisaufbau/Penispumpe
Liebe
Sport/Ernährung
Eigene Kinder
Transgender allgemein
Haartransplantation
Mut machen
Ein neuer Name
Tattoos
Ben persönlich
Buchlesungen/Übersetzungen
Danke!
Ein paar Worte vorab
23 Jahre im falschen Körper. 17 Operationen, um das zu ändern. Ein verflucht langer Weg. Aber ich bin ihn gegangen und angekommen. Nur das zählt!
Manchmal ist es gut, nicht zu wissen, was einem dabei alles passieren wird, denn sonst würde man sich gar nicht erst auf den Weg machen. An unexpected journey heißt der erste Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich bin ein großer HdR-Fan, und dieser Titel könnte auch der Titel meiner eigenen Reise sein, die ich ohne Wenn und Aber angetreten habe. Frodo und seine Hobbit-Freunde müssen auf ihrer unverhofften Expedition größte Gefahren und böse Überraschungen meistern, sehen ihren ärgsten Feinden ins Gesicht und kämpfen um ihr Leben. Gleichzeitig erfahren sie, was Heimat, Freundschaft und Liebe bedeuten. Das ist meine Geschichte. Ich brauchte allerdings mehr als zwei Jahrzehnte, um mich überhaupt auf den Weg zu machen und zu meinen Wurzeln zu finden. Dabei wusste ich bereits als kleines Kind, dass ich im falschen Körper geboren war. Ich kam als Mädchen auf die Welt, fühlte mich aber immer als Junge. Für das, was ich war, hatte ich jedoch keinen Namen. Bis ich in einer TV-Sendung Chaz Bono, den Sohn der US-Sängerin Cher, sah. Ein Transmann. Als Mädchen geboren, zum Mann geworden. Da wusste ich endlich, was ich war. Endlich machten meine Zweifel, meine Einsamkeit, mein Zwiespalt einen Sinn. Wenn auch einen bitteren. »Als hätte der liebe Gott einen Sekundenschlaf gehabt, als bei dir das Geschlecht verteilt wurde«, sagt meine Mutter dazu.
Diesen Sekundenschlaf werde ich mein Leben lang ausbaden müssen. Aber das ist mir scheißegal. Heute bin ich frei und kann der sein, der ich bin. Ich arbeite als Model, Fitness-Coach, Unternehmer und Influencer und habe es als erstes Transgender-Model auf ein Men’s-Health-Cover geschafft. Klar macht mich das stolz. Es ist mein Zeichen an die Welt für mehr Toleranz.
Doch meine Offenheit hat mich auch angreifbar gemacht. Auf eine Art bleibt man eben immer verkehrt. Es heißt, wer im Rampenlicht steht, sollte sich in Acht nehmen. Wie bitte? Ich bin doch nicht diesen schweren Weg gegangen, um mich wieder zu verstecken oder zu verbiegen. No way! Ich erzähle meine Geschichte offen. Auch was sich hinter der großen Narbe am Arm verbirgt. In der Community ein No-Go. Dafür habe ich einen Shitstorm geerntet, galt als Verräter. Es gibt viele Transgender, die aus ihrer Biografie ein Geheimnis machen. Dürfen sie auch. Die meisten haben Angst, ihren Job und ihre Freunde zu verlieren, Angst vor Ausgrenzung. Das verstehe ich. Aber wenn wir nicht darüber reden, wird sich niemals etwas ändern. Schließlich ist es mein Körper. Da muss ich auf niemanden Rücksicht nehmen. Und mein zutiefst empfundenes Glück ist es, endlich als Mann leben zu können. Deshalb gab es für mich keine Alternative. Ich musste diese beschwerliche Reise unternehmen.
Wie Frodo habe ich dabei treue Gefährten an meiner Seite. Vor allem aber Gefährtinnen. Die Frauen in meinem Leben – meine Mutter, meine Tante, meine Omma, meine Ex-Trainerin und meine Freundinnen – haben mich unterstützt und mir immer wieder Mut gemacht. Ohne sie wäre ich noch einsamer gewesen …
Dieses Buch ist kein Ratgeber. Ich erzähle einfach meine Geschichte, weil ich mir damals genau so ein Buch gewünscht hätte. Es hätte mir die Augen geöffnet, viele meiner Fragen beantwortet. Natürlich muss jeder Mensch seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja nicht nur die eine Wahrheit. Aber wenn du betroffen bist, dein Kind oder ein Freund, dann tretet die Reise an, findet Gefährten, seid mutige Begleiter.
Euer Ben
»Ich bin es. Max!«
(1987–2005)
Manchmal war ich Finn oder Chris, meist aber Max – jedoch niemals Yvonne. Meinen Geburtsnamen sagten nur die anderen. Meine Familie, Freunde, Lehrer. Keine Ahnung, wo ich diese Jungennamen aufgeschnappt hatte. Damals war ich drei oder vier Jahre alt, und diese Namen quollen aus meinem Mund heraus wie die Papierschlange aus einer Kasse. Wie bestellt. Daran erinnern sich auch meine Eltern – widersprochen haben sie mir nie. Sie hielten es für einen »Spleen«, eine »Kleinkindmacke« und irgendwie für »niedlich«. Das galt auch für meine Lieblingsklamotten und meine Vorlieben beim Spielen. Pink, Glitzer oder Schmuck? Um Himmels willen! Eine Geschichte, die auf Kaffeekränzchen mit Omas und Tanten gerne unter dem Motto »Typisch Yvonne!« zum Besten gegeben wurde: Klein Yvonne konnte gerade laufen und steckte in einem Kleidchen mit großem Spitzenkragen. Dieser wehte ihr immer wieder ins Gesicht, was sie so wütend machte, dass sie mit hochrotem Köpfchen versuchte, ihn mit ihren Händchen abzureißen, begleitet von hysterischem Kreischen. Von da an waren solche Kleidchen mit Kragen tabu.
Also weder Kleidchen noch Püppchen, stattdessen immer burschikos und zum Raufen aufgelegt. Ich war so ein typischer Wildfang.
Tief in mir hockte bereits meine eigene Wahrheit. Irre, wie früh die Seele weiß, dass da etwas schiefgelaufen ist.
Eine Stimme im Kopf flüstert dir die Wahrheit zu. Sie wird immer lauter. Aber du bist eben noch viel zu klein, um ihr Gehör zu schenken. Du verstehst nicht, worum es geht und was anders ist. Da sind nur diese lauten Stimmen in dir, die was anderes schreien als das, was wahr sein soll. Ständig dieser große Konflikt in dir: Äußerlich bin ich ein Mädchen, innerlich ein Junge.
Das rosa oder hellblaue Etikett wird einem schon im Kreißsaal verpasst. Ist auf eine Art auch gut so, damit es zu keiner Verwechslung kommt. Doch ich bin falsch etikettiert worden. Rosa gelabelt, obwohl ich eigentlich in die blaue Ecke gehöre. Ich bin zwar noch nicht Vater, kann mir aber gut vorstellen, wie dieser Tag für meine Eltern gewesen sein muss. Natürlich haben sie mir alle Geschichten von meiner Geburt erzählt. Wie stolz und froh sie damals waren. Und dann dieser besondere Moment im Kreißsaal: Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Die Frage aller Fragen – denn in den 1980er-Jahren gab es diese 4-D-Ultraschallgeräte ja noch nicht. »Hauptsache gesund«, behaupten Eltern immer. Aber unbewusste und somit unausgesprochene Hoffnungen spielen eine Rolle. Was nun, wenn das geborene Mädchen eigentlich ein Junge hätte sein sollen? Ich aber hatte eine kleine Scheide zwischen den Beinen. Damit stand mein Etikett fest. Yvonne ist geboren!
Mein zweiter Vorname hätte »Ambivalenz« sein können. Da gab es das fröhliche, lustige, beliebte Kind mit der vorlauten Klappe. Und daneben immer auch das einsame, fragende, suchende Kind mit dem Kloß im Hals. Das frohe und beliebte Kind war stets sichtbar, das traurige konnte ich lange Zeit gut verbergen. Die Bühne meines Lebens war dafür auch wie geschaffen. Der Kulisse fehlte es an nichts. Tatsächlich bin ich extrem privilegiert aufgewachsen. Wir hatten sogar ein Ferienhaus in Spanien, eine eigene kleine Jacht und ein Sportflugzeug. Eine beachtliche Leistung von meinem Papa, der aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Ohne fremde Hilfe hatte er sich nach oben gekämpft und einen erfolgreichen Betrieb für Küchen- und Treppenbau gegründet. Mein Vater ist wahrlich kein einfacher Mensch, aber seine Energie und Zielstrebigkeit finde ich bemerkenswert. Als Kind genoss ich seine Stärke und Präsenz. Nicht so eine Luftpumpe wie so mancher Vater in meinem Freundeskreis.
Überhaupt war die Rollenverteilung bei uns zu Hause von außen betrachtet ganz klassisch. Alle Männer in meiner Familie sind Macho-Level 3000. Meine Mutter hingegen ist Frau durch und durch. So eine richtige Tussi, aber im besten Sinne. Schöne Kleidung, lange Haare, Schmuck und Make-up. Sie kann nicht mal mehr auf flachen Schuhen laufen, weil sie immer nur Pumps getragen hat. Meine Mama ist das weiblichste Wesen, das ich kenne, aber sie wollte aus mir niemals ein Abbild von sich machen. Als sie meine Abneigung gegen Rüschen, Glitzer und Co. bemerkte, hörte sie auf, mich wie eine Puppe auszustaffieren. Von Anfang an war sie meine Verbündete. Ob ich mich nun als Yvonne oder Max durchs Leben raufte. Ich kenne niemanden, der so liebevoll und zugewandt ist. In unserer Familie war sie für die Liebe und die gute Laune zuständig. Ganz klar: Das Herz habe ich von meiner Mutter geerbt, den Geschäftssinn von meinem Vater.
Unsere frühen Familienjahre waren ziemlich harmonisch. Kuscheln und auch baden mit Papa war total normal. Der Kampf zwischen uns begann jedoch, als er seinem süßen Töchterchen süße Kleidchen anziehen wollte. Nicht mit mir! Aber wenn mein Vater etwas nicht erträgt, dann sind das Widerstand und Machtverlust. Sein Bild von einer Tochter wollte er verständlicherweise nicht so einfach aufgeben …
Nur leider war seine Art, sich daran festzuklammern und mir zu zeigen, wer der Herr im Haus ist, oft sehr verletzend. Fragte ein Kellner zum Beispiel »Und was möchte Ihr Sohn bestellen?«, bellte mein Vater sofort los »Das ist ein Mädchen, das sieht man doch!«.
Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst oder zumindest unter den Tisch verkrochen, doch ich wollte nicht noch mehr Blicke auf uns lenken. Ein echter Horrortrip. Und je älter ich wurde, desto schrecklicher fühlte es sich an. Noch heute sind mir diese peinlichen Szenen präsent … Musste ich meinen Vater in ein Restaurant begleiten, nahm ich schon mit mulmigem Gefühl Platz. Mein Herz klopfte wie verrückt. Wenn der Kellner kam, senkte ich den Kopf, hielt die Luft an. Als was sah er mich? In mir tobte ein Kampf. »Ignoriere mich!«, schrie es aus einer Ecke, während es aus der anderen dröhnte: »Los, ich möchte als Junge gesehen werden!« Schaut alle her. Ich bin es. Max! Und bitte, bitte, Papa, halt einfach mal die Schnauze.
Doch Schnauzehalten lag meinem Vater aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ein Melzer-Mann verlässt die Arena nur siegreich und niemals ohne einen letzten Spruch. Natürlich schön laut, damit auch ja niemand die Vorstellung verpasste. Sein Bass erfüllte die ganze Arena, und er führte die Worte wie Schwerter, die mich durchdrangen und zerfetzten. »Sind Sie blind? Das ist doch ein Mädchen!«
Der Hieb trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Mir war heiß. Eine unerträgliche Stille machte sich breit. Der Typ zurückhaltender Kellner fing an zu stottern und entschuldigte sich; der Typ vorlauter Kellner konterte: »Was? Das soll ein Mädchen sein? Ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht« oder: »Das glaube ich ja nicht!«
Prompt holte mein Vater zum nächsten Schlag aus. »Los, Yvonne, zeig deinen Ausweis!«
Meine Mutter hätte so etwas nie von mir verlangt. Never ever! Sie besitzt kluges Feingefühl. Bei meinem Vater hatte ich zunehmend den Eindruck, dass er sich sogar an meiner Scham weidete. Zumindest aber liebt er solche Psychospielchen. Doch mit jeder weiteren Machtdemonstration verlor er immer etwas mehr von meiner Liebe und meinem Respekt ihm gegenüber.
Mein Vater hat allerdings auch eine andere Seite. Diese Behüterseite schätze ich sehr. Und wer weiß, ob er sich nicht sogar in diesen für mich so erniedrigenden Situationen als Hüter empfand: als Hüter seiner Tochter Yvonne. Und egal wie hart er sonst auch war, sobald ich ein ganz praktisches Problem hatte, konnte ich mich darauf verlassen, dass er mir helfen würde. Ob handwerklich oder finanziell. Papa Melzer kann alles. Ein Alphamännchen mit zwei rechten Händen und viel Power. Im Laufe der Zeit hat sich diese Power jedoch immer öfter mit der harten, dominanten, brutalen, lauten, abwertenden Seite zusammengetan, was unserem Familienleben nicht gut bekam. Für mich hatte das besonders verheerende Folgen, denn je größer mein Geschlechtskonflikt wurde, desto mehr Gelegenheiten fand er, um mich zu demütigen.
Mein großes Glück war, dass meine Mutter nicht versuchte, mich in die verhasste Mädchenrolle zu pressen. Auch nicht als kleines Kind. Instinktiv erfasste sie alle Zeichen meiner Anti-Mädchen-Kampagne und ließ es schnell bleiben, meine Haare mit Glitzerspangen oder pinken Haarbändern zu malträtieren. Auch wählte sie für mich eher Kleidungsstücke aus, die als neutral durchgingen, also ohne Chichi und Gedöns. Ich trug meist Hosen und unifarbene T-Shirts. Großes Theater gab es allerdings im Vorfeld besonderer Familienfeiern. Strumpfhosen, Kleider, Rüschenblusen, Röcke. Schließlich macht man sich ja fein zu solchen Gelegenheiten. Und »fein« hieß Kleid. Diese Verkleidungen sorgten schon Stunden vor dem Ereignis für Bambule im Hause Melzer. Ich tobte und schrie, schmiss mich auf den Boden, trommelte mit meinen Fäustchen auf den Teppich oder setzte mich bockig vor meinen Kleiderschrank, damit ja keiner an die Sachen herankam. Für meine Eltern bestimmt nervig und anstrengend. Immerhin hielt ich mit meinem Theater den ganzen Laden auf.
Eine Zeit lang konnten sie mich noch in die Mädchen-Uniform pressen, aber je älter ich wurde, desto heftiger wurden die Auseinandersetzungen. In meinem Kleiderschrank hingen zwar zwei, drei Alibi-Kleider, ansonsten aber nur Hosen, Sportsachen, Hoodies. Während meine Freundinnen sich am liebsten in Prinzessinnengewänder hüllten, fühlte ich mich schon in einem schlichten Rock unwohl. Ich erinnere mich noch gut an die Konfirmation meines Cousins. Da war ich noch relativ klein – etwa vier, fünf Jahre alt. Ich sollte unbedingt ein Kleidchen und weiße Strumpfhosen anziehen. Beides habe ich mir sofort nach dem Gottesdienst vom Leib gerissen und bin dann in Unterhose herumgesprungen – das wiederum fand die versammelte Festgesellschaft süß.
Immer seltener ließ ich mir meine »Klamottenhoheit« nehmen. Das galt auch für meine gesamte Karnevalskarriere. Ich lebe ja nun mal in einer Narrenhochburg. Der Rosenmontagszug und Kinderfasching gehörten zum Pflichtprogramm. Wochenlang jagte eine Verkleidungssause die nächste. Und ich nutzte schon sehr früh die Gelegenheit, um erst in Jungen-, später in Männerrollen zu schlüpfen. Meine Freundinnen waren Meerjungfrauen, Feen, Bibi Blocksberg, Pippi Langstrumpf oder Dornröschen. Ich schämte mich nicht eine Sekunde, als Prinz, Cowboy, Pirat, Polizist, Superhero oder Doktor daherzukommen. Zu Halloween war ich auch nicht Hexe, sondern Zombie. Als Teenager gab ich den Psychopathen aus dem Horrorschocker Scream, und auf der Motto-Cliquen-Party war ich der Zuhälter und nicht die Nutte. An die Cowboy-Zeit erinnert mich übrigens eine Narbe über dem Auge. Die verpasste mir »Sheriff« Stefan beim Wildwest-Spiel mit der Eisenpistole.
Inzwischen bin ich so bei mir, dass ich für eine Hawaii-Mottoparty sogar einen Hula-Rock mit Kokosnuss-BH anziehen würde. Man sieht ja ganz klar, dass ich ein Mann bin, weshalb ich damit spielen kann, ohne mich blöd zu fühlen.
Als Kind tat ich intuitiv alles, um den Jungen, der in mir steckte, hervorzuholen.
Zöpfchenfotos von Yvonne sucht man vergebens im Familienalbum. Für mich gab’s nur kurze Haare, sonst nichts. Wurden die zu lang, griff ich notfalls selbst zur Schere und schnippelte sie ratzekurz. Dann sah ich aus, als hätten mich Ratten angeknabbert, aber das war mir allemal lieber als »Mädchenhaare«.
Gegen diese blöden Ohrlöcher konnte ich allerdings nichts mehr ausrichten. Die hatte man mir verpasst, als ich noch zu klein war, um mich dagegen zu wehren. Das gehörte sich eben so: Kleines Mädchen trägt Ohrringe. Punkt. Ansonsten ist es, wie gesagt, meiner Mutter zu verdanken, dass meine Kindheit kein ewiger Spießrutenlauf war. Es gab sogar lange Phasen, in denen ich mich bestens durchmogeln konnte, ohne ständig von außen auf meinen inneren Kampf gestoßen zu werden. Ich fühlte mich als Max, habe mich so verhalten und gekleidet, und das Umfeld hat es mitgetragen. Man sprach einfach nicht drüber. Ich war das Mädchen, das eben lieber Hosen und kurze Haare trug.
»Seit mein zweites Kind denken konnte«, sagt meine Mutter, »hatte ich einen kleinen Jungen, der Yvonne hieß.«
Wir wohnten damals in Marl, also mitten im Ruhrgebiet, wenngleich sehr abgelegen am Waldrand. Für mich und meinen neun Jahre älteren Bruder ein echtes Kinderparadies mit Teich, großem Garten, einem Gästehäuschen und Holzhütte auf dem Grundstück. Bis ich mich allein mit Fahrrad oder Bus von A nach B bewegen konnte, zwang diese Abgeschiedenheit meine Mutter zu vielen Fahrdiensten, die sie aber, ohne jemals zu murren, übernahm.
So gesehen verbrachte ich meine Kindheit in einer Bilderbuchidylle. Geliebt, gefördert und behütet. Doch obwohl ich von Natur aus ein fröhlicher Mensch bin, lustig und voller Tatendrang, ausgestattet mit Dickkopf und frecher Schnauze, sehe ich auf etlichen Kinderfotos traurig, bockig oder sogar verheult aus. Mein innerer Geschlechterkampf hinterließ seine Spuren. So fürchtete ich zum Beispiel nichts so sehr, wie in neue Gruppen zu kommen. Nicht dass ich nicht schnell Freunde gefunden hätte – ganz im Gegenteil: Mit mir wollten alle zusammen sein –, aber der Moment, in dem ich als Yvonne vorgestellt wurde, war jedes Mal furchtbar. Ich fühlte mich doch wie Max und nicht wie Yvonne! Insofern war es auch nicht verwunderlich, dass die anderen Kinder erst mal erstaunt dreinschauten.
»Hä? Dieser Junge ist ein Mädchen?«
Es mögen nur Nuancen gewesen sein, aber ich nahm jede hochgezogene Braue, jedes Räuspern und Kichern wahr. Mein Michandersfühlen war so fest verankert, dass mich die nicht passende Resonanz der anderen Kinder zutiefst verunsicherte. Was die hörten (»Ich heiße Yvonne«), war nun mal nicht kompatibel mit dem, was sie sahen. Wie ein falscher Ton, der lange nachschwingt. Ein ungehaltenes Versprechen. Vielleicht hatten die Mädchen ja auf eine neue Spielfreundin in der Puppenecke gehofft. Oder eine Einsame auf eine neue Gefährtin. Die Jungs wiederum hatten mich gar nicht auf dem Zettel. In ihrer Ecke mit Autos, Superhelden und Raufereien hatte ich als eine Yvonne eigentlich nichts zu suchen.
In den Kategorien, die nach Rosa und Blau, Helden und Feen unterscheiden, war ich immer irgendwie falsch. Denn ich sah aus wie ein Junge und benahm mich auch so, trug aber einen Mädchennamen.
Heute mag man sich fragen, weshalb das Thema Transgender weder in meiner Familie noch in der Schule jemals aufkam. Dass meine Eltern keine Beratungsstelle aufsuchten, fällt aus heutiger Sicht tatsächlich schwer zu glauben. Sicherlich waren da Fragezeichen, doch waren die in den ersten Jahren nie so groß, dass sie unser Familienleben grundlegend störten. Mal abgesehen davon, dass das Thema Transgender erst seit einigen Jahren als gesellschaftlich relevant gilt und entsprechend diskutiert wird. In den Achtzigern und Neunzigern des vergangenen Jahrhunderts – ohne Internet, Handy und Social Media – konnte beziehungsweise musste sich meine Familie durchmauscheln. Zumal es kaum Aufklärung und Beratung gab. Außerdem war ich kein verschlossenes oder gar depressives Kind – und optisch wohl am ehesten ein »Es«. Hübsch, aber eben weder Junge noch Mädchen. »An Yvonne ist ein Junge verloren gegangen«, hieß es immer. Mit dieser Schublade konnten alle Beteiligten ziemlich gut leben. Nach außen hin sogar ich. Schließlich war ich damit aus der Schusslinie. Und für die anderen Kinder gab es eh nur die eine entscheidende Frage: »Ist die doof? Oder kann man gut mit ihr spielen, bolzen, buffern?« Hey, ich bin ein Ruhrpottkind, noch dazu ein sportliches. Ich galt als Teamplayerin und war schon im Kindergarten die Vorreiterin, das Alphamädchen, Chefin-Boss und Mädchenschwarm. Jawohl.
Ich war der Junge, der Yvonne hieß.
Auf diese Weise gelang es mir zumindest sehr lange – wenn auch mal mehr, mal weniger gut –, die innere Zerrissenheit, die mich permanent begleitete, auszublenden.
Kraftquelle Sport und ein fieser Stachel
Ein wichtiges Ventil in meinem Leben war und ist der Sport. Draußen herumtoben, um die Wette rennen, klettern? Seit ich denken kann, genau mein Ding. Und dann kam das Wasser mit all seinen Sportmöglichkeiten hinzu. Es sollte meine große Liebe werden. Mit Schwimmen fing es an. Das lernte ich während eines Spanienurlaubs. Herbert*, der damalige Chef meines Vaters und guter Freund meiner Eltern, brachte es mir bei, als ich vier Jahre alt war. Behutsam unterstützte er meine ersten Schwimmversuche im warmen Mittelmeer, indem er seine Hand von unten gegen meinen Bauch legte, damit ich nicht unterging. Immer und immer wieder – bis ich es schließlich allein konnte. »Da haben wir ja ein richtiges Naturtalent, eine richtige kleine Nixe«, lobte er mich. Das hörte sich schön an, obwohl ich lieber ein Wassermann gewesen wäre. Danach hätte ich das tragende Wasser am liebsten gar nicht mehr verlassen.
Aus dem Urlaub zurück, wollte ich meine neu entdeckte Leidenschaft natürlich nicht aufgeben und ließ nicht locker, bis ich im Schwimmverein angemeldet wurde. Dort machte ich mich so gut – ehrgeizig war ich sowieso –, dass man mich schon bald Wettkämpfe schwimmen ließ. Mit noch nicht mal sechs Jahren. Eine fantastische, sehr unbeschwerte Zeit. Für meine Mutter bedeutete die Schwimmkarriere ihrer Tochter allerdings eine Belastung mehr, denn sie fuhr mich nun zweimal die Woche zum Training nach Dortmund. Vierzig Minuten hin und vierzig Minuten zurück plus den Wettkämpfen an den Wochenenden. Da ich noch ein Kind war, störte sich zunächst niemand im Verein daran, dass ich in Badehose beim Training auftauchte. Immerhin schwamm ich darin ja wie der Blitz und sammelte einen Pokal nach dem anderen und ein großes Bündel an Medaillen. Irgendwann ging das mit der Badehose natürlich nicht mehr, und ich musste wie alle anderen Mädchen auch einen Badeanzug anziehen. Meine Stimmung mag darunter gelitten haben, meine Leistung jedenfalls nicht.
Wasser ist bis heute mein Element. Wenn ich mich darin bewege, wird plötzlich alles viel leichter, irgendwie schwerelos. Nirgends kann ich meinen Kopf so gut abschalten und mich fallen lassen wie beim Schwimmen und Tauchen.
Nach fünf Jahren beendete ich meine Schwimmkarriere jedoch. Ich gewann noch einen wichtigen Pokal, dann hörte ich auf. Das sorgte natürlich für Bestürzung bei Trainer und Mannschaftskolleginnen.
»Oh nein, Yvonne, wir können und wollen nicht auf dich verzichten. Gerade jetzt, wo du die nächste Stufe erreichen könntest«, versuchte mich mein Trainer zu locken. Es tat mir auch sehr leid, denn ich mochte den Sport und die Menschen dort. Aber im Badeanzug hatte ich keine Chance mehr. Meine wachsenden Brüste machten mir einen Strich durch die Rechnung. Sollte ich die ab jetzt etwa öffentlich zur Schau stellen? Für mich eine entsetzliche Vorstellung. Diese beiden Dinger wollten mir etwas aufzwingen, das ich zutiefst ablehnte: das Mädchensein. Also musste ich mir Ausreden einfallen lassen.
»Ich komme doch jetzt auf die weiterführende Schule«, erklärte ich, »da schaffe ich es einfach nicht mehr mit den vielen Stunden und Hausaufgaben und so.«
Dass mein Bruder und mein Cousin André gleichzeitig aufhörten – sie wechselten zur Leichtathletik –, verschaffte mir gleich noch eine Ausrede: Die zusätzliche Fahrerei werde meiner Mutter zu viel.
Ja, mein struggle nahm definitiv an Fahrt auf. Es wurde immer schwieriger, diesen ständigen inneren Kampf zu ertragen. Doch der Sport half mir dabei, mich wenigstens noch als selbstbestimmter Mensch zu fühlen: Auf das Schwimmen folgte die Leichtathletik. Das lag nahe, schließlich war André damals mein bester Freund und wie mein zweiter Bruder. Vielleicht war es für den anderthalb Jahre Älteren deshalb auch nie komisch, dauernd mit einem Mädchen abzuhängen. Seit Jahren unternahmen unsere Familien viel gemeinsam; man feierte so gut wie alle Geburtstage und Feiertage miteinander. Auch als wir älter wurden, waren André und ich fast täglich zusammen. Wenn ich mit dem Schulbus nach Hause kam, hieß es kurz mittagessen, Hausaufgaben zusammenpfuschen – und dann raus: skaten oder eben Leichtathletik. André war mein Sparringspartner im Training und im Leben. Wir hatten nicht nur die gleichen Interessen, sondern sehen uns bis heute sogar sehr ähnlich. Wie Geschwister. Unsere innige Freundschaft dauerte sehr lange an. Erst als er zum Studium nach Köln ging und wir beide in unser Erwachsenenleben einstiegen, haben wir uns etwas aus den Augen verloren.
Nach wie vor hat Sport eine hohe Bedeutung für mich. Er gibt mir die Kraft, mich zu spüren und mit anderen zu messen, an Grenzen zu kommen, sie zu überwinden und die eigene Willensstärke zu spüren. Gleichzeitig ist Sport mein Weg, Wut, Frust und innere Einsamkeit zu kompensieren. Schnell habe ich gemerkt: Wenn du dich auf dem Sportplatz abrackerst, hast du weniger Zeit zum Grübeln. Außerdem bot er mir immer wieder die Gelegenheit, mich mit Jungs zu vergleichen. Konnte ich, was sie konnten? War ich genauso schnell und stark?
Es folgte eine Episode in meinem Leben, die ein großer Triumph hätte werden können, jedoch abrupt endete. Mit einem Stachel im Herzen, den ich wahrscheinlich nie mehr loswerde.
Mein Bruder und André trainierten unter der Leitung der bekannten Kugelstoßerin Gertrud Schäfer. Als ich die beiden eines Tages beim Training besuchte, durfte ich aus Spaß ein paar Runden mitrennen.
»Du bist ja schnell!«, sagte Gertrud Schäfer mit einem ungläubigen Blick auf ihre Stoppuhr. »Junge, Junge … Wann fängst du bei uns an, mein Mädchen?«
Das war mein Sprung ins Team.
Ich hatte einen Mordsrespekt vor meiner neuen Trainerin, betete sie regelrecht an. Nicht nur dass Gertrud Schäfer selbst deutsche Meisterin und Olympia-Teilnehmerin gewesen war, sie ist auch eine Trainerlegende. Unter ihrer Regie gewann die Siebenkämpferin Sabine Braun zweimal die Weltmeisterschaft und wurde zweimal Europameisterin. So jemandem begegnet man wirklich nicht jeden Tag. Und noch unwahrscheinlicher ist es, von so einer Koryphäe betreut zu werden. Das Glück meinte es richtig gut mit mir. Noch dazu bescheinigte sie mir großes Potenzial und wollte mich für eine Sportlerlaufbahn fit machen.
Dass Gertrud Schäfer auf der weiterführenden Schule auch noch meine Sportlehrerin wurde, kam meinem sportlichen Fortschritt sehr zugute, weil sie mich nun noch mehr im Blick hatte. Eine intensive Trainingszeit über drei Jahre schweißte uns zusammen – und meine Trainerin entwickelte einen verheißungsvollen Plan.
»Ich bringe dich zu den Olympischen Spielen!«
Davon war sie offenbar felsenfest überzeugt. Ich traute meinen Ohren nicht. Wie bitte? Ich und Olympia? Der helle Wahnsinn. Das schien so unwirklich, so abstrakt. Einfach sehr weit weg. Da hocke ich immer vor der Mattscheibe, wenn sich Athleten aus der ganzen Welt bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften messen. Und nun soll ich da mitmischen? Ich freute mich wie verrückt, blieb äußerlich aber ganz cool, während mein Ehrgeiz auf Hochtouren kam. Für eine ganze Weile schwebte ich auf Wolke sieben, vergaß sogar meine große Last, die ich mit mir herumtrug.
Gertrud Schäfers Idee war es, mich wie einen Phönix aus der Asche zu präsentieren. Sie wollte mich allein, also ganz ohne Verein, aufbauen, um mich dann bei wichtigen Wettkämpfen aus dem Hut zu zaubern und die Konkurrenz zu überraschen. Auf mich hatte diese Form des Trainings allerdings keinen guten Effekt, weil ich mich ganz selten mit den Besten messen konnte. Dauernd gegen schwächere Mitschüler zu siegen, ist nur halb so schön und zielführend. Und so blieb André, der ähnlich gut war wie ich, mein einziger Sparringspartner. Aber er kämpfte nun mal gegen ein Mädchen.
Nach und nach schwand meine Motivation, was durch den energiefressenden Kampf in mir selber verstärkt wurde. Dauernd nur Training, Training, Training. Dabei setzten mir meine Hormone immer mehr zu. Ich hatte Schlafprobleme, fühlte mich ausgelaugt und überfordert. Es fiel mir immer schwerer, die Laufschuhe zu schnüren, die Sporttasche zu packen. Dann noch der ganze Schulkram und meine Seele. Hilfe! … Vater und Trainerin machten tüchtig Druck. »He, Yvonne, streng dich an.« »Du kannst noch mehr, das weiß ich!« Oft war ich so fertig, dass ich kotzen musste. Das alles führte dazu, dass ich mich immer häufiger fragte: Wofür diese ganze Plackerei? – bis ich es irgendwann einfach satthatte. Viel lieber wollte ich mich den verlockenden, süßen Mädels um mich herum widmen …
Heute bereue ich es zutiefst, nicht durchgehalten zu haben. Es schmerzt mich, vielleicht die größte Chance meines Lebens verpasst zu haben. Das mag angesichts meiner Geschichte nebensächlich erscheinen. Aber den Traum von Olympia nicht realisiert zu haben, hat eine tiefe Narbe hinterlassen. Gertrud Schäfer hatte eine enorme Bedeutung für mich, als Trainerin, aber auch als Mensch, weil sie an mich geglaubt hat. Ihre unkomplizierte Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen, tat mir damals unglaublich gut. Gerade deswegen habe ich mich auch jahrelang so geschämt. Was für eine Enttäuschung muss ich für diese großartige Trainerin gewesen sein.
Gertrud Schäfer erinnert sich …
»Ich muss mich in eure Bewegungen verlieben«, habe ich immer zu meinen Athleten gesagt. Bei Yvonne war das kein Problem. Ich sah sie und wusste sofort, dass ich da ein Riesentalent vor mir hatte.
Die Schule, an der ich als Sportlehrerin tätig war, verfügte über eine zweihundert Meter lange Tartanbahn mit leichter Steigung. Da habe ich Yvonne getestet. Das war selbst für eine alte Sporthäsin wie mich ein sehr aufregender Moment, als ich das schmale Ding die Bahn hochflitzen sah. Ich traute meinen Augen kaum. Yvonne hatte wahnsinnige Beine mit einer unglaublichen Schrittfolge. Eines dieser seltenen Naturtalente. Sie erreichte auf Anhieb Zeiten, von denen andere nur träumen konnten.
Aber nicht nur ihre körperlichen Voraussetzungen waren einmalig. Sie war total sprintstark und hatte eine enorme Ausdauer. Sie war einfach topfit und dank der vielen verschiedenen Sportarten, die sie betrieb, sehr gut durchtrainiert. Ein absoluter Trainertraum.
»Wenn du durchtrainiert bist, dann sehe ich dich als 17-Jährige in der 4 × 400-Meter-Staffel, und zwar bei den Olympischen Spielen in Athen. Du bringst alles mit«, sagte ich zu ihr. Damit hatten wir beide einen Deal und einen Plan.
Langsam steigerten wir das Training. Zu Hause in Marl habe ich selber eine Kugelstoßanlage, einen Diskus-Abwurfplatz und einen Kraftraum. Zudem konnten wir das Gelände im Wald und die Sportstätten der Schule am Wochenende nutzen. Im ersten Jahr hat sich Yvonne voll reingehängt, sehr viel trainiert. Dann aber wallten die Hormone, und die Liebe wurde wichtiger als die Stunden auf dem Sportplatz.