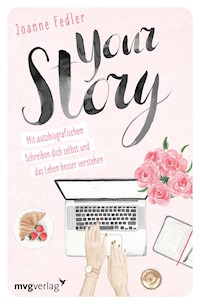8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeit für Freundinnen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Sechs Jahre danach: Ihre Kinder sind groß geworden, ihre Falten leider auch. Leichter ist das Leben der Mütter um Helen und Jo allerdings nicht – im Gegenteil! Die Hölle der Pubertät, Schönheitsoperationen ja oder nein, Sex, den man nicht hat, Ehe, Mutterschaft und ihre eigenen Mütter – genug Gesprächsstoff für ein erneutes kinder- und männerfreies Wochenende ohne Tabus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Ähnliche
Joanne Fedler
Endlich wieder Weiberabend
Roman
Aus dem Englischen von Katharina Volk
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist allen Müttern und Töchtern gewidmet, vor allem aber Lisa und Kaitlyn
Vorabbemerkung der Autorin
Dank Endlich wieder Weiberabend habe ich mit ein paar Freundinnen ein Wochenende im Kangaroo Valley in New South Wales verbracht, wo wir tranken, kochten, spazieren gingen, redeten und uns sogar im Planking versuchten – alles natürlich sehr verantwortungsvoll und rein zu Recherchezwecken. Dieses Buch bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Fiction und Non-Fiction. Viele Dialoge darin sind Abwandlungen echter Gespräche, die ich entweder selbst mit Freundinnen geführt oder aufgeschnappt habe, wenn sich andere Frauen im Park oder vor der Schule unterhalten haben. Dennoch möchte ich betonen, dass dies ein fiktives Werk ist. Ähnlichkeiten der Charaktere mit mir, meinem Mann, meinen Kindern oder meinen Freundinnen sind mehr oder weniger zufällig, obwohl ausgerechnet die absurdesten Vorkommnisse und Gespräche sehr wahrscheinlich genau so stattgefunden haben.
Sicher ist die Vorstellung weit verbreitet, dass ein Tag, der mit dem Abliefern der Kinder vor der Schule beginnt und mit einem gemeinsamen Abendessen am heimischen Küchentisch endet, keine magischen, dramatischen oder aufregenden Ereignisse zu bieten habe. Trotzdem liefert mir die Tatsache, dass ich Mutter bin, immer wieder reichlich Material für neue Bücher. Aus dem unerwartet großen Erfolg von Weiberabend habe ich gelernt, dass Frauen sehr gern etwas über das wahre Leben von Müttern lesen, so wenig glamourös es manchmal auch sein mag.
Prominente Mütter wie Posh Spice oder Angelina Jolie reisen in der Welt herum, stolzieren über rote Teppiche und werden auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt. Für uns ganz normale Mütter dagegen besteht der Tag hauptsächlich aus Kleinigkeiten und immer denselben einfachen Arbeiten. Was wir tun, bleibt meist unbemerkt, und niemand applaudiert uns dafür. Aber nicht nur in der von politischen Schaukämpfen und wirtschaftlicher Macht geprägten großen, weiten Welt gibt es bedeutsamen Wandel. Ruhige Gespräche unter Frauen führen oft zu kleinen Veränderungen, hin zu mehr Autonomie, persönlicher Entscheidungsfreiheit und Weiterentwicklung. In diesem Buch geht es um das alltägliche Ringen darum, etwas Außergewöhnliches zu sein – ein guter Mensch, eine gute Mutter und eine gute Freundin. Es bezeugt zu oft belächelte Siege und die unbeweinten Tragödien der Selbstverleugnung, die Frauen erleben auf ihrem Weg durch jene Wandlungsprozesse, die Mutterschaft und Freundschaft ihnen abverlangen.
Gandhi sagte einmal, sein Leben sei seine Botschaft. Als Frauen und Mütter sind unsere Leben unsere Geschichten.
Joanne Fedler
Sydney, September 2011
Das Wichtigste über uns
Jo
Alter: 44
Seit 16 Jahren mit meinem Mann Frank zusammen, seit acht Jahren verheiratet.
Kinder: Jamie (13) und Aaron (11).
Blick hinter die Fassade: Schlafstörungen ab drei Uhr morgens, vor kurzem mussten Myome entfernt werden, Orangenhaut greift um sich.
Helen
Alter: 49
Bald 16 Jahre mit David verheiratet.
Kinder: Nathan (13), Sarah (12), Cameron (10) und Levi (6).
Blick hinter die Fassade: Werde mir wohl bald die Gebärmutter entfernen lassen müssen, da drinnen ist alles zusammengebrochen, außerdem chronischer Tinnitus, steigendes Übergewicht, nicht vorhandenes Liebesleben.
Ereka
Alter: 46
Immer noch mit Jake zusammen. So ein guter Mann.
Kinder: Olivia (13), Kylie (11).
Blick hinter die Fassade: Verdacht auf Diabetes, muss noch 80 Kilo abnehmen. Mindestens.
CJ
Alter: 48
Geschieden. Lebe seit zwei Monaten mit Kito zusammen.
Kinder: Liam (15), Jorja (13) und Scarlett (11).
Blick hinter die Fassade: Lasse mir regelmäßig Botox spritzen (sieht man das etwa nicht?) und demnächst den Bauch straffen.
Maeve
Alter: 48
Ledig – na ja, geschieden, um genau zu sein, aber das ist schon eine Weile her. Seit fünf Jahren in einer lockeren Beziehung mit Stan.
Kinder: Jonah (23).
Blick hinter die Fassade: Warum um alles in der Welt sollte jemand Genaueres über meinen Gesundheitszustand wissen wollen? Wie die meisten Frauen in meinem Alter komme ich gerade in die Wechseljahre, und meine Zähne knirschen, aber das wirst du doch nicht etwa schreiben, oder?
Summer
Alter: 41
Seit fast einem Jahr mit Craig verheiratet (Ehemann Nummer drei).
Unseren ersten Hochzeitstag feiern wir irgendwo auf den Fidschi-Inseln, und zwar todsicher.
Kinder: Jai (16), Airlee (15) und Jemima (9).
Blick hinter die Fassade: Alles in bester Ordnung – vielleicht ein bisschen Cellulite.
Virginia
Alter: 49
Ledig und kinderlos.
Blick hinter die Fassade: Frühe Wechseljahre (entfernte Gebärmutter), Gelenkrheuma im Frühstadium.
1 Ein Haus, von dem man selbst nur träumen kann
Mit dir ist es gar nicht mehr lustig«, brummt Helen.
Ich stakse auf dem Kopfsteinpflaster hinter ihr her wie ein Groupie auf Highheels nach ein paar Martinis zu viel und zerre meinen Rollkoffer mit. Lavendelbüsche in voller Blüte flankieren den Weg bis zur Tür dieses – glaubt mir, es gibt kein anderes Wort dafür – Anwesens. Ihr wisst schon: so ein Haus, von dem man selbst nur träumen kann. Das einem nie gehören wird, jedenfalls nicht in diesem Leben. Allerdings ist »Haus« hier nicht zutreffend, denn so nennt man üblicherweise die bescheidenen vier Wände, in denen normale Leute wohnen. Das hier ist pure Prahlerei. Giftgrüner Efeu ist um die eleganten Schultern des Gebäudes drapiert, und die glänzenden Fenster zwinkern uns zu. Ich frage mich, welchen Millionären es gehören mag und wo sie jetzt wohl sind. Wahrscheinlich auf ihrer eigenen Insel in der Karibik.
Allerdings werdet ihr vielleicht ein bisschen neidisch, wenn ich euch erzähle, dass wir dieses Anwesen zumindest für ein paar Tage gemietet haben. Helen dachte sich, dass ein Wochenende unter Freundinnen mich aus meiner Depression aufrütteln könnte, obwohl ich ihr immer wieder erkläre, dass ich nicht an Depressionen leide. Es gibt eine Menge Gründe für meine Schlaflosigkeit.
»Du willst meine Mutter sein? Ich bin dir doch scheißegal.« Das waren die letzten Worte meiner Tochter Jamie, ehe sie vor nicht einmal drei Minuten einfach auflegte, während ich in der Einfahrt parkte. Diesmal werde ich sie nicht zurückrufen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Sie ist jetzt dreizehndreiviertel. In dieser Phase gewöhnt man sich allmählich an den Hass.
Letzte Woche allerdings, als sie diesem Wackelhündchen mit der Schärpe, auf der »Weltbeste Mutter« steht, den Kopf abgerissen hat … also, das hat wirklich weh getan. Sie hatte es in der Schule gebastelt, und es war an meinem Armaturenbrett befestigt. »Die ganze Klasse musste diese Dinger machen. War nicht meine Idee«, brüllte sie, als hätte sie lieber Weltblödeste Mutter darauf geschrieben. Ich mochte dieses Hündchen. Sein Torso gilt mir als Mahnmal für alles, was ich als Mutter falsch gemacht habe.
»Schalt doch dein Handy aus«, sagt Helen.
Als wäre es das Telefon, das mich hasst. Sie kämpft mit dem Schlüsselbund, den sie auf dem Weg hierhin im Büro der Ferienwohnungsvermittlung in Bowral abgeholt hat. Ich wartete derweil im Auto und blätterte in Das nackte Überleben: Die 100 größten Gefahren der Welt, das Aaron heute Morgen auf dem Rücksitz hatte liegen lassen. Zweifellos ist dafür wieder mal eine Überziehungsgebühr der Bücherei fällig. Ich könnte sie ihm vom Taschengeld abziehen. Aber dann würde mich bloß seine Klassenlehrerin anrufen und mir berichten, dass er seine Pokemon-Karten oder Nintendo-Gamecards auf dem Pausenhof verkauft. In den zehn Minuten, bis Helen zurückkam, erfuhr ich, wie leicht man durch Botulismus, Kugelfischgift und den gefrorenen Inhalt von Flugzeugtoiletten zu Tode kommen kann – so etwas muss ein elfjähriger Junge offenbar unbedingt wissen.
»Deine Kinder werden schon ein Wochenende lang ohne dich überleben. Steh ihnen einfach mal nicht zur Verfügung.«
Helen hat einen völlig anderen Erziehungsstil als ich und handelt eher nach der Devise: »Lass sie mal machen.« Ich hingegen gleite von einer Sorge (plötzlicher Kindstod, Ersticken an kleinen Gegenständen oder Ertrinken in flachen Gewässern) zur nächsten (Straßen überqueren, allein öffentliche Toiletten aufsuchen und beim Freund einer Freundin im Auto mitfahren, der gerade erst den Führerschein gemacht hat). All das sagt allerdings mehr über die Gesellschaft aus, in der wir leben – eine Welt, die meine Kinder sich mit Vergewaltigern und verantwortungslosen Autofahrern teilen müssen –, als über mich.
Sicheres Geleit – mehr verlange ich doch gar nicht für meine Kinder. Nur von hier bis ins Erwachsenenalter. Aber wohin ich auch schaue, scheint Gefahr zu lauern. Heutzutage kann man ja kaum mehr die Zeitung aufschlagen, ohne vorher Valium zu schlucken. Hai-Attacken, Autounfälle, Skiunglücke, Terroristen, die Pädophilen nicht zu vergessen. Ich liebe Alice Sebold, aber ich muss sagen, dass In meinem Himmel in dieser Hinsicht wenig hilfreich war. Falls Jamie allen Ernstes glaubt, ich würde sie für drei Wochen nach Borneo reisen lassen, damit sie dort irgendeinen Berg hinaufklettern und sich durch einen Urwald voller wilder Tiere schlagen kann, irrt sie sich. Und sie behauptet allen Ernstes, sie sei mir egal.
Helen schließt die Tür auf, und wir betreten ein dämmriges Entree, das in ein lichtdurchflutetes Foyer übergeht.
»Puh«, sage ich und meine mehrere Dinge auf einmal. Zum einen: »Du meine Güte – Kronleuchter!«, und zum anderen: »Was müffelt hier denn so?«
»Modrig«, sagt Helen.
Was immer das sein mag, es riecht definitiv nicht gut.
»Ansonsten ist es gar nicht so übel für unser großes Wiedersehen.«
»Na ja, so groß wird es nun auch wieder nicht, wenn die Hälfte von uns fehlt«, erinnere ich sie.
Nach unserem letzten Treffen, dem berüchtigten Weiberabend im Haus von Helens Mutter, hatten wir große Pläne, das müsst ihr mir glauben. Kann das wirklich schon sechs Jahre her sein? Wir haben uns damals hoch und heilig versprochen, uns mehrmals im Jahr zu treffen. Wir priesen die Bedeutung solcher Zusammenkünfte und beteuerten uns gegenseitig, wie wichtig es sei, Freundschaften zu pflegen, mal nur unter Frauen zu sein, ohne unsere Männer, und ausnahmsweise zuallererst an uns selbst zu denken.
Doch nach Levis Geburt war Helen plötzlich spurlos verschwunden. So, als wäre sie tatsächlich verschollen. Das vierte Kind war endgültig zu viel für sie, und sie stürzte ab. Aber jetzt ist sie wieder da, so wunderbar lebendig, so überlebensgroß wie immer. Sie hat dieses Wochenende mit einem Eifer organisiert, als hinge ihr Leben davon ab. »Wenn ich nicht bald von meiner Familie wegkomme, bringe ich noch jemanden um«, hatte sie fröhlich erklärt.
Ich habe nur halb so viele Kinder wie Helen, trotzdem schaffe ich es an manchen Tagen gerade so, den letzten Teller in die Spülmaschine zu stellen und mit den nassen Handtüchern aus dem Badezimmer kurz über den Boden zu wischen, ehe ich ins Bett falle – mit einem Seitenblick zu Frank, der ihm unmissverständlich signalisiert: »Denk nicht mal daran.«
Wie hat Helen nur die Zeit gefunden, diese großzügige viktorianische Villa für acht Personen, inmitten sanfter Hügel gelegen, mit zauberhaftem Garten, Springbrunnen, Pergola und eigenem Damm ausfindig zu machen? Sie ist der meistbeschäftigte Mensch, den ich kenne, aber irgendwie schafft sie es immer, sich Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu nehmen. Wie sie das macht, ist mir allerdings ein Rätsel.
Helens Behauptung, mit mir sei es nicht mehr lustig, ist eine haltlose Übertreibung – das möchte ich hier mal festhalten. Ich habe mich weder Jesus noch Scientology zugewendet, noch bin ich zur Siebenten-Tags-Adventistin oder Veganerin geworden. Ich habe dem Alkohol nicht abgeschworen und auch nicht noch ein Kind bekommen (sie hingegen schon – und mit wem war es da gar nicht lustig, hm?). Sie übertreibt nur deshalb so schamlos, weil ich mich auf unserem Weg durch Bowral geweigert habe, die frittierten Venusmuscheln bei dem Thai-Imbiss zu holen. Das hat sie ein bisschen persönlich genommen.
Anscheinend hat sie vergessen, dass ich ihr immerhin erlaubt habe, mir am Tag vor meiner Hochzeit die Schamhaare zu rasieren. Eine Gemeinschaftsaktion, und ja, es waren auch Kameras dabei. Und was ist mit dieser Hafenkreuzfahrt, bei der sie mich dermaßen mit Cocktails abgefüllt hat, dass ich mir selbst auf den Schoß gekotzt habe? Mit mir kann man sehr wohl eine Menge Spaß haben. Auch wenn ich zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Kalorientagebuch und einen Schrittzähler im Gepäck habe.
Ich folge Helen ins Wohnzimmer, an dessen Decke man ein Trapez aufhängen könnte – nur für den Fall, dass mal ein Zirkus hier gastieren sollte. Durch die hohen Fenster fällt das Licht herein. Wie ein alternder Filmstar, der noch immer alle Aufmerksamkeit im Raum auf sich zieht, steht ein Flügel auf schwarzen Zehenspitzen in einer Ecke.
»Viel Platz für eine Party, findest du nicht?«, sagt sie.
Dieser Raum bettelt geradezu darum, dass man auf den Knien quer über den polierten Boden rutscht, wie die Protagonistin in Flashdance. Aber das kann ich nicht – am Ende verrenke ich mir dabei den Rücken, und dann wäre es wirklich nicht mehr lustig mit mir.
Direkt vor uns erhebt sich eine prächtige Treppe mit Buntglasfenstern am Treppenabsatz, wo sie sich teilt und in zwei Bögen nach rechts und links schwingt, so dass man sich aussuchen kann, auf welcher Seite man hinauf- oder hinuntergehen will. Als Kind habe ich immer davon geträumt, in so einem Haus zu leben. Wie in Vom Winde verweht.
»Wann kommen die anderen?«, frage ich.
»Irgendwann halt. Warum? Entspann dich. Immerhin können wir uns die besten Schlafzimmer aussuchen.«
Das ist mir nicht so wichtig. Ich schlafe sowieso kaum noch.
»Wer ist eigentlich diese Freundin, die CJ mitbringt?«
»Keine Ahnung. Jetzt mach dich mal locker. Das wird nett, du wirst schon sehen.«
Ich fände es auch sehr angenehm, wenn die Atmosphäre hier locker wäre. Wer nicht? Aber bei CJ weiß man nie. Sie ist Anwältin. Und sie hat ein Problem mit emotionaler Abgrenzung. Am Ende bringt sie eine Mandantin mit, eine Betrügerin, Prostituierte oder Drogenhändlerin – ihr wisst schon, einen von den Menschen, zu denen meine Kinder auf gar keinen Fall heranwachsen sollen. Allerdings, wenn ich so darüber nachdenke … Solche Leute sind bei Partys immer sehr unterhaltsam. Zumindest lenken sie einen von den eigenen Problemen ab.
In einer neu zusammengewürfelten Gemeinschaft ist die sich entwickelnde Gruppendynamik immer Glückssache. Und ich komme so selten mal ein Wochenende weg. Andererseits – wie schlimm kann es schon werden? Unser letztes Treffen war anders. Wir waren alle miteinander befreundet, oder zumindest fast alle. Unsere Kinder gingen in denselben Kindergarten, also konnten wir alle über dieselben ätzenden Mütter lästern. Dem ist nun nicht mehr so. Zunächst einmal wohnt Fiona nicht mehr in Sydney. Nach ihrem Kampf gegen den Brustkrebs haben sie und Ben ein Stück Land in der Nähe der Byron Bay gekauft, ihr Haus mit allem Drum und Dran verhökert und sich dort draußen eine Ökohütte hingestellt, in der sie jetzt eine Massagepraxis betreibt und ihr eigenes Gemüse anbaut. Sie musste eine so heftige Chemotherapie machen, dass sie seitdem keine Augenbrauen mehr hat. Aber sie lebt jetzt so, wie sie es schon immer wollte. Als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe, hatte sie gerade ihren ersten Korb Erdbeeren aus dem eigenen Garten geerntet und klang so glücklich wie nie zuvor.
Eine weitere Veränderung haben wir im Grunde alle kommen sehen: Liz und Carl trennten sich, weil sie eine Affäre hatte. Liz ist jetzt eine noch größere Nummer in der Welt des Marketings und verbringt die Hälfte des Jahres in Europa. Wenn man sie googelt, bekommt man über hunderttausend Ergebnisse angezeigt. Liz und ich versuchten anfangs noch Kontakt zu halten, doch die E-Mails wurden mit der Zeit immer seltener. Wenn man neu anfängt, will man das Leben ablegen, das man geführt hat, als man noch verheiratet war – das ist nur verständlich. Dass dabei ein paar Freundinnen auf der Strecke bleiben, ist völlig normal. Ich bin froh, dass Carl wieder geheiratet hat. Ich bin ihm und seiner neuen Ehefrau einmal am Strand begegnet, mit Chloe und Brandon, seinen gemeinsamen Kindern mit Liz. Sie wirkten auf mich wie eine Bilderbuchfamilie, also gibt es wohl doch so etwas wie ein Leben nach der Scheidung.
Dooly haben wir auch zu unserem Wochenendausflug eingeladen, aber sie konnte »unmöglich« weg. Ich habe sie zuletzt nach der Beerdigung ihrer Mutter gesehen, als ich ihr einen großen Topf Hühnersuppe vorbeigebracht habe. Sie sagte so etwas wie: »Wenn ich nur daran denke, dass sie nie wieder anrufen und mich bequatschen wird, bis ich mich richtig schlecht fühle, dann fühle ich mich gleich noch schlechter.« Das war eine gelungene Zusammenfassung all dessen, woran Mutter-Tochter-Beziehungen so oft kranken.
Wir waren uns alle einig, Tam nicht einzuladen. Mein letzter Kontakt zu ihr war ein Eintrag an ihrer Facebook-Pinnwand, mit dem ich ihr auch in Franks Namen zur Geburt ihres Babys gratuliert habe. Sie hat nicht mal darauf reagiert. Ich glaube, sie hat mich schon immer gehasst.
Mit Helen allein hätte ich jederzeit ein Wochenende in einem Nobelhotel mit Rund-um-die-Uhr-Zimmerservice verbracht. Aber sie meinte, wenn wir ein paar mehr Leute wären, könnten wir ein tolles Haus mieten, irgendwo auf dem Land.
Ereka und CJ haben wir um der alten Zeiten willen gefragt, ob sie mitkommen wollen, obwohl wir die beiden seit Jahren nicht gesehen haben. Ereka kann nur eine Nacht hier verbringen – solche Ausflüge sind immer schwierig für sie, weil ihre Tochter Olivia geistig behindert ist. Und CJ, die offenbar eine neue Beziehung hat, antwortete per SMS: »Darf ich jemanden mitbringen?« Helen war dafür, denn sie hatte ausgerechnet, was uns dieses Anwesen mit dem klingenden Namen Blind Rise Ridge kosten würde. Sie fand, je mehr Leute wir waren, desto besser – und ein bisschen frischer Wind könne doch ganz lustig sein.
Ich habe ebenfalls ein paar Freundinnen gefragt, ob sie mitkommen möchten, darunter auch Maeve. Wir haben uns in der örtlichen Bücherei kennengelernt, beim Vortrag einer buddhistischen Nonne, die die letzten acht Jahre allein in einer Höhle verbracht hatte. Das ist vermutlich eine Extremsportart in der Meditationsszene: kein Fernsehen, keine Gespräche, nicht mal Wäsche waschen. Maeve könnte Susan Boyles jüngere, attraktivere Schwester sein. Diesem Vergleich kann man sich gar nicht entziehen. Als Erstes fielen mir ihre schwarzen Lederstiefel und der Trenchcoat auf, von dem sich herausstellte, dass sie ihn selbst genäht hatte. Er war über und über mit Buttons bedeckt, die sie auf ihren Reisen in alle Herren Länder gesammelt hat. Dass sie ein grünes und ein braunes Auge hat, als hätte Gott sich nicht entscheiden können, sah ich erst, als ich unmittelbar vor ihr stand.
»Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern?«, begann ich das Gespräch.
»Susan Boyle?«, entgegnete sie ein wenig gequält.
Das hörte sie wohl nicht zum ersten Mal.
Trotzdem kam die Unterhaltung in Gang, denn wir waren uns einig, dass die Nonne zwar wahnsinnig heiter und gelassen war, dafür aber auch eine wahnsinnig schlechte Rednerin. Ehe der Abend vorüber war, hatten wir unsere Telefonnummern ausgetauscht, und als ich mir ihre Visitenkarte am nächsten Morgen richtig ansah, stellte ich überrascht fest, dass sie Ethnologieprofessorin ist. Tags darauf schrieb ich ihr eine E-Mail, und wir trafen uns zum Mittagessen in einem kleinen Café nahe der Uni. Nach einer Weile äußerte ich mein Erstaunen darüber, dass wir so lange auf unser Essen warten mussten. Daraufhin erzählte sie mir, dass die San in Afrika ein Gift aus den Larven mehrerer kleiner Käferarten, giftigen Pflanzen, Schlangengift und giftigen Raupen herstellen. Manchmal warten sie bis zu drei Tage lang, bis ein großes Beutetier daran stirbt. Vor diesem Hintergrund war es wohl kaum das Ende der Welt, eine Dreiviertelstunde auf einen Caesar Salad zu warten.
Maeve war auch mal verheiratet (»vor ewigen Zeiten«) und führt derzeit eine sehr lockere Beziehung mit Stan, einem geschiedenen Professor für neuere Geschichte. Ihr erwachsener Sohn Jonah reist mit seiner Gitarre und seiner Freundin kreuz und quer durch Südamerika. Ihre größte Sorge gilt ihrem nächsten wissenschaftlichen Artikel, und am meisten Kopfschmerzen bereiten ihr die zweihundert Examen, die sie zweimal pro Jahr korrigieren muss. Sie gärtnert und näht gerne, geht ab und an zu Weinproben oder Sonderausstellungen in Museen und macht zweimal die Woche um halb sechs Tai-Chi, während ich gerade darüber grübele, was ich meiner Familie zum Abendessen vorsetzen soll. Eines Tages wird mein Leben auch so aussehen. Wahrscheinlich aber mit Frank.
Maeve lächelte hilflos, als ich sie fragte, ob sie ein Foto von Jonah dabeihabe. Offenbar verspüren nicht alle Mütter den Drang, bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit ihrem Nachwuchs anzugeben und dazu stets ein Bild im Geldbeutel parat zu haben. Ich hingegen trage sogar eine Kette mit zwei runden silbernen Anhängern, auf denen Jamies und Aarons Namen und ihre Geburtsdaten eingraviert sind. Die Kette lege ich nie ab.
Maeve kann faszinierende Geschichten über die Kulturen und die Gebräuche der Stämme erzählen, die sie studiert hat – ein paar davon möchte man allerdings lieber nicht beim Essen hören. Hätte ich erst später im Leben Frank kennengelernt und Kinder bekommen, dann hätte ich sicher auch irgendwas Großartiges und Humanitäres gemacht, bei dem man in der ganzen Welt herumreist. Wahrscheinlich könnte ich dann »Wo bitte geht’s zum Bahnhof?« auf Zhuang und Igbo fragen. Ich könnte euch erzählen, wie die Tongaer ihre Toten begraben und die Amischen Hochzeit feiern. Stattdessen kann ich Schulbücher ohne eine einzige Luftblase in Klebefolie einschlagen und mir Spiele ausdenken, die die Folgen des Klimawandels illustrieren – alles Fähigkeiten, die die Tongaer zweifellos faszinierend fänden. Außerdem hat Frank mir zum Hochzeitstag die Verlängerung meines Abos der Reisezeitschrift Getaway geschenkt.
Mit Maeve sitze ich nicht herum, um die Zeit totzuschlagen, während unsere Kinder beim Schwimmen oder Karate sind. Ich brauche auch kein Interesse an den genialen Leistungen ihres Kindes zu heucheln oder mir Litaneien über irgendwelche Verhaltensprobleme anzuhören. Wir beide unterhalten uns über Jonathan Franzens Bücher und Julian Assanges Wikileaks. Dabei trinken wir Kaffee, ohne ständig auf die Uhr zu schauen. Die Mutterschaft ist uns kaum eine Erwähnung wert, genauso wie die Menstruation oder die Wechseljahre: Wir Frauen machen das alle durch, auf die eine oder andere Weise, aber warum ständig darüber reden?
»Ich war noch nie bei einem Freundinnen-Wochenende«, sagte sie, als ich sie dazu einlud. Also muss alles perfekt werden.
Außerdem habe ich noch Alison eingeladen, aus meinem Pilateskurs am Samstagvormittag. Sie ist Kinderärztin, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Freundin Polly zusammen. Helen war ganz aufgeregt bei der Vorstellung, dass wir bei unserem Wochenende eine echte Lesbe dabeihaben würden. Ich überlegte kurz, ob ich auch noch Polly einladen sollte, aber dann dachte ich mir, dass dieses Wochenende ja auch ein Urlaub von unseren Partnern sein soll. Das gilt unabhängig davon, ob dieser Partner eine Vagina hat oder nicht, und damit auch für Alison. Außerdem muss jemand auf ihre Kinder aufpassen. Aber dann schrieb mir Alison per SMS, dass sie dieses Wochenende Notdienst habe und nun doch nicht mitkommen könne. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das Helen gegenüber wiedergutmachen kann.
Über Virginia mussten Helen und ich eine Weile diskutieren. Die beiden kennen sich seit der ersten Klasse. Das ist schön für sie, allerdings gibt es da ein Problem: Virginia ist Single und sie hat keine Kinder. Nicht mal Adoptiv- oder Stiefkinder. In ihrem Leben gibt es niemanden, dem sie Rechenschaft oder Sklavendienste schuldig wäre, kein einziger Klotz am Bein. All das ist natürlich nicht unbedingt erforderlich, um sich für dieses Wochenende zu qualifizieren. Aber sie arbeitet obendrein als Location Scout fürs Fernsehen und kommt in der ganzen Welt herum.
Für mich bedeutet das: Uns steht ein ganzes Wochenende mit einem kinderlosen Glamour-Girl bevor, das uns die ganze Zeit von einem fantastischen Fotoshooting hier und dem grandiosen Urlaubsparadies dort erzählen wird. Ich bin jetzt schon grün vor vorweggenommenem Neid.
»Toll«, sagte ich jedoch zu Helen. »Das bedeutet völlig neue Gesprächsthemen. Dann reden wir wenigstens nicht die ganze Zeit nur über unsere Kinder.«
Dieses Haus wäre groß genug für zwanzig Frauen, stelle ich fest, während wir das Wohnzimmer inspizieren. Der Raum vermittelt das Gegenteil von gemütlicher Vertraulichkeit, wie immer man das auch bezeichnen würde. An der linken Wand hängt ein monströser Spiegel mit einem opulenten vergoldeten Rahmen voller Blätter, Weintrauben und kleinen, verstaubten Engeln. Er lässt den Raum tatsächlich optisch doppelt so groß wirken. Irgendjemand hier mag es möglichst weitläufig.
»Schau mal – wir«, sage ich.
»Ja, wir«, sagt Helen, ohne hinzuschauen.
»Wir sehen gut aus«, bemerke ich.
»Sprich bitte nur für dich.«
Das zählt zu den Dingen, die ich an Helen liebe: Sie trägt immer noch die ausgeleierte Trainingshose, in der ich sie seit zehn Jahren kenne, mit einer Spur Porridge vom Frühstück am rechten Knie – jedenfalls hoffe ich, dass es Porridge ist. Sie schläft oft in ihren Klamotten und läuft den ganzen Tag im Schlafanzug herum. Alle ihre Sachen sind dunkelblau oder schwarz, damit der Schmutz nicht so auffällt, außerdem weit und bequem, meist mit Gummibund. Das einzige Make-up oder Kosmetikprodukt, das ich sie je habe benutzen sehen, ist die Salbe gegen Windelausschlag, die sie immer in der Handtasche hat und als Lippenbalsam hernimmt. Wäre sie eine Immobilie, würde man sie in der Anzeige so beschreiben: Gemütliches, anheimelndes Haus mit eigenem Charakter für die große Familie, geringe Unterhalts- und Nebenkosten – hier bekommen Sie noch viel für Ihr Geld! Eitelkeit gehört jedenfalls nicht zu ihren Lastern.
Plötzlich nehme ich aus dem Augenwinkel drei riesige Gestalten wahr und wirbele herum. Kein angenehmer Anblick. In der Beschreibung stand davon kein Wort. Aus der gegenüberliegenden Wand ragen die Köpfe dreier enthaupteter Kreaturen hervor. Einer sieht nach Wildschwein aus, der zweite gehörte mal einem Hirsch und hat ein prächtig geschwungenes Geweih, der dritte einem Büffel.
»Der da erinnert mich an Fritzy – einen Kerl, mit dem ich mal eine Weile zusammen war, ehe ich David kennengelernt habe«, sagt Helen.
»Du warst mit einem Kerl zusammen, der aussieht wie ein Wasserbüffel?«
»Nein, der andere – nur ohne die Hauer.«
Die dunklen, leuchtenden Augen blicken voll Argwohn auf mich herab.
»Warum sollte jemand ein Lebewesen erschießen?«, murmele ich vor mich hin.
»Adrenalin. Testosteron. Der Kick bei der Jagd.«
»Wie soll ich mich denn bitte entspannen, wenn die uns das ganze Wochenende lang anstarren?«
»Sie starren nicht. Sie sind tot«, erwidert Helen und wedelt mit der Hand vor den Köpfen herum. »Siehst du? Sie zwinkern nicht mal.«
Ich bin keine Vegetarierin, daran kann es also nicht liegen. Ich wende mich von den kalten Augen ab und betrachte das alte Grammophon, das Sofa in burgunderrotem Leder und die antike Standuhr, die ausdruckslos Viertel vor zehn anzeigt, obwohl es schon nach Mittag ist. Nichts davon gehört uns, aber wir haben gutes Geld dafür bezahlt, damit wir uns hier ein Wochenende lang »wie zu Hause fühlen«. Allerdings ist es sehr merkwürdig, dies im Haus fremder Leute zu tun. Ich komme mir ein bisschen voyeuristisch vor, wie beim Kauf von Second-hand-Sachen. Trotz aller Pracht ist Blind Rise Ridge ein Haus, das jemand zurückgelassen hat. Ich kann die Traurigkeit beinahe riechen.
»Ein Kamin.« Ich seufze.
»Das Einzige, was wir nicht anfassen dürfen, ist der Flügel. Der wird nächstes Wochenende versteigert.«
Nicht, dass ich Klavier spielen könnte. Aber wozu die Leute in Versuchung führen? Man weiß nie, wer von uns nach Helens mehr als gut gemixten Cocktails einen kleinen Flohwalzer-Anfall bekommen könnte. Ich habe da schon so einiges erlebt.
Helen lässt sich in einen der gemütlichen Sessel fallen und legt die Füße auf den gepolsterten Hocker davor. »Ich hätte gern ein Glas Champagner und einen Cranberrysaft, danke.«
»Gehört zu diesem Haus etwa kein Butler?«
»Der hätte extra gekostet«, sagt sie seufzend.
»Zu schade.«
»Komm, sehen wir uns oben um.«
Mein erster Freund Travis hat einmal zu mir gesagt: »Wenn man sich ein Schlafzimmer aussucht, wählt man damit seine Träume.« Die Worte sind irgendwie hängen geblieben. Es stellt sich heraus, dass von den acht Zimmern im ersten Stock nur vier Betten haben. Ich will mich ja nicht beschweren, aber in der Anzeige stand etwas von acht.
Eines der Zimmer ist ein Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch aus Stinkholz, das nächste eine Mini-Bibliothek mit Bücherregalen an den Wänden. Ich entdecke unter anderem eine vollständige Ausgabe der Encyclopaedia Britannica und ein mehrbändiges Werk mit dem Titel Australien im Krieg mit rotem Ledereinband. Das dritte Zimmer war offenbar mal ein Kinderzimmer – blaue Enten auf gelber Tapete, ein hölzernes Schaukelpferd in einer Ecke und ein kleines Pianola mit einem Hocker darunter in der anderen. Über den Tasten des Kinderklaviers hat jemand von Hand eine Bordüre mit Pferden und Kindern aufgemalt, die tanzen und Flöte und Laute spielen. Dies war ohne Zweifel einmal ein magischer Raum. Das ist jetzt keineswegs sentimental – ich muss bei dem Anblick nur daran denken, dass die Zimmer meiner Kinder von Monitoren und Displays und Plastikkrempel made in China geprägt sind. Beim Hinausgehen sehe ich die Striche am Türrahmen, mit denen jemand die Größe seines heranwachsenden Kindes markiert hat, und plötzlich wird mir ganz wehmütig ums Herz bei dem Gedanken, wie schnell Jamie und Aaron groß geworden sind.
Das letzte Zimmer am Ende des Flurs ist abgeschlossen. Helen probiert alle Schlüssel an ihrem Schlüsselbund aus. Keiner passt.
»Was meinst du, was da drin ist?«
»Ein paar Leichen und vielleicht irgendwelche Körperteile in Formaldehyd«, sagt Helen, und ich hoffe, es ist ein schelmisches Funkeln, was ich da in ihren Augen erkenne.
Ich lache und erwidere: »Du bist wirklich grausam.«
Die vier Schlafzimmer haben alle Erkerfenster, die sich der Landschaft entgegenschieben wie Brüste in einem Wonderbra. In zweien steht je ein Doppelbett, in den beiden anderen befinden sich je zwei Einzelbetten. Aha … für acht Personen. Helen lässt ihre Reisetasche auf das Bett im größten Schlafzimmer mit eigenem Bad fallen und erklärt, sie werde das Doppelbett liebend gern mit jeder von uns teilen, die ihr nächtliches Schnarchen und Pupsen erträgt.
Wie schön für sie! Ich persönlich kann dazu nur sagen, dass in dieser Phase meines Lebens Freundschaft und Liebe nicht mehr gleichbedeutend sind mit teilen. Im Lauf der Jahre habe ich viel zu viel von mir selbst mit anderen geteilt. Im Grunde tue ich das nach wie vor. Ich teile das Badezimmer, das Bett und meine Vagina mit Frank. Obwohl wir nun seit fünfzehn Jahren zusammenleben, habe ich mich immer noch nicht an die ständige Anwesenheit eines anderen Menschen in meinem Schlafzimmer gewöhnt. Nicht einmal an den guten, alten Frank, dessen Körpergeräusche und -gerüche ich unter hundert anderen blind erkennen und wahrscheinlich vermissen würde, sollte er eines Tages mit seiner Sekretärin durchbrennen.
Er behauptet, dass ich schnarche. Ich würde zwar lieber an meinem eigenen Erbrochenen ersticken, als das zuzugeben, aber jetzt mal ehrlich: Falls ich tatsächlich schnarche, dann nur, wenn ich endlich mal wirklich tief schlafe. Versteht ihr jetzt, warum ich für dieses Wochenende unbedingt ein eigenes Schlafzimmer wollte? Stattdessen sieht es ganz so aus, als müsste ich mit der Peinlichkeit klarkommen, jemand anderen wachzuhalten.
Ich suche mir eines der Zimmer mit zwei Einzelbetten aus, von dem aus man auf einen versteckten Garten an der Westseite des Hauses blickt. In dem Garten gibt es ein Vogelbad aus Stein, das mit nassem Laub verstopft ist, einen Springbrunnen, einen kleinen Teich und ein paar Engelsstatuen, umgeben von einem Halbkreis aus Zitronenbäumchen mit verschrumpelten Früchten daran. Es ist noch nicht lange her, da wäre Jamie ganz aufgeregt darin umhergehüpft und hätte nach Feen gesucht. Heute bringt nur noch diese Talentshow, die jeden Freitagabend um halb acht auf Channel Ten kommt, sie zum Hüpfen.
Ich öffne den antiken Schrank, dessen Türen mit Schmetterlingen bemalt sind. Er ist leer bis auf ein paar Kleiderbügel mit handgenähten, bestickten Überzügen. Hier hat offenbar mal eine Frau gewohnt, die reichlich Zeit hatte.
Das in Rosa und Weiß gehaltene Badezimmer erinnert nicht mehr an Erdbeeren mit Sahne, wie einst erwünscht. Die rosa Badewanne hockt breit auf ihren Klauenfüßen, die Emaille ist in der Mitte abgeschabt. Das Waschbecken trägt einen Rock aus Chintzstoff mit Rosen, passend zu den Vorhängen – wie ein dickes Mädchen in der Disco, das bei der Wahl seines Outfits schlecht beraten wurde. Die Toilette und das Bidet auf der anderen Seite stehen ein wenig gekrümmt, wie ein altes Ehepaar. Noch immer ist deutlich zu erkennen, was sich jemand einmal dabei gedacht hat, aber meist sind es genau solche in die Jahre gekommenen Bäder und Küchen, die den Charme alter Häuser ruinieren, so, wie die schrumpelige Haut an Händen und Hals einer Frau ihr wahres Alter verrät. Und zwar auch dann, wenn diverse andere Körperteile diversen Renovierungsarbeiten unterzogen wurden.
Ich gehe die Treppe hinunter und rufe nach Helen. In einem so großen Haus könnte man sich glatt verlaufen.
»Bin in der Küche!«, ruft sie zurück.
Ich folge der Stimme in die riesige Küche, in der ramponierte Kupfertöpfe und -pfannen wie überfürsorgliche Eltern über dem Kochfeld hängen.
Helen räumt gerade den sahnigen Brie und den Gorgonzola in den Kühlschrank. In dessen Tür steht eine Flasche Baileys, im obersten Fach ist eine Packung Tiramisu aus dem Supermarkt. Da ist nichts dabei, was ich auch nur probieren dürfte.
»Ich weiß nicht, was du essen willst, wenn ich mit Kochen dran bin«, bemerkt Helen lachend.
Sie ist heute für das Abendessen zuständig, ich morgen. Mittagessen und Frühstück sind unter den anderen aufgeteilt.
Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe selbst genug Lebensmittel für dieses Wochenende dabei, denn wenn es um Essen geht, kann man Helen nicht trauen. Sie wäre glatt in der Lage, mir Wodka in die Cola light zu kippen und heimlich Sahne in die Suppe zu rühren. Das ist die hohe Kunst an Freundschaften. Du musst wissen, welche Lügen deine beste Freundin dir gewissenlos auftischen würde, um dich betrunken oder high zu machen oder auch nur dafür zu sorgen, dass du weiter im selben Team spielst.
Als ich all die gesunden Sachen aus meiner Kühlbox zutage fördere, meint Helen: »Das Leben hat mehr zu bieten als Gemüse, weißt du?«
Ich ignoriere sie einfach und schlage stattdessen vor, dass wir den Kühlschrank in zwei Bereiche teilen, die Gesundheits- und die Schlemmerseite.
»Wird sowieso keinem auffallen«, schnaubt Helen. »Du bist die Einzige hier, der das nicht egal ist.«
Schade, dass Jamie das nicht gehört hat.
Helen nimmt die Pappschachteln vom Thai-Imbiss im Ort und kehrt zurück ins Wohnzimmer. Wir öffnen die Türen zu der überdachten Veranda, die einmal um das ganze Haus geht und von der man auf wuchernde Beete mit Lavendel, Rosenbüschen und anderen bunten Blüten blickt. Auf der staubigen Glasplatte des Tisches steht ein leerer Vogelkäfig, über dem Geländer liegt eine Hängematte, von den Deckenbalken hängen zwei kokonförmige Sessel – die ich ganz bezaubernd finde – und eine Reihe bunte, aber sehr staubige Flaschen. Ein gepflasterter Weg führt einen sanften Abhang hinab zu einer Pergola neben einem kleinen Teich.
»Himmel, was für eine Aussicht«, seufzt Helen.
Der Horizont ist von Wald gesäumt, und die sanften Hügel sind unterteilt in pistaziengrüne und zimtbraune Streifen.
Ich lege Helen einen Arm um die Schulter und drücke sie an mich.
»Das war eine gute Idee.«
Sie nickt.
»Hier wurde hoffentlich niemand ermordet?«
»Was glaubst du, warum wir das Haus so günstig bekommen haben? Pass bloß auf, dass du nicht in die Blutflecken auf dem Teppich trittst.«
Sehr lustig. Das soll doch ein Witz sein – oder?
»Sei einfach mal fröhlich und genieße den Augenblick.«
Ich nehme den Arm von ihrer Schulter. Sie weiß genau, wie sie mich treffen kann. Okay, dafür brauche ich ihre Geburtstagsgeschenke nie weiterzuverschenken. Als sie mir letztes Jahr ein Blatt vom heiligen Bodhi-Baum aus Indien mitbrachte – das sie durch den Zoll schmuggeln musste –, habe ich geweint. Sie erzählte mir, wie sie sich zusammen mit Tausenden anderen Touristen darauf gestürzt hatte, als es ausgerechnet vor ihr zu Boden fiel. Aber sie bekam es als Erste zu fassen. Mit Helen möchte man wirklich nicht streiten, das könnt ihr mir glauben.
Frank betrachtete das Blatt und sagte: »Wahrscheinlich hat sie es irgendwo in Delhi von der Straße aufgelesen.« Aber bei etwas so Wichtigem würde Helen mich nicht belügen. Sie hat meine Hand gehalten, während ich schlotternd vor Angst auf eine Darmspiegelung wartete, sie war für mich da, als Frank und ich eine Beziehungskrise hatten, und sie hat mich von Trauer, Heimweh und mehreren schwierigen Phasen in Aarons und Jamies Leben abgelenkt, indem sie mich ins Kino geschleift und mit Maltesers-Schokokugeln vollgestopft hat. Sie hat mir über wirklich schlimme Zeiten hinweggeholfen. Vielleicht werden wir uns demnächst öfter sehen, je älter die Kinder werden.
»Wo sind eigentlich die Besitzer?«, frage ich. »Was hat dieses Haus für eine Geschichte?«
Helen winkt ab. »Keine Ahnung. Wen interessiert das schon? Für die nächsten achtundvierzig Stunden gehört Blind Rise Ridge uns. Wir können tun und lassen, was wir wollen – außer mit dem Flügel. Für mich steht dieser Nachmittag ab sofort unter dem Zeichen der Krabbe. In Thai-Sauce.«
2 Die lang vermisste freie Natur
Mein iPhone zeigt keine verpassten Anrufe oder neuen Nachrichten an, weshalb ich es wieder in die Tasche meiner Jeans stecke. Helen öffnet ihre Pappschachtel und beobachtet dann kritisch, wie ich meinen Krabben-Papaya-Salat ohne Erdnüsse aufmache. Er liegt in der Plastikschüssel auf einem Nest aus Bohnensprossen und Karottenstreifen. Gesund ist gar kein Ausdruck.
Sie nimmt sich eine frittierte Krabbe, beißt hinein und stöhnt vor Genuss. »Die musst du probieren.«
»Hundert Prozent Fettgehalt. Du könntest genauso gut eine Schüssel Walfischspeck essen«, sage ich bloß.
»Macht dieser ständige Verzicht dich wirklich glücklich?«
Sie beißt wieder von der Krabbe ab, deren Panade mit Chili und Koriander gewürzt ist.
»Er hat mich zumindest dünner gemacht. He, du magst doch gar keinen Koriander.«
»Jetzt nicht mehr. Ich liebe Koriander.«
»Seit wann das denn?«
»Schon ungefähr ein Jahr.«
»Du kannst doch nicht einfach anfangen, Koriander zu mögen, und mir nichts davon erzählen. Ich bin deine Freundin, mir solltest du alles sagen.« Was hat sie früher für einen Aufstand gemacht, wenn ich auch nur einen Hauch Koriander in einen Salat oder ein Wok-Gericht geben wollte.
»Wann denn? Ich sehe dich ja kaum noch. Ich muss extra ein Mädels-Wochenende organisieren, um mal ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen.«
Das letzte Mal haben wir uns getroffen, als Helen mich überredet hat, sie zu einem Vortrag im örtlichen Krankenhaus zu begleiten: »So überleben Sie die Pubertät Ihrer Tochter.« Ich habe einiges darüber gelernt, was zwölfjährige Mädchen heutzutage so treiben, und mich schrecklich blamiert, weil ich mindestens drei von zehn Fragen über Sex und Gesundheit nicht beantworten konnte. Da Frank klargestellt hat, dass ich für die Aufklärung unserer Kinder ganz alleine zuständig bin, wollte ich meine Kenntnisse ein bisschen aufpolieren. Schließlich will ich Antworten auf die Fragen haben, die Aaron und Jamie neuerdings so stellen, etwa: »Wie wird man schwul?« oder: »Sollte ein Junge sich die Hände waschen, bevor er ein Mädchen da unten anfasst?« Solche Fragen, das muss ich zugeben, kann ich nicht aus dem Stegreif beantworten.
Helen hatte nicht mal Zeit für einen schnellen Kaffee nach dem ganzen Geblubber über Kondome und PMS. Wir konnten nur ein paar geflüsterte Bemerkungen austauschen, woraufhin die referierende Ärztin uns anfunkelte wie zwei gackernde, ungebärdige Schulmädchen. Trotzdem fühlte ich mich danach besser, wie immer, wenn ich Helen getroffen habe.
Helen wedelt mir mit einem Häppchen Krabbe unter der Nase herum.
»Lass das.«
»Weißt du, seit du bei dieser Diät-Domina warst, hast du deine … Lebensfreude verloren. So ein Weibertreffen ist doch völlig sinnlos, wenn du nichts isst.« Sie zieht mich nicht auf, sie ist wirklich verärgert.
»Was mache ich denn gerade?«, erwidere ich und halte die Plastikschüssel hoch. »Ich esse sehr wohl. Nur eben nichts Fettes.«
Seit ich kurz vor meinem vierzigsten Geburtstag meine Ernährung umgestellt und ziemlich viel abgenommen habe, herrscht eine unterschwellige Feindseligkeit zwischen Helen und mir – sie hat ihre Kumpanin verloren, ihre Mitverschwörerin bei kulinarischen Verbrechen gegen die Kaloriengesetze. Während ich fortan morgens, mittags und abends Salat aß, bekam Helen ein weiteres Kind – einen Jungen, genau wie mein Pendel es vorhergesagt hatte. Während sie Windeln wechselte, etablierte ich meine neuen Essgewohnheiten. Während sie vor Schlafmangel beinahe den Verstand verlor, verlor ich ein Pfund pro Woche.
Heute unterziehe ich alles, was ich esse, einem Verhör, wie einen Teenager, der am Samstagabend ausgehen will: Wie viele versteckte Transfettsäuren enthältst du genau? Und versuch nicht einmal, mir etwas vorzumachen. Wenn ich je dahinterkomme, dass du mich belogen hast, fliegst du von meiner Einkaufsliste. Seit einiger Zeit passe ich wieder in die Jeans, die ich vor meiner ersten Schwangerschaft getragen habe – eine relativ geringe Leistung, was Lebensziele im Allgemeinen angeht, das gebe ich zu, aber trotzdem … Frank war der Meinung, dass meine Diätberaterin ihr Motto »Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt« wahrscheinlich von Magersucht.com abgeschrieben hat. Aber es ist wahr, auf irgendwie erschreckende Art und Weise. Ehrlich, ich bin die Erste, die über Magermodels auf Zeitschriftencovers herzieht und sich über sonstige Botschaften in den Medien aufregt, die Jamie dazu bringen könnten, sich zu viele Gedanken um ihre Figur zu machen. Aber ich darf das. Ich habe mir ein paar Komplexe redlich verdient.
Genauso wie meine kleinen Extravaganzen. Meine neueste Leidenschaft sind schicke Sportklamotten. Sie sind ein modisches Statement, das verkündet: Ich bin jederzeit dafür gerüstet, joggen zu gehen oder auf einen Berg zu steigen. Nicht, dass ich das eine oder das andere je getan hätte, aber der springende Punkt ist: Ich bin bereit dafür. Im Augenblick trage ich meine Lieblings-Laufschuhe mit gepolsterten Sohlen, blau-silbernen und neongrünen Streifen und atmungsaktivem Meshgewebe über den Zehen, obwohl ich immer noch nicht ganz davon überzeugt bin, dass meine Zehen auch mal Luft holen müssen. Das Oberteil in Neonpink mit Reißverschluss hat vier Taschen, von denen zwei verborgen sind. Es geht wirklich nichts über einen Pulli, in dem man Schlüssel, Geldbeutel, iPhone und den einen oder anderen Tampon verstauen kann, ohne eine lästige Handtasche mitnehmen zu müssen.
Für mich sind die Tage tiefer Ausschnitte und Miniröcke weniger gezählt als vielmehr, na ja, vorbei. In Sportklamotten fühle ich mich nicht gar so »übel alt«, wie Jamie sich ausdrückt. Als müsste sie mich extra darauf hinweisen, dass die Situation ziemlich schnell hässlich werden kann, wenn man nicht energische Maßnahmen ergreift, sobald man die magische Vierzig erreicht hat. Schon seltsam, ich kann mich nicht erinnern, dass ich je so gemein zu meiner Mutter gewesen wäre.
»Ehrlich, du bist schon genauso schlimm wie Tam«, sagt Helen.
»Wie bitte?«
»Du hast richtig gehört.«
»Du brauchst nicht gleich so gemein zu werden.«
Vor Jahren, als wir noch demselben Müttertreff angehörten, hat Tam uns regelmäßig in den Wahnsinn getrieben mit ihrer von Pestiziden, Hormonen und Nitraten unbelasteten, gluten-, laktose- und geschmacksfreien Ernährung. Ein Abend mit ihr war ungefähr so unterhaltsam, wie auf der Hochzeitsreise seinen Steuerberater dabeizuhaben.
»Ich bin ihr neulich mit ihrem Baby begegnet«, sagt Helen.
»Sie ist sicher froh, dass es ein Mädchen ist. War die Schwangerschaft eigentlich geplant? Ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen.«
»Ich glaube, das war die Rache für das Baby, bei dem Kevin auf Abtreibung bestanden hat.«
»Woher weißt du davon?«, frage ich schockiert.
»Du hast es mir selbst erzählt, du dumme Gans. Hast du das vergessen?«
Ja, leider. Ich habe total vergessen, dass ich es Helen nur einen Tag nachdem Tam es mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hatte, erzählt habe. Tams Mann Kevin, ein Schönheitschirurg, hatte sie praktisch gezwungen, eine vollkommen unproblematische Schwangerschaft abzubrechen, weil das »kein guter Zeitpunkt« für ihn sei.
»Bitte sag mir, dass du das niemandem weitererzählt hast.«
»Natürlich habe ich das. Mich hat ja keiner darum gebeten, es für mich zu behalten.« Helen schaut mit leicht zusammengekniffenen Augen in die Ferne und seufzt. »Ich hätte Bones mitbringen sollen. Es hätte ihr hier sicher gut gefallen.«
Bones, Helens neue große Liebe, ist ein giftiger kleiner Cairn Terrier. Sie hat ihn in der Woche bekommen, nachdem Levi eingeschult worden war, nach einer dreimonatigen Geduldsprobe. Sie musste diverse Antragsformulare ausfüllen und zu einem veritablen Vorstellungstermin erscheinen, denn »der Hund wählt Sie aus, nicht umgekehrt«. Der langwierige Prozess lässt die Adoption eines Kindes aus einem Dritte-Welt-Land vergleichsweise einfach aussehen. Seit sechs Wochen hinterlässt das Hündchen jetzt seine Häufchen auf ihren dampfgereinigten Teppichböden, heult die halbe Nacht durch und muss zweimal täglich spazieren geführt werden.
Irgendwie scheinen alle meine Freundinnen auf den Hund gekommen zu sein – als könnte ein kleines, kuscheliges Wesen, das man impfen, zur Sauberkeit erziehen und extra bekochen muss, die Illusion aufrechterhalten, dass man noch gebraucht wird. Nachdem der Hund meiner Mutter, ein inkontinent tröpfelnder Mischling namens Snowy, im biblischen Alter von achtzehn Jahren gestorben war, sagte sie: »Freiheit – das ist, wenn alle Kinder von zu Hause ausziehen und die Haustiere sterben.« Da habe ich doch immerhin etwas, worauf ich mich freuen kann.
»Ich bin ziemlich sicher, dass man hier keine Hunde mitbringen darf«, erwidere ich.
»Wer hätte das denn merken sollen?«
»Hat die Frau von der Agentur nicht gesagt, dass es einen Gärtner gibt? Der würde einen Hundehaufen sofort erkennen, wenn er einen sieht.«
»Ach, und was soll er dann machen? Mich fesseln und in den Schrank sperren?«
Manchmal erinnert Helen mich an Aaron. Der hat ebenfalls null Respekt vor jeglicher Autorität. Vielleicht hat sie auch so gut wie jeden Tag nachsitzen müssen. Außer ihr kenne ich niemanden, der es geschafft hat, einen Strafzettel nicht bezahlen zu müssen. Der Trick, so behauptet sie, bestehe darin, mit völlig offener, ruhiger Miene zu lügen, also probiere ich es nicht einmal. Ich vermassele grundsätzlich jeden Versuch, irgendwen zu täuschen, selbst wenn es um Geld geht. Was irgendwie lästig ist, da lügen in einer Ehe unerlässlich sein kann, beispielsweise Ich habe meine Tage, vielleicht nächste Woche?, oder pädagogisch notwendig: Nein, nein, das sieht zwar aus wie Cola, aber das ist mein Magenmittel … Igitt, schmeckt das widerlich.
Helen streckt die Arme aus und rollt den Kopf von einer Seite zur anderen. Ihr wirrer Lockenkopf hat seit mindestens einer Woche keine Bürste mehr gesehen. Dann holt sie etwas aus ihrer Tasche.
»Schau mal, das lag bei der Ferienhaus-Agentur auf dem Tresen«, sagt sie und wirft mir eine Visitenkarte zu. »Garys Ganzkörpermassage, sechzig Dollar. Meinst du, Gary macht auch Hausbesuche?«
Ich betrachte die Karte. Selbst gestaltet. Unprofessionell. Aber schließlich geht es um Massagen, nicht um Hirnchirurgie. Heutzutage bekommt man ja keine einstündige Massage mehr für unter hundert Dollar. Letztes Jahr hat Frank mir eine zum Muttertag geschenkt. Der Gutschein war von einem schicken Spa, das praktischerweise direkt gegenüber von seinem Büro liegt, also eine Fahrstunde von dort, wo wir wohnen – womit bewiesen wäre, dass es sich um einen Panikkauf in der Mittagspause handelte. Der Gutschein steckte ein Jahr lang in meiner Handtasche, bis er schließlich verfiel. Ich kam einfach nicht dazu, mich zwei Stunden lang durch den grässlichen Verkehr in Sydney zu quälen, um eine entspannende Massage zwischen meine anderen Termine zu quetschen.
Ähnlich überfällig wie eine Ganzkörpermassage ist dieses Wochenende. Wir sind alle so sehr mit unserem hektischen Leben beschäftigt, das natürlich nicht unser Leben ist. Denn für etwas, das man »Leben« nennen könnte, reicht die Zeit nicht, wenn man Kinder hat.
Ich gähne. Mit dem Schlaf bin ich ebenfalls schwer im Rückstand. Seit etwa zwei Jahren wache ich jeden Morgen um drei Uhr auf. Ich hoffe jedes Mal, dass Frank auch wach sein könnte, zappele aber nur im Notfall so lange herum, bis ich ihn dabei versehentlich wecke. Diese Einsamkeit im Dunkeln bringt mich immer dazu, über grässliche, umwälzende Fragen nachzugrübeln. Zum Beispiel, warum ich immer noch das Gefühl habe, dass in meinem Leben irgendwas fehlt. Und ob meine Cousine Shireen ihren Lymphdrüsenkrebs überleben wird. Und ob ich überhaupt richtige Freundinnen habe.
Ihr wisst schon – wie die Mädels von unserem letzten Weiberabend, von denen ich dachte, wir würden ein Leben lang Freundinnen bleiben. Aber diese Freundschaften waren nur eine Phase, wie die Kindheit. Als die Eigenarten und Talente unserer Kinder zum Vorschein kamen, überlegten wir sehr gründlich, welches Kind sich in einer reinen Jungen- oder Mädchenschule am besten entwickeln könnte, ob eine Konfessionsschule oder eine mit künstlerischem Schwerpunkt besser wäre. Währenddessen zerstreuten wir uns wie aufgescheuchte Seemöwen in alle Richtungen, wohin die Persönlichkeiten unserer Kinder uns eben verschlugen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie flexibel ich sein kann und wie leicht es mir fallen würde, mich jeweils mit den Eltern der aktuell besten Freunde meiner Kinder anzufreunden. Manchmal frage ich mich, seit wann meine eigenen Vorlieben mir offenbar nichts mehr wert sind.
»Heb sie dir für später auf, wenn du in Rente bist«, hat Frank dazu einmal gesagt.
Das war mit ein Grund, dass ich zu dieser Ernährungsberaterin gegangen bin. Ich wollte wohl dafür sorgen, dass ich auch wieder zähle. Wie ich immer zu den Kindern sage: »Es dreht sich nicht alles bloß um euch.« Aber sie wissen, dass das gelogen ist.
Vor zwei Jahren habe ich dann angefangen, heimlich Geld zu sparen. Frank und ich reden schon seit fünf Jahren von einem Urlaub in der Toskana, nur wir beide. Aber irgendetwas kommt immer dazwischen, und es ist nie genug Geld da. Wer soll sich denn dann um die Kinder kümmern, wo doch unsere Eltern und Geschwister nicht mal auf demselben Kontinent leben? Zu allem Übel ist der Zinssatz für unsere Hypothek gestiegen, Jamie musste zum Kieferorthopäden und brauchte eine Zahnspange und Aaron Nachhilfestunden in Mathe. Na ja, es eilt wohl nicht. Die Toskana läuft uns nicht weg.
Allmählich glaube ich, dass Helen irgendwo ein bisschen geheimes Geld herumliegen hat. Oder dass Davids Geschäft still und unauffällig boomt wie verrückt. Vor drei Monaten war sie mit ihrer Physiotherapeutin (ohne David und die Kinder) zehn Tage auf Bali und davor mit ein paar alten Schulfreundinnen in Indien. Dabei dachte ich, unsere Freundschaft sei etwas ganz Besonderes. Als ich dann wissen wollte, warum sie nie mich fragte, ob ich solche Reisen mit ihr machen würde, lachte sie nur und sagte: »Du würdest deine Kinder niemals zehn Tage lang aus den Augen lassen.« Darum geht es aber gar nicht. Man möchte einfach nur gefragt werden.
Helen hat sich das Kinn mit ein wenig Frittieröl verschmiert. Ich beuge mich vor und wische es mit der Serviette ab. Dankbar nickt sie mir zu. Sie macht mir Appetit darauf, mich zu amüsieren, die großherzige Stimmungsmacherin.
»Es ist schön, mal wieder ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen«, verkünde ich beinahe anbetungsvoll.
Ihr Gesicht nimmt einen ulkigen Ausdruck an. Sie hat es nicht so mit wortreichen Zuneigungsbekundungen.
»Ich werde in absehbarer Zeit nicht sterben«, sagt sie und starrt mich mit großen Augen an. Dann verzieht sie die Lippen zu ihrem breiten Grinsen und fügt hinzu: »Na los, ich hole uns ein Fläschchen Champagner, und wir legen uns in die Sonne.«
Sie eilt nach drinnen und kommt mit zwei Gläsern Champagner und Cranberrysaft wieder heraus. Über ihrer Schulter hängt eine selbstgestrickte Patchwork-Decke, die ich ihr abnehme. Wir gehen die steinernen Stufen hinab und nehmen den Weg in Richtung Damm, um den restlichen Nachmittag voll auszukosten.
Unter einer Großblättrigen Feige steht die hölzerne Pergola. Ihre feinen Bögen wirken wie das Skelett eines Regenschirms, überzogen mit Jasmin, der jedoch schon ein trauriges Ende gefunden hat. Die Ranken sind alle verdorrt und vertrocknet wie ein vergessener Brautstrauß. Die kleine Bank darunter sieht nicht besonders einladend aus, also gehen wir ein Stück weiter bis zu dem Streifen Wiese, suchen uns einen großen, flachen Stein, auf dem wir die Gläser abstellen können, breiten die Decke auf dem weichen Gras aus und lassen uns darauf nieder.