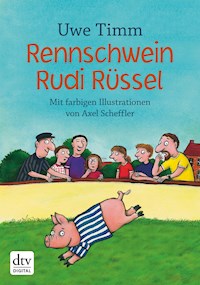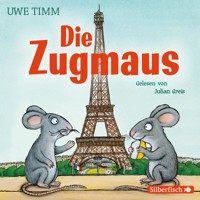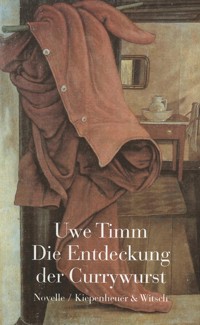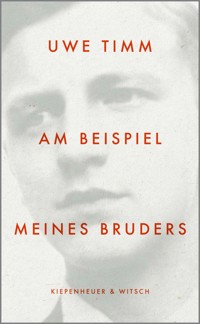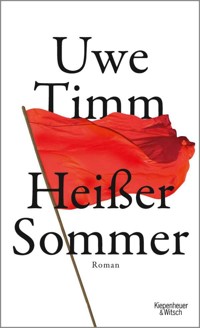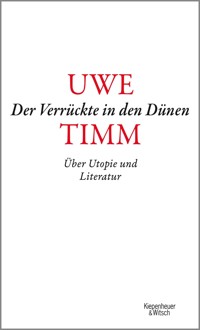12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Uwe Timm über das Schreiben schreibt, kehrt der in den letzten Jahrzehnten so abstrakt gewordene literarische Diskurs zu den Anfängen zurück. Timm nimmt uns mit in den Alltag als Bedingung der Literatur. Wie sieht z.B. der Arbeitsplatz eines Schriftstellers aus? Was bedeutet es, mit der Hand, der Schreibmaschine oder dem Computer zu schreiben? Was geschieht, wenn das Kürzel »O.K.« literaturfähig wird und ein Zahnstocher zur Geschichte werden will? Und die elementarste aller Fragen: Erzählen – gibt es das noch?Für Timm, der sich seinem Thema mit dem fremden Blick des engagierten Ethnographen nähert, gehört das Erzählen zur menschlichen Existenz wie das Sprechen. Es ist ununterdrückbar: in der Lüge, den Wandersagen, der täglichen Dramaturgie des Redens. Mit den Obsessionen des Schriftstellers verstärkt sich der Erzähltrieb, spürt die geschärfte Wahrnehmung Bedeutungen abseits der Norm auf. Erzählen und kein Ende stellt die Literatur wieder auf den Boden und gibt ihr ihre Vitalität und Formenvielfalt zurück. Die Texte entstanden als Poetikvorlesung an der Paderborner Universität im Winter 1991/92.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Uwe Timm
Erzählen und kein Ende
Versuche zu einer Ästhetik des Alltags
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Uwe Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Uwe Timm
Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.
Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch
Der Mann auf dem Hochrad, Legende, 1984 Morenga, Roman, 1984. Der Schlangenbaum, Roman, 1986. Vogel, friss die Feige nicht.Römische Aufzeichnungen, 1989. Kopfjäger, Roman, 1991. Erzählen und kein Ende, 1993. Die Entdeckung der Currywurst, Novelle, 1993. Johannisnacht, Roman, 1996. Nicht morgen, nicht gestern, Erzählungen, 1999. Eine Hand voll Gras, Drehbuch, KiWi 580, 2000. Rot, Roman, 2001, Sonderausgabe 2005. Am Beispiel meines Bruders, 2003. Der schöne Überfluss. Texte zu Leben und Werk von Uwe Timm, hrsg. von Helge Malchow, 2005.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wenn Uwe Timm über das Schreiben schreibt, kehrt der in den letzten Jahrzehnten so abstrakt gewordene literarische Diskurs zu den Anfängen zurück. Timm nimmt uns mit in den Alltag als Bedingung der Literatur.
Wie sieht z.B. der Arbeitsplatz eines Schriftstellers aus? Was bedeutet es, mit der Hand, der Schreibmaschine oder dem Computer zu schreiben? Was geschieht, wenn das Kürzel »O.K.« literaturfähig wird und ein Zahnstocher zur Geschichte werden will? Und die elementarste aller Fragen: Erzählen – gibt es das noch?
Für Timm, der sich seinem Thema mit dem fremden Blick des engagierten Ethnographen nähert, gehört das Erzählen zur menschlichen Existenz wie das Sprechen. Es ist ununterdrückbar: in der Lüge, den Wandersagen, der täglichen Dramaturgie des Redens. Mit den Obsessionen des Schriftstellers verstärkt sich der Erzähltrieb, spürt die geschärfte Wahrnehmung Bedeutungen abseits der Norm auf. Erzählen und kein Ende stellt die Literatur wieder auf den Boden und gibt ihr ihre Vitalität und Formenvielfalt zurück.
Die Texte entstanden als Poetikvorlesung an der Paderborner Universität im Winter 1991/92.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1993, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Mendell & Oberer, München
Covermotiv: © Umschlagzeichnung: Gunnar Matysiak
ISBN978-3-462-30877-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Der Autor, das Schreiben, die Maschine …
2. Die Biographie der Wörter …
3. Über Lüge und Wahrheit …
4. Im Laufe der Zeit …
5. Das Geflüster der Generationen …
1.Der Autor, das Schreiben, die Maschine oder Der Apfel in der Schublade
Ich möchte mit einer Frage beginnen, die, so allgemein wie penetrant, zuweilen auch aggressiv, oft nach Lesungen oder in Diskussionen gestellt wird, eine Frage, die viele meiner Kollegen aufstöhnen lässt, mich übrigens auch: Warum schreiben Sie?
Die Frage – ich habe mich bisher geweigert, sie zu beantworten – ist bei näherem Hinsehen aber gar nicht so unberechtigt. Sie ist möglicherweise sogar »die bewegende Frage einer Poetikvorlesung, denn die andere Frage, die nach dem Wie des Schreibens, können die Literaturwissenschaftler wahrscheinlich besser beantworten als der Autor. Wer sich eine Poetikvorlesung anhört, will, vermute ich, den Praktiker hören, will etwas über die Entstehung von Literatur, von Geschriebenem hören, möchte einen Blick in den höllischen Maschinenraum werfen, also etwas von den Obsessionen, Perversionen, Neurosen, den Motiven erfahren, die den Schreiber zum Schreiben veranlassen oder veranlasst haben. Schreiben ist ja, im Gegensatz zum Sprechen, nichts Selbstverständliches. Und es ist, für die überwältigende Mehrheit der Menschen, von denen viele weder lesen noch schreiben können, auch nicht notwendig.
Die häufigste Antwort der Schreibenden ist, dass sie schreiben müssen, weil sie gar nicht anders können. Das Schreiben-Müssen ist die Beglaubigung des Schriftstellers als Dichter. Es ist das, was mit dem alten Wort be-rufen bezeichnet wird. Wer nicht schreiben muss, egal, ob aus innerem Antrieb oder von den Göttern geschlagen, schreibt, wann, was und wie er will, und wem das Schreiben ins Belieben gestellt ist, der kann auch schreiben, was andere wollen, also im Auftrag.
Also: Warum schreibe ich? Die Antwort könnte lauten: aus erlittenen Verletzungen heraus, oder aus dem Versuch, sich über sich und über die Welt Klarheit zu verschaffen. Aber das müssen noch keine Gründe zum Schreiben sein. Es gäbe andere Möglichkeiten, näherliegende, beispielsweise zu reden, mit Freunden. Warum also schreiben? Manchmal habe ich den Verdacht, dass gerade diejenigen, die immer wieder schreibend versichern, sie könnten nicht anders als schreiben, tatsächlich gar nicht schreiben müssten, sondern sich zum Schreiben zwingen, wie die Mehrheit der Menschen. Für sie ist Schreiben ein Graus. Schreiben ist nicht notwendig. Es ist, wie übrigens auch das Lesen, worauf ich später noch zu sprechen komme, etwas Überflüssiges. Ein schöner Überfluss. Gerade dieses Moment, dass man nicht schreiben muss, dass es nicht selbstverständlich ist, schärft die Frage, warum jemand ausgerechnet schreibend sich mitzuteilen versucht, denn in aller Regel will, wer schreibt, ja auch gelesen werden. Warum denke auch ich, dass ich schreiben muss, ja, dass ich keine andere Wahl habe? Wobei ich hier anmerke, dass ich diese Tätigkeit nicht als Qual empfinde. Ich muss mich – jedenfalls meistens – nicht an den Schreibtisch zwingen, für mich ist es eine lustvolle Tätigkeit.
Warum sprechen Sie? wäre – wenn einer nicht gerade daherplappert – eine ganz widersinnige Frage, eine Frage, die einem wahrscheinlich die Sprache verschlagen würde. Man wüsste keine Antwort. So sehr gehören Sprechen und Denken zusammen, so sehr sind wir schon immer in der Sprache, dass wir eine sinnvolle Antwort nach dem Warum nicht einmal denken könnten. Wir könnten eine Antwort geben, warum wir in einer bestimmten Situation etwas sagen, also kommunizieren, aber warum wir überhaupt sprechen, warum Sprache ist, was sollten wir darauf sprechend antworten? Allenfalls: Wir können nicht anders. Wir können nicht nur sprechen, wir müssen sprechen, auch wenn wir schweigen, ist es ein Sprechen, ein stummes eben. Das Sprechen, die Muttersprache, lernen wir als Kinder meist spielend, zuweilen auch unter Druck. Anders verhält es sich mit dem Schreiben. Das geschieht unter Zwang. Schreibenlernen ist eine Disziplinierung, für die man stundenweise kaserniert wird. Und wer desertiert, kann, zumindest hier in Deutschland, von der Polizei gestellt und zurückgebracht werden. Schulpflicht heißt das. Schreibenlernen ist nicht nur die Fähigkeit, Schriftzeichen nachzuahmen, sondern auch eine Ausrichtung, die Erziehung zu folgerichtigem Denken.
Vilém Flusser hat in seinem Essay Die Schrift (Göttingen 1987) darauf hingewiesen, wie das Alphabet das Denken, das sich in vorschriftlichen Kulturen im Kreise bewegte, bildhaft, also mythisch war, linear ausgerichtet hat. Wie durch die Buchstaben Bildhaftes in Zeichen umgesetzt wurde und wie das Schreiben mit dem Alphabet eine nach innen gewandte Geste ist, die den Schreiber in sich hineinhorchen lässt, Vorstellungen und Kausalitäten schafft und sich dann wieder, und zwar ausdrücklich, nach außen wendet, also auf einen Leser zielt. Die Schrift ist damit auch im ursprünglichen Sinn politisch. Dieses Erlernen des Alphabets, der Schrift, ist nicht nur menschheitsgeschichtlich, sondern auch individualgeschichtlich immer wieder mit der Unterdrückung des fluktuierenden bildhaften Denkens verbunden, mit einer Begradigung der Gedanken zur Folgerichtigkeit, einem Zwang zum abstrakten Denken. Dies ist nicht nur an die Inhalte gebunden, sondern liegt in der Form der Schrift. Das Alphabet gibt dem kreisenden Denken mit der Zeile eine Richtung, macht es fest in den Zeichen. Es ist die Rechtschreibordnung, die, wie ein Korsett der gesprochenen Sprache angelegt, sie verfeinert, gliedert, aber auch beengt.
Im Rechtschreiben liegt ein permanenter Zwang, der nur erträglich wird, weil wir ihn so lange ein- üben, dass wir ihn schließlich nicht mehr oder kaum noch bemerken. Für einige hingegen ist die Alphabetisierung ein lebenslanger Prozess, weil sie immer wieder über das Richtigschreiben nachdenken müssen, immer wieder stutzen, und zwar nicht nur bei neuen und unbekannten, sondern auch bei altbekannten Wörtern. Ich gehöre zu diesen unsicheren Alphabeten.
Der Schüler aus meiner Grundschulzeit, der die besten, weil fehlerfreiesten Diktate schreiben konnte, leitet heute eine Mülldeponie bei Hamburg und sagt – was ich sofort nachvollziehen kann –, es sei eine wunderbare Beschäftigung, dieses Chaos zu überblicken, diese Dinge, die da weggekippt werden, verbrauchte wie halb verbrauchte, die von Planierraupen hin- und hergeschoben werden, darüber die Möwenschwärme. Vielleicht ist diese Beschäftigung seine Antwort auf den Rechtschreibzwang, den er fraglos erduldete. Jetzt schreibt und liest er nicht mehr. Ich sage das ohne jeden Triumph. Er muss nur noch Häkchen machen. Und dann natürlich seine Initialen, wenn wieder ein Zehntonner den Dreck abkippt. Ich vermute, viele Menschen beantworten die frühe Alphabetisierung mit einer späteren Verweigerung zu schreiben – und zu lesen. Andere wiederum reagieren mit Überanpassung, sie studieren Germanistik, schreiben lettristische Gedichte oder vergleichen Sprachen. Diese Disziplinierung durch Schreiben, die ich als einen Würgegriff in Erinnerung habe, hat bei mir möglicherweise dazu geführt – und zwar, um Luft zu kriegen –, dass ich erzählte, also mit einer an der Mündlichkeit ausgerichteten Form die Schreibübungen beantwortete.
Ich bog den Druck durch Erzählen ab, wobei ich, auf die Situation, das Bild konzentriert, die Wörter in der schriftlichen Form variierte, die Schreibweise nach Klang und Rhythmus umbaute. Selbstverständlich fand das bei Herrn Blumenthal, meinem Lehrer, kein Verständnis. Seine Antwort waren Fünfer. Ich hatte das Schreiben durch das Legen von Buchstaben lernen müssen. Es mangelte 1946 an Schreibheften und Bleistiften. Die Abc-Schützen (selbst dieser Scherzname verrät etwas von militärischer Ordnung) bekamen kleine Buchstabenkarten, die zur Wortbildung aneinandergelegt werden mussten. Diese Buchstaben waren in unserer Fibel immer mit einem Ding dargestellt. B wie Bett, Sch wie Schwan. Schob ich die Buchstaben zusammen, schob sich ein Bild dazwischen, so der Schwan, eingefroren auf dem Isebekkanal, der immer wieder versuchte aufzufliegen, ohne von der Stelle zu kommen. Warum Schwan mit einem, nicht mit zwei a geschrieben wurde, obwohl er doch zwei Flügel hatte, warum Vogel mit V und nicht mit F, das konnte mir Herr Blumenthal nicht erklären. Diese Zeit war keineswegs so lustig, wie es jetzt klingen mag. In die Schule gehen zu müssen, war für mich, jedenfalls in den Grundschuljahren – später sollte sich das ändern –, ein Grauen, verbunden mit Schlafstörungen und Albträumen. Und ich kann mich an viele mit meinen Eltern unternommene Wochenendausflüge in die Lüneburger Heide und an die Elbe erinnern, die überschattet waren – obwohl doch die Sonne schien –, weil am Montag ein Diktat geschrieben oder ein geschriebenes herausgegeben wurde. Auch heute noch muss ich den Duden öfter konsultieren als – so vermute ich – die meisten Kollegen. Und noch immer kann ich mich über die Rechtschreibordnung wundern, nein, ärgern, etwas Obstinates steigt in mir auf, wenn ich im Duden blättere.
Ich habe in der Frankfurter Poetikvorlesung von Peter Bichsel Der Leser. Das Erzählen (Darmstadt 1982) von dessen Schwierigkeiten mit der Orthographie gelesen. Es hat ja etwas Beruhigendes zu wissen, dass man mit seinen Schwächen nicht allein ist. Vielleicht haben die Erzähler, gebe ich einmal zu bedenken, größere Schwierigkeiten mit der Orthographie – weil sie dem mündlichen Sprechen näher sind – als die sprachanalytisch Schreibenden. Man müsste einmal nachfragen.
Der Versuch, Situationen und Bilder in die Schrift zu bringen, ist zunächst einmal ein Widerspruch, denn die Buchstaben, die Zeichen geben ja keine Bilder, sondern Laute wieder. Dagegen anzuschreiben, zugleich auch etwas von dieser reichen, fluktuierenden Bildwelt der Kindheit einzuholen, ist möglicherweise ein weiterer Antrieb für mich, zu schreiben. Bild und Zeichen sind, wie gesagt, einander fremd und müssen doch, jedenfalls in meiner Vorstellung, zusammenkommen. Dieses Verhältnis zum Schreiben, das, wie gesagt, für mich etwas Lustvolles hat, kennt darum auch qualvolle Momente, immer dann, wenn sich die Sprache bei dem Versuch, die vorgestellten Bilder und Situationen zu beschreiben, verweigert. Flusser spricht von der Vergewaltigung der Sprache beim Schreiben. So brutal-dramatisch empfinde ich es nicht, aber es ist für mich eine mühsame Annäherung, ein Mehrmals-Schreiben, ein Umschreiben, Nachschreiben, ein Dialog, wenn man so will, zwischen mir, dem Schreiber, und mir, dem Erzähler, oder aber, da schon einmal das Wort libidinös gefallen ist, zwischen dem Autor und der Sprache. Befriedigend ist es, wenn sich die Sprache öffnet, sich über die Wörter assoziativ neue Situationen und Bilder einstellen und ich dem lediglich nachschreiben muss, wobei sich die Orthographie buchstäblich auflöst: Die muss ich in den folgenden Fassungen wieder »zurechtrücken«.
Ausgangspunkt für das Erzählen ist für mich, wie gesagt, meist eine Situation, ein Bild. So das Steinbeil im Altonaer Museum. Wir hatten – ich war damals zwölf – mit der Klasse das Museum besucht, danach sollten wir die Säle, die wir besichtigt hatten, beschreiben, also den Weg, den wir genommen hatten, vom Zunftsilber bis zu den Trachtenstuben. Mich aber interessierte allein das Steinbeil. Es hatte nämlich zwei Bohrlöcher für den Schaft. Ein durchgehendes und ein unfertiges. Ich hatte das Bild vor Augen, wie jemand über diesem schon zugeschliffenen Stein gebeugt saß und tagaus, tagein mit einem hölzernen Drillbohrer an dem Loch arbeitete, bis es zu dieser Unterbrechung kam, eine Korrektur. Wie kam es dazu? Ich habe mit einer Geschichte eine Antwort darauf gesucht. Ich habe für diesen Aufsatz, für die acht Seiten lange Geschichte, eine 5 bekommen. Thema verfehlt, und dann auch noch 40 Rechtschreibfehler. Der Lehrer, Herr Blumenthal, las den Aufsatz der Klasse zur Abschreckung, und um mich lächerlich zu machen, vor. Alle lachten denn auch. Nur ein Schüler, Georg Hüller, stand auf und versuchte Herrn Blumenthal zu erklären, was ich mit der Geschichte gemeint haben könnte. Aber Herr Blumenthal sagte nur: Alles Quatsch! Hinsetzen! Und die anderen durften wieder lachen.
Vielleicht bildete sich damals ja der Wunsch heraus, Schriftsteller zu werden.
So viel zu meinen Differenzen mit dem Alphabet, meiner Irritation beim Schreiben. Und all die anderen Obsessionen, die Ängste, dunklen Triebe? Darüber kann ich nur erzählend schreiben, nicht reden.
Was mich an literarischen Arbeiten, den eigenen wie auch denen anderer Autoren, momentan interessiert – und ich komme damit zu dem Thema der Vorlesung –, ist, wie sehr sie Alltägliches absorbieren, nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Form.
Was ist Alltag?
»Alltag, die Lebensverhältnisse und Handlungsformen einzelner Menschen, kleiner und größerer Gruppen und von Gesellschaften, eingebettet in bestimmte religiöse, kulturelle und soziale Traditionen und historische Entwicklungen, so wie sie sich als einmaliges Ereignis, als immer wiederkehrende und wenig beachtete Routinetätigkeit, als Erlebtes und Erlittenes zeigen; dabei werden oft bestimmte Verhaltensmuster und Mentalitäten fest ausgeprägt.«
Mein Augenmerk richtet sich auf das »einmalige Ereignis« und auf die »immer wiederkehrende« sowie die »wenig beachtete Routinetätigkeit«. Ich halte diese Definition des Alltags für gut, sie hat auch den Vorteil, dass sie jeder nachlesen kann, im Brockhaus Band x, in der Ausgabe von 1986.
Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann hat mit dem Literaturwissenschaftler Dietrich Harth ein Buch mit dem Titel Kultur als Lebenswelt und Dokument (Frankfurt 1991) herausgegeben, das eben dieses kulturelle Gegensatzpaar auseinanderlegt: die Lebenswelt, die bestimmt ist durch einen zeitlichen Nahhorizont, durch Dialogizität, durch Alltagssprache, durch Spuren, und das Monument, das betrachterbezogen ist, Botschaften liefert, so das sakrale Werk und das Kunstwerk, das auf einen Fernhorizont gerichtet ist, sich an die Nachwelt richtet, sich durch Monologizität und eine durchgestaltete Sprache auszeichnet.
Um es in diesen Kategorien zu sagen: Mich interessiert der Übergang von den alltäglichen Dingen der Lebenswelt zum Monument. Das mündliche Erzählen im Alltag kennt eine Vielzahl ästhetischer Formen, die immer schon über den bloßen Augenblick hinausreichen, die denn auch in der Sprache aufgenommen und tradiert werden. Dieses strukturierte mündliche Erzählen berührt sich mit dem literarischen Erzählen. Die Schrift bildet eine Brücke zwischen dem zeitlichen Nahhorizont und dem Fernhorizont. Sie überliefert aus dem alltäglichen Geschehen sowohl die einmaligen wie auch die sich wiederholenden Ereignisse, die oft unscheinbar sind, schmuddelig, schäbig, voller komischer, kurioser, grotesker, tragischer Momente, aber doch von bewegender Kraft.
Ein wesentlicher Unterschied zum alltäglichen Sprechen, zum alltäglichen Erzählen liegt beim literarischen Erzählen darin, dass sein Interesse sich gerade