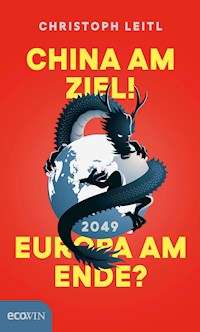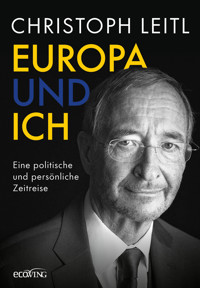
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
75 Jahre Europarat – und Christoph Leitl: Ein leidenschaftlicher Europäer erinnert sich und blickt in die Zukunft der EU Der Politiker und Unternehmer zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der Zeitgeschichte: Christoph Leitl wirft in seinen Erinnerungen einen Blick auf die Geschichte und Bedeutung der Europäischen Union. Vor 75 Jahren im Mai 1949 schlossen sich zehn Staaten in London zum Europarat zusammen – ein historisches Ereignis. Im selben Jahr wurde Leitl im Österreich der Nachkriegszeit geboren. Das gemeinsame Jubiläum ist für ihn Anlass, auf sein Leben und die Europäische Union zurückzublicken. Dabei treibt ihn eine Frage um: Wie kann die Zukunft Europas aussehen? - Die Biographie eines Politikers, der die Zeitgeschichte Österreichs und Europas prägte - Ein Rückblick auf 75 Jahre Geschichte der EU - Ein Plädoyer für europäische Werte und politisches Engagement - Eine Vision der Zukunft Europas in einer globalisierten Welt - Das ideale Geschenk für Politikinteressierte Eine Chance für den Frieden: Erwartungen an ein Europa der Zukunft Nostalgie findet sich in der Lebensgeschichte von Christoph Leitl nicht: In seiner Autobiografie schildert der außergewöhnliche Politiker seine Erfahrungen in der Europapolitik und verbindet sie stets mit europäischen Werten wie der Förderung des Friedens, der Schutz der Menschenrechte oder die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit. Folgen Sie in einer Zeit des Zweifels einem überzeugten Europäer in die Zeitgeschichte, um Zuversicht und Mut für die Zukunft zu schöpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
CHRISTOPH LEITL
EUROPAUND ICH
Eine politischeund persönliche Zeitreise
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
© 2024 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Verfasst unter Mitwirkung von Wolfgang Machreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Futura
Umschlaggestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider, diceindustries
Coverfoto: © Jeff Mangione / KURIER / picturedes.com
Autorenillustration: Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN: 978-3-7110-0334-8
eISBN 978-3-7110-5358-9
INHALT
PROLOG
»Ich bin im Sternzeichen Europas geboren!«
KAPITEL 1
1949 bis 1959: Zwei Nachkriegskinder
KAPITEL 2
1960 bis 1969: Going to San Francisco …
KAPITEL 3
1970 bis 1979: Ein »Wolkenkuckucksheim« wird Realität
KAPITEL 4
1980 bis 1989: Der Wind der Revolution
KAPITEL 5
1990 bis 1999: »Genutzte und vergebene Chancen«
KAPITEL 6
2000 bis 2009: Atemberaubende Fortschritte, schmerzhafte Rückschläge
KAPITEL 7
2010 bis 2019: Europa-Domino
KAPITEL 8
2020 bis 2049: Europa wieder in Schwung bringen
RÜCKBLICK
1949: Eine Chance für Europa
EINBLICK
2024: Eine Chance für den Frieden
AUSBLICK
2049: Eine Chance für die Jugend
PROLOG
»ICH BIN IM STERNZEICHEN EUROPAS GEBOREN!«
Europa feiert 2024 ein Jubiläum. Vor 75 Jahren begab sich eine Staatengemeinschaft auf den Weg zur Einigkeit. Das ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern vor allem zum Nachdenken und Vordenken. Der 5. Mai 1949 ist für mich das wichtigste und wegweisendste Datum in der Geschichte unseres Kontinents. Als sich an diesem Tag vor 75 Jahren in London zehn Staaten unseres Kontinents im Europarat zusammenschlossen, wurde eine Idee Wirklichkeit, die der französische Schriftsteller, Politiker und Humanist Victor Hugo bereits hundert Jahre davor zu entwerfen wagte.
Im Sommer 1849 hielt Hugo am Pariser Weltfriedenskongress eine Rede, in der er eine Zeit beschwor, in der die Staaten Europas sich »zu einer höheren Gemeinschaft zusammenschließen und die große europäische Bruderschaft begründen werden«. Zu Hugos Lebzeiten, während und nach den napoleonischen Umwälzungen des Kontinents, setzte der Nationalismus gerade an, um Europa immer wieder in Krieg und Elend zu stürzen. Umso mehr imponieren mir Victor Hugos Mut und seine Zuversicht, eine Zeit vorauszusagen, »wo es keine anderen Schlachtfelder mehr geben wird als die Märkte, die sich dem Handel öffnen, und die Geister, die für die Ideen geöffnet sind. Ein Tag wird kommen, wo die Kugeln und Granaten von dem Stimmrecht ersetzt werden …«
Der 5. Mai 1949 war dieser Tag. Nach den Schlachten, den Kugeln, den Granaten und Verheerungen des Zweiten Weltkriegs wurde mit der Gründung des Europarats ein neues Kapitel in der europäischen Geschichte aufgeschlagen. Damit ist der Council of Europe nicht nur die älteste politische Organisation europäischer Staaten. Mit seinem Bekenntnis für Menschenrechte, Demokratie und rechtsstaatliche Grundprinzipien legte der Europarat auch das Fundament, auf dem wir in den Jahrzehnten seither das gemeinsame Haus Europa bauen.
Und ich durfte mitbauen. Der Zufall, ich sage »gutes Schicksal« dazu, wollte es, dass ich im Jahr der Gründung des Europarats auf die Welt gekommen bin. Auf das dadurch gelegte Fundament konnte ich mein privates, berufliches und politisches Leben bauen. Im Sternzeichen Europas geboren, darf ich seither unter den guten Sternen des gemeinsamen Europas leben. Dass mir diese Sterne, von den Gründern dem Sternenkranz Mariens entnommen, zur politischen Lebensidee wurden und ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, ihr Strahlen auch anderen zu vermitteln, dafür bin ich dankbar.
Allerdings können Jahrestage dazu verführen, sich im milden Licht der Abendsonne auf verklärende Erinnerungen zu beschränken. Ich halte mich da lieber an einen weiteren Viktor. Nämlich an Viktor Frankl, den Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse. In seinem »Scheunengleichnis« beschreibt er eine beim Blick in die Vergangenheit weit verbreitete Unart: »Der Mensch sieht nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit«, kritisiert Frankl, »aber er sieht nicht die vollen Scheunen der Vergangenheit. Im Vergangensein ist nämlich nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr alles unverlierbar geborgen.« Frankls Diagnose lässt sich auch auf Europa gut anwenden. Wie oft erlebe ich es und ärgere mich darüber, wenn sich der Blick zurück auf das Einigungsprojekt Europas seit der Gründung des Europarats bis zur heutigen Europäischen Union auf die Beschreibung abgeernteter Stoppelfelder beschränkt.
Dabei haben wir allen Grund, auf die vollen Scheunen der europäischen Vergangenheit in den letzten 75 Jahren zu schauen. Die vollen Speicher sind ein Schatz, ein Kapital zur Investition in eine gemeinsame Zukunft, die auch künftigen Generationen zugutekommen wird.
Ich habe die Nachkriegsjahre erlebt, die Teilungen in Zonen und Blöcke, die Stacheldrähte, die Grenzbalken. Dass Trennendes ein Ablaufdatum hat, war eine gute Erfahrung meines Lebens. Dass wir heute in Europa, in der Welt ein überwunden gedachtes Blockdenken wieder erleben, macht mich betroffen, aber nicht mutlos. Warum sollte es Europa nicht ein zweites Mal schaffen, was uns schon einmal gelungen ist? Frieden ist möglich! Ob wir ihn erhalten, hängt jedoch von uns ab!
KAPITEL 1
1949 BIS 1959:ZWEI NACHKRIEGSKINDER
Was sind schon vier Jahre vor dem Hintergrund der Geschichte des Kontinents? Nur vier Jahre nach dem fürchterlichsten Krieg, den die Welt und auch meine Eltern- und Großelterngeneration je erleiden mussten, bin ich in Linz zur Welt gekommen. Ich habe kein Kriegsgeschehen selbst erlebt, konnte aber noch sehen und spüren, was dieser Krieg angerichtet hat: Bombenkrater so groß wie Baugruben, kaputte Häuser, Menschen, die mit Leiterwagen ihre Habseligkeiten transportierten, und vor allem Kriegsversehrte, die mit schwersten körperlichen und seelischen Verletzungen zurande kommen mussten.
Als Kind war das für mich alles natürlich. So war halt die Welt, in die ich und mein Jahrgang damals hineingeboren wurden. Eine Begebenheit hat sich mir allerdings ins Gedächtnis geprägt. In meinem Geburtsjahr 1949 hatte Österreich noch nicht einmal die Hälfte seiner Besatzungszeit durch die vier Siegerstaaten des Zweiten Weltkriegs hinter sich gebracht. Alle hegten große Hoffnung und Zuversicht, dass diese ein baldiges Ende finden würde. Ich bin also gerade noch rechtzeitig geboren, um mit eigenen Augen zu sehen, wie man in einem besetzten Land lebt, um zu spüren, was das bedeutet und welchen Druck Fremdbestimmtheit erzeugt.
MEIN NIBELUNGENBRÜCKE-MOMENT
Es muss an einem Samstag oder Sonntag vor dem Abzug der Besatzungsmächte gewesen sein. Ich saß am Rücksitz unseres Autos. Meine Eltern saßen vorne, und wir fuhren von den Großeltern am Linzer Pöstlingberg nach Eferding, wo der Stammsitz unseres Unternehmens ist und wir damals auch wohnten.
Linz war damals eine geteilte Stadt. Die Donau bildete die Zonengrenze zwischen dem amerikanischen Sektor am Südufer und dem sowjetischen Sektor im Norden. »In Linz herüben der Ami, in Urfahr drüben der Ruß – der Ritt über die Bruckn wird a harte Nuss!« Dieser Spruch war in der damaligen Zeit gang und gäbe und beweist, wie gut es den Linzern, den Oberösterreicher gelungen ist, eine unleidliche Zeit mit einer Prise Humor erträglich zu machen.
Wir fuhren also auf die Nibelungenbrücke zu. Je näher wir der russischen Zonengrenze kamen, umso stiller wurde es im Auto. Meine Eltern verstummten, ungute Stille und eine bedrückende, gespannte Atmosphäre machten sich breit. Gerade Kinder kriegen in der Luft liegende Spannungen bei Erwachsenen sehr schnell mit. Ein Sowjetstern, den ich damals mit Weihnachten und Christbaum verband, hing am gezimmerten Kontrollposten.
Die Soldaten schauten streng, die Gewehrläufe, die über ihre Schultern schauten, machten sie noch furchteinflößender. Meine Eltern wussten sehr genau, dass der Urfahraner Brückenkopf mit dem Kontrollposten zur damaligen Zeit kein Ort für Späße war. Schikanöse Ausweiskontrollen waren an der Tagesordnung, und es konnte unter Umständen lange dauern, bis die eigentlich kurze Strecke bewältigt war.
Nicht umsonst nannte der damalige oberösterreichische Landeshauptmann Heinrich Gleißner die Nibelungenbrücke zwischen Linz und Urfahr »die längste Brücke der Welt, sie verbindet Washington mit Moskau«. Dass Gleißner auf dieser längsten Brücke der Welt später einmal tanzen würde, konnte niemand ahnen. Als am Linzer Brückenkopf die ständigen Kontrollen des Personen- und Lastenverkehrs aufgehoben wurden, kam es zu einer spontanen Feier, in deren Verlauf der Landeshauptmann mit Elmire Koref, der Gattin des Linzer Bürgermeisters Ernst Koref, unter viel Beifall einen »Brücken«-Walzer tanzte.
Aber zunächst saßen wir, die Leitls im Familienauto auf dem Weg über die Nibelungenbrücke, nach wie vor in gedrückter Stimmung. Auf der anderen Donauseite begrüßte uns eine Holzwand, die zweidimensional ein Lebkuchenhaus darstellte. »Welcome to U.S. Zone Austria« war darauf zu lesen. Die Anspannung im Auto löste sich von einem Moment auf den anderen. Da traute auch ich mich wieder, den Mund aufzumachen und meinen Vater zu fragen, warum wir gerade alle leise sein mussten und was es mit diesen Kontrollen auf sich habe. Er erklärte mir: »Christoph, es war Krieg. Linz und Österreich sind geteilt und besetzt. Damit wir wieder ein freies Land werden und damit es wieder bergauf geht und kein Krieg mehr kommt, dürfen wir in Zukunft nie mehr gegeneinander kämpfen, sondern wir müssen zusammenhelfen und zusammenhalten. In Österreich und in Europa.«
Damals, nach unserem »Ritt über die Bruckn«, habe ich zum ersten Mal von der europäischen Idee des Miteinanders, der Idee des Friedens, der Idee der Versöhnung, der Idee, aus einer bitteren Geschichte gelernt zu haben, gehört. Mein Vater hat mir diese Idee an einem emotional sehr aufgeladenen Ort, nach einem sehr emotionalen Erlebnis auf eine sehr emotionale und kindgerechte Weise mitgegeben. Ich hatte begriffen, dass nach so viel Streit, Kampf und Zerstörung Versöhnung und Frieden entstehen muss. Das habe ich schon als kleiner Bub mitgekriegt und nie vergessen.
Europa, der Gedanke von Frieden und Zusammenarbeit, wurde mir damit in die Wiege gelegt.
VERBINDUNG ZWISCHEN DEN WELTEN
Schon 1946 hatte Winston Churchill mit seiner »Let Europe arise«-Rede an der Universität Zürich die Idee für »eine Art Vereinigte Staaten von Europa« in die Köpfe gelegt: »Wir alle müssen dem Schrecken der Vergangenheit den Rücken kehren und uns der Zukunft zuwenden.« Laut Churchill war die wichtigste Maßnahme, um den in Trümmern liegenden Kontinent mit seinen zerstörten Landstrichen und den physisch wie psychisch versehrten Menschen in eine bessere Zukunft zu führen, die »Wiedererschaffung der europäischen Familie – und indem wir ihr eine Struktur geben, in der sie in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben kann«.
Der britische Staatsmann griff damit auf eine Vision zurück, die zuvor die paneuropäische Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg vertreten hatte. Auch während des Zweiten Weltkriegs zirkulierten in Widerstandskreisen im Exil und unter den Vertretern der Résistance in Frankreich, Belgien, Holland oder Italien Pläne für eine europäische Einigung nach dem Krieg.
Am 5. Mai 1949 war es so weit. Da unterschrieben die Außenminister von Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Staaten, Norwegen, Schweden, Dänemark, Irland und Italien im Londoner St. James Palace das »Statut des Europarates«. Drei Monate später eröffnete Édouard Herriot, ehemaliger französischer Regierungschef und überzeugter Europäer, in der Aula der Straßburger Universität die erste Sitzung der »Beratenden Versammlung des Europarates«. Österreich trat 1956, ein Jahr nach dem Staatsvertrag, dem Europarat bei. Neben der Aufnahme in die Vereinten Nationen war dieser Beitritt ein entscheidender Meilenstein am Weg zur Integration Österreichs in die europäische Staatengemeinschaft.
Auch wenn der Europarat als Institution nicht mit der Europäischen Union verbunden ist, hat er eine immense symbolische Bedeutung als Keimzelle der späteren EU, die unter derselben Flagge fährt und zur selben Hymne singt. Für mich ist der Europarat zudem quasi die institutionelle Umsetzung von dem, was ich mit dem beschriebenen Nibelungenbrücke-Moment familiär, biografisch, emotional erfahren habe. Das Miteinander und Zusammenhalten, von dem mein Vater in einer mir verständlichen Weise gesprochen hat, findet mit dem Europarat auf politischer Ebene erstmals eine konkrete Form. Man hat sich zusammengeschlossen für Menschenrechte, das heißt Respekt voreinander, für Rechtsstaatlichkeit, das heißt gleiche Behandlung aller Menschen auf Basis entsprechender Normen, für Demokratie, das heißt gleiche Mitbestimmungsrechte an der politischen Gestaltung, und für Frieden, das heißt Miteinander statt Gegeneinander.
NIE VERGESSEN!
Wann immer ich in den vergangenen Jahrzehnten bei diversen Veranstaltungen vor jungen Leuten vom Friedensprojekt Europa gesprochen habe, haben sie mich mit großen Augen angeschaut. Die meisten haben sich wohl gedacht: Wovon redet der?
Umso wichtiger sind Dokumentationen wie die filmischen Geschichtsaufarbeitungen des legendären und unvergesslichen Welterklärers Hugo Portisch. Aber so akribisch auch recherchiert wurde, so eindrücklich die Bilder auch sind, sie können niemals den unmittelbaren Bericht eines Menschen ersetzen, der dies selbst erlebt hat. Am intensivsten sind sicherlich jene Momente, die man als Kind erlebt hat, und die Lebensgeschichten der Eltern und Großeltern, die man im familiären Rahmen erzählt bekommt.
Nun ist der Krieg wieder näher gerückt. Er tobt vor unserer Haustüre im Nahen Osten und im Osten Europas. Ukrainische Kriegsflüchtlinge in großer Zahl leben unter uns. Viele Erwachsene arbeiten hier, die Kinder gehen hier zur Schule. Ob und wie sich daraus auch wieder ein neuer Enthusiasmus für die europäische Friedensidee entwickeln kann, wird sich zeigen. Im Unterschied zu den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg scheint mir heute aus Krieg und Not oftmals nicht ein Mehr an Miteinander, sondern im Gegenteil, mehr Abschottung, mehr Nationalismus und mehr Kleinstaaterei zu wachsen. Umso wichtiger wäre ein erneuter Blick zurück an den Anfang des größten gemeinsamen europäischen Vielfachen, um aus diesen Erfahrungen für den größten gemeinsamen Nenner in der Zukunft Europas zu lernen. »Lernen Sie Geschichte!«, rief dereinst Kanzler Kreisky einem Journalisten zu. Und obwohl der Kontext dieses Kreisky-Sagers ein anderer war, hat er doch eine Art dauernder Gültigkeit. Wir müssen aus der Geschichte lernen.
Meine Vorfahren mussten ebenfalls in europäischen Kriegen kämpfen, gegen die Bayern in den oberösterreichischen Bauernkriegen, gegen Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig. Der Großvater im Ersten Weltkrieg auf dem Balkan, der Vater im Zweiten Weltkrieg in Russland, in der Nähe der heute wieder schwer umkämpften Stadt Melitopol. Ihre Erzählungen habe ich nicht vergessen. Der Großvater, der in sehr lieben Worten von den friedliebenden Menschen und dem guten Miteinander der Bosniaken trotz unterschiedlicher Ethnien und Religionen sprach. Und mein Vater, der in seinem Panzer abgeschossen und als Einziger der Besatzung schwerstverletzt überlebt hatte, den nur ein Büchlein in seiner Brusttasche vor einem tödlichen Splitter ins Herz gerettet hatte.
Neben der Verwicklung in europäische Bruderkämpfe waren meine Vorfahren unternehmerisch tätig. Mein Urgroßvater Johann Obermayr hat gemeinsam mit seinem Bruder Leopold die erste Betriebsstätte unserer Ziegelfabrik 1895 in Eferding gegründet. Ab 1931 leitete mein Großvater Carl Leitl das Ziegelwerk durch die schwere Zeit der Weltwirtschaftskrise. Mein Vater Karl Leitl übernahm das Unternehmen ein Jahr nach Kriegsende, im April 1946. In einer Zeit, wo es an allem mangelte, man Bezugscheine brauchte für jede Art von Material, man schauen musste, wie Maschinen wieder zum Laufen gebracht wurden, als viel repariert und noch mehr improvisiert wurde. Die Leute mussten findig sein und waren es auch. Die Zeit war sehr fordernd, aber die Menschen haben einander unterstützt. Ein solidarisches Zusammenstehen war Gebot der Stunde, und das Bewusstsein, dass es nur gemeinsam zu schaffen war, war weitverbreitet. Der Eigennutz musste dahinter zurückstehen. Die Bereitschaft dazu war vorhanden. Damals wurden die Grundlagen der betrieblichen Partnerschaft gelegt. Mein Vater sagte, wir mussten uns im Krieg aufeinander verlassen, jetzt wollen wir uns auch im Wiederaufbau aufeinander verlassen.
Die ersten neun Jahre meines Lebens habe ich in Eferding verbracht. Als das Familienunternehmen größer geworden ist und es mehrere Standorte gab, sind wir nach Linz gezogen. Seitdem bin ich am Pöstlingberg in einem maximilianischen Festungsturm beheimatet mit einer, wie ich sie nenne, »emotionalen Heimat« in Neumarkt im Mühlviertel, woher meine väterlichen Vorfahren stammen. Dort finde ich in unserem fünfhundert Jahre alten bäuerlichen Auszugshäusel, einem liebevoll gepflegten Garten und einer wunderbaren Landschaft eine seelische Krafttankstelle, zu der eine regelmäßige Sonntagsmesse mit anschließendem Stammtisch beim Ochsenwirt eine wichtige Ergänzung ist.
Neben den beruflichen Herausforderungen mit der Übernahme der Leitung des Familienunternehmens von meinem Vater 1977 kamen neue Aufgaben auf mich zu, als ich 1990 in die oberösterreichische Landesregierung berufen wurde. Das Familienunternehmen führte ab diesem Zeitpunkt mein Bruder Martin, ihm folgte 2018 mein Sohn Stefan.
WER AN EUROPA ZWEIFELT, SOLLTE SOLDATENFRIEDHÖFE BESUCHEN!
Die Verwobenheit meiner Familie, meiner Vorfahren und von mir selbst mit Unternehmertum und Wirtschaft verbindet uns Leitls auch mit der Geschichte des gemeinsamen Europas. Mit »It’s the economy, stupid!« wird viele Jahrzehnte später einmal der angehende US-Präsident Bill Clinton die treibende Kraft der Wirtschaft für Politik und Gesellschaft auf den Punkt bringen. Im Falle Europas war es vor allem das Politiker-Kleeblatt Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer und Alcide De Gasperi, das an der Wiege Europas stand und das aus den Kriegslehren entstandene Kind auf die Welt brachte.
Als entscheidendes Eckdatum der politischen Einigung Europas und damit der Europäischen Union von heute gilt der 9. Mai 1950, als der französische Außenminister Robert Schuman seinen Plan für eine engere Zusammenarbeit präsentiert und vorschlägt, die Kohle- und Stahlindustrie der westeuropäischen Länder zu vereinen. Auf Grundlage dieses Schuman-Plans unterzeichnen die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande am 18. April 1951 den »Vertrag von Paris« zur Gründung der Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), auch Montanunion genannt. Als Zweijähriger hat mich dieses Ereignis natürlich überhaupt nicht berührt, geschweige denn, dass mir die enorme Bedeutung dieses Zusammenschlusses für mein Leben bewusst geworden wäre. Aber die Montanunion, die jene damals als kriegswichtig betrachteten Potenziale, nämlich Kohle und Stahl, unter eine supranationale Behörde stellte, das heißt in die Verantwortung einer Institution, die über den nationalen Regierungen steht, bildet neben dem Europarat das zweite wichtige Fundament Europas.
Mit diesen beiden Eckpfeilern haben die Gründerväter gleichzeitig idealistisch und realistisch gedacht.
Der Franzose Schuman dachte: Zweimal ist es uns gelungen, Deutschland in verheerenden Kriegen niederzuwerfen, zweimal hat das Frankreich gewaltige Kraft und enorme Opfer gekostet. Ein weiteres Mal darf das nicht passieren. Man darf vor Deutschland keine Angst mehr haben müssen!
Der deutsche Adenauer dachte wohl: Deutschland hat mit zwei Weltkriegen fürchterliches Elend angerichtet. Jetzt wollen wir mit unserer jungen Demokratie wieder zurück zu den europäischen Grundwerten und in Europa und die westliche Welt eingebunden werden. Was der Krieg in Deutschland angerichtet hat, soll auch nie wieder geschehen. Man wird sich vor Deutschland nicht mehr fürchten müssen!
Seit dem Zeitpunkt, da dieser Grundkonsens getroffen wurde, ist der deutsch-französische Motor zur bestimmenden Zugmaschine der Gemeinschaft geworden. Die beiden Staaten bilden bis heute eine verlässliche Achse. Dazu gehören wechselseitige Treffen, angefangen bei den Staatsspitzen über die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung bis hin zu Studenten- und Schüleraustausch, Städtepartnerschaften oder grenzüberschreitenden kulturellen Initiativen wie dem europaweit einzigartigen deutsch-französischen Kultursender ARTE. Viele symbolische Gesten wurden auf allen Ebenen gesetzt, um zu zeigen, dass aus jahrhundertelangen Erzfeinden Freunde geworden sind. Manche dieser Gesten sind zu Ikonen geworden, wie etwa jenes Bild aus dem Jahr 1984, das den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl und den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand Hand in Hand auf einem deutschen Soldatenfriedhof in Verdun zeigt. Siebzig Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, lediglich 45 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was für eine Geste! Was für ein Triumph der Brüderlichkeit! Was für ein Europamoment!
Daran schließt nahtlos der Rat meines Freundes Jean-Claude Juncker an, der Europa, egal ob als langjähriger Luxemburger Premier, als Euro-Gruppenchef oder EU-Kommissionspräsident, viele Etappen lang begleitete und weiterbrachte. Dieser Europäer mit Herz und Verstand wird nicht müde, allen Nörglern, Skeptikern und Kritikern der Europäischen Union immer wieder zu sagen: »Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!«
Von klein auf sind mir die Kriegerdenkmäler allerorten in unseren Städten und Gemeinden mahnende Begleiter. Die Skulpturen, Säulen, Tafeln mit den vier Jahreszahlen 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 stehen für Millionen Tote, Vermisste, Verwundete und noch mehr versehrte und verstümmelte Seelen. Diese Mahnmale für die Gefallenen sind mit mir alt geworden. Es ist auch ein Verdienst des gemeinsamen Europas, dass wir seither keine neuen Zeilen in diese granitenen Opferlitaneien meißeln mussten.
In meiner Schulzeit ist sehr wenig über die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg gesprochen worden. Leider, denn das hätte mich am meisten interessiert. Aber damals hörte der Geschichtsunterricht beim Ersten Weltkrieg auf, und die Folgezeit wurde kursorisch in ein, zwei Stunden abgehandelt. Die Schule hat da leider versagt.
Auch in meiner Familie gab es Verwandte, die dem damaligen Zeitgeist entsprachen, sich vom Nationalsozialismus eine bessere Zukunft erwarteten und in ihren Hoffnungen bitter enttäuscht wurden. Ich sprach meinen Vater darauf an, wie es die meisten Menschen meiner Generation mit ihren Altvorderen getan haben. Mein Vater sagte darauf: »Die Ideale unserer Jugend sind missbraucht worden. Pass auf, wenn jemand etwas sagt, was sehr verlockend ist, was aber nicht ins Miteinander, sondern ins Gegeneinander führt. Hüte dich vor Verallgemeinerungen. Und lerne aus der Vergangenheit: Nicht diejenigen sind schlecht, die sich dem Zeitgeist nicht entziehen konnten, sondern diejenigen, die sich dann geweigert haben, die dahinter gestandene Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen und daraus zu lernen.«
BESCHLEUNIGUNG UND FEHLZÜNDUNGEN
Am 3. September 1953 tritt die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft, die als Wertefundament Europas von zeitloser und ortsunabhängiger Gültigkeit sein sollte. Im Jahr darauf geriet der eben erst in Schwung gekommene Motor jedoch ins Stottern.
Bereits 1954 waren die Pioniere für ein einiges Europa bereit, nach den kriegswirtschaftlich wichtigen Bereichen Kohle und Stahl auch eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik zu formen. An der Ablehnung der französischen Nationalversammlung ist diese europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert. Was für eine verpasste Chance, an deren Nichtergreifung wir siebzig Jahre später noch leiden. Heute sehe ich keine europäische Armee am sicherheitspolitischen Horizont der EU. Vorstellbar wäre jedoch eine Kooperation der europäischen nationalen Streitkräfte samt einer schnellen Eingreiftruppe, in deren Rahmen auch Österreich unter Berücksichtigung seiner neutralitätspolitischen Erfordernisse teilnehmen könnte.