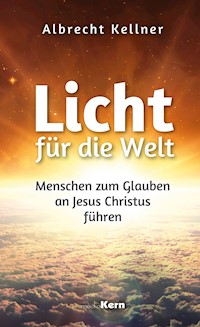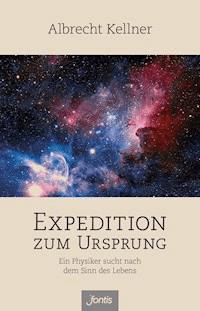
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es sind die existentiellen Fragen des Lebens, die sich jeder einmal stellt: Woher kommen wir, wohin gehen wir - und was ist der Sinn des Lebens? Um diese großen Fragen zu beantworten, studierte Albrecht Kellner Physik. Doch die Naturwissenschaften konnten ihm keine befriedigenden Antworten liefern. Daraufhin experimentiert er mit bewusstseinserweiternden Mitteln, lernt zu meditieren und beschäftigt sich mit fernöstlichen Philosophien - ohne wirklich fündig zu werden. Es scheint so, dass er seinem Ziel kein Stück näher kommt. Fast will er aufgeben, bis er auf jemanden stößt, der ihm die Lektüre der Bibel empfiehlt. Zu seiner Überraschung findet er einen Weg, der sich radikal von allen seinen bisherigen Erfahrungen unterscheidet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albrecht Kellner Expedition zum Ursprung
Für meinen Sohn Christian
Albrecht Kellner
EXPEDITION ZUM URSPRUNG
Ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens
Autobiografie
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Die Bibelstellen wurden, soweit nicht anders angegeben, folgender Übersetzung entnommen:
Lutherbibel © 2017 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Dieses Buch war ursprünglich in mehreren Auflagen bei SCM Brockhaus veröffentlicht worden. Die vorliegende Fontis-Neuausgabe wurde stark überarbeitet, ergänzt und erweitert.
© 2018 by Fontis – Brunnen Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Foto Umschlag: NASA Images / Shutterstock.com E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-492-9 ISBN (MOBI) 978-3-03848-493-6
www.fontis-verlag.com
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1:AUFBRUCH
Kapitel 2:VORSTOSS DES VERSTANDES
Eine Sackgasse
Rätsel der Materie
Rätsel des Raumes
Rätsel des Lebens
Rätsel des Ursprungs
Kapitel 3:REISEN DURCH DIE PSYCHE
Die Pforten der Wahrnehmung
Im Labyrinth des Unterbewussten
Kapitel 4:GRENZÜBERGÄNGE DES BEWUSSTSEINS
Ursprünge des Denkens
Erfahrung der Leere
Kapitel 5:GRATWANDERUNGEN DES LEBENS
Ausstieg
Begegnungen
Kapitel 6:EIN WEGWEISER
Der direkte Blick
Unmöglichkeiten
Kapitel 7:ABGRÜNDE
Gabelungen
Irrwege
Kapitel 8:UMKEHR
Ende des Weges
Letzte Hürden
Zwischen den Fronten
Kapitel 9:DURCHBRUCH
Im Licht der Logik
Erste Einblicke
Kapitel 10:AM URSPRUNG
Durchblick
Gewissheit
Kapitel 11:DER SCHATZ
Geier über dem Fundort
Glaube und Erfahrung
Der Schatz lebt!
Das Unerwartete
Das Geheimnis
Kapitel 12:SPRENGUNGEN
Risse im Felsen
Rückkehr
Ein Freund
Vorstoß ins Unbekannte
Neuorientierung
Es bricht sich Bahn
Kapitel 13:DIE LOGIK DES ENDGÜLTIGEN
Die Existenz des Ursprungs
Die Bedeutung des Ursprungs
Das Wesen des Ursprungs
Der Weg zum Ursprung
Das Leben am Ursprung
Das Leben aus dem Ursprung
Nachwort
Anmerkungen
Vorwort
Dieses Buch ist meinem Sohn Christian gewidmet. Wie für alle Menschen wird auch für dich – einmal oder mehrmals in deinem Leben – der Zeitpunkt kommen, wo die Frage nach dem eigentlichen Sinn deines Daseins auf diesem Planeten allmählich oder plötzlich eine ganz neue Bedeutung und Tiefe bekommt. Ich wünsche dir von Herzen, dass diese Frage dann nicht gerade von scheinbar Wichtigerem überlagert wird, so dass du sie überhörst oder verdrängst, oder dass sie durch leidvolle Ereignisse mit derartiger Wucht an dich herantritt, dass du plötzlich gezwungen bist, dich ihr ohne Vorbereitung zu stellen, sondern dass es dir so ähnlich ergehen wird wie mir.
Ich hatte das Glück, dass mich diese Frage schon in meiner Teenagerzeit immer wieder beschäftigte, so dass ich eigentlich nicht davon sprechen kann, von ihr überrascht worden zu sein. Meine mehr oder weniger kontinuierliche Suche nach der Antwort kommt mir im Rückblick fast wie eine zielgerichtete geistige Expedition zum Ursprung des Daseins vor.
Den Verlauf und den Ausgang dieser Reise habe ich dir hier aufgeschrieben. Dabei habe ich versucht, die Ereignisse und meine innere Entwicklung so genau wie möglich aus meiner Erinnerung zu rekonstruieren.
Es ist eine wahre Geschichte.
Wohl wissend, dass sich die Lebenswege der Menschen total voneinander unterscheiden und jeder auf ganz individuelle Weise den grundlegenden Fragen des Lebens begegnet, wünsche ich dir und allen anderen Lesern, dass diese Geschichte meines Weges doch vielleicht einige Hinweise geben, möglicherweise auch ein Ansporn sein kann für dieses faszinierendste aller Abenteuer: der Suche nach dem Endgültigen.
Ich möchte dich bitten, das Buch von vorne nach hinten durchzulesen und nicht etwa mittendrin schon im hinteren Teil zu blättern, weil sich das Ende der Geschichte unter anderem gerade aus der Abfolge der Stationen auf dieser Expedition entwickelt.
Ein Ergebnis kann ich jedoch schon vorwegnehmen: Man weiß mit Sicherheit, wann diese Expedition ihr Ziel erreicht hat.
Kapitel 1
AUFBRUCH
Es war zur Zeit der Flower-Power-Bewegung. Ich saß in einer Boeing 707 auf dem Flug nach Los Angeles neben einer attraktiven Studentin, die ebenso wie ich vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Stipendium für die University of California in San Diego bekommen hatte. Leicht benebelt vom Sekt, dem wir schon reichlich zugesprochen hatten, ihrem erfreulichen Anblick und dem Duft ihres Parfüms schaute ich aus dem Fenster. Unter uns kam Land in Sicht.
Amerika.
Was würde mich erwarten? An der ehrwürdigen Georg-August-Universität zu Göttingen hatte ich gerade das Studium zum Diplomphysiker abgeschlossen. Die Diplomarbeit hatte ich in theoretischer Festkörperphysik geschrieben. Nun erhoffte ich mir von Professor Suhl, einer weltweit anerkannten Koryphäe auf diesem Gebiet, weitere Einblicke, die mein bisheriges Wissen vertiefen würden.
Das war die offizielle Begründung für meinen Aufenthalt in Amerika. Meine charmante Begleiterin, und auch meine Eltern, Freunde und Bekannten, wussten jedoch nichts von meiner geheimen Zielsetzung und Hoffnung, deren Ursache bis weit vor die Zeit meines Studiums zurückreichte.
Vielleicht hatte es in jenem Moment begonnen, in dem ich als kleiner Junge zum ersten Mal in großer Höhe den Kondensstreifen eines Flugzeuges sah. Auch heute noch erinnere ich mich daran, wie mich damals plötzlich eine ungeheure Sehnsucht packte, ich aber nicht sagen konnte, wonach. «Da möchte ich einmal hin», eröffnete ich einem Freund, der verdutzt neben mir stand und genauso wenig wie ich begriff, was ich damit eigentlich meinte.
Vielleicht war es auch erst ganz allmählich durch den Einfluss der Umgebung entstanden, in der ich aufgewachsen war: in einem winzigen Ort in Namibia an der Grenze zweier unendlicher Weiten, der Wüste und dem Meer.
Wer einmal meinen Geburtsort Swakopmund besucht, wird dieses eigenartige Gefühl der Einsamkeit und Verlorenheit, das diese Küstenstadt am Rande der Wüste Namib durchweht, bald zu spüren bekommen. Ein Gefühl, das sich noch verstärken kann, wenn man eine Fahrt auf einer der staubigen Pisten in diese älteste Wüste der Welt unternimmt. In der großartigen Landschaft aus Dünen, unendlichen Flächen und schwarzen, schroffen Felsgebirgen wird einem vielleicht zum ersten Mal bewusst, wo man sich eigentlich befindet.
Auf einem Planeten im Weltall.
Diese Wahrnehmung vertieft sich noch, wenn man einmal im Freien übernachtet. Der Anblick des Nachthimmels ist mit nichts zu vergleichen, was man etwa in Europa vom Sternenhimmel kennt. Der ganze Himmel ist mit Myriaden funkelnder Sterne übersät. Die Milchstraße erstreckt sich als helles, dichtes Band quer über den Himmel.
Richtet man das Fernrohr auf einen der funkelnden Punkte, dann sieht man, wie dieser sich in unzählige weitere helle Lichtpunkte auflöst. Es geht immer weiter und weiter. Der Himmel strahlt in kristallener, durchsichtiger Klarheit bis in fernste Tiefen, und angesichts dieser überwältigenden Dimension konnte ich mich nur schwerlich der Ahnung verschließen, dass sich hinter all diesem etwas noch viel Größeres, ein Sinn, ein Ursprung, verbergen müsse. Immer wieder überkam mich die unbestimmte Sehnsucht danach, diesen eines Tages irgendwie erfassen zu können.
Insofern war es nicht verwunderlich, dass ich an einem kalten Februartag nach einer romantischen Fahrt mit einem der großen Passagierdampfer, mit denen man damals noch von Afrika nach Europa fuhr, und anschließender Reise mit Fähre und Bahn in der alten Universitätsstadt Göttingen eintraf, um mich dort für das Studium der Physik immatrikulieren zu lassen. Ich war voller Hoffnung, hier Antworten finden zu können auf diese seltsame Sehnsucht, deren genaues Ziel ich zwar noch kaum artikulieren konnte, deren Drängen sich dafür aber immer deutlicher bemerkbar machte.
Die Expedition zum Ursprung hatte begonnen.
Erst später wurde mir bewusst, dass diese schwer definierbare Suche nach dem Endgültigen, nach Antworten auf die Frage nach dem Woher und Wohin unserer Existenz tatsächlich den Charakter einer Expedition hat. Und ebenso wurde mir erst später klar, dass es sich hier um eine Art ultimativer Expedition handelt, auf der sich letztlich jeder Mensch befindet, obwohl das den meisten nur hin und wieder explizit zu Bewusstsein kommt.
Oberflächlich gesehen besteht diese Reise in der Suche nach einem erfüllten und glücklichen Leben – einer Suche, die ohne Zweifel jeden dieser merkwürdigen Zweibeiner auf unserem Planeten innerlich antreibt und letztlich alle seine Handlungen bestimmt. Die Auswirkungen dieser Suche reichen von der vermehrten Anhäufung materiellen Reichtums, dem Streben nach Ansehen oder der intensiven Befassung mit Kunst, Philosophie und Religion über die entbehrungsreichen Expeditionen eines Christoph Kolumbus, eines Roald Amundsen oder eines Reinhold Messner bis hin zu den kostspieligen Versuchen, ins Weltall vorzustoßen und dort nach unseren materiellen Ursprüngen zu forschen.
Wenn man all diese Unternehmungen zu ihrem eigentlichen Auslöser zurückverfolgt, dann zeigt sich immer wieder, dass diesen äußerlichen Expeditionen letztlich eine einzige innere Forschungsreise zugrunde liegt: die Suche nach einem im wahrsten Sinne des Wortes end-gültigen Sinn unseres Daseins.
Generell ist diese Frage allerdings derart unter den Aktivitäten des Alltags oder auch durch eine latente Resignation, ob diese Sehnsucht überhaupt zu stillen ist, verschüttet, dass nur in den seltensten Fällen versucht wird, sie explizit zu beantworten.
Darin liegt eine merkwürdige Inkonsistenz: Einerseits wird man letztlich in allen Handlungen von dieser Suche nach einem sinnerfüllten Leben angetrieben, anderseits scheint diese Suche selbst aber ein Tabu zu sein. Man unternimmt die abenteuerlichsten Expeditionen bis hin zur Gefährdung des eigenen Lebens, aber kaum jemand ist bewusst unterwegs auf dieser ultimativen Reise, die allem zugrunde liegt und auf der sich jeder irgendwie befindet, ob er es wahrhaben will oder nicht.
Mir war früh klar geworden, dass ich diese Widersprüchlichkeit in meinem Leben nicht gelten lassen wollte. Dementsprechend hatte ich auch während meines Studiums in den letzten fünf Jahren in Göttingen gelebt. Aber eine Lösung war noch nicht in Sicht.
Im Gegenteil: Ich war in einem Labyrinth gelandet. Ich brauchte Hilfe.
Und während sich die 707 dem Flughafen von Los Angeles näherte, ließ ich jene bewegte Zeit noch einmal Revue passieren.
Kapitel 2
VORSTOSS DES VERSTANDES
Es war ein faszinierender, aber auch ungeheuer mühevoller Weg, der mich bisweilen bis an den Rand des Versagens führte und mich mit dem Gedanken spielen ließ, das Studium abzubrechen.
Daran waren einige der Professoren nicht ganz unschuldig, die offenbar Vergnügen daran hatten, die ohnehin schwierige Materie so herablassend unpädagogisch wie möglich darzustellen. Bisweilen verstanden wir während einer Mathematik-Vorlesung nicht ein einziges Wort. Dafür waren wir aber bald in der Lage, in Windeseile alle Formeln an der Tafel samt allen verbalen Erklärungen fast Wort für Wort mitzuschreiben; inklusive aller Witze, die der Professor gnädigerweise ab und zu einstreute – sie hätten ja auch etwas Bedeutungsvolles beinhalten können. Bis in die Nächte mühten wir uns dann ab, unser Geschreibsel nachträglich zu verstehen.
Auch die Assistenten, die uns betreuten, während wir unsere physikalischen Experimente in den Übungen durchführten, hatten offenbar weniger Freude daran, uns die Faszination der Naturwissenschaft nahezubringen, als daran, uns ihre Macht spüren zu lassen. Immer wieder erklärten sie das Ergebnis der Arbeit eines ganzen Nachmittages wegen geringfügiger Fehler für null und nichtig. Unseren Ärger konnten wir anschließend nur mit größeren Mengen Alkohol in einer nahe gelegenen Kneipe herunterspülen.
Gut sind mir auch noch die Chemie-Übungen im Gedächtnis, wo es passieren konnte, dass man den ganzen Tag an einer Flüssigkeit herumdestillierte und -titrierte, um die gesuchte Substanz zu isolieren, die sich dann aber beim allerletzten Schritt mit einem leisen «Pfft» versehentlich in Dampf auflöste und unwiederbringlich dem Erlenmeyerkolben entfleuchte.
Mit verbissener Selbstdisziplin arbeitete ich mich trotz aller Widrigkeiten und trotz der ständigen Verlockungen des studentischen Nachtlebens durch die Materie der ersten fünf Semester – Experimentalphysik, Chemie, theoretische Mechanik und Thermodynamik sowie die zugehörige Mathematik. Dann nahte der erste Meilenstein auf meiner Expedition zum Ursprung: der Abschluss des Vordiploms.
Es sollte einer der wichtigsten Meilensteine auf meiner Reise werden.
Während ich mich bis zum Zeitpunkt des Vordiploms nur darauf hatte konzentrieren können, mir den umfangreichen Stoff in der kurzen verfügbaren Zeit einzuverleiben, hatte ich jetzt zum ersten Mal etwas Muße, das Gelernte auch zu verdauen und auf seine Brauchbarkeit für meine Expedition zu überprüfen.
Das Ergebnis war verblüffend.
Entsprechend der weithin vorherrschenden Meinung hatte auch ich erwartet, dass die Physik die Grundelemente unserer Welt und infolgedessen das gesamte Dasein, also auch unser Woher und Wohin, grundsätzlich erklären könne. Und das, was man noch nicht erklären konnte, würde eines Tages auch noch erschlossen werden.
Ich hatte gehofft, dass mir die Physik das Naturgeschehen in seiner inneren Bedingtheit als derart selbstständig und in sich autark begreiflich machen würde, dass damit das endgültige und eigentliche Wesen der Natur offengelegt wäre und alle Fragen auf rein rationale Weise beantwortet werden würden. Die unbelebte Natur wäre somit eine auf diese Weise endgültig erklärbare Maschine und das Leben das ebenso erklärbare Produkt einer viele Milliarden Jahre währenden Evolution. Dabei verbliebe kein Rest eines grundsätzlich Unerklärlichen, Rätselhaften, das etwa eine Hypothese eines außerhalb der Natur stehenden Urhebers, eines Schöpfers, erforderlich machen könnte.
In welch hoffnungsvoller Erwartung dieser Erkenntnisse hatte ich das Studium begonnen!
Doch schon nach den ersten fünf Semestern wurde mir unwiderruflich klar, dass diese Hoffnung nicht erfüllt werden konnte. Die Physik hatte sich als eine für meine Fragen nicht zuständige Instanz entpuppt.
Ich kann mich noch gut an die Enttäuschung erinnern, die sich nach all dieser hochkonzentrierten Anstrengung bei mir einstellte. Doch nur weil ich über das populärwissenschaftliche Wissen hinaus in die Materie eingedrungen war, hatte ich diese Erkenntnis bekommen können. Sie wies mich eindeutig und endgültig hinaus über die Naturwissenschaft und letztlich über alle Wissenschaften und rein rationalen Versuche, zu «erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält».
Ich war sozusagen ein Seelenverwandter von Goethes Dr. Faustus geworden.
Wie war es dazu gekommen?
Eine Sackgasse
Wir wissen seit einigen Jahrhunderten, dass die Erde auf einer exakt definierten Bahn um die Sonne kreist.
Aber: Weiß das auch die Erde?
Woher weiß sie, wie weit sie zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Sonne entfernt ist und wie sie ihre Bahn krümmen muss, damit sie auf der vorgeschriebenen Ellipsenbahn fortfährt und nicht geradlinig an der Sonne vorbeischießt?
Wie spürt die Erde die Nähe der Sonne?
Die meisten würden antworten: Dass die Erde die Sonne «spüren» muss, ist eine unsinnige Unterstellung. Jeder weiß, dass die Gravitation, die Anziehungskraft der Sonne, die Erde auf ihrer Bahn hält. Und was Gravitation ist, das wissen die Physiker. Damit ist alles erklärt. Da gibt es nichts Geheimnisvolles, Unerklärliches mehr.
Das hatte ich auch gedacht.
Doch nun musste ich feststellen, dass die Physiker eben nicht wissen, was Gravitation ist. Keiner meiner Professoren konnte mir erklären, wie es dazu kommt, dass zwei Massen offenbar ein Gespür dafür haben, wo sie sich relativ zueinander befinden und wie sie sich dementsprechend gegenseitig anziehen müssen. Das eigentliche Wesen, die Essenz dieses Phänomens, wird nicht geklärt, es bleibt rätselhaft.
Mehr noch: Ich musste feststellen, dass es letztlich gar nicht das Ziel der Physik ist, die Gravitation in einem endgültigen Sinn zu erklären. Und dies gilt nicht nur für die Gravitation, sondern auch für alle anderen Naturphänomene.
Die Physik geht von der Vorgegebenheit der Phänomene aus, ohne diese Vorgegebenheit ihrem eigentlichen Wesen nach weiter zu hinterfragen. Ihre Zielsetzung besteht lediglich darin, diese weiterhin als rätselhaft belassenen Phänomene zu beobachten, auf Gesetzmäßigkeiten zu untersuchen und diese in die Sprache der Mathematik zu übersetzen.
Mehr nicht.
Das war der entscheidende Aha-Effekt nach fünf Semestern Studium.
Die Physik erklärt nicht. Sie beschreibt nur. Sie sammelt und ordnet.
Allerdings ist sie dabei äußerst scharfsinnig und höchst abstrakt – und das verleiht ihr aus populärwissenschaftlicher Sicht immer wieder den Nimbus einer Wissenschaft, die alles erklären kann.
Das Sammeln besteht in der Durchführung von Experimenten. Das Ordnen besteht in dem Versuch, die inneren Abhängigkeiten der experimentellen Ergebnisse aufzudecken und in möglichst wenigen, möglichst «eleganten» mathematischen Formeln darzustellen: den physikalischen Gesetzen, deren Gesamtheit dann die jeweilige physikalische Theorie bildet, wie etwa die der Gravitation.
Angetrieben wird dieser Prozess der Theorienbildung von dem Wunsch, zu immer grundsätzlicheren Gesetzen vorzustoßen, mit denen ein immer größeres Spektrum an Phänomenen beschrieben werden kann.
Dazu bedient man sich in den meisten Fällen der Methode der Modellbildung. Dabei wird versucht, die experimentell gefundenen Ordnungen und Zusammenhänge auf noch grundlegendere, kompaktere Ordnungen und Zusammenhänge zurückzuführen. Diese sind aber nun nicht mehr direkt aus Beobachtungen abgeleitet, sondern werden als Annahmen oder physikalische Modellvorstellungen zunächst einmal postuliert und anschließend daraufhin überprüft, ob Beobachtungen korrekt beschrieben werden.
Gewissermaßen handelt es sich um Grenzübergänge vom Materiellen zum Geistigen: Die Objekte der Beschreibung verschieben sich von beobachteten Ordnungen im messbaren, materiellen Bereich zu hypothetischen, gedanklichen Konstrukten und ihren logischen Zusammenhängen, den physikalischen Modellvorstellungen. Diese Grenzübergänge zu vollziehen und solche Modellvorstellungen zu finden, gehört zu den aufregendsten Momenten in der Arbeit eines Physikers.
Gerade die Mächtigkeit solcher Modellvorstellungen, die darin besteht, eine Vielzahl von Phänomenen vorherzusagen, ist einer der Gründe dafür, dass man der Physik die Fähigkeit zuschreibt, alles erklären zu können. Und doch handelt es sich bei den Modellvorstellungen auch nur wieder um Beschreibungen vorgegebener und nach wie vor rätselhafter Gesetzmäßigkeiten, auch wenn diese im Unterschied zu den direkt aus den Beobachtungen gefundenen Ordnungen nunmehr hypothetische Ordnungen geistiger Konstrukte sind. Letztere kommen dabei meist in noch rätselhafterem Gewand daher als die Erscheinungen selbst.
Dementsprechend sind physikalische Theorien auch grundsätzlich von einer gewissen Unsicherheit gekennzeichnet, da sich die zugrunde liegenden Modelle immer einer Überprüfung durch weitere Experimente stellen müssen. In diesem Sinne sind sie nie endgültig, da sie jederzeit durch neue empirische Erkenntnisse relativiert werden können.
Das heißt, dass die Physik nicht nur das Wesen der Natur lediglich beschreibt, statt es zu erklären, sondern auch, dass diese Beschreibungen selbst einer ständigen Relativierung unterworfen sind. Dies geschieht allerdings in so großen zeitlichen Abständen, dass mitunter der irrige Eindruck entsteht, man habe nun die endgültige Theorie gefunden.
Eine neue Theorie ist beispielsweise dann entstanden, wenn sie neben erweiterten Beschreibungsmöglichkeiten auch eine Verfeinerung einer älteren Theorie in dem Sinne beinhaltet, dass sie eine Herleitung der Gesetze dieser älteren Theorie ermöglicht.
Zum Beispiel konnte man aus der neueren Theorie der ständig gegeneinanderstoßenden Moleküle in Gasen die älteren Gesetze des Gasdrucks ableiten und sie in diesem Sinne aus der neueren Theorie «erklären».
Übrigens scheint gerade diese Art des Erklärens ein weiterer Grund für das populärwissenschaftliche Missverständnis zu sein, eines Tages werde die Physik in der Lage sein, alles zu erklären. Denn es scheint ja so, als ob die Physik auf diese Weise in der Lage ist, bislang noch Unerklärtes sukzessive immer tiefer zu verstehen, so dass es nur noch eine Frage der Zeit sein kann, bis alles erklärt ist.
Doch dass diese Hoffnung ein Irrtum ist, war nun für mich nicht mehr zu leugnen: Bei diesem vermeintlichen Erklären geschieht nichts weiter, als dass man Beschreibungen auf andere, subtilere Beschreibungen zurückführt. Nach wie vor bleibt es bei einem bloßen Ordnen und Beschreiben der Phänomene unseres Daseins, deren Vorgegebenheit dabei trotz aller Subtilität der Darstellung auch nicht das Geringste ihrer Rätselhaftigkeit eingebüßt hat. Im Gegenteil: Je subtiler die Theorien werden, als desto geheimnisvoller erweist sich die zugrunde liegende Wirklichkeit.
Eine weitere Art der Selbstrelativierung der Physik besteht neben dieser sukzessiven Verfeinerung darin, dass mitunter ältere Theorien radikal umgekrempelt und in ihrem früheren universellen Gültigkeitsanspruch als falsch erkannt werden – nur in Grenzbereichen können sie noch näherungsweise gültig bleiben. In diesem Fall wird die vermeintliche Fähigkeit der Physik, die Welt erklären zu können, also von ihr selbst in Frage gestellt.
Der berühmte Physiker Stephen Hawking schreibt in seinem Buch Einsteins Traum, «dass eine physikalische Theorie immer nur ein mathematisches Modell ist, mit dessen Hilfe wir die Ergebnisse unserer Beobachtungen beschreiben. Eine Theorie ist eine gute Theorie, wenn sie ein elegantes Modell ist, wenn sie eine umfassende Klasse von Beobachtungen beschreibt und wenn sie die Ergebnisse weiterer Beobachtungen vorhersagt. Darüber hinaus hat es keinen Sinn zu fragen, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt, weil wir nicht wissen, welche Wirklichkeit gemeint ist».1
Deutlicher kann kaum ausgedrückt werden – und das aus berufenstem Munde –, dass die Physik nicht die Instanz ist, letzte Wirklichkeiten zu erklären.
Rätsel der Materie
Eine gute Illustration dieser allgemeinen Betrachtungen liefert die eingangs erwähnte Gravitationstheorie, anhand derer im Folgenden gleichzeitig vielleicht auch etwas von dem faszinierenden Abenteuer physikalischer Forschungen vermittelt werden kann.
Ausgangspunkt war die für damalige Verhältnisse revolutionäre Erkenntnis von Kopernikus und Galilei, dass die Planeten nicht etwa um die Erde, sondern um die Sonne kreisen. Nun galt es, die innere Ordnung, die Gesetze zu finden, nach denen sich die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne richten.
Wohlgemerkt: Von der Anziehungskraft der Sonne wusste man damals noch nicht das Geringste, aber diese unablässige Suche nach Ordnungen in den Naturphänomenen stieß schließlich das Tor zu unserem heutigen Wissen über diese seltsame Eigenschaft der Sonne und letztlich aller Objekte in unserem Weltall auf.
Dazu mussten auf der Basis unendlich akribischer Beobachtungen die grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten in der Bewegung der Planeten erst einmal erarbeitet werden.
Diese Mammutarbeit leisteten im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert der dänische Astronom Tycho Brahe und der deutsche Mathematiker Johannes Kepler, der als Brahes Assistent mit ihm zusammengearbeitet hatte. Die Zusammenhänge, die sie schließlich fanden, die sogenannten Kepler’schen Gesetze, stellten eine erste kompakte mathematische Beschreibung dieser Gesetzmäßigkeiten dar.
Diese «Theorie» der Planetenbahnen zeigt noch deutlich den rein beschreibenden Charakter aller physikalischer Theorien, denn es handelt sich lediglich um die Feststellung, dass sich Planeten auf Ellipsenbahnen bewegen, und um die Aufzählung der beobachteten mathematischen Zusammenhänge zwischen Umlaufzeiten und Abständen von der Sonne. Die Angabe tieferer, zugrunde liegender Gesetze im Sinne einer Modellvorstellung fehlt.
Den entscheidenden Durchbruch zu einer derartigen Modellvorstellung schaffte Sir Isaac Newton. Möglicherweise war dieser geniale Mathematiker und Physiker der erste Naturwissenschaftler überhaupt, der den Grenzübergang von den rein materiell beobachteten Gesetzmäßigkeiten zum Postulat gedanklicher Konstrukte und ihrer Zusammenhänge – den Schritt zur Modellbildung – vollzog.
Stark vereinfacht lässt sich dieser faszinierende Schritt folgendermaßen nachvollziehen: Zunächst stellte Newton fest, dass jede Beschleunigung eines Objektes durch eine Kraft hervorgerufen wird und dass die Größe der Beschleunigung zu dieser Kraft proportional ist. Diese Erkenntnis formulierte er in seinem berühmten Bewegungsgesetz: «Das Produkt aus Masse mal Beschleunigung eines Körpers ist gleich der Kraft, die auf diesen Körper einwirkt.»
Nun machte er die Beobachtung, dass alle Objekte beim Fall auf die Erde eine Beschleunigung erfahren – ergo musste die Erde eine Kraft auf die Objekte ausüben. Und irgendwann kam dann dieser erregende Moment, der für Jahrhunderte unser naturwissenschaftliches Weltbild maßgeblich prägen sollte: Newton erkannte in einem Gedankenblitz, dass die gleiche Kraft, die die Erde auf einen vom Baum fallenden Apfel ausübt, auch zwischen Sonne und Planeten und letztlich zwischen allen Körpern wirkt.
Damit hatte er die Gravitationskraft entdeckt!
Mit den Kepler’schen Gesetzen und seinem Bewegungsgesetz war es nun für Newton ein relativ Leichtes, mit einigen mathematischen Operationen zu einer Modellvorstellung dieser Kraft, zu seinem Newton’schen Gravitationsgesetz, zu kommen. Dieses Gesetz erlaubte es nicht nur, die Kepler’schen Gesetze auf eine kompaktere Beschreibung zurückzuführen, sondern stellte insgesamt eine universelle Theorie der Gravitation zwischen beliebigen Körpern dar. Eine Theorie, die 350 Jahre zu den unwidersprochenen theoretischen Grundpfeilern der Physik gehörte.
Für mich als Suchendem auf dem Weg zu den Ursprüngen war nun die entscheidende Frage: Konnte diese Theorie die bei Kepler fehlende tiefere Erklärung für das Wesen der Gravitation liefern?
Das Newton’sche Gravitationsgesetz geht davon aus, dass jeder Körper um sich herum ein Feld erzeugt, das wiederum auf einen anderen Körper eine Kraft ausübt, deren Größe und Richtung in jedem Moment mittels des Gravitationsgesetzes berechnet werden können.
Die Sonne erzeugt also etwas, sie lässt etwas in dem sie umgebenden Raum entstehen.
Ein Feld.
Und dieses Feld übt eine Wirkung auf die Planeten aus.
Ich war um nichts klüger geworden.
Ich hatte eine Erklärung gesucht und eine Modellvorstellung gefunden: eine Annahme, dass es ein Feld geben müsse, und die Beschreibung der Ordnung oder Gesetzmäßigkeit, nach der dieses Feld mit den erzeugenden Massen zusammenhängen sollte.
Über das Eigentliche, also auf welche Weise die Sonne dieses Kraftfeld im Weltraum entstehen lässt, was dieses Feld eigentlich ist und auf welch rätselhafte Weise das Feld wiederum auf die Planeten einwirkt, wie die Planeten diese Wirkung spüren und auf sie reagieren können, darüber schweigt sich dieses Gesetz vollkommen aus. Newton hatte das, was er in Bezug auf die Planetenbahnen beobachtet hatte, auf das hypothetische, gedankliche Konstrukt eines «Feldes» zurückgeführt.
Es blieb bei einer bloßen Beschreibung. Und zwar der Beschreibung des nach wie vor Unerklärlichen, denn dieses Konstrukt eines Feldes war für mich mindestens ebenso rätselhaft wie das Phänomen der Gravitation selbst. Die tiefere Ursache, ein echter ontologischer Bezug, fehlte mir hier genauso wie bei Kepler.
Kepler hatte konstatiert, dass es Ellipsen gibt, und diese mathematisch beschrieben.
Newton hatte konstatiert, dass es ein Kraftfeld gibt, und dieses mathematisch beschrieben.
Des einen Ellipsen waren des anderen Kraftfeld.
Zwar lässt sich Kepler auf Newton zurückführen, aber das heißt nicht, dass Newton Kepler erklärt hätte. Denn worauf konnte man Newton zurückführen?
Allerdings war man nun mit der Newton’schen Theorie in der Tat in der Lage, einen großen Teil aller Phänomene zu beschreiben, die mit den Anziehungskräften von Massen zu tun haben – auch derjenigen, die man jetzt erst nachträglich auf ihr Verhalten untersuchte. Dementsprechend groß war die populärwissenschaftliche Versuchung, die Frage nach dem eigentlichen Wesen der Gravitation zu unterdrücken und die erweiterte Beschreibungsfähigkeit bereits als Erklärung zu werten.
Aber es war keine Erklärung.
Es blieb eine bloße Beschreibung.
Die gefundene Ordnung ließ sich auf ein ungeheuer weites Spektrum ausdehnen, ihre Gültigkeit war offenbar universeller Natur – das war erfreulich. Aber die Vorgegebenheit dieser Ordnung und ihre Eigenart blieben ein Rätsel. Und das war unerfreulich.
Zumindest für mich, der ich ja gehofft hatte, dass die Welt eine Maschine ist, die durch die Physik restlos erklärt werden kann – ohne weitere Geheimnisse und aus sich selbst heraus. Um diese Erklärungen zu verstehen, hatte ich nun mit großen Erwartungen einen beträchtlichen Teil meiner jugendlichen Jahre und Energie aufgewandt!
Doch die Physik hatte sich als reine Phänomenologie entpuppt. Sie hatte keinen ontologischen Anspruch. Es gehörte nicht zu ihrem Handwerk, die Essenz der Phänomene aufzuspüren. Ich war einem allgemeinen Trugschluss aufgesessen, der eine in ihrer Dimension für mich aus heutiger Sicht völlig unbegreifliche Verbreitung genießt. Denn allenthalben hält man das Entdecken und Beschreiben vorgegebener Ordnungen bereits für eine Erklärung!
In welchem Ausmaß dieser Trugschluss in der Allgemeinheit, aber erstaunlicherweise auch bei vielen Physikern verbreitet ist, lässt sich daran ersehen, dass viele denken, ein Urheber allen Seins sei aufgrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse überflüssig.
Diese Folgerung erschien mir aufgrund allein schon des Basiswissens der Physik, über die ein Vordiplomand verfügt, nun geradezu unfassbar. Nach der gleichen Logik könnte man folgern, dass nach genauer Analyse und anschließender sorgfältiger Beschreibung der Architektur und Bauweise eines Hauses die Existenz eines Architekten eine überflüssige Hypothese sei.
Rätsel des Raumes
Wie schon erwähnt: Es ist die Physik selbst, die die Allgemeingültigkeit ihrer Beschreibungen und damit erst recht das populärwissenschaftliche Missverständnis hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die Welt grundsätzlich erklären zu können, im Laufe der Geschichte immer wieder in Frage stellt. Dies zeigt sich unter anderem wieder an der Gravitationstheorie, die mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Relativitätstheorie durch Albert Einstein im Jahre 1915 auf eine Weise umgekrempelt wurde, von der Newton sich nie hätte träumen lassen.
Diese faszinierende Umwälzung lässt sich zumindest in den Grundzügen im Nachhinein verhältnismäßig leicht nachvollziehen, auch wenn der Weg dorthin einen ungeheuren gedanklichen Wagemut und höchste gedankliche Disziplin verlangte. Einstein war nämlich etwas aufgefallen, dessen Konsequenzen bislang unbeachtet geblieben waren.
Anhand des Beispiels der Bahn der Erde um die Sonne kann man das etwa folgendermaßen beschreiben: Zur Berechnung dieser Bahn wird das bereits erwähnte Newton’sche Bewegungsgesetz verwendet: «Das Produkt aus Masse mal Beschleunigung eines Körpers ist gleich der Kraft, die auf diesen Körper einwirkt.»
Mathematisch formuliert ist dieses Gesetz eine Gleichung, in der links vom Gleichheitszeichen das Produkt aus der Masse der Erde mit ihrer Beschleunigung steht und rechts die Anziehungskraft, mit der die Sonne an jedem Punkt der Erdbahn auf die Erde einwirkt und sie beschleunigt:
Diese Anziehungskraft der Sonne ist das besagte Newton’sche Gravitationsfeld. Nach der Newton’schen Theorie berechnet sie sich aus einer Reihe von Faktoren, zu denen auch die Masse der Erde gehört. Eingesetzt in die obige Gleichung ergibt sich:
Die Masse der Erde taucht also sowohl links als auch rechts vom Gleichheitszeichen auf. Damit kann sie aus der Gleichung herausgekürzt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Erde in der Bahngleichung gar nicht mehr auftaucht (auf einige zusätzliche diesbezügliche Überlegungen zu der Gleichheit von schwerer und träger Masse sei hier der Einfachheit halber verzichtet):
Das bedeutet, dass die Bahn der Erde nicht von ihrer eigenen Masse abhängt. An die Stelle der Erde könnte man auch den viel kleineren Pluto setzen oder den gigantischen Jupiter – alle würden gemäß der Newton’schen Theorie rein rechnerisch auf der Bahn der Erde bleiben, sofern man ihnen nur in dem Moment, in dem man sie an die Stelle der Erde setzt, die gleiche Richtung und Geschwindigkeit wie die der Erde mitgeben könnte.2
An dieser Stelle kam Einstein die entscheidende Erkenntnis: Er folgerte, dass es sich bei der Gravitationswirkung der Sonne offenbar nicht um eine Kraftwirkung auf die Massen der verschiedenen Planeten handelte, wie Newton es angenommen hatte, sondern um eine Wirkung auf die Geometrie, in der diese Bahnen beobachtet und vermessen werden.
Dies war der revolutionäre Gedanke, der die moderne Gravitationstheorie und mit ihr die Basis unseres heutigen Wissens über die Entwicklung des Weltalls hervorbrachte!
Es handelt sich hier jedoch wieder um eine reine Modellvorstellung, die sich allerdings radikal vom Newton’schen Modell unterscheidet. Die Sonne bewirkt kein Feld mehr, sondern eine Verkrümmung der Geometrie des Raumes. Die möglichen Wege der Himmelskörper sind durch diesen gekrümmten Raum um die Sonne auf ganz spezielle Weise eingeschränkt, so dass die Planeten und Kometen Ellipsen- beziehungsweise Hyperbelbahnen beschreiben müssen.
Eine gute Veranschaulichung dieser Vorstellung liefert der Vergleich mit einer Laus, die auf der Oberfläche eines aufgeblasenen Luftballons entlangkrabbelt. Läuft diese Laus immer geradeaus, ohne Abweichung zur Linken oder zur Rechten, dann kommt sie nach der Umrundung des Ballons wieder an ihren Ausgangspunkt zurück. Das heißt, sie durchläuft eine geschlossene Kreisbahn, was offensichtlich damit zusammenhängt, dass die Ballonoberfläche gekrümmt ist.
Würde der Ballon platzen, und man würde das Teilstück, auf dem sich die Laus gerade befindet, auf eine ebene Unterlage legen, dann würde die Laus auf einer geraden Linie weiterkrabbeln. In diesem Falle bliebe ihr die Überraschung, sich plötzlich wieder am Ausgangspunkt ihrer Expedition zu befinden, erspart. Erst die Krümmung der Oberflächengeometrie bewirkt, dass die «Bahnen» der Laus geschlossene Linien ergeben.
Völlig analog hierzu, aber wegen des Übergangs von den zwei Dimensionen der Ballonoberfläche zu den drei Dimensionen des Raumes vorstellungsmäßig kaum nachvollziehbar, werden die Bahnen von Planeten in einer gekrümmten Raumgeometrie zu geschlossenen Kreisen und Ellipsen. Und dass die Raumgeometrie gekrümmt ist, das nun bewirkt die Masse der Sonne.
Ein ungeheurer Gedanke!
Massen verkrümmen die Geometrie des Raumes!
Lässt sich die Kühnheit dieses gedanklichen Schritts schon kaum ermessen, so war die intellektuelle Herausforderung nicht minder gewaltig, die jetzt noch auf Einstein wartete. Dieser Gedanke hätte nämlich nur dann Bestand, wenn es ihm gelänge, die Gesetzmäßigkeiten zu finden, nach denen Massen auf den sie umgebenden Raum einwirken.
Zunächst musste er an die Stelle des Newton’schen Gravitationsfeldes, das von der Sonne erzeugt wird und auf die Planeten einwirkt, ein wesentlich komplexeres gedankliches Konstrukt setzen, den sogenannten metrischen Tensor. Es handelt sich dabei um eine Zahlentabelle, die das maßgebliche mathematische Objekt zur Beschreibung einer allgemeinen gekrümmten Geometrie darstellt.
Nun musste er die Gleichungen finden, anhand derer berechnet werden konnte, wie gravitierende Massen diesen metrischen Tensor bestimmen.
Eine gewaltige Herausforderung. Aber es gelang!
Die Erstellung der sogenannten Einstein’schen Feldgleichungen gehört zu den eindrucksvollsten Leistungen, die je ein Physiker erbracht hat.
Doch nun war das Wesen der Gravitation noch geheimnisvoller geworden.
Das rätselhafte Phänomen, dass Äpfel senkrecht vom Baum auf den Boden fallen und dass Planeten die Sonne umkreisen, mitsamt den dazugehörigen Gesetzmäßigkeiten, wie sie Kepler in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen hatte, war nun auf ein noch rätselhafteres gedankliches Konstrukt reduziert: auf die Vorstellung eines metrischen Tensorfeldes, das auf eine unerklärliche Art und Weise von Massen beeinflusst werden kann.
Auch hier liefert die Theorie nicht mehr und nicht weniger als eine Beschreibung von Ordnungen oder Gesetzmäßigkeiten zwischen beobachtbaren und gedanklichen Entitäten, auch wenn diese sich radikal von denen der Newton’schen Theorie unterscheiden. Das Geheimnis der Existenz der Gravitation und seiner Gesetzmäßigkeit ist um nichts transparenter geworden.
Allerdings ist die Einstein’sche Theorie um ein Vielfaches mächtiger als die Newton’sche, denn sie beschreibt nicht nur einiges sehr viel präziser, sondern hat vor allem auch Phänomene vorhergesagt, die bis dahin noch niemand beobachtet hatte und die dann in der Tat, zum Teil erst Jahre später, auf der Basis von Messungen bestätigt wurden.
Diese Phänomene hatten die Fachwelt immer wieder in helle Aufregung versetzt, wie etwa die Ablenkung des Sternenlichts an der Sonne, die Existenz von Gravitationslinsen im Weltall, die Verlangsamung von Uhren in der Nähe großer Massen, schwarze Löcher, die Fluchtbewegung der Sterne sowie der später auch von astronomischen Messungen nahegelegte Urknall.