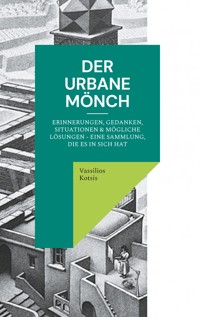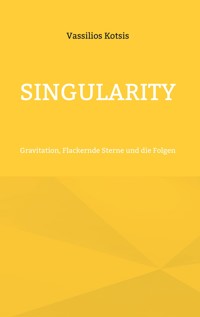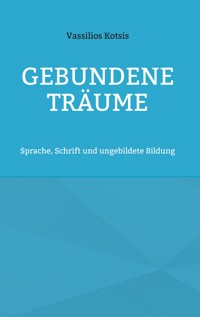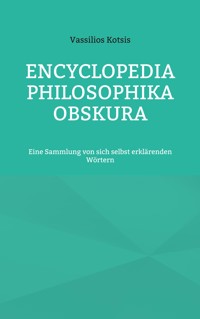Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Werk mit dem vielsagenden Titel - Fragmente der Zeit, versucht dem Leser einen Einblick zu gewähren in sein eigenes 'Ich'. Ganz getreu nach den Worten Heraklits - Erkenne Dich selbst, soll es dabei die grundlegenden neuronalen Mechanismen von Homo Sapiens ergründen und uns allen zugänglicher werden lassen. Ein Hauptaugenmerk ist in diesem Falle auf die subjektive Zeitwahrnehmung gesetzt worden. Aus ihrer logischen Konsequenz einer dynamischen Kompetenz eines jeden Menschen heraus, die aufgrund von Alterung, Fähigkeit und Ausdifferenzierung, zwangsläufig einen Gradienten der realistischen Zeitwahrnehmung verursacht, soll Schritt für Schritt ein Verständnis geschaffen werden für allzuoft verborgen verbleibende Sachverhalte. Der Autor verbleibt während der gesamten gemeinsamen Reise durch unsere eigene Zeitwahrnehmung darum bemüht keineswegs den Leser durch eine abgehobene Fachsprache zu verlieren, obgleich dies manchmal recht schwierig erscheint, da die neuronalen Mechanismen nicht zwangsläufig simpel sind. Geschmückt mit zahlreichen Details und Kontroversen menschlicher Erkenntnis im Verlauf des Schaffensprozesses ermöglicht das vorliegende Werk auch Laien sich einen Einblick zu verschaffen in das verworrene Feld der Wissenschaft und ihrer 'Selbst'. Spannend und unterhaltsam zugleich bereichert es und erweitert ganz unbefangen unseren Erkenntnishorizont
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ANFANG – BEGINNING – ΑΡΧΗ
Epischer Prolog
Vorwort
Einleitung
Zitat
Grundsätzliche Betrachtungsweisen der Erkenntnis
Philosophische Betrachtungsweise
Bewusstsein – Erster Akt
Der Weg des Lichts
Der Weg des Schalls
Wahrnehmung
Bewegung
Wahrnehmung von Bewegung
Gravitation
Oszillation
Rhythmus
Lange und kurze Zyklen – τ, λ
Das Herz & die Lunge
Der Puls
Die Atemfrequenz
Kalendarische Zyklen
Tag & Nacht – 24 St. (Circadian)
Der Mond – 28 Tage
Temperatur
Neuroanatomie – Ein Kurzüberblick
Zentren der Verarbeitung
– Die Riechbahn –
Retina
– Die Sehbahn –
Cochlea
– Die Hörbahn –
Der Kontrast & das Chaos
Thalamus
Der Cortex – Die Cortices
– Die Somatosensorische Bahn(en) –
Symmetrie
Zeit und neuronale Strukturen
Hippocampus
Amygdala
Neuronale Schleifen
Synchronizität
Bewusstsein – Zweiter Akt
Der Weg ist das Ziel
Grundlegende Fragen, die offen bleiben
Aphorismen
Anhang – Ewige Zitate
Anhang – Literatur
Anhang – Fachliteratur
Anhang X
Anhang Σ
Epilog Ω
ANFANG – BEGINNING – ΑΡΧΗ
Nicht alles was plausibel ist, ist wahr und nicht alles was wahr ist, ist auch plausibel.
Dezember 2023
Epischer Prolog
Wenn unsere Gedanken auf Reisen gehen ohne, dass wir sie selbst zu lenken versuchen – wenn die intensive Beobachtung und Empfindungen mit allen uns gegebenen Sinnen, einen Zustand der reinen Wahrnehmung erzeugt, so dann scheint die Zeit still zu stehen. Vergangenheit und Zukunft sind jeweils beides Illusionen unserer Selbst – nur die Gegenwart ist real. In ihr möglichst intensiv mit allen Sinnen zu verbleiben ist auch die Kunst, um eben erwähnte Illusion der Vergangenheit mit reichhaltigen Erinnerungen schmücken zu können und in der Lage zu verbleiben, Zukunft realistisch einschätzen zu können.
Vorwort
Das vorliegende Werk mit dem vielsagenden Titel – Fragmente der Zeit, versucht dem Leser einen Einblick zu gewähren in sein eigenes 'Ich'. Ganz getreu nach den Worten Heraklits – Erkenne Dich selbst, soll es dabei die grundlegenden neuronalen Mechanismen von Homo Sapiens ergründen und uns allen zugänglicher werden lassen. Ein Hauptaugenmerk ist in diesem Falle auf die subjektive Zeitwahrnehmung gesetzt worden. Aus ihrer logischen Konsequenz einer dynamischen Kompetenz eines jeden Menschen heraus, die aufgrund von Alterung, Fähigkeit und Ausdifferenzierung, zwangsläufig einen Gradienten der realistischen Zeitwahrnehmung verursacht, soll Schritt für Schritt ein Verständnis geschaffen werden für allzuoft verborgen verbleibende Sachverhalte. Der Autor verbleibt während der gesamten gemeinsamen Reise durch unsere eigene Zeitwahrnehmung darum bemüht keineswegs den Leser durch eine abgehobene Fachsprache zu verlieren, obgleich dies manchmal recht schwierig erscheint, da die neuronalen Mechanismen nicht zwangsläufig simpel sind. Der Anspruch und das Ziel dieser Schrift liegt hauptsächlich darin eine möglichst große Leserschaft zu erreichen und zu erfreuen und keineswegs eine weitere fachspezifische Schritt für ohnehin bereits vorgebildete Fachexperten zu schaffen.
Einleitung
Wir müssen nun gleich zu Beginn unserer Einleitung nüchtern den Tatsachen unseres eigenen 'Ichs' ins Gesicht blicken und feststellen, dass obgleich der Wunsch besteht zu erkennen, zu begreifen und zu vertiefen, uns unser eigenes 'Ich' doch auch allzuoft einen Streich zu spielen scheint, und uns in aller Regelmäßigkeit eben darum auch daran hindert uns selbst zu verstehen. Viel zu häufig verbleiben eben eigene Anteile des sogenannten 'Ichs' uns selbst verborgen und offenbaren sich lediglich im zwischenmenschlichen Austausch zu anderen Artgenossen, der dann dadurch auch allerdings viel zu häufig als negative Kritik und Geringschätzung wahrgenommen wird und demnach auch nicht annehmbar erscheint. Als erfahrene Experten in diesem Felde, gelingt es zwar Neurowissenschaftlern ein gewisses Maß an introspektiver Erkenntnis zu erlangen – eine Vermittlung dieser Erkenntnisse, bleibt dann allerdings im Dialog auch häufiger in der stark asymmetrischen Kommunikation mit Artgenossen stecken und mündet allzuoft wieder in eine schier endlosen Spirale von sogenannten Übertragungen und Gegenübertragungen. Wie können wir nun diesen zirkulär anmutenden Widerspruch lösen, der uns scheinbar daran hindert unser 'Selbst' zu ergründen und letztendlich auch zu verstehen?! Dies ist die Aufgabe und der Anspruch des vorliegenden Werkes – es soll als Wegweiser, auch nicht im Felde der Neurowissenschaften bewanderten Lesern, einen Einblick verschaffen und Möglichkeiten erschaffen, um ihr 'Selbst' besser zu ergründen. Dabei folgt die vorliegende Schrift einem strikten Rahmen und Pfad der Erkenntnisse, die hauptsächlich die empfundene Zeit als Anker einer introspektiven Erfahrung nutzt, um ein wenig Licht ins Dunkle unserer 'Selbst' zu bringen.
Zitat
– ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ –
– Erkenne Dich selbst –
– Know thyself –
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – Heraklit – Heraclitus
Grundsätzliche Betrachtungsweisen der Erkenntnis
Bevor wir nun unsere Reise beginnen und gemeinsam in die Tiefen unseres Selbst eintauchen, möchten wir einige grundlegende Betrachtungsweisen der Erkenntnis selbst etwas näher ergründen. Betrachten wir nämlich den Menschen als biologischen Organismus – ja als Säugetier, ganz strikt und streng nach seiner Morphologie und vollkommen losgelöst von seiner Kultur, so wird man bereits im Ansatz dieses Unterfangens recht schnell merken wie artifizell und unrealistisch dieser Versuch verbleiben würde. Um dieses Dilemma etwas näher zu verdeutlichen und die logischen Barrieren diesbezüglich zu erläutern, bedienen wir uns gerne gemeinsam einiger Gedankenexperimente und tauchen etwas tiefer in unsere biologische Entwicklungsgeschichte ein und befassen uns ebenfalls mit unserem kulturellen Werdegang. Wir können zwar sehr konkret unseren Körper beschreiben und auch beurteilen, bis hin zu recht präzisen Vorhersagen, die wir treffen können, dass zum Beispiel bei einem Reiz oder einem Stoß am linken Knie die nachfolgenden Nervenimpulse bis zum Rückenmark und am vermeintlichen Ende auf der kontralateralen Hirnrinde – dem sogenannten somatosensorischen Cortex in unserem Gehirn zu der bewussten Wahrnehmung führen, die uns entweder Schmerz fühlen lässt, falls der Stoß eine adequate Intensität übersteigt oder nur den taktilen Sinneseindruck, den wir dann als 'Druck' oder eben als 'Stoß' benennen, jedoch verbleiben solche Beschreibungen als recht triviale Versuche den Pfad neuronaler Aktivität zu kartieren eher didaktisch fade und künstlich losgelöste Versuche dem gesamten menschlichen Erleben Rechnung zu tragen. Ferner verliert sich die didaktische Präzision ohnehin in Anbetracht der stetig zunehmenden Konvergenz, die mit jeder weiteren neuronalen Verschaltung zunimmt. Versuchen wir hingegen der kulturellen Vergangenheit unserer eigenen jetzigen Existenz Rechnung zu tragen und im Rahmen unseres Gedankenexperiments mit zu berücksichtigen so wird zwangsweise die Frage aufkommen, welche Kultur und welche Kulturepoche wir denn, wie – mit zu berücksichtigen hätten?! Sollten wir unsere Kultur als Jäger und Sammler der Steinzeit, unsere Kultur als nicht sesshafte Nomaden oder eher nur unsere jüngere Kultur der Moderne berücksichtigen?! Diese schier unlösbar erscheinende erkenntnistheoretischen Fragen zwingen uns unweigerlich eine philosophische Perspektive einzunehmen und ebenfalls fordern und fördern sie weiterhin unsere Fähigkeit der retrospektiven Imagination.
Philosophische Betrachtungsweise
Kann der Akt der Selbsterkenntnis eigentlich jedem und immer gelingen?! Diese Frage ist recht einfach mit einem selbstbewussten – 'Nein' zu beantworten in Anbetracht von der nahezu unfertig erscheinenden Morphologie eines neugeborenen Menschenkindes. Aber auch für ausgereifte und bereits ausdifferenzierte Menschen im erwachsenen Alter ergibt sich unweigerlich die Antwort 'Nein', da wir alle im Zustand des Schlafes oder des Träumens keineswegs behaupten können zu wissen wer und was wir sind, da wir ohne Bewusstsein ein Erleben nur rückwirkend beurteilen und selten kohärente Zusammenhänge eines bewussten 'Ichs' empfinden und erinnern. Ferner ist vorab die Vorstellung über ein stabiles, greifbares 'Ich' und der Anspruch einer hinreichend zufriedenstellenden Beschreibung von stabiler Gestalt unrealistisch und äußerst irreführend, da wir einem hochgradig dynamischen Wechselspiel von Reizen, Bewegung, Erfahrung, Trieben und verschiedenen Aktivitätsniveaus unterliegen, welche uns eine Illusion eines 'Ichs' lediglich ermöglichen und keineswegs zwingend voraussetzen.
Bewusstsein – Erster Akt
Cogito ergo sum! Ich denke also bin ich! René Descartes
Nun hier beginnt unsere Reise nunmal – im Bewusstsein unserer 'Selbst' versuchen wir uns eben genau das bewusst zu machen was wir Mittels unserer sprachlichen Möglichkeiten eben 'Bewusstsein' nennen. Wir merken bereits auf Anhieb den zirkulären Charakter dieses Versuchs und mögen geneigt sein dieses Unterfangen als hoffnungslos abzutun und gegebenenfalls voreilig aufzugeben, jedoch ist dies nicht unsere Art und Weise an grundlegende Fragestellungen heranzugehen, um sie zufriedenstellend zu beantworten. Demnach können wir uns getrost zurücklehnen und uns vergegenwärtigen, dass wir uns erst am Beginn der Reise unserer Selbsterkenntnis befinden. Eine Reise, die hoffentlich voller beeindruckender erkenntnistheoretischer Erlebnisse und voller Wunder unseres Verstandes sich zeigen wird. Vorab möchte ich den geliebten Lesern nochmals ins Gedächtnis rufen, wie viele vermeintliche Fachexperten uns allen bereits, mittels kurzer prägnanter Phrasen uns vorgeprägt haben und den meisten von uns eine Illusion des Wissens und Verstehens im Geiste eingepflanzt haben. Mit Phrasen wie etwa – Der Thalamus, das Tor zum Bewusstsein, oder den eher pharmakologisch orientierten Experten, die manche Substanzen als 'bewustseinserweiternd' bezeichneten und andere wiederum, die eher dem esoterischen Spektrum sich angehörig fühlten, sprachen von der Astralreise unseres 'Selbst' und auch die Theologien in verschiedensten Akzentuierungen, suggerieren manch einem eine mehrdimensionale Existenz, die nicht nur biologische und demnach weltliche Form annehmen kann, sondern zugleich auch göttlichen oder spirituellen Charakter aufweist. Nun soll hier keineswegs eine Art Wertung aller bereits entstandener Weltanschauungen – ganz gleich, ob weltlich wissenschaftlicher, oder eben theistischer Natur, angestrebt werden – vielmehr soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein jeder eine von uns ein Resultat seiner eigenen vergangenen Biographie darstellt und demnach gefangen scheint in Weltanschauungen, Glaubenskonstrukten und einer Identität, die einem hinterherhinkendem 'Selbst' gleicht, welches nach Erkenntnis strebt, und in Anbetracht der schier unerschöpflichen Fülle an Erkenntnis und der sehr hohen Geschwindigkeit in der diese in unserer Moderne gewonnen wird, beinahe jeder an seinem Anspruch auf 'totaler Aufklärung' zum scheitern verurteilt scheint. Denn nicht ein Unvermögen des einzelnen Akteurs ist hier die Quelle des vermeintlichen Scheiterns, sondern die Illusion der Möglichkeit einer perfekten und allumfassenden 'Informiertheit' und der daraus entstehende unrealistische Anspruch einer permanenten und perfekten Aufklärung, untergräbt allzuoft und unnötigerweise ein selbstbewusstes 'Selbst' – welches uns allen abhanden zu geraten scheint. Nun ist es aber nahezu offensichtlich, dass innerhalb eines beliebigen menschlichen Kollektivs unserer Kulturepoche es dazu kommt, dass verschiedene Ausprägungen, Neigungen, Vorlieben, Stärken, Schwächen, Interessen, Sympathien und auch Antipathien zwischen den Akteuren dieses Kollektivs sich finden – ganz allgemein betrachtet verschiedene Charaktere mit verschiedenen Interessen und potentiellen Bindungen bzw. Abgrenzungstendenzen zu anderen Akteuren. Diese aus der Arbeitsteilung und der zivilisatorischen Realität entstandene Vielfalt und Variationsbreite menschlichen Wirkens führt zwangsläufig zu einem Kommunikationsdrang, der es allen Akteuren ermöglicht, trotz ihrer verschiedenen Spezialisierungen und ihrem eigenen, sich abzugrenzen versuchenden Charakter, an einem gemeinsam empfundenen Schaffensprozess teilzunehmen, der als stabile, friedliche und Schlussendlich auch als erfolgreiche Gesellschaftsordnung empfunden wird.
Der Weg des Lichts
– Und es werde Licht!
Folgen wir nun dieser physikalischen Größe – Licht, die ohnehin, selbst für Physiker vorab bereits sehr obskuren quantenphysikalischen Gesetzmäßigkeiten zu folgen scheint, die unter anderem durch den sogenannten 'Wellen-Teilchen Dualismus' beschrieben wurde und in Heisenbergs Unschärfe-Relation mündete und eine wahrscheinlichkeitstheoretische Beschreibung des Lichts notwendig machte, so mag es wiedermals als ein hoffnungsloses Unterfangen empfunden werden, den fortwährenden neuronalen Weg des Lichtes zu folgen zu versuchen. Doch auch hier kann ich uns beruhigen und unseren geliebten Lesern nochmals Mut zusprechen, denn alleine die Tatsache, dass sie gerade diese und noch folgende Zeilen lesen, bezeugt bereits die Fähigkeit des Lichtes unsere Welt und unser Dasein zu bereichern. Vorab möchte ich allerdings auch darauf aufmerksam machen, dass wir als Primaten der Gattung Homo Sapiens sehr stark sehlastige Wesen sind und dem Licht und der neuronalen Verarbeitung des Lichtes sehr große Aufmerksamkeit zuteil kommen wird im Verlauf unserer weiteren Reise durch unser 'Selbst'.
Der Weg des Schalls
Von der Scala Tympani zum Nervus Cochlearis– und das hörende 'Selbst'
Folgen wir nun der physikalischen Größe Schall, nachdem sie unser Trommelfell getroffen hat, so offenbart sich ein sehr eindrucksvolles Organ namens Cochlea (Siehe Kapitel: Cochlea). Dieses so filigrane Organ, welches auch gerne mal als Ohrschnecke bezeichnet wird und tatsächlich die Form einer Schnecke aufweist, ist – obwohl es zu den kleinsten unserer primären Sinnesorgane zählt, alles andere als einfach aufgebaut und erst recht nicht trivial oder gar als plump zu betrachten. Demnach kann auch keineswegs von einer intuitiven Zugänglichkeit seiner Funktionsweise ausgegangen werden, die uns eben das Erlebnis des Hö-rens ermöglicht. So scheint es beinahe mysteriös, dass obwohl wir imstande sind zu hören und alle Vorzüge des Hörens in aller Regelmäßigkeit genießen, unser Verständnis für die mechanischen, aber auch die dahinter nachgeschalteten neuronalen Prozesse uns in der Regel verborgen bleiben und erst nach jahrelangem Studium sich zu offenbaren vermögen. Versuche ich nun als Autor dieser Zeilen und in diesem Felde bereits vorgebildeter Akteur, die Prozesse in Worte zu fassen, die ein recht naiver Leser nun auch verstehen und genießen soll, so finde ich mich allzuoft in einem Dilemma wieder, das eine Wortlosigkeit zur Folge haben kann, da eben kaum diese – genau diese Worte zu finden wären, die den Leser auch zufriedenstellend zu bereichern im Stande sind. Wir merken nun wieder, dass wir uns scheinbar in einem zirkulären Widerspruch wiederfinden, der allerdings kein Grund darstellt hier nun unsere weitere Reise der Selbsterkenntnis frühzeitig aufzugeben. Ganz im Gegenteil spornt mich das persönlich erst richtig an, eine Schrift zu erschaffen, die eben auch all jene bereichert und erleuchtet, die noch nicht in den Genuss einer tiefgreifenden Bildung kamen.
Wahrnehmung
Der Wahrnehmungsprozess bei uns Menschen setzt sich zusammen als Summe aller unserer Sinnesorgane und der daraus resultierende Eindruck unserer 'Selbst' im Fluss der Zeit. Dabei sind die Modalitäten in Abhängigkeit der Dominanz des jeweiligen Sinnesorgans wie folgt in absteigender Reihenfolge, zusammenzufassen: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken, dem Sinn für Gleichgewicht und dem Vermögen Temperaturen zu empfinden, die im Rahmen der drittgenannten Modalität des Fühlens, eine gesonderte Sonderstellung einnimmt. So ebenfalls die Modalität – Schmerz, beide letztgenannten nehmen, so denn man denn will eine evolutionäre Sonderstellung im Rahmen unserer weiteren Betrachtung ein, da sie eben den Organismus vorab vor Schaden schützen sollen (z.B. Unterkühlung, Überhitzung, Verletzungen) und einen besonders starken Einfluss auf unsere Gemütslage ausüben und ebenfalls sehr stark die subjektiv empfundene Zeitwahrnehmung zu modulieten imstande sind.
Bewegung
– Panta Rhei – ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ
– Alles fließt immer – mit diesem antiken aber dennoch zeitlos anmutenden Aphorismus beginnen wir nun unser Kapitel der Bewegung. Denn, obwohl wir nun im jetzt geneigt sind zu glauben, einen momentanen Stillstand zu verkörpern, da wir uns in entspannter und zurückgelehnter Haltung uns gemeinsam versuchen unsere eigene Bewegung zu vergegenwärtigen, müssen wir auch hier gleich zu Beginn dieses Versuchs feststellen, dass aber eben trotzdem – alles immer fließt, seitdem wir sind. Ob unser Blut getrieben von unserem Herzschlag oder unsere Lungen, unsere Muskeln und alle internen Prozesse unseres 'Selbst', sind ständig in permanenter oszilierenden Bewegung. Ganz unabhängig von der externen Welt, die ja ebenfalls in ständiger Bewegung ist, ob die Erdrotation oder der Drift unserer Sonne im Arm unserer Galaxie und alle weiteren kosmischen Bewegungen, ständig und immer ist die Bewegung unser Begleiter. Nun scheint es für unseren Geist allerdings eher störend zu sein, so denn man denn geneigt ist zu versuchen in einer intensiven körperlichen Bewegung unseren Geist selbst in Bewegung zu setzen. Jeder eine von uns ist sich darüber im klaren, dass man ein gewisses Maß an körperliche Ruhe benötigt, um seine Gedanken effizient und zielführend zu einem Zustand zu bringen, der es uns ermöglicht effektiv eine erkenntnistheoretische Reise zu gehen, die dann auch erfüllend und bereichernd sich auswirkt. Niemand geht zum studieren in einen Dauerlauf oder versucht beim Gewichtheben tatsächlich neue geistige Erleuchtung zu erlangen – ebenfalls ist es noch niemanden ernsthaft gelungen im chaotisch anmutenden 'WirWar' eines Rummelplatzes einen erkenntnistheoretischen Durchbruch zu erlangen, obwohl so manche Anekdote gerne und häufiger so oder so ähnlich erzählt wird.
Wahrnehmung von Bewegung
Nachdem wir nun sehr eindrucksvoll unsere eigene Bewegung und jene unserer Umwelt kurz angerissen haben, kommen wir nun zu einer etwas unkonventionellen Betrachtungsweise von Bewegung, weil es bereits eine erste Ebene einer Abstraktion von Bewegung darstellt. Und mittels dieser vermeintlich abstrakteren Form – der Wahrnehmung von Bewegung gelangen wir bereits in unser 'Selbst'. So kennt vermutlich jeder eine von uns die Situation, in der wir alleine und recht konzentriert das Strömen eines Flusses, oder die im Wind flatternden Blätter eines Baumes beobachten. Oder wenn wir in den Himmel blicken und die wandernden Wolken beobachten. Ebenso kennen wir nahezu alle auch das Erlebnis, welches wir entwickeln beim Zuhören einer Melodie, einem Gespräch oder eben nur beim Lauschen der Geräusche in der freien Natur. Diese anfangs recht trivial erscheinende Beobachtungen von Bewegung sind hier als zaghafte Einzelbeispiele einzelner Sinne erwähnt, wie dem Sehen und dem Hören und passieren in der Regel gleichzeitig, und wir