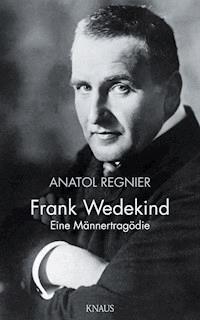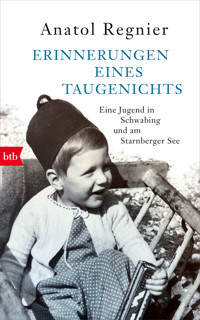Inhaltsverzeichnis
Widmung
I - Auf dem Dorf und in der Stadt
Kapitel 1 - Die Kammerers und Wedekinds
Kapitel 2 - Kein preußischer Untertan 1866-1872
Kapitel 3 - Ein Schloss in der Schweiz 1872-1880
Copyright
Für Carola und Adrianaim Andenken an Pamela und Kadidja
I
Auf dem Dorf und in der Stadt
Auf dem Dorf und in der Stadt Schnarchen alle Menschen hinter dichtgeschloßnen Fenstern; Und was Haus und Bett nicht hat, Dreht sich unterm Hochgericht mit fröhlichen Gespenstern!
FRANK WEDEKIND:«Chorus der Elendenkirchweih», aus König Nicolo, 1901
1
Die Kammerers und Wedekinds
Während Frau und Kinder noch schlafen und bevor der erste Arbeiter den Fabrikhof betritt, steht Jakob Friedrich Kammerer, der Großvater Frank Wedekinds, in Schlafrock und Schürze im Garten seines Hauses in Zürich-Riesbach und okuliert seine Rosen. Später schaut er nach den Feigenbüschen, Traubenspalieren und Gemüsebeeten, überprüft geharkte Kieswege und geht zum Gewächshaus, wo er Kakteen züchtet, deren Bedürfnisse er so genau kennt, dass ihn sogar studierte Botaniker um Rat fragen. Dabei hat er keine Schule besucht und sich Lesen und Schreiben selbst beigebracht. Was er kann und besitzt verdankt er seinem Lernwillen, seinem Geschäftssinn und seinem außerordentlichen Fleiß.
Sein Haus liegt auf einer Anhöhe mit Aussicht auf die Uetliberge und den Zürichsee. Im Obergeschoss wohnt die Familie, das Erdgeschoss beherbergt Fabriksäle, Comptoir, Laboratorium und Packstube sowie eine Art Küche zur Zubereitung der Zündmasse für die Schwefelhölzer, die Jakob Friedrich Kammerer als Erster in der Schweiz industriell herstellt. Es dampft und stinkt, und der Arbeiter, der die Masse mischt, singt revolutionäre Lieder, wohl wissend, dass sein Dienstherr sie gerne hört. Denn auch Jakob Friedrich Kammerer ist Revolutionär, hat wegen politischer Umtriebe im Gefängnis gesessen und das heimatliche Württemberg als politischer Flüchtling verlassen.
Geboren ist er, als zweitjüngstes von sieben Geschwistern, am 24. Februar 1796 in Ehningen bei Stuttgart, drei Jahre nach dem Tod jenes Herzogs Karl Eugen, der den jungen Schiller drangsalierte und den Dichter und Musiker Christian Friedrich Daniel Schubart auf dem Hohen Asperg schmachten ließ, und unweit der Stadt Tübingen, wo Schiller, Hegel, Schelling und Hölderlin studierten. Jakob Friedrich Kammerer erfährt solche Förderung nicht. Sein Vater, ein Siebmacher, schickt ihn als Hausierer über Land. Der Knabe sammelt, was er an bedrucktem Papier findet, entziffert die Buchstaben und deren Sinn. Später lernt er Latein und Griechisch und studiert Chemie, alles im Selbstunterricht. Er übernimmt die väterliche Siebmacherei, pachtet eine Gastwirtschaft, gründet eine Hutfabrik und vertreibt Mostpresstücher und wasserdichte Stiefel aus Gummielastikum. Er nennt sich Königlich Württembergischer Patenthutfabrikant, aber ist längst nicht zufrieden. Wo ist die Tat, die ihn reich und berühmt machen kann?
Die umständlichen, schlecht funktionierenden Feuerzeuge aus Stahl, Feuerstein und Zunder geraten in sein Blickfeld - wer hier Neues vorlegt, ist eines großen Marktes sicher. Im Schuppen seines Hauses experimentiert Kammerer, bis ihm eine Masse aus Phosphor, Schwefel und Sauerstoff spendendem Kaliumchlorat gelingt, die, am Ende eines Spans getrocknet, durch Reiben Feuer fängt. Ob er, wie oft behauptet wird, tatsächlich das Phosphorzündholz erfunden hat, ist umstritten, dass er Entscheidendes zu seiner Entwicklung beitrug, steht außer Frage. Man schreibt das Jahr 1832, Jakob Friedrich Kammerer ist sechsunddreißig Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet, mit vier Söhnen aus erster und einem aus zweiter Ehe. In Frankreich regiert der«Bürgerkönig»Louis Philippe, in Deutschland fordert das Volk Souveränität beim Hambacher Fest. Kammerer, der Nachteile niederer Geburt bewusst, schließt sich einer Verschwörergruppe an.
Im Juli 1833 wird er verhaftet. Der Vorwurf: versuchter Sturz der württembergischen Regierung. Caroline, seine zweite Frau, verbrennt belastendes Schriftmaterial, als die Häscher bereits im Haus sind. Das verunstaltet ihre Hände, aber bewahrt ihren Mann nicht vor der Untersuchungshaft auf dem Hohen Asperg. Dort erleidet Kammerer einen Blutsturz, führt jedoch seine chemischen Studien fort.
Kammerers Element ist das Feuer. Kaum entlassen, gründet er in Ludwigsburg eine Streichholzfabrik, gegen den Willen seiner Nachbarn, die von Gezündel und Explosionen nichts wissen wollen. Kurze Zeit später verbrennt der Dachstuhl seines Hauses. Kammerer kauft ein neues Haus und erweitert seine Fabrik auf vierundzwanzig Arbeiter und sechshundert Zündholzkistchen täglich, die ein Nürnberger Versandhaus bis nach Schweden und Nordafrika vertreibt. Im Februar 1836 wird er wegen intellektueller Beihilfe zum versuchten Hochverrat angeklagt. Zwei Jahre Festungshaft drohen. Kammerer flieht nach Straßburg und zieht, als ihm die Herstellung von Zündhölzern verweigert wird, nach Zürich, wo er außerhalb der Stadt eine Zündholzfabrik bauen darf, die erste ihrer Art in der Schweiz.
Auch diese geht in Flammen auf. Während die Feuerwehr noch löscht und ehe die Nachricht von der Katastrophe sich verbreitet, kauft Kammerer von einem Bauern das Land für seine jetzige Fabrik. Emilie Kammerer, sein drittes Kind aus zweiter Ehe und Mutter Frank Wedekinds, geboren am 8. Mai 1840, wird in der Wiege aus dem Obergeschoss des brennenden Hauses herabgelassen - ein Umstand, den sie später stets mit Stolz erwähnt. Am Ende ihres Lebens verfasst sie einen Bericht über ihre ungewöhnliche Jugend.
Emilie Kammerer liebt ihren Vater. Er ist für sie der vollkommenste Mensch. Was er anfasst, gelingt. Er ist pünktlich auf die Minute und nie in Eile. Seine Angestellten lieben und verehren ihn. Sonntagabends spielt er für sie zum Tanz, auf einem selbst gebauten Tafelklavier, unerschütterlich taktfest und mit nie versiegendem Melodienreichtum. Seiner Autorität, glaubt Emilie, gehorcht sogar die Natur: Auf seinen Zuruf kommen die Tauben aus ihrem Schlag, um ihm zu gefallen, kriecht die Schildkröte im Frühjahr pünktlich aus ihrem Erdloch, und die von ihm gezüchteten Rosen bringen ihm zu Ehren (und zum Staunen der Passanten) immer wieder verschiedenfarbene Blüten auf ein und demselben Stamm hervor. Seine Fabrik ist für Emilie ein feuriges Wunderwerk. Sie liebt es, die Angestellten auf ihrem abendlichen Kontrollgang zu begleiten, und sieht mit wohligem Schauer das an Tischen und Böden haftende Phosphor bläulich leuchten und flammengleich blitzen. Vor dem Einschlafen lauscht sie den Klängen der Äolsharfe, die ihr Vater gebaut hat und die unter dem Dach beim leisesten Wind zu singen beginnt.
Dass Jakob Friedrich Kammerer auch cholerisch sein kann, verschweigt Emilie nicht, zumal sie sein hitziges Temperament geerbt hat: Als die Katze von Netti, der Frau ihres Halbbruders Hermann, ihr sorgsam gehegtes Gemüsebeet verwüstet, ergreift sie das Tier beim Schwanz und schlägt es mit solcher Wucht gegen den steinernen Brunnenrand, dass es tot zu Boden fällt. Erwachsene fragen sich, woher ein fünfjähriges Mädchen solche Körperkraft nimmt.
Kurz darauf stirbt ihre Mutter, neununddreißig Jahre alt. Emilie sieht sie aufgebahrt, gelb im Gesicht, die Haare abgeschnitten, eine mit Gewürznelken besteckte Pomeranze in den brandnarbigen Händen, und beobachtet aus der Bodenluke, wie Fabrikarbeiter den Sarg hinaustragen und Trauergäste dem Vater die Hand drücken.
Ein paar Monate nach dem Tod der Mutter hört Emilie beim Nachhausekommen Lärm im Treppenhaus. Ihr Vater steht ihrem Halbbruder Wilhelm gegenüber, beide mit hochrotem Kopf. Der Grund: Wilhelm will Hanne heiraten, ein hübsches Schwabenmädchen, das während der Krankheit von Emilies Mutter den Haushalt besorgen half, aber hat soeben erfahren, dass sein Vater sie für sich beansprucht, selbst heiraten will und ihre Zustimmung bereits erhalten hat. Wilhelm droht, Hanne zu erstechen und seinen Vater umzubringen. Seine Brüder bändigen ihn. Er reist noch in der Nacht ab und ergibt sich dem Alkohol. Jakob Friedrich Kammerer aber heiratet Hanne. Er ist stolz auf sie und zeigt sie überall herum. Es ist der Höhepunkt seines Lebens.
Jeden Sonntag gibt es Ausflüge, und alle dürfen mitkommen. Man fährt auf der Limmat nach Baden oder mit dem Dampfschiff auf dem Zürichsee. Wirte öffnen Tore und Keller, wenn Kammerer an der Spitze fröhlicher Menschen ihr Lokal betritt, und sagen nichts, wenn die Kinder seines Gefolges Schaukeln und Spielgeräte besetzen. Neidvolle Blicke streifen die Toiletten seiner Damen, aber die Stimmung ist gut. Überall, wo Vater hinkam, brachte er seine schwäbische Gemüthlichkeit und Fröhlichkeitmit, erinnert sich Emilie, deshalb wurde er auch von Alt und Jung so geliebt und gefeiert.
Jakob Friedrich Kammerer, Zündholzfabrikant und Großvater Frank Wedekinds
In Deutschland scheitert die«Märzrevolution». Aufständische fliehen in die Schweiz, unter ihnen der Dichter Georg Herwegh, und finden Unterschlupf in Kammerers Haus. Kammerer bewirtet sie an langen Tafeln, versorgt sie mit Kleidung und Schuhwerk, verschafft ihnen Arbeit. Sie ehren ihn mit einem Fackelzug und rufen:«Kammerer lebe hoch!»Seine Frau gebiert einen Sohn, den er als überzeugter Republikaner Liberatus Germanus Konstantinus nennt.
Aber seine Geschäfte gehen schlecht. Die Zündholzidee hat viele Nachahmer; in Ludwigsburg hat ein Verwandter ein Konkurrenzunternehmen eröffnet. Kammerer wird mürrisch. Eifersüchtig überwacht er seine Frau, bezichtigt sie der Untreue und wird wütend, wenn sie sich verteidigt. Er spricht undeutlich, vernachlässigt Kleidung und Hygiene, gibt wunderliche Aufträge. Seine Schrift wird nahezu unleserlich, seine Arbeiter können ihm nichts mehr recht machen. Emilie sieht traurige und verängstigte Gesichter, Weihnachten geht man nach der Bescherung wortlos auseinander.
Im Frühjahr 1853, Emilie ist zwölf Jahre alt, wird Jakob Friedrich Kammerer wahnsinnig. Eine schwere Eisenstange in den Händen, droht er, seine Frau im Bett zu erschlagen. Man schafft ihn nach Württemberg in eine Irrenanstalt, wo ihn Ärzte als nicht behandelbar ablehnen. Ein Ludwigsburger Arzt lässt ihn bei sich wohnen. Seine Söhne führen die Fabrik weiter. Jakob Friedrich Kammerer hat, könnte man sagen, das Feuer zu bändigen versucht und ist an der eigenen Leidenschaft verbrannt. Die Theorie, die in seiner jungen Frau das Urbild von Wedekinds Lulu sieht, ist immerhin bedenkenswert.
Der Name Wedekind, früher Widukind, ist seit dem achten Jahrhundert bekannt und bedeutet im Althochdeutschen Waldkind. Ein gewisser Johann Wedekind, geboren 1278, war Geheimschreiber bei Herzog Otto dem Strengen von Braunschweig, der ihm in Horst bei Hannover ein Gut schenkte, das bis heute Familiensitz ist. Die Wedekinds sind Soldaten, gelegentlich Mönche, meist aber Beamte: Zahlmeister, Rentmeister, Amtmänner, Kontributionseinnehmer, Pagenhofmeister oder Kondukteure herzoglicher Vorwerke. Auch Juristen und Mediziner sind dabei, Künstler keine. Ein Scipio Wedekind fällt 1431 in einem Scharmützel gegen die Türken, ein Johann Heinrich Wedekind geht 1740 nach Ostindien, sonst aber bleiben die Wedekinds, wo sie herkamen: im flachen Land zwischen Braunschweig, Hannover und Hamburg, in Wolfenbüttel, Hildesheim, Hoya, Süllfeld, Elsdorf oder Visselhövede. Die Wedekinds sind Protestanten, Mischehen oder sonstige Glaubensverwirrungen sind so gut wie unbekannt. Das Familienwappen zeigt einen Stern auf blauem Grund und einen zunehmenden Halbmond. Der Familienwahlspruch«Nil diferre»(Nichts aufschieben) stammt von Anton Christian Wedekind, einem Lüneburger Oberamtmann, der um 1790 eine gute Tat ungebührlich lang hinauszögerte und sein Versäumnis mit einer«Stiftung für deutsche Geschichte»und einem Legat von hundertfünfzig Goldmark an den«Wedekind-Familien-Fond»sühnte. Sein Neffe Friedrich Wilhelm Wedekind, der Vater Frank Wedekinds, am 21. Februar 1816 in Herste bei Göttingen geboren, schlägt ein wenig aus der Art. Er geht gern ins Theater, schreibt Gedichte und sympathisiert mit politischen Strömungen, denen seine Verwandten wenig Gutes nachsagen. Als Medizinstudent der Göttinger Universität erhält er vierzehn Tage Karzer wegen«Beleidigung des Hannoverschen Militärs». Ein Feuerkopf ist Friedrich Wilhelm Wedekind deswegen nicht. Ein Bildnis des Dreißigjährigen zeigt weiche Gesichtszüge, einen sinnlichen Mund und gutmütige, leicht verträumt blickende Augen. Seine beruflichen Wünsche sind weitreichend, aber utopisch, sein Werdegang ist sprunghaft: Nach seiner Promotion zum Doctor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe will er eine orthopädische Heilanstalt auf Spiekeroog gründen und erbittet die Schenkung eines Teils der Insel. Nach der kaum überraschenden Ablehnung durch die Behörden lässt er sich als praktischer Arzt in Aurich nieder. Das befriedigt ihn so wenig, dass er nach Konstantinopel reist, dort angeblich türkischer Bergwerksarzt wird und auf Expeditionen bis zum Euphrat und Tigris vordringt. Zeugnisse seines dortigen Wirkens gibt es nicht, wohl aber ein lebenslanges Interesse an orientalischen Waffen, Münzen und anderen vermeintlichen Kostbarkeiten, die er, obschon als Historiker und Kunstkenner ohne Ausbildung, mit Begeisterung sammelt. In Finanzdingen ist er tüchtig: Nach seiner Rückkehr aus dem Orient leistet er sich eine ausgedehnte Ruhepause in Paris, von selbstverdientem Geld wie es scheint, denn ein nennenswertes Familienvermögen ist nicht bekannt.
Die Revolution von 1848 findet ihn auf der Seite des Volks. Er debattiert mit Lust und Geschick und wird im ostfriesischen Esens als Ersatzmann ins Hannoversche Ständehaus gewählt. Auch das genügt ihm nicht. Während die Frankfurter Nationalversammlung um eine Neugestaltung Deutschlands ringt, wandert Friedrich Wilhelm Wedekind nach Amerika aus, genauer gesagt nach Kalifornien, das gerade einen Goldrausch erlebt und wo Risiken und Chancen am höchsten sind.
In San Francisco eröffnet er eine Praxis als Arzt und Gynäkologe, dem Vernehmen nach in einer mit Blech verstärkten Holzhütte, aber kommt rasch voran. In der Goldgräberstadt steigen die Grundstückspreise rasant, und wer sich aufs Spekulieren versteht, kann viel Geld verdienen. Dr. Wedekind besitzt bald ein prächtiges Haus, arbeitet nur noch gelegentlich und wird Präsident des Deutschen Clubs. Zum hundertsten Geburtstag Friedrich Schillers gibt er ein Gartenfest mit angeblich dreitausend Teilnehmern und trägt eine vielstrophige, selbstgedichtete Ode vor - endlich hat Dr. Wedekind eine Stellung erklommen, die seinen Vorstellungen entspricht, wenn auch nur unter den Exildeutschen von San Francisco. Seine Sympathie gilt jetzt den Besitzenden: Er beteiligt sich an einer Bürgerwehr, die gegen marodierende Banden und anderes Gelichter vorgeht. Im Land der Freiheit ist das eine bürgerliche Tugend.
In der Liebe fehlt ihm das Glück. Frauen sind Mangelware in San Francisco, aber dass ein wohlhabender, kultivierter Europäer keine finden sollte, mutet seltsam an. Wie dem auch sei: Dr. Wedekind, die vierzig überschritten, findet keine und gilt in seinen Kreisen schon fast als Hagestolz.
Emilie Kammerer führt im vaterlosen Haus ein Schattendasein. Die Schule hat sie mit vierzehn Jahren verlassen, jetzt lernt sie Nähen und Kochen, um irgendwann, wie man hofft, geheiratet zu werden. Ihre sechs Jahre ältere Schwester Sofie hingegen hat den Heiratsantrag eines Juristen ausgeschlagen und in Mailand Gesang studiert, war an der Oper in Zagreb engagiert und ist jetzt, man staune, Primadonna an der kaiserlichen Hofoper in Wien. Ihr Vorschlag, Emilie zu sich zu nehmen, kommt der Familie wie gerufen. Auch Emilie ist begierig, die Welt kennenzulernen.
Ein Bruder bringt sie hin. Der Glanz der Kaiserstadt blendet Emilie. Sofie hat eine Vierzimmerwohnung mit Diener und Köchin. Zu Proben und Aufführungen holt sie ein Hoflakai in der Equipage ab. Es gibt ungeahnte Köstlichkeiten zu essen, Sofie kauft ihr Hüte, Mantillen und Handschuhe - an der Hofoper sind Garderobe und Aussehen mindestens ebenso wichtig wie Stimme und Schauspielkunst, und ein hässliches Entlein als Schwester würde Sofies Ruf schaden.
Irgendwann erkennt Sofie: Die Sängerinnen sind Freiwild für die Höflinge. Fast jede von ihnen hat einen«Protektor»und braucht ihn auch, nicht zuletzt, um die Kosten für die Garderobe zu decken. Je höher seine Stellung, desto größer ihr eigenes Ansehen. Als der Lakai eines Erzherzogs Sofie einen Blumenkorb überbringt, mit der Bitte seines Herrn, sie besuchen zu dürfen, weiß sie, was die Stunde geschlagen hat. Ihre Köchin gratuliert ihr zu ihrer Aquisition, Sofie selbst, nach Erziehung und Naturell unabhängige Schweizerin, ist schockiert und will Wien verlassen.
Familie und Freunde beschwören sie, ihr Glück nicht von sich zu stoßen. Ein Hofkapellmeister warnt: Ein solcher Schritt bedeute das unweigerliche Ende ihrer Karriere. Aber Sofie lässt sich nicht umstimmen und reist, Emilie im Schlepptau, über Triest und Venedig nach Nizza, wo man sie engagiert und erste Rollen singen lässt. Emilie hat nichts zu tun, schaut aufs Meer und isst Schokolade. Emilie ist gefräßig und faul, notiert Sofie und beschließt, die Schwester so bald wie möglich in die Schweiz zurückzubringen.
Ein junger Mann heftet sich an Sofies Fersen: Theodor Amie-Gazan de la Pérrière, französischer Offizierssohn, angeblich aus altem Adel. Obwohl sie erklärt, ihn nicht zu lieben, lässt er sich nicht abschütteln, und als sie mit Emilie in Mailand die Postkutsche in Richtung Gotthardt besteigt, sitzt er auf dem freien Platz, den er heimlich reservieren ließ. Emilie ist wütend, Sofie von so viel Beharrlichkeit gerührt.
In Zürich überschüttet Amie-Gazan Sofie mit Geschenken und droht, sich im Fall einer Ablehnung umzubringen; dem Gerücht, Millionär zu sein, tritt er nicht entgegen. Sofies Familie redet ihr auf das Bestimmteste zu, Fremde gratulieren zu ihrer fabelhaften Partie. Sofie heiratet Amie-Gazan und reist mit ihm nach Peru, wo er ein Fotoatelier zu eröffnen und französische Luxusartikel zu verkaufen gedenkt. Eine Tochter wird geboren und erhält den Namen Leonie.
Emilie vermisst ihre Schwester. Das gemeinsame Zimmer, das sie nun allein bewohnt, wird ihr zu einer Art Schrein, den außer ihr niemand betreten darf. Um Sofie nah zu sein, nimmt sie ihrerseits Gesangsunterricht und entdeckt, dass auch sie eine gute Stimme hat. Bei Auftritten des Singvereins erhält sie kleine Soli, die sie immer besser meistert.
Im Frühjahr 1857 kommt ein Brief Sofies, in dem sie Emilie zu sich einlädt; fünftausend Franc Reisegeld seien unterwegs. Emilie ist hocherfreut, auch die Familie stimmt zu - das Risiko, ein siebzehnjähriges Mädchen allein über den Ozean zu lassen, wird verdrängt oder gar nicht erst bedacht. Als das Reisegeld nicht eintrifft, beschließt man, es vorzustrecken, und bucht eine Passage. Auf dem Weg nach Le Havre besucht Emilie ihren Vater in Ludwigsburg. Er erkennt sie nicht und stirbt ein paar Monate später, einundsechzig Jahre alt. Seine Heimatstadt Ehningen wird ihm ein Bronzedenkmal setzen und eine Schule nach ihm benennen.
An Bord des Dreimasters«Alma»ist Emilie die einzige Frau - wer dies nach ihrer Ankunft erfährt, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und bittet, nicht darüber zu reden: So viel sträflicher Leichtsinn werfe ein schlechtes Licht auf ihre Familie. Emilie selbst ist nicht beunruhigt. Sie hält ihre Kajüte sauber und erledigt jeden Tag ein Pensum Näharbeit. Der Kapitän und die Mitreisenden sind freundlich, mit den Matrosen zu sprechen ist den Passagieren nicht erlaubt.
Am Kap Hoorn wird es kalt. Emilie hat nur Sommersachen dabei, denn in der Schweiz war man der Meinung, dass es, je südlicher man käme, immer wärmer würde. Taue frieren ein, das Deck vereist. Ein Zusammenstoß der«Alma»mit einem Dampfschiff im Schneegestöber wird knapp vermieden. Passagiere schlafen im Salon in der Nähe des Ofens. Dort hat Emilie einen Albtraum: Ihr ist, als erdrücke sie ein schweres Gewicht, und als sie mit einem Schrei erwacht, entfernt sich ein Schatten in die Dunkelheit. Seitdem schläft sie auch beim ärgsten Sturm in ihrer Kabine. Dann bessert sich das Wetter. Vogelzüge grüßen, die«Alma»gleitet dahin und erreicht nach hundertundein Tagen ununterbrochener Seereise im Oktober 1857 Valparaiso.
Am Kai wartet niemand. Irgendwann erscheint Amie-Gazan, weißhaarig und dünn. Sofie liegt krank in einem Hotelzimmer, eine schwarze Amme hält die kleine Leonie. Amie-Gazan hat den Zoll für die von ihm importierten Waren nicht bezahlen können, musste sein Fotoatelier schließen und hat das Geld, das Sofie mit Opernaufführungen für einen belgischen Impresario verdiente, immer wieder verspielt. Die fünftausend Franc Reisegeld wurden nie abgeschickt.
Emilie nimmt die Herausforderung an. Sie veranstaltet einen Großputz, quartiert die Amme aus, pflegt und kleidet die Nichte. Mit Sofie plant sie gemeinsame Konzerte und stellt ein Repertoire zusammen. Die Schwestern üben Duette aus«Norma»,«Lucrezia»und der«Regimentstochter», schneidern Kostüme, malen Plakate, engagieren Musiker und einen Kapellmeister, der vom Pianino aus dirigiert. Die tapferen jungen Frauen lösen eine Welle von Sympathie aus, die Eintrittskarten sind schnell verkauft. Sofies Stimme ist so schön wie früher, auch Emilie macht ihre Sache gut. Es regnet Blumen und Kränze. Aber Amie-Gazan, der das Geld verwaltet, verspielt es in hoffnungsloser Leidenschaft. Die Polizei nimmt ihn fest.
Die Schwestern planen eine Konzertreise entlang der Pazifikküste nach Norden. Ein Pianist, der auch Saxofon spielt, schließt sich ihnen an; die kleine Leonie nehmen sie mit. Von La Serena geht es über Tacna, Copiapo und Caldera nach Iquique und Arequipa. Eine ansehnliche Summe von Zwanzigdollarmünzen ist gespart, aber irgendwann taucht Amie-Gazan wieder auf, und gleich am ersten Abend fehlt Sofies Bühnenschmuck. Die Schwestern wollen nach Kalifornien, aber das Schiff, das sie nach Guatemala bringen soll, läuft auf eine Sandbank und muss umkehren. In Panama, dem berüchtigten Seuchennest, stecken sie vierzehn Tage lang fest. Ihr Geld ist aufgebraucht.
Bei einem Konzert in der französischen Botschaft von Panama wird Sofie auf der Bühne ohnmächtig. Ein Arzt konstatiert Herzschwäche und verordnet Ruhe. Endlich kommt der Postdampfer. Da lag der Coloss! Schwarz angestrichen wie ein Riesensarg. Sein düsterer Anblick machte uns traurig und muthlos. Ich durfte meine Schwester nicht ansehen. Entsetzlich schmal war ihr liebliches Gesicht geworden. Sie starrte nach dem unheimlichen Schiff mit einem Ausdruck der Angst, als ob sie ahnte, welches Los ihr dort bevorstand.
Schiffsgeruch und Ausdünstung der Passagiere erzeugen Übelkeit in Sofie. Emilie bemerkt einen gelblichen Schimmer auf ihrer Haut. Amie-Gazan beschwört sie, es niemandem zu sagen; ein Schiffsarzt, der Sofie untersuchen soll, öffnet die Kajütentür nur einen Spaltbreit und hält sich ein Tuch vor den Mund. Eine Wärterin sagt zu Emilie:«Ihre Schwester hat das Gelbe Fieber, und Sie werden es auch bekommen.»Sofie Kammerer stirbt in der Nacht vor Heiligabend 1858, vierundzwanzig Jahre alt. Die Schiffsmotoren halten, ein Schuss ertönt, die Leiche gleitet ins Wasser. Man sperrt Emilie in ihre Kabine und schiebt Essen durch eine Luke. Bei der Ankunft in San Francisco lässt man sie erst heraus, als alle Passagiere von Bord sind.
Der Geist des freien Amerika tut Emilie gut. Sie mietet ein Zimmer in einem der schnell gebauten Holzhäuser für sich, Amie-Gazan und die kleine Leonie, unterteilt es durch Vorhänge in ein Wohnquartier und sucht Arbeit. Ein deutscher Männerchor engagiert sie und zahlt ihr auf einen Schlag einhundertachtzig Dollar, eine Kirche bietet ihr eine Stellung als Altistin an. Amie-Gazan will seine Tochter zu Verwandten nach Frankreich schaffen, Bekannte sollen sie hinbringen. Emilie deckt die Kosten der Überfahrt durch ein Benefizkonzert und bricht die Beziehung zu ihrem Schwager ab. Sie singt in San Franciscos Deutschem Theater und in englischen und italienischen Ensembles, reist für Gastspiele nach Sacramento, Marysville und San José und macht auch als Schauspielerin eine gute Figur. Und seitdem ich den Beifall - im Gegensatz zu früher, wo ich neben meiner Schwester nicht in Betracht kam - auf mich beziehen durfte, fand ich hohe Befriedigung in meinem Beruf.
Ein Jahr nach ihrer Ankunft verliebt sich Emilie in einen deutschen Sänger. Die Hochzeit ist beschlossen, aber der Bräutigam macht einen Rückzieher. Emilie leidet erheblich, und als ein gewisser Herr Schwegerle, ein ältlicher ehemaliger Opernsänger, jetzt Schankwirt und Hilfsdirigent am Deutschen Theater, um ihre Hand bittet, gibt sie ihm das Jawort, gegen den Rat zahlreicher Freunde, die ihr eine bessere Partie zutrauen. Emilie beschreibt ihren Mann als ruhig, ein wenig undurchsichtig und nicht sonderlich sauber; in der von ihm geführten Gastwirtschaft isst sie nur mit Widerwillen. Aber er hilft ihr bei der Einstudierung von Rollen und ist, bei seltener Anwesenheit zu Hause, gut zu haben. An Wochenenden unternehmen sie gemeinsame Ausflüge.
Indessen hat ein anderer Mann ein Auge auf sie geworfen: Dr. Friedrich Wilhelm Wedekind, Präsident des Deutschen Clubs und geachtetes Mitglied in San Franciscos Emigrantengemeinde. Emilie hat ihn wegen rheumatischer Schmerzen konsultiert, seitdem bestimmt sie sein Denken und Wollen. Aber anstatt offen um sie zu werben, entwirft er eine heimliche und komplizierte Annäherungsstrategie.
Er wird Stammgast bei dem Mittagstisch der Pension, in der Emilie mit Schwegerle wohnt, und sitzt ihr bei abendlichem Kartenspiel nach Möglichkeit gegenüber. Unter dem Vorwand, ein Kostümbuch leihen zu wollen, besucht er sie auf ihrem Zimmer und bleibt, wie aus Versehen, fast eine Stunde. Bei einem Neujahrsessen hat er ein französisches Liederbuch für sie dabei, aber traut sich nicht, es ihr zu überreichen. Ein mit ihrem Namen graviertes Lorgnon trägt er tagelang mit sich herum. Den Fortgang seiner Bemühungen notiert er in einem speziell hierfür angelegten«Journal Intime», auf Französisch, der Sprache der Liebe und der Diskretion. Emilie erscheint dort nur als«E», Schwegerle als«er».
Dr. Wedekind umschleicht Emilie wie ein Jäger das Wild. Sein Eindruck ist nicht immer positiv: Emilie kann auch ungebärdig sein. Bei einem Maskenball fuchtelt sie den Damen mit ihrem Federwisch um den Kopf, so dass diese um ihre Frisuren bangen. Wie würde sie, sollte es je dazu kommen, als seine Ehefrau wirken? Würde sie ihn gebührend achten und respektieren?
Schwierig wird es, als Emilie in Tuckers Hall singen will, einem«Melodeon»oder Tingeltangel, in dem Mädchen verschiedener Nationalitäten auftreten. Emilie findet nichts dabei, aber San Franciscos deutsche Kolonie ist entrüstet. Dr. Wedekind befürchtet, ihretwegen gesellschaftlich kompromittiert zu werden. Als man im Deutschen Club negativ über sie spricht, stellt er sich schlafend, um nicht Stellung beziehen zu müssen. Mehrmals steht er vor dem Eingang von Tuckers Hall, aber wagt nicht einzutreten. Er redet Emilie ins Gewissen, als väterlicher Freund und Ratgeber, aber sie will nicht hören, und Dr. Wedekind konstatiert bei ihr une certaine froideur de cœur, eine gewisse Herzenskälte. Um seine Leidenschaft für sie abzutöten, unternimmt er entbehrungsreiche Ritte ins Landesinnere von Kalifornien und ist fast schon dabei, sie zu vergessen, als eine unerwartete Wendung eintritt.
Bei Emilie erscheint ein Gerichtsvollzieher mit einem Pfändungsbeschluss und lässt ihr frisch abbezahltes Klavier kurzerhand hinaustragen. Emilie erfährt, dass ihr Mann vor der Ehe Schulden solchen Ausmaßes angehäuft hat, dass Klavier, Hausrat, das beiderseitige Ersparte und ein mehrfacher Jahresverdienst von Tuckers Hall nötig wären, sie zu begleichen. Eine namenlose Angst überfiel mich. Scham und Ekel vor mir selber. Ärmer als eine Bettlerin, sollte mir nichts mehr gehören, nicht einmal die Früchte meiner Arbeit! Nein, nein und tausendmal nein!! Dagegen bäumte sich mein ganzes Wesen auf. Es gab nur Eines: die Scheidung. Um die Gerichtskosten zu bestreiten, verkauft sie Sofies seidene Kleider. Im Varieté will sie als alleinstehende Frau nicht singen, ein Klavier zum Einüben von Opernpartien hat sie nicht mehr. Sie bezieht ein möbliertes Zimmer und näht in Hausarbeit für einen Schneider.
Jetzt endlich gesteht ihr Dr. Wedekind seine Liebe. Die Nachricht ihrer Trennung von Schwegerle sei ihm wie ein Wunder vorgekommen, und sein einziger Wunsch sei es, sie als Frau heimzuführen. Dann setzt er ihr, mit einer gewissen trockenen Geschäftsmäßigkeit, seine Verhältnisse auseinander. Er bittet sie, sein Angebot zu überdenken, denn eines müsse klar sein: Eine Tätigkeit im Theater sei für seine Ehefrau ausgeschlossen. Sollte Emilie der Bühne nicht entsagen können, sei er bereit, ihr eine Gesangsausbildung in Deutschland zu finanzieren. Tiefbewegt und andächtig hatte ich zugehört. Die Nachwirkungen all des durchkämpften Elends und die Vorstellung, die Frau dieses bedeutenden und vornehmen Mannes zu werden, von ihm treu und aufrichtig geliebt, an seiner Seite für immer den Härten des Lebens entzogen zu sein, überwältigte mich so gewaltig, dass ich, keines Wortes mächtig und weinend, ihm meine Hand reichte, die er erfasste und an sich zog, um mich mit seinen Küssen fast zu ersticken.
Dr. Wedekind notiert: Alea iacta est. Die Würfel sind gefallen. Wir sind einig. Wir werden uns niemals trennen, wir werden immer beisammen bleiben und ganz Eines für das Andere leben. Mein Glück läßt mich beinahe zittern.
Emilie Kammerer und Dr. Friedrich Wilhelm Wedekind heiraten am 26. März 1862 in Oakland - die Anfeindungen der deutschen Kolonie San Franciscos wegen seiner Verbindung zu einer Sängerin zweifelhaften Rufs waren so heftig, dass er auf die andere Seite des Sacramento River gezogen ist. Die Braut ist einundzwanzig, der Bräutigam sechsundvierzig Jahre alt. Beide sind entschlossen, Amerika zu verlassen. Dr. Wedekind wählt Hannover als künftigen Wohnort, wo seine Mutter lebt und er sein medizinisches Staatsexamen gemacht hat. Am 29. Januar 1863 kommt in Oakland der Sohn Armin Francis zur Welt.
Bei der Rückreise nach Europa ist Emilie hochschwanger. Wenige Wochen nach der Ankunft wird am 24. Juli 1864 in der Großen Aegidienstraße 13 in Hannover Benjamin Franklin Wedekind geboren, der spätere Dichter. Es ist Sonntag, der Vater entbindet persönlich. Der Wetterbericht meldet: Früh sternhell, darnach sonnig und warm. Nachmittags Cirrostratus und Cumulus, langsam und mit Dunst umgeben, ohne Regen, Luft still. Abends allgemeine Nebelausbreitung.
2
Kein preußischer Untertan 1866-1872
Dr. Wedekind ist unzufrieden. Er hat Rentier Henckell, seinem Vermieter, das Haus Weißekreuzstraße 6 abgekauft, in das er kurz nach Franklins Geburt mit seiner Familie gezogen ist, jetzt will die Stadtverwaltung ihn zwingen, das hannoversche Bürgerrecht zu erwerben - wer in der Stadt Haus oder Grund besitze, sei dazu verpflichtet und müsse den Bürgereid leisten.
Genau das will Dr. Wedekind nicht. Denn mit dem Eid auf Hannover würde er auch Preußen die Treue schwören, das Hannover im«Deutschen Krieg»besiegt und vom Königreich zur preußischen Provinz herabgestuft hat. Als preußischer Untertan müssten seine Söhne ins preußische Militär - die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht war eine der ersten Amtshandlungen des neuen Regimes; die Behörden führen Listen, die Minderjährige und sogar Säuglinge erfassen. Außerdem befürchtet Dr. Wedekind, dass ein Bekenntnis zu Preußen sein Bürgerrecht in den Vereinigten Staaten tangieren könne, wo sein Geld angelegt ist und wohin zurückzukehren er sich offenhält.
Dr. Wedekind macht Eingaben, erklärt seine Lage, wirbt um Verständnis - er verzehre in der Stadt lediglich sein nicht unbedeutendes Einkommen, was Letzterer doch nur zum Vorteil gereiche. Aber die Stadtväter bleiben hart, und zwei Jahre nach dem Erwerb seines Hauses muss Dr. Wedekind es wieder verkaufen, an jenen Rentier Henckell, der jetzt erneut sein Vermieter ist, für dieselben siebentausend Reichstaler, die er damals bezahlt hat, aber um Notar- und Gerichtskosten ärmer, ein Barverlust von nahezu tausend Talern.
Überhaupt hat sich Dr. Wedekind das Leben in Deutschland anders vorgestellt. Den Arztberuf hat er aufgegeben, die Position, die er in San Franciscos Emigrantengemeinde innehatte, gilt hier wenig oder nichts. Wie soll er den Rest seines Lebens zubringen? Im Hotel Römischer Kaiser hält er eine antipreußische Rede und verteilt die auf eigene Kosten erstellte Druckfassung an die Zuhörer. Die Resonanz ist gering.
1871 besiegt Deutschland den«Erbfeind»Frankreich und macht den Preußenkönig Wilhelm I. zum deutschen Kaiser. Hannover, kürzlich noch Preußens Gegner, ist im Siegestaumel: Ehrenpforten sind errichtet, Triumphbogen aufgebaut, Palmenreihen säumen die Straßen. In«lebenden Bildern»werden kriegsentscheidende Szenen nachgestellt. Abends gibt es«Illuminationen»: Bürger stellen Lichter in die Fenster ihrer Häuser, und wer nicht mitmacht, riskiert spitze Bemerkungen oder öffentliche Rüge. Für Kinder ist in Hannover fast alles verboten: das Lärmen und Schreien, das Werfen mit Bällen, Schnee, Steinen und Knüppeln, das Schießen mit Armbrüsten, Blasrohren oder dergleichen Instrumenten, das Glitschen, Schlittschuhlaufen und Steigenlassen der Drachen.
Dr. Wedekinds Söhne Armin und Franklin gehen zur Schule. In Paletots und genagelten Stiefeln stapfen sie zum Unterricht ins Auhagen’sche Institut beim Aegidientorplatz, eine Privatschule, die ihr Vater aus Misstrauen gegen alles Preußische für sie gewählt hat. An den Bahngleisen können sie Züge der Linie Hannover - Braunschweig beobachten, am Gefängnis in der Langenstraße zeigt sich gelegentlich ein Insasse hinter vergitterten Fenstern. In der Nähe der Weißekreuzstraße gibt es ein Aquarium, und bei schönem Wetter geht die Mutter mit ihnen in den Zoo auf der Eilenriede.
Wie verkraftet Emilie Wedekind das Leben in Deutschlands Norden? Wie steht es um ihre Ehe? Vom Tag der Hochzeit an fehlt jeder Nachweis. Kein Brief, kein Tagebuch, kein persönliches Dokument ist erhalten, fast so, als hätten die Partner ein soeben geöffnetes Buch gleich wieder geschlossen und für immer versiegelt. Auch über ihren gesellschaftlichen Umgang in Hannover ist so gut wie nichts bekannt. Für alle sichtbar hingegen ist Dr. Wedekind ein fleißiger Erzeuger: Im Mai 1866 kommt der dritte Sohn William Lincoln zur Welt, benannt nach dem unlängst ermordeten amerikanischen Präsidenten, im November 1868 die Tochter Frida Marianne Erika und im November 1871 Donald Lenzelin. Dessen zweiter Name gibt Hinweis auf eine Entwicklung, die das Leben Dr. Wedekinds und seiner Familie drastisch und unwiderruflich verändert.
Armin und Franklin Wedekind (links) als Grundschüler in Hannover
Bei einem Badeaufenthalt in Bändlikon am Zürichsee im August 1872 - Armin und Franklin, seine Ältesten, dürfen ihn begleiten - begeht Dr. Wedekind eine unerhörte, irrationale, ja verrückte Tat: Er kauft ein Schloss. Kein Schlösschen mit Türmchen und Erker, sondern eine Trutzburg mit Zugbrücke, Zinnen, Schießscharten und Stützmauern, Hunderte von Jahren alt und Hunderttausende von Tonnen schwer, dreizehn Einzelgebäude auf einer Fläche von annähernd siebentausend Quadratmetern. Dr. Wedekind kauft sie für sich, seine Frau und seine fünf Kinder.
Gelesen hat er darüber in einer Anzeige in der«Neuen Zürcher Zeitung», und gleich am nächsten Tag ist er hingefahren: nach Lenzburg, westlich von Zürich im Kanton Aargau. Eine Bahnstation gibt es nicht, ab Wildegg verkehrt ein Postomnibus, die letzte Strecke läuft man. Das Schloss ist kilometerweit zu sehen. Dr. Wedekind erklimmt den Schlossberg und steht auf dem Burghof, überwältigt von der Wucht der Anlage und der majestätischen Rundsicht. Von den vielen Gebäuden ist nur eines wirklich bewohnbar - aber was ist dagegen das gemietete Haus in der Weißekreuzstraße in Hannover? Einen Besitz wie diesen hätte sich Dr. Wedekind selbst in Amerika nicht leisten können. Hier kann er für neunzigtausend Franken sich und seiner Familie etwas bieten, was jenseits aller Erwartung liegt. Oder will er, wie manche behaupten, mit dem Umzug in eine Burg seine Frau gesellschaftlich aus dem Verkehr ziehen und einer eventuellen Untreue ihrerseits vorbeugen? Dr. Wedekind ist ein eifersüchtiger Ehemann - in Hannover soll er seine Frau beim Blumengießen am Fenster beaufsichtigt haben, um sicherzustellen, dass sie mit keinem Mann auf der Straße anbandelt. Aber vielleicht will er nur eine große Tat vollbringen, wie es die amerikanische Verfassung vorsieht und es freiheitliche Kräfte allerorts fordern.
Dr. Wedekind unterschreibt den Kaufvertrag und handelt Konditionen aus - den Kaufpreis halb in bar, halb in jährlichen Raten auf fünf Jahre. Er eilt nach Hannover, macht Geld flüssig, packt seine Habseligkeiten in zwei Güterwaggons und ist zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung wieder in Lenzburg - er will vor Eintritt des Winters eingewohnt sein.
Seine Frau erfährt von all dem erst, als der Handel perfekt ist. Als sie zum ersten Mal auf dem Schlosshof steht, bricht sie in Tränen aus. Das Schloss hat keine Wasserleitung! Wie konnte ihr Mann ein so entscheidendes Detail übersehen? Wie stellt er sich eine Haushaltsführung mit fünf Kindern und Wasser aus einem dreißig Meter tiefen Brunnen vor? Dr. Wedekind steht als Träumer da, seine Großtat verliert an Glanz. Aber es gibt kein Zurück.
3
Ein Schloss in der Schweiz 1872-1880
Lenzburg, dreihundertsiebenundneunzig Meter über dem Meeresspiegel an der Hallwiler Aa gelegen, hat zweitausendvierhundert überwiegend protestantische und vielfach versippte und verschwägerte Einwohner. Die Hünerwadels und Laués betreiben Baumwollspinnereien, die Bertschingers eine Lebensmittelgroßhandlung und ein Baugeschäft, die Haemmerlis eine Papeterie mit Buch- und Postkartenverlag. Hirts Schuhwaren-Versandhaus ist eines der ältesten der Schweiz, und Konsul Zweifel, der nebenher spanische Bürger betreut, zieht Malagawein aus Eichenholzfässern in Flaschen. Lenzburgs größtes Gebäude ist die Kantonale Strafanstalt, die wichtigste Straße die Rathausgasse. Zum Jugendfest, das wochenlang vorbereitet wird, ist sie blumen- und girlandengeschmückt. Lenzburgs Kadetten marschieren, weiß gekleidete Mädchen schwenken Fahnen, abends gibt es Tanz. Jeder kennt jeden. In der«Aavorstadt»stehen die Häuser direkt am Wasser, Kähne liegen an verträumten Gärten, in der«Witwenvorstadt»wohnen Erbinnen der Fabrikanten und Handelsleute in Villen mit eisernen Balkonen unter hundertjährigen Eiben.
Aber der ruhige Schein trügt: Lenzburg durchlebt turbulente Zeiten. Seit Napoleon I. den Kanton Aargau gründen ließ, ist der Konfrontationskurs zur Kantonshauptstadt Aarau ein Dauerzustand. Wirtschaftlich geht es bergab. Die Baumwollverarbeitung ist mechanisiert, die Heimarbeit so gut wie verschwunden, die Zahl der Betriebe zurückgegangen. Bei der Trassenführung der«Schweizer Nordostbahn»blieb Lenzburg unberücksichtigt. Jetzt hat die Stadt Aktien im Wert von einer halben Million Franken für eine geplante«Nationalbahn»gezeichnet, aber Experten bezweifeln, dass sie ein Erfolg werden kann. Bürger, die sich privat engagiert haben, fürchten um ihre Einlage.
Sich selbst überlassen, von den Großen missachtet - so sehen sich die Lenzburger. Umso eifriger pflegen sie ihre Kultur. Der Cäcilienverein führt Oratorien Haydns und Mendelssohns auf, die Theatergruppe Schillers Dramen, im harten Aargauer Schweizerdeutsch, aber sorgfältig geprobt und für viele im Publikum von bleibendem Eindruck. Was besonders berührt, kommt ins Poesiealbum. Tagebuchschreiben ist in Mode, das Notieren von Träumen auch. Und da fast alle miteinander verwandt sind, gibt es reichlich Gelegenheit, Familienfeiern und Jubiläen mit Selbstgedichtetem zu verschönern. Besonders Motivierte bringen Dramen aus der eigenen Feder im Saal des Gemeindehauses zur Aufführung - das Dichten, sagen die Lenzburger, sei unter ihnen so verbreitet, wie anderswo das Lösen von Kreuzworträtseln. Im Winter gibt es Bälle und Kostümfeste in Fülle - wer geht mit wem, wer tauscht Blicke, wer bleibt länger oder glänzt durch Abwesenheit? Das kleinstädtische Miteinander ist streng geregelt und im Rahmen des Schicklichen freizügig. Wer ungeschriebene Gesetze verletzt oder Grenzen überschreitet, riskiert die Isolation.
Hundert Meter über der Stadt thront das Schloss. 1173 war Friedrich Barbarossa hier auf dem Weg nach Italien. Dann gehörte es Staufern, Habsburgern und Berner Landvögten, die es befestigten, immer wieder umbauten und von ihm aus das Land regierten. 1803 ging es in den Besitz des neu gegründeten Kantons Aargau über, der nicht recht wusste, was damit anzufangen sei, und Pläne einer Verwendung als Militärschule oder Lehrerseminar aus Kostengründen verwarf. Dreißig Jahre lang diente es dem Braunschweiger Pädagogen Christian Lippe als Erziehungsinstitut für Knaben; nach der Schlacht von Solferino war es für kurze Zeit Militärspital für österreichische Soldaten. Jetzt gehört es Dr. Wedekind.
Das Verhältnis der Lenzburger zu den Schlossherren ist traditionell gespannt. Früher gefürchtet, jetzt geduldet, trennt sie ein unsichtbares Band von den Städtern.«Oben»und«Unten»ist klar definiert. Wer«oben»ist, lebt auf dem Präsentierteller und gilt bei aller Bemühung nie als Gleicher unter Gleichen. Dr. Wedekind bietet den Seinen Außerordentliches, aber zwingt sie auch in einen permanenten Ausnahmezustand.
Ist ihm das bewusst? Ein sechzehnseitiger Brief an seinen Bruder Theodor in Göttingen erwähnt nur Positives: Die prachtvolle Aussicht auf Säntis, Glärnisch und Titlis, auf Eiger, Mönch und Jungfrau und eine Luft, so rein und leicht, daß man im Vergleich zu der kohlenstaubigen Atmosphäre Hannovers und anderer großer Städte balsamischen Aether einzuathmen vermeine. Lenzburgs Schulsystem sei gut, der Preis der Omnibusbilletts günstig, der Charakter der Bevölkerung freisinnig, aufgeklärt, höflich, zuvorkommend und, wie der aller Schweizer, erwerbseifrig. Jedermann, auch die Jugend, habe ihn von Anfang an höflich gegrüßt, jetzt grüße er feste zuerst, lüpfe den Hut und sage«Grüezi», was aber meistens wie«Grütze»klinge.
Geduldig beschreibt er jedes Gebäude und jedes Detail: das sechsundfünfzig Meter lange Schulhaus, das Ritterhaus aus dem vierzehnten Jahrhundert mit klaffenden Schießscharten, das Haupthaus, den Uhrenturm mit Wendeltreppe, den Pferdestall, die Futterkammer, den Hühnerhof, das Taubenhaus, die Spargelund Erdbeerbeete, Brombeersträucher, Zwerg- und Spalierobstbäume, das Gewächshaus, das am Grundstücksende auf einem überhängenden Felsen balancierende Gartenhaus mit«Caffezimmer», den Brunnen und sein handbetriebenes Pumpwerk und den Schornsteinfeger, der sich auf einem Brett in den Schacht hinablässt, um anfallende Reparaturen zu erledigen. Vor dem äußeren Tor, so liest man, steht ein Kran mit einem fünfzehn Fuß hohen Tretrad, der Lasten die letzten Meter heraufziehen kann, auf denen Tragtiere keinen Halt finden. Ein Rebmann bearbeitet Dr. Wedekinds Weinberg, die Gärtnersfamilie im Torwarthäuschen erhält einen Franken Tageslohn und darf ein Stück Land bebauen, aber muss dafür die nöthigen Gemüse liefern, Hof, Garten, Geräthe, Blumen und Obstbäume besorgen, Holz hacken, Wasser tragen und für jeden und zu jeder Zeit das Thor öffnen. Vor allem freut es Dr. Wedekind, günstig eingekauft zu haben: Veräußerte er seinen Besitz nur zum Abbruch für Baumaterial, würde er mehr als den Kaufpreis herausschlagen. Von seiner Familie erwähnt Dr. Wedekind nur, dass seine Jungens ihre Studierstube über seinem Arbeitszimmer haben. Auf Fotografien kreuzt er an, wo sich Schlaf-, Ess- und Wohnräume befinden.
Schloss Lenzburg im Aargau - Familiensitz der Wedekinds
Was diese Jungens treiben - gemeint sind die drei Ältesten Armin, Franklin und William, genannt Hammi, Bebi und Willi -, erfährt man durch mehr oder weniger folkloristische Berichte Dritter. Es hat von Anfang an theatralischen Charakter. Emilie Wedekind hat drei Esel angeschafft, die Wasser auf die Burg bringen, wenn der Brunnen versiegt oder die Pumpe kaputt ist. Armin, Franklin und William reiten auf ihnen in die Stadt, landesunüblich gekleidet in schwarze, mit einem Gurt zusammengehaltene Kittel und glänzende Lackstiefel. Entsprechend groß ist das Aufsehen. Kinder laufen auf die Straße und wollen die Tiere streicheln, Erwachsene schauen sich an oder schütteln die Köpfe. Wie wirken wir? Ihre Position als Schlosskinder, ihre Herkunft, ihr Hochdeutsch, ihre Mutter, die sie auffällig kleidet (und dem Vernehmen nach in Amerika einmal Sängerin war!), ihr knorriger, alter, ganz und gar unschweizerischer Vater sorgen dafür, dass ihnen diese Frage immer präsent ist.
Die Wedekind-Buben besuchen zuerst die Gemeindeknabenschule am Kronenplatz, später die Bezirksschule im Neuen Schulhaus. Armin lernt solide und strebsam. Von William weiß man, dass er mit einem Flobert in das Fenster einer Toilette schoss, auf der gerade ein Lehrer saß, und von der Schule flog. Franklins Schulzeit jedoch, für das Verständnis seines Lebens und seiner Persönlichkeit von kaum überschätzbarer Bedeutung, ist im Licht späterer Berühmtheit mit Legenden geradezu überfrachtet, die ihn wechselweise als Tunichtgut, Rebell, Rattenfänger oder Mädchenverführer schildern.
In Wirklichkeit ist er wohl eher ein nachdenklicher Junge, der für sein Leben gern philosophiert und diskutiert. Erwachsene staunen über die Vielfalt seiner Interessen und die Reife seines Urteils. Er schätzt das Alleinsein, scheint es zu brauchen. Gereizt, wird er jähzornig wie Großvater Kammerer oder seine Mutter. Von denen hat er auch die Musikalität: Er erfindet mit Leichtigkeit Melodien und kann Lieder, später sogar Opernarien, fehlerfrei nachsingen. Körperlich ist er ungelenk, im Turnen bestenfalls mittelmäßig. Er hat breite, gerötete Hände mit kurzen, stumpfen Fingern, die ungeschickt aussehen, es aber nicht sind. Er bastelt gern und zeichnet leidlich. Seine hervorstechendste Begabung ist das Spiel mit Worten, das Reimen, Verseschmieden. Er betreibt es seit früher Kindheit. Was er produziert, sammelt er in einer ausgedienten Spielzeugkiste, dem sogenannten«Steinbaukasten», der heute in einem Lenzburger Archiv zu bewundern ist. Die Aufnahmeprüfung in die Bezirksschule hat er, wiewohl der Jüngste seiner Klasse, als einer der Besten bestanden.«Das ist der Denker», sagt sein Vater, wenn er ihn vorstellt.
Er verliebt sich oft und heftig, ist aber nicht der Typ, dem Mädchenherzen zufliegen. Walther Oschwald, ein Mitschüler und späterer Ehemann seiner Schwester Frida Marianne Erika, hält Mädchenfreundschaften Wedekinds schon deswegen für unwahrscheinlich, weil die Mädchen sich vor ihm und seinem gescheiten Kopf eigentlich fürchteten. Ob er mal getanzt hat mit einem Mädchen, weiss ich nicht mehr, ich kann mir das nicht recht vorstellen. Seine dichterische Begabung hat wohl das eine oder andere Liebesgedicht an eine Lenzburger Schöne hervorgebracht, aber das war mehr ein poetisches oder zynisches Schwärmen aus der Ferne. Die eine oder andere Mädchenfigur erfüllte ihn vielleicht, aber er kannte sie nicht persönlich. Ein Mädchenjäger, wie man aus gewissen Publikationen schließen könnte, ist Franklin ganz bestimmt nicht gewesen. Er war ungewandt, linkisch und ohne Schliff.
Tatsächlich findet sich in Wedekinds Werk kaum eines jener schwärmerischen, selbstsicheren Liebesgedichte im Stil von Goethes«Willkommen und Abschied». Die romantische Phase, fast möchte man sagen die Jugend, scheint an Wedekind vorbeigegangen zu sein. Ihn beschäftigen Gedanken an Tod und Vergänglichkeit:
Schnell wie am Firmament die Wolken ziehn, Wie eines Waldbachs Fluthen niederstürzen, Sehn wir die Tage unaufhaltsam fliehn Und emsig unsere Lebenszeit verkürzen.
Laut Walther Oschwald ist Wedekind ein Einzelgänger: Er blieb dem Treiben von uns Lenzburger Buben außerhalb der Schule fern, an unseren Spielen, dem Baden und Fischen, Kühe weiden und ähnlichen Dingen und den großen Schneeballschlachten zwischen Städtlern und Vorstädtlern hat er nicht teilgenommen. Körperliche Tugenden und Leistungen und harmlose Bubenfreuden des Alltags haben ihn wohl nicht angezogen.
Stattdessen übt er sich in Provokation. Sich einzupassen, in der Menge zu verschwinden widerstrebt ihm. Er will auffallen und eine Rolle spielen und könnte es, dank seiner Begabung und Intelligenz, durch schulische Leistung, tut es aber durch Quatschmachen und Stören. Der Zwölfjährige wird bestraft wegen fortwährenden Unfleißes bei allen Lehrern, Unfuges während des Unterrichts, Trotzes und Ungehorsams gegen die Lehrer, endlich wegen Lügens. Ein schlimmes Beispiel habe er seiner Klasse gegeben. Es steckte ein frühreifes Urteil und ein etwas satirisches, ironisches und nicht an Tradition gebundenes Wesen in ihm, meint Walther Oschwald, das ihn mit der Schule und den Lehrern in Konflikt brachte. Diese Lehrer waren gegen ihn direkt feindlich eingestellt und verstanden ihn und sein Wesen nicht.
Die Lenzburger Kadetten trainieren zweimal wöchentlich in blauer Uniform mit roten Streifen und gelten viel im Städtchen; Mädchen schwärmen für sie. Franklin Wedekind, der Schlossjunge, ungelenk und aus Deutschland zugezogen, will sich hervortun, reitet mit seinem Esel auf den Exerzierplatz und fuchtelt mit einem Türkendolch herum, den er aus der väterlichen Sammlung entwendet hat. Manche finden das komisch, andere nicht. Seine Vorgesetzten ärgert es. Bei Übungen bemüht er sich redlich. Die Ernennung zum Leutnant, üblicherweise eine Routinesache, aber im Städtchen nicht unwichtig, wird bei ihm zum Politikum: Die Herren Instruktoren geben zu, daß Wedekind ein Schlingel sei, jedoch auf dem Exerzierplatz seinen Pflichten gehörig nachkomme und sich zu präsentieren wisse. Man drückt ein Auge zu und befördert ihn - vierzehn Tage später ist die Herrrlichkeit schon wieder zu Ende.
Der Anlass ist harmlos - kleine Liebeleien und Briefetauschen mit Mädchen wurden beobachtet - und Franklin Wedekind bei Weitem nicht der einzige Übeltäter. Aber er wird ausgesondert, verliert den Leutnantsrang und muss seinen Säbel zurückgeben - eine große und stadtweit bekannte Schande. Als er im Unterricht wieder aufsässig ist, zerschlägt ein Lehrer einen Haselnussstock auf seinem Rücken. Wedekind gibt keinen Laut von sich, aber am nächsten Tag macht ein höhnisches Gedicht die Runde, das er, wie Walther Oschwald meint, absichtlich in der Schule liegen ließ oder scheinbar vergaß, nur damit der verhöhnte Lehrer davon Kenntnis erhielt. Mir wurde fast angst um ihn, und ich habe das alles wie etwas Teuflisches angesehen und Franklin zu überreden versucht, er solle doch von diesen unnötigen Gedichten und Teufeleien, der Herausforderung von Strafe und Ahndung absehen: ohne Erfolg.
Wedekind gibt sich trotzig, straft das Kadettenwesen mit Verachtung und schwänzt ostentativ den Turnunterricht. Aber weil er empfindsam und verletzlich ist, trifft ihn die Strafe hart. Auf dem Schloss leckt er seine Wunden.«Meinem Säbel»heißt das Gedicht, in dem er das Erlebnis verarbeitet: Eines Nachts wird er zu ihm zurückkehren, und dann wird er es allen zeigen.
Ostern 1879 wechselt Franklin Wedekind auf die Kantonsschule nach Aarau, die sein Bruder Armin bereits seit zwei Jahren besucht. Aarau ist dreimal größer als Lenzburg und war 1798 für sechs kurze, aufregende Monate Hauptstadt der Schweiz. Jetzt ist es Sitz des kantonalen Behördenwesens. Die Straßen sind kopfsteingepflastert, Brunnen plätschern, Häuser haben bemalte Giebel. Man schaut auf die Hänge des Jura. Industriebetriebe für Feinmechanik, Optik und Glockengießerei haben sich angesiedelt. Die Kantonsschule, ehemals städtisches Waisenhaus, liegt auf einem Hügel am Stadtrand. Von Lenzburg, das neuerdings einen eigenen Bahnhof hat, fährt man nach Aarau eine halbe Stunde. Aber Armin und Franklin wohnen bei Professor Rauchenstein, einem pensionierten Philologen und Bekannten ihres Vaters, der auch ihre Hausaufgaben überwachen soll.
In Aarau wird Franklin Wedekind schnell Zentrum eines Kreises Gleichgesinnter. Die Kantonsschule ist ein modernes, liberal geführtes Institut. Schulfeiern sind von den Schülern selbst zu gestalten, Fähigkeiten im Formulieren und Verseschmieden gefragt. Hier ist Franklin Wedekind seinem Umfeld turmhoch überlegen. Die Kommilitonen bestaunen die Gewandtheit, mit der er Verse aus dem Ärmel schüttelt, die Treffsicherheit seiner Pointen, die Schlagkraft seines Witzes. Wedekind mag hier zum ersten Mal gespürt haben, dass er Menschen in seinen Bann ziehen kann, und er tut es unverkrampft: Sein Interesse an Philosophie, Geschichte und Religion ist echt, nichts macht ihm mehr Spaß, als ein Problem zu durchdenken und auf den Punkt zu bringen. Darüber hinaus hat er natürliches pädagogisches Geschick - kein Wunder, dass Mitschüler ihn bewundern und seine Nähe suchen. Solche wohlgemerkt, die mit seiner Art etwas anfangen können. Andere betrachten ihn als sonderbar oder überspannt. Walther Oschwald erinnert sich: Aus dem, was diese«Philosophen»berieten, sickerte dann das eine oder andere durch. Ein wichtiger Grundsatz lautete:«Alles Seiende ist seiend.»Damit konnte ein biederer Jüngling, wie ich einer war, wirklich nichts anfangen. Seiner Meinung nach ist Wedekind auch in Aarau Eigenbrödler, mehr gefürchtet als geachtet und geliebt.
Die Lehrerschaft polarisiert er noch immer. Manche hassen ihn, andere erkennen seine Begabung und Ernsthaftigkeit und fördern ihn nach Kräften. Seine Leistungen sind unterschiedlich im Extrem. Was ihn interessiert, formuliert er in Gedanken von verblüffender Schärfe, auf anderen Gebieten ist er so ahnungslos, dass Lehrer sich fragen, ob er weiß, um welches Fach es sich handelt. Nachts lärmt er in den Straßen. Ein Polizist nimmt ihn fest und sperrt ihn in eine Arrestzelle. Er nutzt die Zeit für ein Gedicht:
Da sitze ich nun im Kerker hier, Im grausigen Dunkel der Hölle. Mein einziger Trost ist dieses Papier, Dieser Stift mein einz’ger Geselle.
Doch da kommt die göttliche Phantasie Auf ihrem rosigen Flügel. Sie folgt mir treu und verlässt mich nie Trotz aller Schlösser und Riegel.
Die Mauern verschwinden in ihrem Licht, Frei kann der Geist sich bewegen Und schleudert ein unverblümtes Gedicht Den frechen Philistern entgegen.
Es folgen elf weitere angriffslustige und ironische Strophen, deren Pointiertheit und Eleganz sich auch ein Heinrich Heine nicht schämen müsste - und Wedekind beendet sie, bevor der Wärter um drei Uhr früh die Zellentür wieder aufsperrt.
Als Weihnachtsgeschenk für sein dreijähriges Schwesterchen Mati, geboren auf Schloss Lenzburg im April 1876 und naturgemäß der Liebling aller, schreibt Wedekind 1879 ein«Kinderepos», betitelt«Der Hänseken», nach der Vorlage von Theodor Storms Märchen vom«Kleinen Häwelmann», der, anstatt zu schlafen, auf einem Mondstrahl in den Himmel reitet. Armin illustriert das Werk mit viel Fleiß, Phantasie und Blattgold.
Bewundert man des fünfzehnjährigen Franklins Fertigkeit, die vielen Strophen mit Schwung, Witz und Poesie zu füllen, so lässt der Schluss aufhorchen: Wie beim«Häwelmann»beendet die Sonne Hänsekens Reise. Aber anders als der, fällt er nicht ins Meer, sondern geradewegs auf Schloss Lenzburg, wo Willi bei einer Strafarbeit das Tintenfass umwirft, das sich in den Schlossweiher ergießt. Dort landet Hänseken. Voller Freude über seine Errettung läuft er zu seiner Mutter, ohne zu ahnen, dass das Tintenbad ihn schwarz gemacht hat. Seine Mutter erkennt ihn nicht. Er beteuert immer wieder, ihr Sohn zu sein, aber sie schickt ihn fort:
Du kleiner, schwarzer Wanderer, Du bist mir völlig unbekannt Und ganz gewiss ein anderer. Gehst du nicht gleich von meiner Schwelle, Dann ist die Polizei zur Stelle!
Mit dem Besen scheucht sie ihn hinaus. Auch im Städtchen will ihn niemand haben. Hänseken besteigt einen Kahn und fährt nach Afrika, wo alle schwarz sind und eine neue Mutter wartet.
Fazit: Wenn die Weißen dich mißhandeln, dann mußt du zu den Mohren wandeln. Eigentlich heißt Hänseken natürlich«Hänschen», wird aber nach Dr. Wedekinds Tonfall niederdeutsch ausgesprochen. Der hat bekanntlich bereits in San Francisco die gewisse Herzenskälte seiner Frau beklagt.
Über die Familienatmosphäre auf Schloss Lenzburg gibt es ein direktes Zeugnis. Es stammt von Sophie Haemmerli-Marti, einer bekannten Aargauer Heimat- und Mundartdichterin, ursprünglich Bauerntochter aus Othmarsingen und als Schülerin oft Gast auf dem Schloss. Kalifornische Luft habe dort geweht, meint sie, und gestaunt habe man, wenn Mutter Wedekind am Klavier wie eine Lerche in allen möglichen Sprachen gesungen habe. Den Vater habe man nur zu den Mahlzeiten gesehen. Dabei habe er meist stumm am Tisch gesessen und nur dann und wann mit seiner Bassstimme dazwischengepoltert, habe aber auch, wenn ihm die Gastlichkeit zu bunt wurde, eine noch ungeöffnete Weinflasche vom Tisch nehmen und im Schrank verschließen können. Sophie Haemmerli-Marti beschreibt ihn als weißbärtig und steif, ein Eichenstamm aus dem uralten niedersächsischen Herrengeschlecht; wohlgefühlt habe man sich in seiner Gegenwart nicht. Er und Emilie seien wie Sonne und Mond gewesen: Kommt der eine, geht der andere.Treffen sich zwei harte Steine, gibt es Feuer.
Die Mutter Emilie Wedekind, der Vater Friedrich Wilhelm Wedekind
Deutlichere, wenn auch verschlüsselte Zeugnisse liefert Wedekind selbst in seinem späten Stück«Franziska»: Schöne Erinnerungen, heißt es da, habe er nur an die Berghänge in der Umgebung des Schlosses. Das Innere, samt Hof und Schattenplätzen, sei ihm ein Grauen gewesen. Im Inneren war der Krieg und draußen der Friede. Oft sei er am Tor gestanden, den Klopfer
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Copyright © 2008 by Albrecht Knaus Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-02544-1
www.knaus-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de