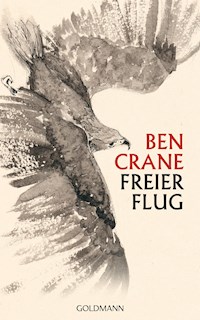
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende Vater-Sohn-Geschichte
Auf den Spuren von Habicht, Falke und Adler bereiste Ben Crane die halbe Welt, bis er zwei verletzte Jungvögel zu sich nimmt und sie voller Hingabe aufpäppelt. Im Zusammenleben mit den Königen der Lüfte, von deren Instinkt und Schönheit er mit feiner Beobachtungsgabe erzählt, lernte der Asperger-Autist die gesamte Bandbreite menschlichen Empfindens kennen. Diese emotionale Erfahrung ermutigt ihn, die Verbindung zu seinem verloren geglaubten Sohn wieder aufzunehmen. Eindrücklich zeigt Crane, wie das intensive Naturerlebnis die Sinne auch für das zwischenmenschliche Miteinander schärfen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Auf den Spuren von Habicht, Falke und Adler bereist Ben Crane die halbe Welt, bis er zwei verletzte Jungvögel zu sich nimmt und sie voller Hingabe aufpäppelt. Im Zusammenleben mit den Königen der Lüfte, von deren Instinkt und Schönheit er mit feiner Beobachtungsgabe erzählt, lernt der Asperger-Autist die gesamte Bandbreite menschlichen Empfindens kennen. Diese emotionale Erfahrung ermutigt ihn, die Verbindung zu seinem verloren geglaubten Sohn wieder aufzunehmen. Eindrücklich zeigt Crane, wie das intensive Naturerlebnis die Sinne auch für das zwischenmenschliche Miteinander schärfen kann.
Weitere Informationen zu Ben Crane
finden Sie am Ende des Buches.
Ben Crane
Freier Flug
Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»Blood Ties. A memoir of Hawks and Fatherhood«
bei Head of Zeus Ltd., London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugängl ichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung
Copyright © 2018 der Originalausgabe by Ben Crane
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Originalverlag: Head of Zeus Ltd., London
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München in Anlehnung an den Originalumschlag (Anna Dergacheva)
Umschlagmotiv: Alamy Stock
Redaktion: Ralf Lay
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23610-6V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Pete, der mir Raum gegeben hat,
für Steve und Hollie für das Handwerkszeug
und für E und J für die ansteckende Fröhlichkeit.
INHALT
Einführung: Der Falkner und die Vögel
1 Die Straße nach Pakistan
2 Weitere Reisen
3 Der Fall
4 Der Aufstieg
5 »CC«
EPILOG
GLOSSAR
EINFÜHRUNG:
Der Falkner und die Vögel
In dem warmen Raum des Cottages, der einem Mutterleib ähnelt, flackert das Licht des Kaminfeuers und wirft stumpfe Schatten von Vögeln an die Wand. Auf meiner behandschuhten Faust steht ein schmaler, leichter und wunderschön gemusterter weiblicher Sperber, zu meiner Linken ein kleineres, jedoch nicht minder eindrucksvolles Sperbermännchen. Beide Greifvögel strahlen eine stille, selbstgenügsame Ruhe aus. Ein diffiziles Gleichgewicht von feinster Präzision, jederzeit zur Handlung bereiter, unerbittlicher Instinkt, umschlossen von einer zarten Hülle aus Federn, Haut, Muskeln und Knochen. Sie erinnern mich an jenen knappen, flüchtigen Augenblick, kurz bevor der Springteufel aus seiner Schachtel hüpft. Beide Sperber waren aus freier Wildbahn zu mir gekommen, verletzt. Sie rechtmäßig mein Eigen nennen zu dürfen ist ein seltenes Vergnügen.
Die meisten wissen es nicht, aber Greifvögel riechen.
Nach dem Unfall roch der Atem des Sperberweibchens wie eine Mischung aus metallisch saurem Fisch und Ammoniak, ein ranziger Geruch nach Verdorbenem, der mir auf der Haut und in der Nase haften blieb. Das Männchen, eingesperrt und von der Welt abgeschieden, hatte in der abgestandenen Fäulnis der erzwungenen Gefangenschaft all seinen Glanz verloren.
Alle Greifvögel besitzen einen schimmernden Schutzfilm, eine Art Flaum, der sie regenfest macht. Die rosige Frische eines Greifvogels mit perfektem Gefieder ist einfach göttlich. Jetzt, da beide Sperber nach aufwendiger Rehabilitation vollständig wiederhergestellt sind, verströmen sie einen leicht modrigen Geruch nach weicher Erde und verrottenden Pfirsichen, nach der marmeladigen Moosigkeit trockener Zweige. Was so duftet, ist zweifelsohne so weit, wieder in die Freiheit entlassen zu werden.
Die Reha und die Freilassung der beiden Sperber sind die vorletzte Phase und der Höhepunkt einer obsessiven Reise, die mich auf die Suche nach einer intuitiven und unmittelbaren Beziehung zur Natur geschickt hat. Einer Reise, die mich vielen zutiefst bewegenden Augenblicken aussetzte. Ich habe Steinadler gesehen, die sich von monumentalen Berghängen aus Granit in die Lüfte erhoben, die über österreichischen Burgen und den schneesturmgepeitschten Landschaften Deutschlands und Nordeuropas kreisten. Bei Temperaturen von unter minus dreißig Grad Celsius flog in der Nähe der Reservate der Sioux in South Dakota ein winziges Fleckchen am Himmel, ein abgetragener Falke, eine Schleife und stieß mehrere hundert Fuß in die Tiefe. In atemberaubender Geschwindigkeit schnitt sie[*] über einen aufgeflogenen Fasan hinweg, der taumelnd zu Boden stürzte, während herabregnendes Blut zu Perlen gefror und der Schnee mit granatapfelrotem Fleisch besprenkelt wurde. In der diesigen Hitze eines kroatischen Sommermorgens sah ich die durch die Beschleunigung unscharf verwischte Spur eines wilden Sperbers, der Erdwachteln in den azurblauen Himmel aufjagte und sie in einer braun getüpfelten Explosion kleiner Aufziehfeuerwerke versprengte. In den schneidenden Seitenwinden des strengen Winters in South Dakota erblickte ich den mächtigsten Falken überhaupt: einen seltenen, wilden, fast schwarzen, melanistischen Gerfalken, dessen Umriss gespenstischer Ausmaße sich vor den tanzenden silbernen Kräuselungen eines riesigen Sees abzeichnete. In Texas folgte ich einem Familienverband wilder Wüstenbussarde. Die gerissen und listig in Kompanie jagenden Vögel hetzten Kaninchen durch das Wüstengestrüpp, wo am Golf von Mexiko blasser Sand auf stürmisches Meer trifft. Ebenfalls in Texas fing ich einen winzigen Buntfalken. Mit seinen kobaltblauen Schulterdecken und dem wie polierte Bronze leuchtenden Stoßgefieder war er noch farbenprächtiger als ein Kolibri und biss mich mit aller Kraft in den Finger, als ich ihn freiließ.
Von allen Reisen, die ich unternommen habe, war es die Zeit in Pakistan, die ich 2007 mit den Stammesfalknern verbrachte, welche meine Wahrnehmung von Greifvögeln grundlegend veränderte. Wie bei allen indigenen Völkern sind auch die Methoden der pakistanischen Stammesfalkner seit vielen Tausenden von Jahren gleich geblieben. Ihre Art der Beizjagd ist vielleicht die am wenigsten verfälschte, die ich je erlebte. Im Großen und Ganzen handelt es sich um arme Subsistenzbauern, die die Falknerei zum Überleben brauchen. Für diese Menschen ist die Jagd mit dem Greifvogel tief in einer Identität verwurzelt, die sich wiederum selbst in einem ausgewogenen Gleichgewicht mit ihrer Umwelt befindet.
Die Zeit in ihrer Gesellschaft konfrontierte mich mit einer Lebensweise, die in der westlichen Welt wenig bekannt ist. Trotz offensichtlicher Sprachbarrieren, scheinbar unüberwindlicher kultureller Unterschiede und fremder Gebräuche fühlten wir uns durch die Falknerei augenblicklich innig miteinander verbunden. Wir wurden Freunde und respektierten einander.
Einige Lektionen, die ich dort gelernt habe, konnte ich auf das Abtragen und die Pflege der beiden Sperber in meinem Cottage übertragen. Die Methoden der pakistanischen Falkner sind so alt, so hoch entwickelt und so verfeinert, dass auf den exquisit geformten Schultern der beiden Vögel das Wissen von unzähligen Generationen der Menschheitsgeschichte ruht. Sie sind vielleicht die wichtigsten Greifvögel, die ich je besaß. Sie sind absolut unersetzlich, im buchstäblichen Sinn des Wortes unbezahlbar – und ich kann es kaum erwarten, sie endlich freizulassen.
Und dann sehe ich sie hoffentlich nie wieder.
Rückblickend hat aus mir wohl zwangsläufig ein Falkner werden müssen. In meinem Elternhaus herrschte immer Respekt vor anderen Völkern und Kulturen, unser Leben war von Reisegeschichten durchdrungen. In seiner Jugend war mein Vater auf dem Hippie-Trail von Europa nach Indien getrampt. Er hatte Amerika gesehen und im Outback von Australien für Bergbaugesellschaften gearbeitet. Die Andenken an seine Reisen bewahrte er in einer riesigen Eichentruhe auf, in die ich kletterte und in der ich Stunden damit zubringen konnte, all die seltsamen und fremden Gegenstände zu betasten und zu bestaunen: versteinertes Holz, einen ausgetrockneten Kugelfisch, einen ausgebleichten hellbraunen und gelblichen Igelball, den Reißzahn eines Dingos, Münzen, Perlen, Totems aus Holz und zahlreiche Schwarzweißfotografien. Eine davon ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Auf dem Bild stehen zwei schlanke junge Männer in einer Wüste und halten ein Paar protestierender Adlerküken, deren Flügel sie auseinanderziehen und auf Taillenhöhe ausbreiten.
Die Herangehensweise meiner Eltern an die Erziehung ihrer Kinder könnte man als nonkonformistisch, libertär und in der Praxis nicht immer ganz reibungslos bezeichnen. Die Regeln waren fließend, je nach Lust und Laune, Scherze waren an der Tagesordnung. Einmal machten sie mir weis, ich könne Eier legen. Ein Nest wurde gebaut, und ich wurde ermuntert, mich daraufzusetzen und wie eine brütige, fünf Jahre alte Kreuzung aus Mensch und Vogel, angetan mit einer Spiderman-Unterhose, auf ein Ei zu warten. Ich spüre noch heute, wie sich mein Magen vor Vorfreude zusammenkrampfte. Die Enttäuschung, die unweigerlich folgen musste, war immens.
Unser Haus lag inmitten einer ländlichen Gegend Englands. Da ich schon früh mit der Natur in Kontakt gekommen und sowohl künstlerisch veranlagt als auch kreativ war, lebte ich entweder in der Fantasie oder verbrachte meine Zeit im Freien. Ich baute mir verschiedene Höhlen und Verstecke aus Holz und Laub und bastelte mir dabei auch meine eigene Welt zurecht. Ich machte Feuer, ging auf die Jagd und lockte Tiere in Fallen. Ich brachte mir selbst bei, Bachsaiblinge zu fangen, indem ich sie mit der bloßen Hand aus dem Wasser schlug. Dann nahm ich sie aus und briet sie mir zum Mittagessen. Im Frühjahr und Sommer landeten Blindschleichen, Molche, Frösche, Kröten und Kaulquappen zuhauf in meinem Eimer. Ich bewarf ein Hornissennest mit Steinen, woraufhin sich große, gemein aussehende Insekten als gewaltige ockerfarbene Wolke in den Himmel erhoben und ein tiefes, drohendes Summen von sich gaben. Ich band Weberknechte in Baumwollgarn und warf sie in die Luft, bevor ich sie wieder auf den Boden hinunterließ – ein Vergnügen, dem ich stundenlang frönen konnte. Einen verletzten Maulwurf, den ich schlau in einer Metallschachtel hielt und beobachtete, fütterte ich mit Würmern aus dem Garten. Als er sich allmählich als zu gefräßig erwies, ließ ich ihn wieder frei. Ich erinnere mich noch gut an das weiche silberne Fell und die dicken rosafarbenen Schaufelhände, mit denen er unter der Erde davonschwamm. Zahlreiche tennisballgroße Babykaninchen bevölkerten Boden und Türschwelle. Einige von ihnen überlebten, andere wurden Opfer von Stress, Unordnung und den Kiefern der Katze. Eines späten Winternachmittags, ich war allein zwischen Schösslingen, von denen der Schnee gefallen war, und kahlen Bäumen unterwegs, hörte ich ein Muntjak schreien. Vor mir auf dem Boden ein einzelner dreizackförmiger Fußabdruck. Mit dem Kopf voller fantastischer Geschichten und dem seltsamen Geräusch des kleinen Hirschs war ich davon überzeugt, dass es sich bei ihm um ein Monster handeln musste. Ich geriet in Panik und rannte um mein Leben. Allzu wissbegierig und ohne genaue Vorstellung vom Prinzip von Ursache und Wirkung tauchte ich mit den Händen in die Tiefen eines umgefallenen Baums und holte sie mit einem handtellergroßen Babyeichhörnchen darin wieder hervor. Es war kalt, beinahe leblos. Um seine Körpertemperatur zu erhöhen, steckte ich es in den einzigen Gegenstand, der warm genug dafür war: in meinen verschwitzten Turnschuh. Ich lief den knappen Kilometer barfuß nach Hause, schürfte mir die Haut auf und holte mir Blasen. Später fütterte ich das winzige Eichhörnchen mit Kuhmilch, konnte sein zerbrechliches Leben aber nicht daran hindern zu entgleiten. Im hohen Gras in unserem Garten »borgte« ich mir zwanzig Rebhuhnküken aus dem Nest der umherlaufenden, rufenden Mutter. Jedes von ihnen hatte die Form und Beschaffenheit einer Hummel. Ich baute ihnen ein neues Nest aus meiner Bettdecke und hielt sie mit einem Föhn warm. Als wir entdeckt wurden, steckte man die Küken in eine Schachtel und fuhr sie zu einem Mitglied der örtlichen Jagd, wo man sie aufzog, freiließ und dann erschoss – elterliche Logik. Bei kleineren Vögeln, die aus dem Nest gefallen waren oder von den Katzen angeschleppt wurden, standen die Chancen besser. Einen zog ich mit der Hand auf. Er saß im Haus auf den Vorhängen, flog durchs Wohnzimmer, um sich Würmer und Maden aus meiner Hand zu holen, und war alles in allem ein aussagekräftiges Omen dessen, was da noch kommen sollte.
Mein Leben als Erwachsener war nicht so unkompliziert und einfach. Es gelingt mir nicht, langfristige, enge Freundschaften mit anderen Menschen zu schließen oder Liebesbeziehungen einzugehen. Ich fühle mich in Menschenmassen oder größeren Gruppen äußerst unwohl und ziehe die eigene Gesellschaft auch über längere Zeiträume hinweg häufig vor. In visueller Hinsicht bin ich hypersensibel. Ich verstärke und vergrößere jegliche Kommunikation, und da ich über keinerlei Filter verfüge, dauert es oft Tage, bis ich mich entspannen und die Bedeutung des Gesagten enträtseln kann. Meist interpretiere ich ein und dasselbe Gespräch auf viele verschiedene Weisen. Ich vermeide Blickkontakt, bin leicht abgelenkt und aufgewühlt. Ich mache mir oft unerträglich große Sorgen und bin übertrieben ängstlich. In Gegenwart von Fremden befinde ich mich fast die ganze Zeit über im Kampf-oder-Flucht-Modus. Unbewusst überschreite ich Grenzen oder platze mit unpassenden Kommentaren heraus. Das vermittelt in der Regel den Eindruck von mangelnder Impulskontrolle und Chaos.
Hinsichtlich dessen, was mich interessiert, entwickle ich gnadenlos feste Routinen. Kann ich sie nicht einhalten, bin ich frustriert und leide. Ich widme mich ihnen auf Kosten von allem anderen, ich erschöpfe mich in ihnen und stelle die Geduld der Menschen in meinem Umfeld auf eine harte Probe.
Ich bin ein geborener Außenseiter, unfähig, locker zu sein, und dabei so sehr darum bemüht, sinnhafte Verbindungen einzugehen. Der einzige Ort, an dem ich immer Frieden finde, ist die Natur: Sie ist gewissermaßen mein Vermittler und Fürsprecher, sie kanalisiert und stabilisiert meine Emotionen. In ihr fühle ich mich am ehesten dazu in der Lage, zum Ausdruck zu bringen und zu kommunizieren, wer ich bin.
Ich finde die Natur unendlich fesselnd und visuell entspannend. Ich bin den Freiheiten, die sie uns schenkt, und ihrer Fülle voll und ganz ergeben. Die hypnotisierenden komplexen geometrischen Gebilde, die farbenfrohen Geräusche, der schwindelerregende Rausch der Einzelheiten, die zarten punktuellen Muster in den Formen von Tieren, Pflanzen, Elementen, Geschmäckern und Geweben – all das ergibt absolut einen Sinn. Strikt demokratisch interessiere ich mich für alles, was krabbelt und schwimmt, saugt, umherstreift, springt oder bläst, alles, was schlüpft, drückt, pulsiert, fliegt, fächelt oder atmet. Ich habe mich in die endlose Schaffenslust verliebt, die unzählige Gestalten hervorbringt, Millionen Ideen, die sich ent- und zufalten, leben und sterben, überleben oder vergehen. Die Natur ist die Verkörperung und der perfekte Tummelplatz der Unterschiede, eine Kraft, die sich schlicht selbst feiert und um ihrer selbst willen gefeiert wird. Ein Ort ohne Grenzen oder Angst, den ich zu meinem eigenwilligen und lebensbejahenden Lehrer ernannt habe. Die bedeutendste, am meisten sinnstiftende und beständigste Beziehung in meinem Leben ist die zur Natur. Ohne sie fühle ich mich hilflos verloren.
Die Begegnung mit Greifvögeln war wie eine Offenbarung für mich. Als ich das erste Mal einen Habicht auf der Faust hatte, war ich geradezu schockiert von der erschreckenden Intensität und Klarheit. Das also war es, wonach ich gesucht hatte …
Mit der Zeit zeigten sich ganz allmählich die einzelnen Eigenschaften der Vögel, und die mächtige Verbindung, die ich zu ihnen spürte, ergab vollständig einen Sinn. Greifvögel sind ausgesprochen reine, pure Wesen, höchst nervös, intelligent, ängstlich und über weite Strecken hinweg Einzelgänger. Sie leben im Augenblick, haben nur wenige subtile Grauzonen und agieren oder reagieren ausschließlich gemäß ihrer angeborenen Natur. Behandelt man sie inkonsequent oder lieblos, kehren sie sehr rasch zu ihrem wilden Zustand zurück. Zu einer guten Beziehung zwischen Greifvogel und Mensch gehören definierte, vertraute Parameter – vom Greifvogel definiert wohlgemerkt, nicht vom Menschen. Greifvögel zaudern nicht, sie lassen sich nicht einschüchtern oder zu etwas zwingen. Sie verhandeln nicht. Sie verfügen über ihre eigene innere Logik und stellen sehr spezifische Ansprüche. Um eine starke Beziehung aufzubauen, muss sich das menschliche Ego den Bedürfnissen des Vogels beugen. Beim Abtragen eines Greifvogels muss man sich in ihn hineinversetzen, wenn ein gelingendes Band entstehen soll. Man muss sich selbst auf- und in die Welt des Vogels hineinbegeben, sie durch seine Augen sehen und begreifen. Man muss dem Vogel mit Geduld dienen und ihm in tiefer, empathischer Ebenbürtigkeit gegenübertreten.
Unterlässt man das, ist der Misserfolg programmiert.
Erst nachdem ich die Falkner in Pakistan beobachtet und auch am Leben anderer Falkner teilgehabt hatte, nahmen die Facetten meines Gefühls des Einsseins mit der Natur und mein Verständnis von Greifvögeln Gestalt an. Erst ihre Methoden und Lebensweisen vervollständigten das Bild. Unter diesen Menschen fand ich, wenngleich in verschiedenen Abstufungen, eine Geisteshaltung, die die meine widerspiegelte. Das Verschmelzen von Ost und West, von althergebracht und modern, eröffnete mir ein besseres Begreifen der Vögel, ihrer Beute und ihres Schutzes. Meine Erlebnisse in Pakistan zeigten mir, dass die Falknerei ein wahrer Flickenteppich der Erfahrung ist, wo man sich austauscht und gegenseitig unterstützt, egal, aus welchem Kulturkreis man stammt. Die Falknerei in ihrer dauerhaftesten, überragenden, vollendeten Form entspringt unabhängig von dem Kontinent, auf dem sie ausgeübt wird, immer derselben fundamentalen, uralten Quelle: heimischen wilden Greifvögeln, die in ursprünglichen Landschaften geflogen werden und Jagd auf heimische wilde Beute machen.
Das vielleicht Wichtigste, was ich von meiner Reise nach Pakistan mit nach Hause genommen habe, sind die Einfachheit und Freiheit der dortigen Falknerei. Das Leben der pakistanischen Falkner dreht sich ausschließlich um die Vögel: Alles beginnt und endet mit ihrem derzeitigen Standort und der Landschaft um sie herum. Mitzuerleben, wie Menschen mit Stil und Humor fünftausend Jahre alte Methoden anwenden, sich nur das nehmen, was sie brauchen, und nie Spuren hinterlassen, war wirklich beeindruckend. Dadurch erkannte ich, dass mein tief verwurzelter menschlicher Instinkt zu jagen moralisch richtig ist, dass die Jagd mit dem Beizvogel nicht grausam, ungewöhnlich oder zerstörerisch ist, sondern eine Tätigkeit, die die Natur nachmacht und sich mit ihr im Einklang befindet. Dass die Nahrungsbeschaffung mittels Greifvogel, dass diese Art der Ernte, durchgeführt auf eine absolut ausgewogene Weise, ein Geschenk und ein Privileg ist.
Nach meiner Rückkehr aus Südasien machte ich eine langsame Wandlung durch, bei der ich die Reise zerpflückte und in eine für mich stimmige Logik sortierte. Meine Erlebnisse wurden ordentlich verstaut, eingelagert wie ein Same, der weiche Kern verborgenen Wissens, der darauf wartete zu keimen, wenn seine Zeit gekommen war. 2010, fast vier Jahre später, erreichte mich die erschütternde Nachricht einer furchtbaren Naturkatastrophe: Der Stamm, das Dorf, die Kinder, die Hunde und die Greifvögel waren von einer nie dagewesenen Überschwemmung heimgesucht worden. Als direkte Folge des Klimawandels war ein Dorf und mit ihm eine ganze lebendige, Ackerbau und Falknerei betreibende Kultur binnen weniger Tage ausgelöscht worden. Meine Reaktion darauf war Wut, eine stille, motivierende Wut, die mir bis heute geblieben ist. Das war nicht nur irgendeine Schlagzeile in der Zeitung, die man wieder vergisst, sobald man umgeblättert hat. Auf meine ganz eigene Weise beschloss ich, nicht zu vergessen, und so veränderten die Methoden der pakistanischen Falkner zusammen mit den bereichernden Erfahrungen meiner weiteren ausgedehnten Reisen schließlich mein Leben.
Ich müsste lügen, würde ich sagen, dass diese Wandlung geplant oder bewusst gewählt war. Das war sie nicht. Ich hatte keinerlei Einfluss auf die zugrunde liegenden Umstände und Auslöser. Sie stellten sich ganz plötzlich und aus einer sonderbaren, unerwarteten Richtung im selben Jahr ein, in dem die verheerende Flut Pakistan überraschte.
Betrachte ich meine eigene Geschichte aus der Distanz, kann ich einen beängstigend tiefen emotionalen Absturz ausmachen, der mit der Geburt meines Sohnes begann. In dem Moment, in dem sich die meisten Menschen unbändig freuen und überglücklich sind, trat ich eine völlig andere, dunklere, brutalere seelische Reise an, bei der die damals noch unerkannten Aspekte meiner Persönlichkeit meine Misserfolge und Frustrationen in Bewegung setzten und untermauerten. Damals war mir der Absturz nicht bewusst, und ich war dem freien Fall größtenteils hilflos ausgeliefert. Doch während ich fiel, handelte ich in einer Art und Weise, die die Gesellschaft mit Entsetzen und Entrüstung zur Kenntnis nimmt: Ich verließ meinen Sohn ohne auch nur die geringste Vorstellung davon, wie, wann und selbst ob ich jemals zurückkehren würde.
Es wäre unaufrichtig zu behaupten, dass die Falknerei und die Pflege und Wiederauswilderung von Greifvögeln mir zu dieser Zeit geholfen hätten, dass ich durch ihre Rettung mich auch irgendwie selbst rettete. Nein, das ist eher der Stoff, aus dem Märchen geschneidert werden. Als Schmerz und Schuld am schlimmsten waren, hatte ich mich nicht nur von meinem Sohn abgewandt, sondern auch von Greifvögeln, und ich sollte erst wieder zu beiden zurückfinden, nachdem ich mich von den emotionalen Trümmern, in die sich mein Leben zerschlagen hatte, freigerungen hatte. Diese Freiheit war ausschlaggebend – durch sie erlangte ich meine mentale Klarheit und Ruhe wieder, die gemeinsam mit meiner Liebe zur Natur das stabile Gerüst bildeten, das ich zu meiner Erneuerung brauchte. Von diesem Gerüst aus kletterte ich wieder nach oben, kalibrierte mich neu und stellte die Zusammenhänge wieder her. Meine Reisen, das Leben der Falkner, denen ich begegnete, und meine ureigenste Existenz waren nun keine separaten Geschichten mehr, sie verschmolzen zu einer Straßenkarte ohne Grenzen, zu einer Lebensweise und einem Selbstverständnis, zu dem ich schon Jahre zuvor hätte gelangen sollen. Plötzlich erkannte ich, dass sich meine Gefühle für die Natur, insbesondere für Greifvögel, parallel zu den Gefühlen für meinen Sohn entwickelten. Ich fand heraus, dass es sich bei ihnen um die beiden Seiten derselben Medaille handelte: Die tiefempfundene Liebe für das eine konnte, wenn ich behutsam vorging, die tiefe Liebe für das andere freisetzen. Aus dieser Erkenntnis heraus begann ich, die Beziehung zu meinem Sohn und zu seiner Mutter zaghaft neu aufzubauen. Ich begann, meine Furcht vor dem Vatersein zu überwinden, und fand einen Weg, mich durch und für meinen Sohn auszudrücken. Ich denke, dies ist das zentrale Thema meiner Geschichte.
Heute wird mein Leben bestimmt durch die Vögel, ihre Stimmungen, die Jahreszeiten, ihre Landschaften und die Beute, die die Vögel jagen. Ich habe endlich einen abgeschiedenen Ort gefunden, an dem ich wilde Sperber pflegen und wieder auswildern und Habichte auf dieselbe Weise – und aus denselben Gründen – wie in Pakistan fliegen kann.
Ich habe mich all dessen entledigt, das ich als überflüssig erachte. Ich habe einer einträglichen Karriere und einer Dozentenstelle an der Universität von Cambridge den Rücken gekehrt. Ich lebe so schlicht wie möglich und verdiene meinen bescheidenen Lebensunterhalt als Künstler sowie durch Sommerarbeit auf verschiedenen Landsitzen. Ich teile mir mein Häuschen am Ende einer alten, holprigen Straße am Rand eines winzigen Dorfs mit zwei Hunden. Größere Besitztümer habe ich nicht, dafür aber auch keine Schulden, keine Kreditkarten und abgesehen von einem in die Jahre gekommenen Laptop kaum moderne Annehmlichkeiten. Mein Cottage verfügt weder über doppelt verglaste Fenster noch über eine Zentralheizung, nur im Wohnzimmer steht ein großer Holzofen. Ist mir kalt, sammle ich Holz und mache ein Feuer. Ich verbrauche wenig Strom und habe keinen Fernseher, kein Festnetztelefon, kein WLAN und kein Internet oder andere Zerstreuungen. Wenn ich Hunger bekomme, gehe ich auf den Feldern auf die Beizjagd. Haben wir dabei keinen Erfolg, versuche ich, andere Tiere in Fallen oder Fische zu fangen. In meinem Garten stehen ein paar Obstbäume, hinter dem Haus habe ich drei kleine Gemüsebeete angelegt. Ich besitze eine Tiefkühltruhe und einen Kühlschrank und kaufe Gemüse, das ich nicht selbst anbaue, auf Bauernmärkten in der Umgebung ein. Für alles andere gibt es einen Dorfladen und die Post in fünf Kilometern Entfernung, der nächste Supermarkt ist zehn Kilometer entfernt.
Ein solches Leben ist nicht nach jedermanns Geschmack. Ich spüre die Elemente und die Jahreszeiten immer sehr direkt: Herbst und Winter sind kalt, dunkel und lang. Doch wenn dann der Frühling kommt, nisten im Dach meines Cottages Singvögel, deren Nachwuchs so zahlreich und stimmgewaltig ist, dass buchstäblich das ganze Haus zu singen scheint. An den Sommerabenden sitze ich auf meiner Türschwelle und sehe vier verschiedenen Arten von einheimischen Fledermäusen dabei zu, wie sie durch die Abenddämmerung huschen. Im Umkreis von knapp einem Kilometer gibt es Füchse, Frösche, Kreuzkröten, Kammmolche, Ringelnattern, wilde Sperber und nistende Habichte. Durch die Tür kommen laufend Fliegen ins Haus, und dann beobachte ich die Spinnen in den Ecken dabei, wie sie sie fangen. Auf dem Dachboden leben Ratten, hinter dem Kamin überwintert ein Igel. Ganz in der Nähe gibt es Wanderfalken, Rohrweihen, Rotmilane, Mäusebussarde, Turmfalken und Merline. Hermeline und Wiesel streifen regelmäßig vorüber, sie hüpfen und springen, und es ist absolut fesselnd, ihnen bei der Jagd zuzusehen. Auf den Feldern und im Unterholz tummeln sich Fasane, Kaninchen, Brachvögel, Kiebitze und Lerchen. Im März treten die Hasen im Boxkampf gegeneinander an. Am und im Bach wimmelt es nur so von Insekten, laichenden Forellen, Lachsen und einem Dutzend verschiedener Entenarten. Am Ufer haben Eisvögel ihre Nester gebaut. Aale aus der Saragossasee schwimmen in silbrig-durchsichtigen Schwärmen dammaufwärts zu den vielen verschlickten Teichen rund um das Cottage. Einheimische Flusskrebse, kleine gepanzerte Süßwasserhummer, verstecken sich dicht gedrängt unter Kieseln im nahe gelegenen Stausee. Beide heimische Spechtarten schwirren in schlingerndem, torkelndem Flug vorüber. Dompfaff, Türkentaube, Grünfink und Dutzende von Heckenbraunellen hüpfen im Garten herum. Da das Haus an einer Zugroute liegt, fliegen jährlich Tausende von Grau-, Kanada- und Kurzschnabelgänsen tief und laut rufend über das Dach hinweg. Hier ist die Natur überschwänglich, sie strotzt nur so von Fülle, sie zirpt und schnattert und platzt das ganze Jahr über aus allen Nähten.
Ein Leben, das durch und für einen Greifvogel gelebt wird, entwickelt sich ständig weiter und überrascht immer wieder aufs Neue – eine sinnliche Erfahrung, die auf Rhythmen im Einklang mit den Kreisläufen der Natur basiert. Es ist ein Leben voller Möglichkeiten, immer anregend und beglückend. Ein Leben, das mich bereitwillig in die Landschaft entlässt, in die Natur, um zu denken, zu fühlen und zu staunen.
[*] Falkner beziehen sich, wenn sie über ihre Vögel sprechen, immer auf das biologische, nicht auf das grammatikalische Geschlecht. Die hier verwendeten Begriffe der Falknersprache finden Sie am Ende des Buches in einem Glossar erklärt (A. d. Ü.).
1 Die Straße nach Pakistan
Bells sind klein, aber bei einem Beizvogel von großer Bedeutung. Ein guter Beizvogel tötet auf ungeheure Entfernungen und kröpft in der Deckung, lautlos, perfekt getarnt und beinahe unsichtbar. Stößt der Falkner schließlich dazu, ist das hohe Klingeln der Bell oft der letzte Rettungsanker, der das Wiederauffinden vom Verlust des Vogels trennt.
Früher, viel früher, haben die Falkner ihre gesamte Ausrüstung selbst angefertigt. Handschuhe, Falknertaschen, Federspiel, Drahlen, Aufblockmöglichkeiten, Hauben und natürlich die Bells – alles maßgeschneidert, alles einzigartig, alles auf die Bedürfnisse des jeweiligen Vogels abgestimmt. Mittlerweile sind insbesondere die Bells maschinell hergestellte Massenprodukte, und die Bequemlichkeit hat der Individualität handgefertigter Bells den Garaus gemacht. Doch auch heute noch genießt das eigene Anfertigen von Ausrüstungsgegenständen unter Falknern ein hohes Ansehen, vor allem wenn es sich um eine verlorene Kunst handelt. Natürlich wollte auch ich unbedingt herausfinden, wie man Bells selbst anfertigt, und bestellte rasch alle Einzelteile, ohne wirklich zu wissen, wie man sie zusammenfügt.
Über eine Woche lang arbeitete ich fieberhaft. Ich folgte meiner Intuition und lernte aus Fehlern. Ich überzog das Haus mit einer feinen Staubschicht aus Metall, rasierklingenscharfe Metallspäne verfingen sich im Fußboden und schnitten mir die Füße auf. Ich brannte Löcher in den Teppich. Ich war viel zu konzentriert und hektisch bei der Arbeit, als dass ich mir um meine Sicherheit Gedanken gemacht hätte, und so flogen Metallstückchen von der Dremel auf und wirbelten wie Sterne durch die Luft; sie frästen sich in meine Stirn, die am Ende ein Tattoo dunkler Punkte unter einem rotblutigen Ausschlag zierte. Einige der Bells waren wunderschön und funktionierten, andere fielen fast augenblicklich wieder auseinander. Um sie weiterzuentwickeln und beständigere Erfolge zu erzielen, lieh ich mir in der Bibliothek Bücher aus und suchte Hilfe in den sozialen Netzwerken.
Die arabischen und muslimischen Nationen weisen eine lange und enge Verbindung zur Falknerei auf. Dort durchziehen Greifvögel das gesamte Leben, sie dringen bis ins Herzstück des Lebens vor. Lange bevor man im Westen um das Potenzial von Habichtartigen und Falken für die Jagd wusste, perfektionierte die muslimische Welt die Praxis bereits und erhob sie in den Stand der Wissenschaft. Über Handelswege gelangte sie schließlich auch nach Europa, der Prophet Mohammed selbst soll ein eifriger Falkner gewesen sein. Deshalb überrascht es nicht, dass die ältesten Stile und die traditionellsten Beizvogelbells noch heute im Osten angefertigt werden.
Nachdem ich Falknereiforen durchstöbert hatte, fand ich Bilder von höchst kunstvoll verzierten und juwelenbesetzten Bells, deren Gestaltung unglaublich detailliert und atemberaubend schön war. Der Herr, der sie zum Verkauf anbot, war ein Falkner aus Pakistan und hieß Salman Ali. Ich schrieb ihm eine Mail. Im Laufe des nachfolgenden Mailwechsels fragte ich ihn, ob ich kommen und mir ansehen dürfe, wie die Bells gemacht wurden. Er war einverstanden, und so hob ich 2007 mein gesamtes Geld vom Konto ab und buchte einen Flug. Ich folgte schlicht einem Impuls.
Ich schätzte, die Reise im Land selbst würde etwa zwei bis drei Tage dauern. Ich wollte in einem Hotel übernachten und nach einer Woche wieder zu Hause sein. Da Karatschi nicht ganz ungefährlich ist, schlug Salman mir stattdessen vor, während meines Aufenthalts bei ihm zu wohnen, länger in Pakistan zu bleiben und in den entlegeneren Regionen des Sindh, einer der vier pakistanischen Provinzen, Habichte zu fliegen. Anschließend wollte er mit mir nach Lahore reisen, wo wir uns mit dem Bellmacher treffen würden. Mir war nicht wirklich klar, welche Folgen dieses großzügige Angebot haben sollte. Jedenfalls schenkte ich einem völlig Fremden mein Vertrauen und legte mein Wohlergehen treuherzig in seine Hände.
Ein paar Monate später schüttelte mir am Flughafen ein ruhiger, elegant gekleideter, muskulöser Mann zurückhaltend die Hand und brachte mich zu seinem Haus in einem wohlhabenden Vorort der Stadt. Ich war vom Jetlag noch völlig benommen und fiel erst einmal in einen langen, tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen tranken wir in einem kleinen, aber sehr sauberen Innenhof im Schatten eines großen Feigenbaums Tee.
Der Innenhof, in dem Salman eine bescheidene Auffangstation für wilde Greifvögel eingerichtet hatte, war von einer Mauer umgeben. Über Salmans Schulter konnte ich vier aufgeblockte Vögel sehen: einen weiblichen Sakerfalken, ein kleineres Männchen derselben Art, also einen Sakret, einen Luggerfalken und eine Unterart des Wanderfalken mit dem wunderschönen Namen »Rotnackenshahin«.
Diese Falkenarten werden auf der Arabischen Halbinsel sehr geschätzt, manche von ihnen erzielen Preise von umgerechnet bis zu vierzigtausend Euro oder mehr. Im Laufe der Jahrhunderte sind Saker- und Luggerfalken dort in großer Anzahl gefangen, außer Landes gebracht und entweder auf Tiermärkten oder an reiche Privatpersonen in den Golfstaaten illegal verkauft worden. Viele der Vögel lassen dabei ihr Leben, und so sind die Falken durch die zusätzliche Bedrohung des immer mehr schwindenden Lebensraums mittlerweile stark gefährdet.
Wenn Salman sie gesund gepflegt hatte, sollten die Falken wieder freigelassen werden und hatten ein potenziell langes und produktives Leben vor sich. Leider war es auch möglich, dass sie erneut in Fallen gerieten und bald darauf auf einem anderen Markt illegal zum Kauf angeboten wurden. Da Salman der Schutz der Tiere ungeheuer am Herzen lag, war ihm die geringe Aussicht auf Erfolg Zeit und Mühe aber durchaus wert.
Ein gesunder Falke von welcher Spezies auch immer ist eine respekteinflößende und eindrucksvolle Erscheinung. Die Augen klar, dunkel und kreisrund, die Füße makellos sauber, kraftvoll, schuppig wie die einer Echse und in der Lage, Beute mit großer Geschwindigkeit mitten im Flug zu greifen. Der Schnabel ist glatt und gebogen, die Spitze scharf. Form und Aussehen eines gesunden Falken ähneln warmem Wind, der über ein erntereifes Sommerfeld streicht. Von Kopf bis Stoß fließen die gefiederten Konturen in sanften Wellen, ohne Unterbrechungen, ohne zersplitterte Ränder. Ein gesunder Falke ähnelt einer auf den Kopf gestellten Träne mit perfektem Federkleid.
Die Falken in Salmans Innenhof dagegen waren unförmig, schäbig, das Gefieder stumpf und glanzlos. Sie machten einen in sich befremdlichen Eindruck, irgendwie schief, mit schlechter Haltung und müden, trüben Augen, so als wären sie nur halb fertig, verhalten und unendlich traurig. Bei näherer Betrachtung zeigten sich verschiedene Leiden: gebrochene Federn, gebrochene und zersplitterte Schnäbel, verdrehte, von Geschwüren und Fäule befallene, schorfige und wunde Füße. Sosehr mich der Anblick dieser äußerlichen Verletzungen auch mitnahm: Sie waren nur die Spitze des Eisbergs.
Greifvögel zeigen in der Regel erst Schwäche, wenn sie dem Tod nah sind, ein natürlicher Sicherheitsmechanismus, der sie in freier Wildbahn vor anderen Beutegreifern schützt. Man muss sie schon sehr genau beobachten und über einige Erfahrung verfügen, um die Wurzeln der tiefer liegenden Erkrankungen zu erkennen, die hinter dem Offensichtlichen lauern.
Damit Pflege und Wiederauswilderung überhaupt gelingen können, muss der Vogel konstant mit Nahrung versorgt werden. Es kann viele Monate dauern, einen Habicht oder Falken auf diese Weise gesund zu pflegen, und dabei muss er täglich geatzt werden. In England gibt es spezielle Hersteller für Raubtiernahrung, meist ein Nebenprodukt der Eierindustrie. Das Protein, das diese Produkte enthalten, ist sauber. Sie sind bakterienfrei, preiswert und werden auf Bestellung bis an die Haustür geliefert. Nach dem Auftauen kann das Fleisch sofort verfüttert werden, ohne dass man sich dabei Sorgen über eine eventuelle Kreuzkontamination machen müsste.
Salman atzte seine Vögel mit Straßentauben.
Sie gingen gerade aus, und so machten wir uns auf den Weg zum Tiermarkt, um neue zu kaufen. Im wabenförmigen Netz dunkler, mittelalterlicher Straßendurchgänge stapelten sich Hunderte von rechteckigen Käfigen aus Hasendraht, Reihe auf Reihe, sechs Meter hoch. Affen, kleinere Vögel, Falken, Nagetiere, Eulen, Eidechsen, alle nur Zentimeter voneinander entfernt dicht zusammengedrängt, von ohrenbetäubendem Lärm, widerlichem Gestank und drückender Hitze umgeben. Pisse und Scheiße tropften und klecksten durch den Draht und beschmutzten von oben nach unten der Reihe nach alle anderen Tiere. Ich spürte irgendetwas an meinem Hosensaum zerren: Fette Ratten huschten und drängelten sich über meine Stiefel.
Nach getätigtem Kauf schleppten wir den Plastiksack voller unruhig zappelnder Tauben zum Jeep. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir damit, sie von Hand zu schlachten und jede einzelne auf Anzeichen von Krankheiten zu untersuchen. In einem dürren Kadaver fanden wir eine große Abkapselung gelblich faulender Flüssigkeit um das Herz herum. Salman warf ihn weg. Dafür mussten wir mehrere gefangene wilde Spatzen töten, die in Käfigen hinter dem Haus herumhüpften. Als wir sie geatzt hatten, entspannten sich die Falken zusehends. Wir trugen vorbereitete Akazienpaste, ein natürliches Antibiotikum, auf ihre Füße auf und ließen sie dort ihre Arbeit verrichten.
Um Mitternacht wurde ich geweckt. Ich sollte eine kleine Tasche packen, und dann machten wir uns auf den Weg zum Busbahnhof.
Vor den Toren der Stadt vergehen mehrere Stunden, während der Bus in der Schwärze dahinrollt. Bei Tagesanbruch taucht der Sindh drohend vor uns auf, ausgedehnte Flächen voller Ziegeleiöfen, die Feuer und Rauch speien und Lehm zu soliden, praktischen Ziegeln brennen. Ödes Land.
An der Endhaltestelle nehmen wir uns ein Taxi und halten schließlich am Straßenrand in der Nähe eines winzigen Dorfes an. Die Landschaft hat sich verändert: Sie ist jetzt fruchtbar und erstreckt sich flach in einem riesigen Streifen von links nach rechts. Bewässerungsgräben ziehen sich waagerecht bis in weite Ferne, überall finden sich kleine Ansammlungen von Bäumen und Sträuchern. Vor uns erhebt sich eine niedrige, unscheinbare Mauer, in ihrer Mitte, teilweise hinter einer Palme verborgen, eine Tür.
Dahinter breitet sich ein großes, rechteckiges Grundstück aus. In drei Ecken sind willkürlich bescheidene Häuser gebaut, entlang der Mauer finden sich zwei Ställe, ein Esel und eine Latrine. Ein Dutzend zäh aussehende Hühner und eine Hündin mit Welpen stolzieren und tollen in der Sonne herum.
Wir werden von vier Männern – Manzoor, Chanesar, Jamal und Haider – begrüßt. Ihre Kinder tragen zwei Sitzgelegenheiten aus Bastseilen in die Mitte des Grundstücks, und wir setzen uns. Drei der Männer verschwinden in ihren Häusern und tauchen nur wenige Augenblicke später wieder auf – jeder mit einem großen Habicht auf der Faust.
Die Habichte sehen sich um, suchen die Umgebung nach kaum wahrnehmbaren Bewegungen ab und blinzeln in der nun grellen Welt um sie herum. Zwei von ihnen, ein männlicher und ein weiblicher Vogel, also Terzel und Habichtweib, haben rötlich orangefarbene Schlieren auf der gewölbten gelben Iris, eine Farbabstufung so subtil wie Tinte, die auf Löschpapier verläuft. Die Farbe ihres Gefieders besteht aus einer Mischung aus hellen Brauntönen mit einem Hauch von Schiefergrau auf Schwingen und Rücken. Diese dunkleren, ins Bläuliche tendierenden Federn tauchen sporadisch hier und da auf und folgen keinem erkennbaren Muster. Die vielfältige Farbgebung deutet darauf hin, dass die beiden Vögel allmählich ins Alterskleid wechseln, das sich schon fleckenweise zeigt und mit der Zeit immer deutlicher und leuchtender hervortreten wird.
Das lupenreine Gefieder des kleineren Weibchens umfasst Karamell-, Creme-, Hellbraun- und Weißtöne. Ihre Farben sind eher gedämpft, und verglichen mit dem Männchen ist sie bestens getarnt. Sie ist zwar ein Jungvogel, erst dieses Jahr vor weniger als acht Monaten geschlüpft, aber bereits voll ausgewachsen.
An den Seiten der Habichte stehen kurze, gefiederte Hosen ab, die den Eindruck erwecken, als trügen sie einen Hosenrock. Daraus ragen unten Beine und Füße dick, kompakt und ungeheuer kräftig hervor. Die mittlere Zehe ist rund siebeneinhalb Zentimeter lang und so breit wie der Finger eines Mannes. Die Länge der Zehe wird von der keratinschwarzen, sichelförmig gebogenen Klaue noch einmal verdoppelt. Unter der blassgelb geschuppten Haut verbinden Sehnen Zehe und Klaue mit den Muskeln am oberen Ende des Beines.
Beide Habichte sind Wildfänge und die ersten wilden Habichte, die ich je gesehen habe. Sie sind zwar abgetragen, bewegen sich jedoch am Rande der Kluft zwischen Domestizierung und unverfälschtem Instinkt. Bevor sie in Kontakt mit dem Menschen kamen, waren sie aus dem Land heraus entstanden. In Ruhe bilden sie einen Widerspruch in sich selbst: zu gleichen Teilen schön und zerstörerisch. Ihre rohe Gewalt ist von ihrer zarten gefiederten Zerbrechlichkeit gleichzeitig untermauert und überlagert. Eine so feine und subtile Weichheit würde man in etwas so Tödlichem nicht erwarten. Sie ersticken den Raum geradezu mit ihrer Präsenz, ihre äußerliche Ruhe ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass sie sich in ihrer Umgebung absolut wohl fühlen. Ich finde sie ungeheuer faszinierend.
Ich hatte davor schon viele Habichte gesehen, alles vom Menschen erschaffene Wesen, entweder durch künstliche Befruchtung oder in Gefangenschaft gezüchtet. Mit ihnen lassen sich diese Vögel nicht vergleichen: Jeder von ihnen besitzt etwas einzigartig Originäres, etwas Befreites, eine Lebenskraft weit jenseits menschlicher Regeln und menschlicher Kontrolle. Sie preisen die absolute Freiheit. Ihre kompromisslose Vitalität, ihr Kontext und ihre Geschichte stellen meine Welt auf den Kopf.
Um das verstehen zu können, müssen wir uns kurz den Wurzeln und der Historie der Falknerei zuwenden.
Vor mehr als fünftausend Jahren, zur Blütezeit der allerersten Königreiche in der Menschheitsgeschichte, vor den ersten geschriebenen Worten, vor den ersten Aufzeichnungen, lange vor dem Konzept geprägter Münzen und der Erfindung des Papiergelds, lange vor der organisierten monotheistischen Religion, zweitausendsechshundert Jahre vor dem Islam und dreitausend Jahre vor dem Christentum, sah ein Mensch oder sahen Menschen in den Steppen Russlands einem Greifvogel dabei zu, wie er in der Wildnis Beute machte.
Als sie das Tal hinunter und auf den Vogel zugingen, erschreckten sie ihn. Er flog davon und ließ seine Beute zurück. Das frisch getötete Wild lag halb aufgefressen vor ihnen auf dem Boden. Sie hoben es auf, sahen es sich an, nahmen es mit ins Lager und aßen es. So überlebten sie die Nacht. Da es ihnen nicht genügte, nur willkürlich auf zurückgelassene Beute zu stoßen, beschlossen die Menschen, einen Greifvogel zu fangen, ihn abzurichten und seine natürlichen Jagdfähigkeiten dazu zu nutzen, ihnen Nahrung für ihre Familien zu verschaffen.
Die Falknerei war geboren.
Es gibt keinerlei schriftliche Zeugnisse davon, dass dies jemals so geschehen ist, doch stammen Abbildungen von Menschen, die mit Greifvögeln jagen, aus dieser Zeit. Neben Hunden und Pferden stellt die Jagd mit dem Beizvogel eines der ältesten Beispiele des Zusammenschlusses von Mensch und Tier zu einem gegenseitig nützlichen Bündnis dar. Und die drei Habichte vor mir sind direkte Abkömmlinge dieser ungebrochenen Tradition. Die Methoden, mit denen die Stammesfalkner die Vögel fangen und abtragen, sind ebenso wie die Jagdmethoden die gleichen, deren sich die ersten Falkner in den Steppen Russlands bedienten. Die Habichte vor mir sind eine Art Zeitkapsel: In ihnen steckt Wissen, das sich quer über Kontinente und Kulturen erstreckt. Ihr Abtragen und ihre Existenz sind gewissermaßen ein Handschlag unbekannter Vorfahren, ein annähernd neunzig Generationen altes Mem, das die Zeiten überdauert hat – noch immer lebendig, noch immer Realität, noch immer wesentlich. Ich komme mir klein vor in ihrer Gegenwart.
Eben hat Haiders kleiner Habichtterzel die Hühner bemerkt, die zu meinen Füßen im Staub herumpicken. Sein Kopf folgt ihnen in einer einzigen, langsamen, flüssigen Bewegung. Plötzlich ein Stimmungswechsel: Er legt erkennbar die Federn an, dann entspannt er sich. Er schüttelt sich und gähnt. Bald wird er zum Jagen bereit sein.
Wenige Stunden später steht die Sonne als leuchtend weiße Scheibe tiefer am Himmel, und mit der sinkenden Sonne sind auch die Temperaturen etwas gefallen. Dies ist wichtig für die Vögel. Haider steht auf und bewegt sich nun auf eine direktere, weniger gemütliche Art. Chanesar geht in die Hocke und nimmt den Boden unter die Lupe; er untersucht die Kotspritzer der Vögel im Staub. Was normalerweise ein schwarzer fester Anteil in einer weißen Flüssigkeit ist, hat sich zu viridiangrünem Schaum vor einem opak-kreidigen Hintergrund gewandelt. Diese Veränderung in Farbe und Beschaffenheit des Kots deutet darauf hin, dass der Vogel die gestrige Nahrung nun vollständig verdaut hat.
Proteinmangel und Tageszeit spiegeln sich im Appetit des Greifvogels wider. Die Habichte werden merklich unruhiger: Die Federn auf dem Kopf haben sie zu einem niedrigen Kamm aufgestellt, die Ränder dünn und zerklüftet wie der Umriss einer getrockneten Kardendistel. Sie beginnen, mit dem Kopf hin und her zu wippen, die Pupillen weiten sich. Die Habichte sind nun in einer ganz bestimmten Verhaltensphase: Sie sind in Yarak,in Jagdstimmung.
Wenn sich ein Greifvogel in der Natur konstant auf Messers Schneide zwischen Verhungern und Jagderfolg bewegt, wenn er nur vom einen Beutemachen zum nächsten lebt, wird er immer schwächer und ineffizienter und stirbt schließlich. Beim natürlichen Jagen hat ein Greifvogel mehr Misserfolge als Erfolge. Neun von zehn Versuchen scheitern. Deshalb muss ein Greifvogel nicht nur schnell sein, er braucht auch Ausdauer, er muss geistig wach, konzentriert und bei der Jagd erbarmungslos sein. Wilde Greifvögel, die es bis zum Altvogel schaffen, verfügen über üppige Fettreserven, sie sind stämmig und in perfekter Kondition. Für einen Greifvogel in freier Wildbahn ist Hunger nicht notwendigerweise immer der motivierende Faktor. Er jagt, weil dies sein Sinn und Zweck ist, manchmal sogar aus Vergnügen. Der Trieb, auch ohne nagenden Hunger zu fliegen und zu töten, nur aufgrund des Appetits allein, ist ein Anzeichen der erfolgreichsten, potentesten und gesündesten Greifvögel überhaupt.
Aus diesem Grund ist es nicht leicht, einen falknerisch gehaltenen Greifvogel in Yarak zu bringen. Lediglich die geschicktesten Falkner schaffen es relativ durchgängig. Ein schwerer, übergewichtiger Vogel, der von den Elternvögeln aufgezogen oder in freier Wildbahn gefangen wurde, hält sich nicht gern in der Nähe des Menschen auf und fliegt weg. Den Vogel in Yarak zu bringen erfordert Zeit und Hingabe. Er muss die richtige Kondition haben, täglich geflogen werden und mindestens jeden zweiten Tag Beute machen. Damit dies gelingt, brauchen Vogel und Falkner Zeit, Raum, das geeignete Land und jede Menge Beute.
Ich sehe zu, wie Haider seinen Habicht auf die Faust nimmt und sich ihn ganz nah ans Gesicht hält. Er blickt dem Vogel eindrücklich in die Augen und drückt ihm die Finger tief ins Brustgefieder. Der Habicht macht keine Bewegung, er protestiert nicht, er ist völlig entspannt. Haider ertastet sein Gewicht, beobachtet seine Reaktionen, nimmt durch Betrachten und Berühren selbst die kleinsten Signale wahr, die der Vogel aussendet. Und der Habicht erzählt ihm detailliert, wie sehr er in Yarak ist, wie nah am Jagen.
Später darf auch ich den Habicht anfassen. Er hat die Form eines kleinen Fasses. Das Brustbein fühlt sich nicht im Geringsten knochig an, eher wie der schmale Kiel eines Schiffs. Die Muskeln sind kompakt und rund, prall und mollig. Mir ist weder davor noch danach ein Greifvogel begegnet, der so fit und gut auf die Jagd vorbereitet war wie dieser.
Mit der zunehmenden Aktivität ist die Spannung auf dem Grundstück beinahe greifbar. Nach und nach treffen die anderen Mitglieder des Stammes ein und laufen am Eingang durcheinander. Unsere Jagdgesellschaft wird immer größer, immer mehr Freunde, Familienmitglieder, Kinder und Ältere stoßen dazu. Auch ein Falkner namens Punhal mit seinem Sperber: Er hat den Großteil des Tages damit verbracht, aus einem Dorf in mehreren Kilometern Entfernung hierherzukommen, in seiner Sharkstooth-Jacke und mit seiner schicken, gefälschten TAGHeuer-Uhr.
Ein Sperber ist mehr oder weniger die Miniaturversion eines Habichts. Sie gehören beide zur Familie der Habichtartigen und ähneln einander in Psychologie und Verhalten. Die einzigen signifikanten Unterschiede bestehen darin, dass der Sperber auf kürzere Distanzen explosiv schneller ist und sich auf eine andere Beute spezialisiert hat. Der Habicht jagt größere Vögel, Kaninchen, Hasen und im Grunde alles, was springt, fliegt oder rennt und unter drei bis vier Pfund wiegt. Der Sperber hingegen hat sich in der Jagd auf kleinere Vögel und kleinere Säugetiere perfektioniert.
Bei all der Aufregung, dem Herumalbern, dem Plaudern und dem Hin-und-her-Laufen scheint sich unsere Beizjagd zu einem wichtigen, gemeinschaftlichen Vorhaben der ganzen Gegend zu entwickeln. Ich hatte erwartet, dass die vielen Menschen uns einfach nachwinken würden, wenn wir uns mit den Vögeln auf den Weg machten. Stattdessen scheinen alle mitkommen und helfen zu wollen, verbunden durch ein gemeinsames Ziel, so, wie es bei den Jägern und Sammlern überall auf der Welt schon immer üblich war.
Während wir den Jeep beladen, wandern die Greifvögel von einer Faust auf die andere. Die Habichte und der Sperber haben zwar jeweils einen Besitzer, der sich in erster Linie um sie kümmert, doch scheinen sie im Grunde der gesamten Gemeinde zu gehören. Die Wasserträger und Treiber sind so wichtig wie die Falkner selbst, jeder ist ein integraler Bestandteil der auf die Jagd gehenden Gruppe. Alles in allem zähle ich dreizehn Menschen, drei Habichte, einen Sperber und zwei Schrotflinten, die in zwei Fahrzeuge gestopft werden.
Als ich frage, warum sie sich die Greifvögel miteinander teilen, ist die Antwort ebenso logisch wie simpel. Würde der Vogel nur auf einen Falkner reagieren, könnte er verloren gehen oder getötet werden, wenn der jeweilige Besitzer nicht rechtzeitig bei ihm sein könnte. Gehört ein bestimmter Vogel nur einem bestimmten Falkner und wird dieser Falkner krank oder bricht sich beispielsweise ein Bein, kann der Vogel von niemand anderem geflogen werden. Dann wäre er so gut wie nutzlos. Da ist es viel besser, dreizehn Menschen zu haben, die gleichermaßen gut mit dem Tier umgehen können, als nur einen einzigen.
Der Jeep verlässt das Gelände, das Dorf fällt hinter uns zurück, und die Landschaft verliert alle Anzeichen offensichtlichen menschlichen Eingreifens; sie wird ursprünglicher. Zwanzig Minuten später halten wir an. Falkner und Treiber klettern aus den Fahrzeugen, stellen sich auf die Straße und begutachten die Umgebung. Salman nickt mir zu: Die Vögel sind bereit.
Die Gruppe teilt sich in zwei kleinere Gruppen auf, Salman und Chanesar nehmen den großen weiblichen Habicht mit. Ich bleibe bei Haider, seinem Habichtterzel und drei weiteren Helfern. Wir verlassen die Straße und begeben uns auf raueres Terrain hinunter, wo uns die seidig-weiche, dichte und leuchtend grüne Vegetation bis an die Brust reicht.
In dieser Gegend ist eine Art von kleinem Federwild heimisch, das von den Falknern sehr geschätzt wird. Der Frankolin, auch bekannt als Schwarzwachtel, ähnelt in Größe und Form dem Rebhuhn. Der robuste Vogel fliegt schnell und ist sehr wendig. So ist es auch für einen Habicht nicht leicht, einen Frankolin zu fangen.
Unsere Gruppe schwärmt aus, langsam schreiten wir das Gelände ab.
Haider hält die Faust mit dem Habicht hoch über seinen Kopf. Fast augenblicklich geht eine Veränderung in dem Vogel vor, er wird unruhig. Er streckt sich, wird ganz schmal auf seinen langen Beinen, der Kopf zuckt vor und zurück. Der Nacken reicht weit nach vorn, das Gefieder ist eng angelegt. Auf einmal schlägt er wild mit den Schwingen und schnellt durch das Geschüh, die Lederriemen, die um seine Knöchel geschlungen sind und die Haider fest in der Hand hält, zurück auf den Handschuh. Er hat etwas entdeckt, was wir noch nicht bemerkt haben, und nimmt die Beute bereits ins Visier. Ich bin so nah an ihm dran, dass ich sehen kann, wie sich die Augen des Vogels weiten. Das pulsierende Gelb der Iris verengt sich zu schmalen Ringen um das Schwarz der Pupille. Letztere sind nun riesig, daumennagelgroß und fähig, alles Licht und alle Bewegung vor uns in sich aufzusaugen.
Die Deckung vor uns wird dünner. Aus einer Lücke fliegt schnell und mit lautem, flatterndem Geräusch ein Frankolin auf, verschwommen und schwirrend. Der Habicht wird freigegeben und beschleunigt auf der Stelle. Zunächst steigt der Frankolin hoch auf, bildet einen Bogen, rasch, formvollendet. Der Habicht folgt ihm, überlegt neu und lässt sich dann unter und leicht hinter den Frankolin fallen. Die Sonne blitzt spiegelnd kurz auf dem Rückengefieder des Habichts auf.
Auf den ersten hundert Metern wendet der Habicht den Kopf mehrfach in Richtung Himmel. Der Frankolin wird entweder abrupt landen oder zum Horizont durchstarten. Indem er sich zurückhält, verschwendet der Habicht keine Energie, macht keine Fehler, beobachtet, wartet, klug und listig.
Zwei-, dreihundert Meter weit fliegen sie gemeinsam, der Frankolin weigert sich, abzudrehen und die Richtung zu ändern. Seine Geschwindigkeit ist wie vom Metronom vorgegeben, präzise und kontrolliert.
Die Sekunden vergehen, noch immer fliegen die Vögel parallel zueinander.
Nach fünfhundert Metern wird der Frankolin müde, ängstlich, versucht, höher aufzusteigen und dem Habicht davonzufliegen. Vollkommen synchron, wie ein Schatten, folgt der Habicht ihm. Sie fliegen weiter, einander ebenbürtig. Doch ganz unmerklich verändert sich das Gleichgewicht der Kräfte. Der Frankolin gerät in Panik, der Habicht schießt mit voller Wucht nach vorn, schneidet lautlos durch die Luft und kreuzt den Weg der Beute. Als einzelner schwarzer Punkt stürzen sie in einer langsamen, verzögerten Bewegung gemeinsam hinunter.
Ich renne durch die Hitze und die dichte Vegetation zu der Stelle, an der Habicht und Frankolin auf dem Boden aufgeschlagen sind. Ich höre eine Bell und finde den Habicht auf einem kleinen Flecken nackter, staubiger Erde zwischen Büscheln von Pampasgras. Ich beobachte genau, wie der Habicht wild an den Handschwingen an jedem Flügel des Frankolins zerrt. Der Frankolin flattert immer noch, versucht zu entkommen, doch erbarmungslos hat der Habicht seine Klauen in den Rücken der Beute geschlagen und drückt sie auf den Boden. Indem er ihm die äußersten Schwungfedern zuerst ausreißt, wird der Frankolin fluchtunfähig gemacht. Selbst wenn er sich befreien könnte, würde er so nicht mehr fliegen können und wäre im Nu wieder eingefangen. Dieses Wissen hat die Natur dem wilden Greifvogel eingepflanzt, der allein aus Instinkt handelt.
Ein paar Sekunden später ist auch Haider bei uns und kniet sich neben mich. Beide atmen wir schwer. Wir sehen uns an, lächeln und lachen dann laut auf. Verbunden durch gemeinsame Ehrfurcht und den Jagderfolg des Habichts. Mit einem kleinen Messer durchtrennt Haider sauber das Genick des Frankolins. Langsam tritt Blut hervor, dick, sauerstoffreich, tiefrot. Der Vogel zuckt, die letzten Bewegungen spulen sich ab wie ein Spielzeugpropeller an einem Gummiband, ein schnarrendes Geräusch, dann liegt er ganz still. Haider lässt den Habicht die Brusthöhle der Beute aufbrechen. Zuerst reißt er brutal an dem Fleisch, bevor er es mit äußerster Präzision herauspickt. Während sein Vogel kröpft, hebt Haider sanft den Stoß des Habichts an, damit er sich die langen Schwanzfedern am Boden nicht knickt oder gar bricht. Der Vogel bleibt entspannt, es stört ihn nicht, angefasst zu werden.
Hat ein Greifvogel Beute gemacht und gefressen, sucht er sich einen sicheren Ort zum Ausruhen. Nachdem Haiders Habicht seine Belohnung bekommen hat, sieht auch er sich nach einem erhöhten, sicheren Ort um. Bäume gibt es in der Nähe keine, und so scheint ein eins achtzig großer weißer Mann aus dem Westen der geeignetste Ort zum Verdauen einer Mahlzeit zu sein. Der Habicht fliegt auf und landet auf meiner Schulter. Noch unzufrieden klettert er höher, auf meinen Kopf. Ich kann den Druck der scharfen Klauenspitzen unter meiner Kappe spüren, doch keinerlei Anzeichen von Aggression. Wie aufs Stichwort erscheint der Rest der Gruppe. Die Leute sehen den Habicht auf meinem Kopf und fangen lachend an zu klatschen.
Der Frankolin wird vom Boden aufgehoben und inspiziert. Er weist ein komplexes Muster aus Braun-, Erd- und Schlammtönen auf, dazwischen zart gesprenkelte gelbe Tupfer. Der Vogel lebt zwar nicht mehr, ist aber immer noch faszinierend. Der Kreatur, die sich im gleichen Zeitraum der Evolution mit ihm entwickelt hat, ebenbürtig, sind seine Jagd und sein Tod zwar sicherlich traurig, aber auch zufällig. Die Jagd hätte so oder so ausgehen können. Heute hatte der Habicht Glück gehabt. Ich war Zeuge einer wahrhaft natürlichen Auslese geworden.
Während wir uns sortieren, um die Jagd wiederaufzunehmen, erschallt in der Ferne ein Ruf. Salmans Gruppe hat mehrere Schwarzwachteln aufgescheucht. Chanesars Habicht sucht sich eine aus und schießt mit pumpenden Schwingen über den Horizont. Der Frankolin, diesmal mit einem viel besseren Vorsprung, vertraut auf die dichte, undurchdringliche Deckung und lässt sich in sie hineinfallen. Die Falkner rennen dem Habicht hinterher und kommen Sekunden später bei ihr an. Sie wird auf die Faust genommen und auf den nächsten Angriff vorbereitet.





























