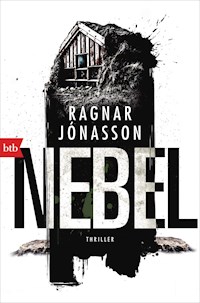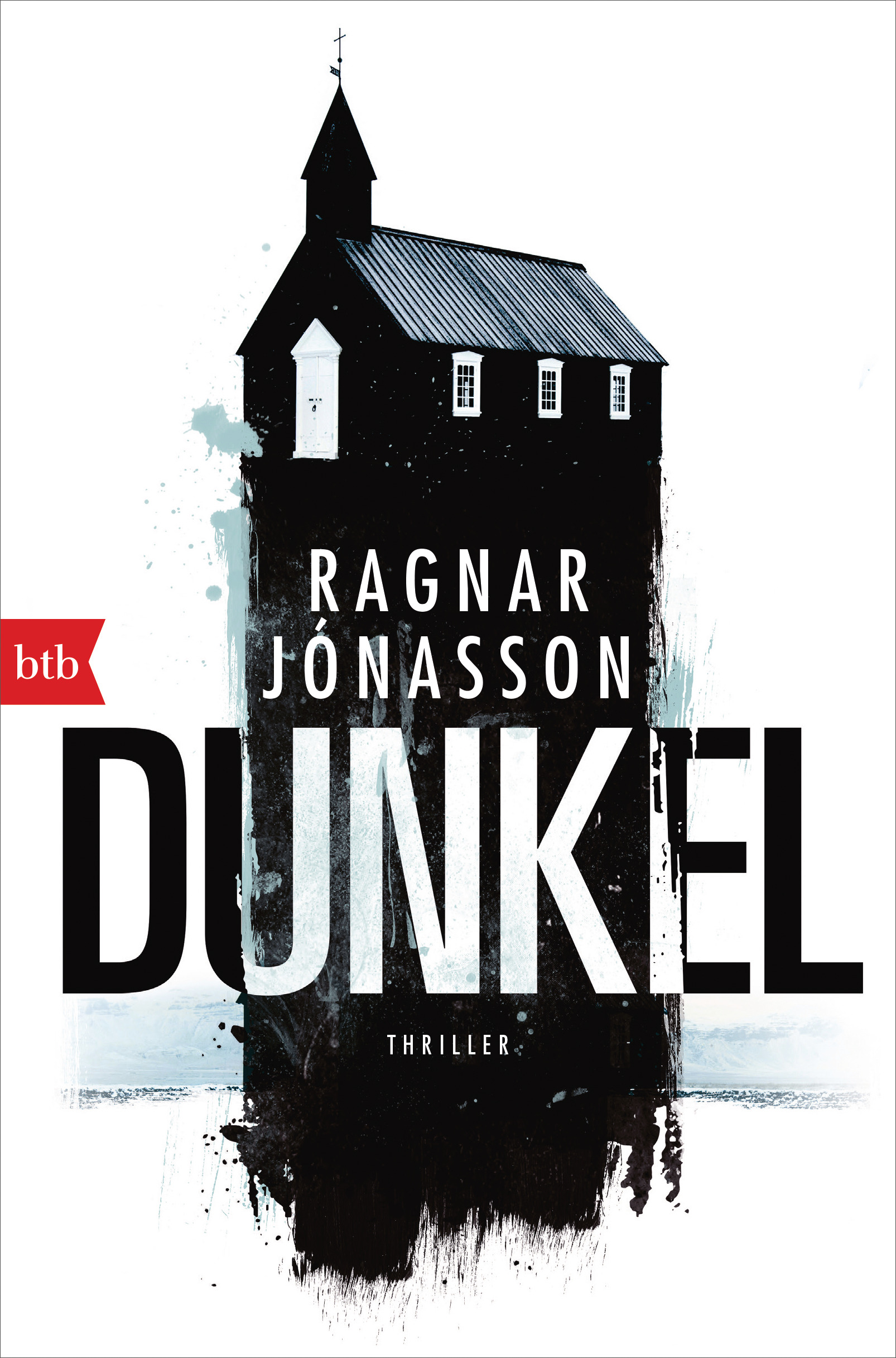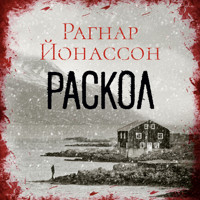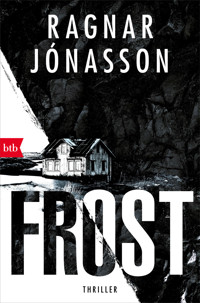
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Komissar Helgi Reykdal ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der junge Kommissar Helgi Reykdal kommt aus dem Studium in Großbritannien zurück und tritt seine erste Stelle bei der Polizei in Reykjavík an. Gleichzeitig schreibt er seine Abschlussarbeit über das größte Rätsel der isländischen Kriminalgeschichte: 1983 wird in einem alten Tuberkulose-Krankenhaus die Krankenschwester ermordert, kurz danach stirbt der Chefarzt. Was ist damals wirklich passiert? Und wieso sind die damaligen Ermittlungen von Hulda Hermannsdóttir ins Stocken geraten? Wurde sie womöglich zum Schweigen gebracht? Ein faszinierender Kriminalroman mit eisiger Atmosphäre und grandioser Spannung - vom isländischen Weltbestsellerautor Ragnar Jónasson.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Ein altes Sanatorium. Ein entschlossener Ermittler. Ein ungelöstes Rätsel.
Helgi untersucht eines der größten Rätsel der isländischen Kriminalgeschichte, einen Cold Case: die Todesfälle im Tuberkulose-Sanatorium. 1983 waren dort, im eisigen Norden Islands, eine Krankenschwester und der Chefarzt umgekommen. Was ist 1983 wirklich geschehen? Und wurde die damalige Ermittlerin Hulda zum Schweigen gebracht?
Die Fortsetzung der großen HULDA-Trilogie von Ragnar Jónasson, in der der junge Kommissar Helgi in den Fokus rückt – jener junge Mann, für den Kommissarin Hulda Hermannsdóttir in »DUNKEL« ihren Schreibtisch räumen musste.
Zum Autor
RAGNARJÓNASSON, 1976 in Reykjavík geboren, ist Mitglied der britischen Crime Writers’ Association und Mitbegründer des »Iceland Noir«, dem Reykjavík International Crime Writing Festival.
Seine Bücher werden in 21 Sprachen in über 30 Ländern veröffentlicht und von Zeitungen wie der New York Times und Washington Post gefeiert. Nach der SPIEGEL-Bestseller-Trilogie um die Ermittlerin Hulda Hermannsdóttir erscheint mit »FROST« eine unabhängige Fortsetzung der Reihe.
Ragnar Jónasson lebt und arbeitet als Schriftsteller und Investmentbanker in der isländischen Hauptstadt. An der Universität Reykjavík lehrt er außerdem Rechtswissenschaften.
Ragnar Jónasson bei btb
DUNKEL. Thriller
INSEL. Thriller
NEBEL. Thriller
Ragnar Jónasson
FROST
Thriller
Aus dem Isländischen von Anika Wolff
Die isländische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Hvítidauði« bei Veröld, Reykjavík.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Das Zitat auf S. 7 entstammt folgendem Werk: Jóhann Sigurjónsson, »Der Becher«, in: Die Lyra des Orpheus. Lyrik der Völker in deutscher Nachdichtung, hrsg. von Felix Braun, übersetzt von Melitta Urbancic. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 1952.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2021
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Ragnar Jónasson
Published by agreement with Copenhagen Literary Agency ApS, Copenhagen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Getty images/Bragi Kort; Shutterstock/Vidar Nordli-Mathisen; Anton27
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-27498-6V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Helga Ellerts
Hinter mir harret der Tod schon
Jóhann Sigurjónsson (1880–1919)Aus dem Gedicht »Bikarinn« (»Der Becher«)
2012
Helgi
Die bedrückende Stille wurde zerrissen.
Jemand stand vor der Tür und klopfte, ziemlich energisch, nachdem er sicher schon zigmal auf die Türklingel gedrückt hatte, aber die war kaputt.
Helgi stand auf.
Er hatte mit einem Krimi auf dem Sofa gesessen, hatte sich vor dem Schlafengehen wieder einigermaßen fangen wollen, indem er in die Romanwelt abtauchte, aber so wurde das nichts.
Bergþóra und er wohnten zur Miete in der Kellerwohnung eines alten Hauses im Reykjavíker Stadtteil Laugardalur. Auch das restliche Haus war vermietet, über ihnen wohnte ein Ehepaar mit zwei Kindern. Der Eigentümer lebte wahrscheinlich irgendwo im Ausland.
Zu den Leuten von oben hatte Helgi keinen guten Draht, sie waren meist unfreundlich und mischten sich in alles ein, als hätten sie mehr zu sagen, weil sie den größeren Teil des Hauses bewohnten. Der Kontakt zwischen ihnen war daher auf ein Minimum reduziert und ziemlich unterkühlt.
Helgi ahnte, dass ebendieser Nachbar vor der Tür stand und sich mal wieder wichtigmachen wollte. Aber es gab noch eine andere, deutlich schlimmere Möglichkeit.
Langsam trat er in die Diele. Das Wohnzimmer war richtig gemütlich, alle Wände voller Bücher – seiner Bücher –, vor den Regalen stand ein bequemer Sessel und zum Fernsehen gab es ein passables Sofa. Auf dem Couchtisch standen Duftkerzen, die Helgi aber nicht angezündet hatte. Heute nicht. Dafür hatte er eine Platte aufgelegt, eine echte Schallplatte. Der Plattenspieler war neu und an das Soundsystem im Wohnzimmer angeschlossen, darauf spielte er die alten Jazz-Platten seines Vaters. Das Hämmern an der Tür durchbrach die warmen Jazz-Töne, zerriss die Ruhe, die in der Wohnung eingekehrt war.
Verdammt, dachte Helgi.
Als er die Tür fast erreicht hatte, wurde das Klopfen noch lauter und eindringlicher. Er schnappte nach Luft, legte die Hand auf die Türklinke und wartete, nur einen kurzen Moment. Dann öffnete er die Tür.
Draußen stand ein uniformierter Polizist, ein junger Mann, vielleicht fünfundzwanzig Jahre alt, gedrungen und mit ausdrucksstarkem Gesicht. Er stand im Schein der Außenlampe, hell erleuchtet in der Dunkelheit, und wirkte konzentriert, als erwartete er einen Konflikt. Helgi kannte den Mann nicht. In seinem Schatten stand ein weiterer Polizist, der Helgi etwas entspannter vorkam, obwohl er sein Gesicht nicht sehen konnte.
»Guten Abend«, sagte der Polizist, der im Licht stand. Er klang nicht so ernst, wie Helgi erwartet hatte, seine Stimme zitterte sogar leicht. Wahrscheinlich wirkte der Mann nur so konzentriert, weil er seine Unsicherheit überspielen wollte. Vielleicht war das sein erster Einsatz. »Helgi? Helgi Reykdal?«
Helgi war nicht viel älter als sein Gegenüber, gut dreißig, aber er fühlte sich dem jungen Polizisten überlegen.
»Ja, Helgi Reykdal. Was gibt’s?«, fragte er mit fester Stimme. Rückte die Machtverhältnisse zurecht. Das hier war sein Zuhause, und sie störten ihn spät am Abend.
»Es ist, wie soll ich sagen …« Der Polizist zögerte, was Helgi nicht überraschte. »Es ist eine Beschwerde eingegangen …«
Helgi fiel ihm ins Wort.
»Eine Beschwerde? Von wem?« Helgi würde sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
»Tja, wir … das dürfen wir Ihnen nicht sagen.«
»Mein Nachbar da oben, stimmt’s?«, sagte Helgi und lächelte. »Dieser Hund, der beschwert sich ständig über irgendetwas. Ich glaube, er ist unglücklich in seiner Ehe. Man darf nicht die Stimme erheben, noch nicht einmal den Fernseher aufdrehen, schon hämmert er mit dem Besenstiel auf den Boden. Und wie ich sehe, hat er jetzt sogar die Polizei gerufen.«
»Er hat einen lauten Streit gehört …« Der Polizist hielt mitten im Satz inne, als er merkte, dass er zu viel verraten hatte. »Also, ja, es ist eine Beschwerde eingegangen …«
»Das haben Sie bereits gesagt«, sagte Helgi bestimmt.
»Eine Beschwerde, dass es laut geworden ist. Es wurden Streit und Schreie gehört. Mehr als bei einer normalen Auseinandersetzung.«
Jetzt trat der andere Polizist aus dem Schatten heraus, machte einen Schritt auf Helgi zu und sah ihm in die Augen.
»Tatsächlich! Ich wusste doch, dass mir der Name bekannt vorkam«, sagte er zu Helgi.
Auch Helgi erinnerte sich sofort, als er den Mann sah. Sie hatten im vergangenen Jahr hin und wieder gemeinsame Schichten bei der Reykjavíker Polizei gehabt. Aber sie kannten sich nur flüchtig.
»Reimar«, stellte der Polizist sich vor. »Du warst doch letzten Sommer bei uns, oder?«
»Ja, ein Sommerjob nach der Ausbildung. Danach habe ich studiert, Kriminologie«, antwortete Helgi.
»Ja, stimmt, ich erinnere mich, das hat mir jemand erzählt. In Großbritannien, oder? Mit dem Gedanken habe ich auch oft gespielt, mich noch weiterzubilden«, sagte Reimar.
Helgi nickte. Er stand immer noch in der Tür und demonstrierte, dass er hier der Hausherr war. »Das stimmt. Streng genommen bin ich immer noch Student, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit. Aber wir sind schon zurück nach Island gezogen, weil meine Frau hier einen guten Job gekriegt hat.« Helgi lächelte.
»Schön, dich wiederzusehen«, sagte Reimar. »Tja, vielleicht nicht unter den erfreulichsten Umständen. Es gibt Probleme mit dem Nachbarn, sagst du?«
»Ja, das kann man wohl sagen. Dieser Idiot. Aber das ist zum Glück nur eine Mietwohnung, früher oder später ziehen wir hier sowieso aus.«
»Er sagt, er hat Lärm gehört«, schaltete sich der andere Polizist wieder ein. Jetzt klang er deutlich ruhiger.
»Das stimmt schon, es gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen mir und meiner Frau. Aber nichts, weshalb man die Polizei rufen müsste. Wie gesagt, man muss nur den Fernseher mal ein bisschen lauter drehen, schon steht der Kerl auf der Matte. Diese alten Häuser sind so verdammt hellhörig.«
»Da sagst du was. Ich wohne auch in so einem Haus in der Weststadt«, sagte Reimar.
»Es tut mir leid, dass ihr wegen so etwas ausrücken musstet«, sagte Helgi und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Wollt ihr mit meiner Frau sprechen? Euch vergewissern, dass alles in Ordnung ist? Sie schläft, aber ich kann sie natürlich wecken.«
Reimar lächelte. »Nicht nötig.«
Sein Kollege schien etwas einwenden zu wollen. Helgi sah ihn an, und es war, als verschluckte das Schweigen seine Einwände.
Schließlich ergriff Reimar wieder das Wort: »Entschuldige die Störung, Helgi. Ich hoffe, wir haben dich nicht geweckt.«
»Schon gut, ich habe noch gelesen.«
»Kommst du nach dem Studium denn wieder zu uns?«
»Ich arbeite daran. Bin gerade in Gesprächen mit der Reykjavíker Polizei, dass ich vielleicht im Frühjahr einsteige. Das wäre schon ein Traumjob.«
»Sehr schön, dann sehen wir uns sicher bald wieder.« Er streckte die Hand aus. Helgi verabschiedete sich per Handschlag und schloss die Tür.
Er atmete tief durch. Das war ja noch mal gut gegangen. Er hätte nicht gedacht, dass der Idiot da oben tatsächlich die Polizei rufen würde, obwohl er es zu einem gewissen Grad verstehen konnte, denn es war wirklich ganz schön laut geworden.
Sein Herz klopfte unangenehm schnell, aber er war zufrieden, dass er den Polizisten gegenüber so besonnen aufgetreten war. Da half die Erfahrung, die er bei der Polizei gesammelt hatte.
Er setzte keine großen Hoffnungen in einen zweiten Anlauf mit dem Krimi, aber versuchen wollte er es trotzdem noch einmal. Wollte sich von dem blöden Nachbarn nicht auch noch den Rest des Abends versauen lassen. Er arbeitete unter Hochdruck an seiner Abschlussarbeit und musste aufpassen, dass er sich zwischendurch genügend Verschnaufpausen gönnte. Am allerbesten schaffte er das bei einem guten Buch auf dem Sofa.
Sein Vater war Antiquar im Norden Islands gewesen, mit einem besonderen Faible für übersetzte Kriminalliteratur, die er mit Eifer gesammelt hatte. Auch seinen Sohn hatte er bereits in jungen Jahren mit dem Krimi-Virus infiziert. Nach dem Tod des Vaters hatte Helgi die Sammlung geerbt und hielt sie seitdem in Ehren. Einen großen Teil der Bücher kannte er bereits, aber noch nicht alle, das holte er jetzt nach, aber er genoss es auch, Bücher noch einmal zu lesen, die er als Jugendlicher verschlungen hatte.
Er ließ sich aufs Sofa fallen und schlug den Krimi auf. Mord im Irrenhaus von Patrick Quentin, eine alte, zerfledderte Ausgabe. Der erste Roman mit Detektiv Duluth, zu dem es im isländischen Radio ein Hörspiel gegeben hatte, ziemlich gut gemacht, wenigstens hatte er das als Jugendlicher so empfunden. Daraufhin hatte Helgi den Roman auf Englisch gelesen. Es ging um Morde in einer Nervenheilanstalt, in der Duluth wegen seines Alkoholismus behandelt wurde. Ein ziemlich ungewöhnliches Thema, dafür, dass der Roman in den 1930ern, im goldenen Krimizeitalter, erschienen war. An dieses Buch hatte Helgi in letzter Zeit häufiger gedacht, wegen seiner Abschlussarbeit. Todesfälle in einem Krankenhaus …
Helgi las ein paar Seiten, doch er konnte sich nicht richtig konzentrieren. Vielleicht lag es an der Qualität des Buchs, aber er glaubte eher, dass die Polizei – oder vielmehr: der Nachbar von oben – schuld daran war. Dieser Besuch hatte ihn aus der Bahn geworfen. Vielleicht hob er sich das Buch besser fürs Wochenende auf und ging jetzt schlafen. Er würde auf dem Sofa schlafen, wie immer nach solchen Auseinandersetzungen. Wie immer war er derjenige, der sich opferte.
Vorsichtig legte er das Buch auf den Tisch – mit seinen Büchern ging er äußerst sorgsam um. Diese alten Krimis waren ihm kostbar, auch wenn sie in Wirklichkeit sicher nicht viel wert waren.
Wenn er ehrlich war, freute Helgi sich sogar aufs Schlafen, er schlief meist gut und brauchte auch alle Kräfte für den Endspurt des Studiums. Das Thema seiner Abschlussarbeit war ziemlich ungewöhnlich, und er war erstaunt gewesen, dass der Professor in Großbritannien sich darauf eingelassen hatte.
Diese Nacht mussten Sofakissen und eine dünne Decke als Bettzeug reichen, aber das machte nichts, er war einiges gewohnt. Außerdem war es angenehm warm in der Wohnung.
Er zog sein weißes Hemd aus, hängte es über die Sessellehne – und bekam einen Schreck.
Zum Glück hatten die Polizisten den Blutfleck am Ärmel nicht bemerkt.
1983
Tinna
Tinna kämpfte sich durch den Regen, den Kopf eingezogen und den Regenmantel fest um sich geschlungen. Der Himmel war so grau wie selten, und im strömenden Regen verschwamm alles, die Wolken, der Gehweg, sogar die Häuser wirkten farblos in diesem Wetter. Die gesamte Umgebung war wie verblasst, und außer dem Regen waren keinerlei Geräusche zu hören. Wobei zu dieser Tageszeit, um sieben Uhr früh an einem Samstag, auch sonst nicht viel los gewesen wäre. Erleichtert erreichte sie ihr Auto und brachte sich in Sicherheit.
Tinna war jung, hatte frisch ihr Pflegestudium absolviert. Sie war in Akureyri geboren und aufgewachsen, auf dem Spítalavegur, und hatte sich riesig gefreut, als sie nach der Ausbildung in Reykjavík hier in ihrer Heimatstadt einen Job bekommen hatte, in der Nähe ihrer Eltern und der Familie. Und die Arbeit im alten Tuberkulosesanatorium war auch in Ordnung. Der einzige Haken war, dass es etwas außerhalb lag und sie nicht zu Fuß zur Arbeit gehen konnte. Die Arbeit an sich war nicht wirklich fordernd, aber ein guter Einstieg. Tuberkulose-Patienten gab es schon lange keine mehr, das war weit vor Tinnas Geburt gewesen, aber trotzdem lag über dem alten Sanatorium noch dieser unheimliche Hauch des Weißen Todes. Die Bewohner von Akureyri sprachen mit Ehrfurcht von diesem Ort, obwohl sie seit Jahrzehnten keinen an Tuberkulose Erkrankten mehr zu Gesicht bekommen hatten. Das alte Sanatorium hatte größtenteils den Betrieb eingestellt, und die Gebäude am hübschen Wäldchen standen leer, bis auf die eine Abteilung, in der Tinna arbeitete. Sie und ihre Kollegen waren hauptsächlich mit Analysen, Studien und der Optimierung von Arbeitsabläufen befasst; Patienten gab es hier keine mehr. Irgendwo in Reykjavík saßen Leute, die sich Gedanken darüber machten, wie das alte Sanatorium in Zukunft genutzt werden sollte.
Tinna war gestern spät schlafen gegangen, nachdem sie ihre Freundin Bibba besucht hatte und bis in die Nacht geblieben war. Jetzt musste sie gegen die Müdigkeit ankämpfen. Da war das Wetter nicht gerade hilfreich. Am liebsten hätte sie wieder kehrtgemacht, sich ins Bett gelegt, unter ihrer Decke eingekuschelt und dem Regen gelauscht, bis sie über dem monotonen Trommeln eingeschlafen wäre. Vielleicht hätte sie sich krankmelden sollen, aber das wäre bei den Kollegen sicher nicht so gut angekommen. Sie musste sich zusammenreißen und durch den Morgen quälen, Kaffee trinken und hoffen, dass der Tag sich noch zum Guten wendete.
Sie war morgens immer als Erste vor Ort, machte das Licht an, setzte Kaffee auf und brachte alles in Gang. Um Punkt sieben begann ihr Arbeitstag, und eine Stunde später trafen die beiden anderen Krankenschwestern ein, Yrsa und Elísabet, beide erfahrener als sie. Die Ältere, Yrsa, war seit Jahrzehnten im Job und stand kurz vor der Rente. Sie hatte, genau wie Tinna, ihre Karriere an diesem Ort begonnen und wollte sie offenbar auch hier beenden. Zweifellos hatte Yrsa in ihren ersten Jahren einen schwereren Job gemacht als Tinna, als das Sanatorium noch von Tuberkulosekranken bevölkert war. Jetzt spukten nur noch die Geister der Verstorbenen durch die Flure, dachte Tinna manchmal, obwohl sie noch nichts in dieser Richtung wahrgenommen hatte. Aber unwohl fühlte sie sich trotzdem oft, vor allem, wenn sie allein war.
Die Fahrt zum alten Sanatorium hatte ungefähr zehn Minuten gedauert, nun eilte Tinna ins Gebäude. Sie war so froh, dem Regen zu entkommen, dass ihr nicht sofort auffiel, dass die Tür, die eigentlich abgeschlossen sein sollte, es aus irgendeinem Grund nicht war. Hatte jemand am Vorabend vergessen, sie abzusperren? Es brannte auch Licht. Das war merkwürdig.
Wahrscheinlich ging das auf Yrsas Kappe, was gut war, denn dann durfte sie niemand anderem Vorwürfe machen. Denn obwohl Yrsa so ruhig und maßvoll wirkte, konnte sie sich tierisch aufregen, wenn ihr etwas nicht passte. Erst neulich hatte sie Elísabet wegen irgendeiner Kleinigkeit richtig zurechtgestutzt. Elísabet war schon deutlich länger hier als Tinna, wahrscheinlich genoss Tinna deshalb noch eine Art Welpenschutz bei Yrsa, auch wenn sie alles andere als Freundinnen waren. Im Grunde wusste Tinna kaum etwas über Yrsa, abgesehen davon, dass sie seit Jahrzehnten als Krankenschwester arbeitete. Doch – sie wusste, dass Yrsa geschieden war, aber das war auch alles. Sie sprachen nie über Privates. Yrsa hatte Tinna noch nie nach ihrer Familie oder ihren Interessen gefragt, und auch sie gab nichts über ihr Privatleben preis. Überhaupt war Yrsa eher wortkarg. Sie guckte immer bedrückt, als hätte sie in ihrem Leben zu viel Leid gesehen, und wahrscheinlich stimmte das auch. Tinna sah sie vor sich: klein, in ihrer tadellos glatten, weißen Schwesternuniform, das kantige Gesicht vom kurzen, silbergrauen Haar gerahmt, der Blick fern, in Gedanken wahrscheinlich bei irgendwelchen alten Erinnerungen, bei den Kranken, die den Kampf gegen die tödliche Krankheit verloren hatten. Eines wusste Tinna sicher: Sie würde hier nicht ihr gesamtes Berufsleben zubringen. Dieser Job war lediglich ein Sprungbrett, sie würde sich spezialisieren und spannendere Aufgaben in einem größeren Krankenhaus übernehmen. Eine langweiligere Arbeit war kaum zu finden, aber es gab die Hoffnung, dass das einstige Sanatorium bald wieder in irgendeiner Weise genutzt würde, daher hielten die Mitarbeiter durch.
Tinna stieg die Treppe hinauf, die ersten Stufen nahm sie langsam, ihre Schritte hallten durchs Treppenhaus, und ihr wurde wieder einmal unangenehm bewusst, dass sie ganz allein in diesem Trakt war. Immer war sie als Erste da, jeden Morgen, und immer hatte sie ein bisschen Schiss. Daher lief sie etwas schneller, wie immer, wenn sie sich dem Treppenabsatz näherte und das Echo lauter wurde, überwältigender, allumfassend. Oben angekommen atmete sie auf, zog vorsichtig den triefenden, gelben Mantel aus, den sie erst kürzlich gekauft hatte, und bemühte sich, nicht alles nass zu machen. Trotzdem bildete sich eine kleine Pfütze am Spind. Egal. Es würde sowieso wieder ihre Aufgabe sein, alles aufzuwischen.
Die Tür zu Yrsas Büro stand offen. Auch das war ungewöhnlich, und wieder überkam Tinna dieses ungute Gefühl. Bis ihr aufging, dass sie vielleicht gar nicht allein war. Vielleicht war Yrsa heute früher gekommen. Deshalb war die Tür unten nicht mehr abgeschlossen gewesen, und deshalb stand Yrsas Büro offen.
Tinna rief, allerdings ziemlich leise: »Yrsa, bist du schon da?«
Sie stand immer noch am selben Fleck vor dem Spind, regungslos, und sah zu, wie die Tropfen vom gelben Mantel auf die Fliesen fielen. Sie rechnete damit, dass Yrsa antwortete, barsch wie immer. Dass sie einen Kaffee bestellte, »und zwar sofort.« Doch das Einzige, was Tinna hörte, waren die Tropfen, die auf den Fliesen landeten, dumpf, aber doch ein sicheres Zeichen dafür, dass Yrsa nicht da war.
Trotzdem wollte Tinna sichergehen. Sie fühlte sich unwohl, irgendetwas war hier los, das spürte sie. Sie ging auf Yrsas Büro zu und blieb kurz vor der Tür stehen, ehe sie sie ganz öffnete.
Ihre erste Reaktion war Verwunderung, doch nur für einen kurzen Augenblick, dann kam der Schock.
Tinna sah sofort, dass Yrsa tot war, und auch, dass der Tod sie nicht auf natürliche Weise ereilt hatte. Trotzdem legte sie vorsichtig die Finger an Yrsas Hals und fühlte nach einem Lebenszeichen. Es war kein Puls zu finden.
Den Ausdruck in Yrsas Gesicht würde sie nie vergessen. Tote Menschen hatte Tinna bereits gesehen, aber in Yrsas Gesicht war nichts Friedliches. Sie schien bis zum letzten Moment um ihr Leben gekämpft zu haben, war nicht bereit für den Tod gewesen. Und das, obwohl es sicher nicht vieles gab, für das sie gelebt hatte. Dieser kaltherzige Gedanke ging ihr durch den Kopf, während sie versuchte zu begreifen, was sie da sah, und sich gleichzeitig davor scheute, weil es so furchtbar war.
Yrsa hatte immer wieder und nicht ohne Stolz betont, dass der schwere Schreibtisch in ihrem Büro ihr persönlich gehörte, ein altes Familienerbstück. Der Tisch, an dem schon mein Vater saß, hatte sie gesagt. Und jetzt lag Yrsa mit dem Oberkörper auf ihrem Schreibtisch, das graue Haar wie eine Krone um ihren Kopf. Auf dem Tisch hatte sich eine dunkelrote Blutlache gebildet, die einen schaurigen Kontrast zu der gräulichen Haut bildete. Im ersten Moment hatte sie geglaubt, das Blut sei aus Yrsas Kopf geflossen, nach einem Schlag an den Schädel oder von einer Schusswaffe, doch dann entdeckte sie mit Entsetzen die beiden abgetrennten Finger. Die verstümmelte Hand ruhte auf dem Tisch, und ein Stück daneben lagen die beiden Gliedmaßen.
Tinna wandte den Blick ab, taumelte einen oder zwei Schritte zurück und versuchte, tief durchzuatmen. Ein Teil von ihr wollte wegrennen, doch sie blieb. Die Neugier war stärker als die Vernunft. Sie betrachtete die Situation als eine Art Prüfung. Wenn sie als Krankenschwester arbeiten wollte, musste sie sich an einiges gewöhnen. Also richtete sie ihren Blick wieder auf die Leiche.
Sie hatte richtig gesehen.
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand waren abgetrennt, daher kam das Blut, und ebendieses Blut deutete darauf hin, dass der brutale Akt vollzogen worden war, als Yrsa noch lebte.
Bei dem Gedanken schauderte es Tinna.
Und auf einmal wurde ihr bewusst, dass auch sie möglicherweise in Gefahr schwebte.
Schnell warf sie einen Blick über ihre Schulter, ihr Herz klopfte wie verrückt. Hinter ihr war niemand, und da Yrsas Büro klein war, konnte sie sicher sein, dass sich auch niemand dort versteckte. Tinna stand einen Augenblick still und lauschte, doch es war nichts zu hören außer dem typischen Luftzug in dem alten Gebäude. Sie war allein, der einzige lebende Mensch in diesem Trakt, der einzige lebende Mensch im ganzen Sanatorium.
Sie verließ Yrsas Büro und achtete darauf, dass sie nichts mehr berührte. Beim Hereinkommen hatte sie die Türklinke angefasst, aber daran konnte sie jetzt nichts mehr ändern.
Als Erstes musste sie die Polizei informieren. In Yrsas Büro gab es ein Telefon, aber das konnte sie nicht nutzen. Der Oberarzt hatte auch ein Telefon, aber seine Tür war zu, und Tinna traute sich nicht, einfach hineinzumarschieren.
Also lief sie die Treppe hinunter zum Mitarbeitertelefon am Eingang. Am liebsten wäre sie einfach davongerannt, aber die Polizei musste so schnell wie möglich informiert werden, sie hatte keine andere Wahl. Sie überlegte kurz, ob sie wohl irgendwelche Spuren vernichtete, wenn sie den Hörer anfasste, aber das kam ihr doch eher unwahrscheinlich vor. Als sie die Nummer wählen wollte, fiel sie ihr beim besten Willen nicht ein. Sie rief ja nicht tagtäglich bei der Polizei an, wahrscheinlich war dies sogar das allererste Mal. Sie sah sich um, suchte das Telefonbuch, aber fand es nirgends. In einer Schublade entdeckte sie schließlich eine alte Ausgabe. Sie schlug die Nummer nach und rief an. Sofort ging jemand ran.
»Polizei Akureyri«, sagte eine raue Männerstimme.
Im ersten Moment kriegte Tinna keinen Ton heraus, war wie gelähmt vor Angst.
»Polizei«, wurde wiederholt.
Sie räusperte sich und holte tief Luft. »Ja … ja, guten Tag, Tinna ist mein Name, ich rufe vom alten Tuberkulosesanatorium an, ich …« Wieder schwieg sie, fand nicht die richtigen Worte.
»Ja? Ist etwas passiert?«
»Ja … ja, ich glaube, eine Frau wurde … ich glaube, sie wurde ermordet.«
1950
Ásta
Ásta hatte in ihren zwanzig Jahren im Tuberkulosesanatorium so viel gesehen. Zu viel.
Diese Krankheit konnte so gnadenlos sein und machte keinen Unterschied zwischen den Menschen. Diese unvorstellbaren Qualen, die viele Erkrankte durchmachen mussten, und oft konnte sie nichts tun, konnte nur versuchen, es für die Patienten etwas erträglicher zu machen, wenn sie nichts mehr zu erwarten hatten außer einem viel zu frühen Tod.
Anfangs war es am schlimmsten gewesen, denn im Laufe der Jahre hatte man die Krankheit immer besser in den Griff gekriegt, immer weniger Patienten starben, und trotzdem war der Sieg noch nicht errungen. Noch nicht. Aber man durfte hoffen, dass er nicht mehr fern war.
Die Ärzte waren spürbar optimistisch, vor allem Oberarzt Friðjón. Er gehörte der jüngeren Generation an, war noch keine vierzig, blitzgescheit und einflussreich. Der Sohn eines angesehenen Anwalts, der Bruder des Polizeidirektors, der sich in die Dinge einmischte und sich bewusst für diese Arbeit hier im Norden entschieden hatte, in einer Einrichtung wie dieser, wo gute Menschen wirklich Gutes tun konnten. Leider konnten sie nicht alle retten, noch nicht, aber Ásta spürte, dass bessere Zeiten bevorstanden, dass es früher oder später sichere Heilungschancen bei dieser furchtbaren Krankheit geben würde.
Der heutige Tag, ein grauer, verregneter Montag, war vor diesem Hintergrund besonders schlimm gewesen.
Ein neuer Patient war auf die Station gekommen. Es war immer eine Hiobsbotschaft, wenn jemand neu in diese Gemächer des Todes eingewiesen wurde. Und als wenn das nicht genug wäre, war der kleine Patient erst fünf Jahre alt. Fünf Jahre! Sie erinnerte sich noch daran, als ihr Sohn fünf Jahre alt gewesen war, der kleine Engel, unschuldig und gleichzeitig so clever. Und als sie, nur ganz kurz, einen Blick durch die Glasscheibe in das Krankenzimmer des kleinen Jungen geworfen hatte, in seine tränennassen Augen, hatte sich der Blick ihres Sohnes in seinen Augen gespiegelt. Sie hatte ein solches Mitleid mit dem Jungen. Sie wusste, wie gefährlich die Tuberkulose war, und hoffte, dass er stark genug für den Kampf sein würde. Denn sie wusste auch, dass die Krankheit keineswegs ein Todesurteil war, hatte so oft das Gegenteil erlebt, Patienten, die sich nach schwerem Kampf wieder erholten und eine zweite Chance bekamen. Die Krankheit befiel oft die Lunge, und wer sie überlebte, wurde nie wieder so kräftig wie vorher, aber er lebte, das war das einzig Wichtige. Sie hatte miterlebt, wie die Patienten, die dem Tod von der Schippe gesprungen waren, dem Leben mit offenen Armen entgegentraten. Sie hatte die Hoffnung in ihren Augen gesehen, und wahrscheinlich hatte sie genau aus diesem Grund noch nicht aufgegeben, sondern hielt diese Arbeit seit zwei Jahrzehnten durch. Die Hoffnung schenkte ihr diese Kraft und gab ihrem Leben einen größeren Sinn.
Aber es gab Tage wie diesen, an denen die Hoffnungslosigkeit die Oberhand gewann. Ein kleiner Junge, der es mit dieser Übermacht aufnehmen musste. Und er hatte es sowieso schon schwer gehabt, hieß es. Die Mutter war alleinerziehend und eine Trinkerin, hatte zwei Söhne, den kleinen Jungen und noch einen großen Sohn, wahrscheinlich noch nicht einmal vom selben Vater.
Ásta war nicht mehr weit vom Ruhestand entfernt. Sie wollte so bald wie möglich aufhören, wollte die schönen Jahre mit ihrem Mann genießen, die Enkelkinder aufwachsen sehen. Sie hatte ihr Bestes gegeben, fand sie, hatte kranken Menschen geholfen, sie gepflegt und ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Welt ein kleines bisschen besser wurde. Sie war nie auf Ruhmesorden aus gewesen und hatte auch nie welche bekommen. Eine Zeit lang hatte sie gedacht, man würde sie bitten, die Stelle der Oberschwester zu übernehmen, als der Posten vor zwei Jahren frei wurde. Aber sie wurde nicht gefragt, sondern eine junge Frau namens Yrsa bekam die Stelle. Sie kamen gut miteinander aus, obwohl sie sich privat nicht weiter kannten, aber der Altersunterschied setzte ihr doch zu. Yrsa hätte ihre Tochter sein können, war etwas über dreißig, und trotzdem war sie nun diejenige, die sagte, wo es langging. Inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt, wie immer, aber möglicherweise trug diese Rangordnung dazu bei, dass sie so früh wie möglich aufhören wollte. Alles hatte seine Zeit.
Der arme Junge. Sie musste ständig an ihn denken. Es gab natürlich andere Patienten, bei denen die Krankheit schon weiter fortgeschritten war und um die sie sich kümmern musste. Menschen, die ihr ans Herz gewachsen waren. Der kleine Junge gehörte noch nicht einmal zu ihren Schützlingen, nicht direkt, aber sie spürte eine starke Verbindung zu ihm und wollte ein Auge auf ihn haben, darauf achten, dass es ihm hier gut ging, dass er sich trotz allem nicht zu allein fühlte. Er war lebenslustig, eine Frohnatur. Erzählte immer Geschichten. Heute hatte er behauptet, sein Papa sei bei der Polizei, ja sogar Polizeidirektor. Sie hatte ihm einfach zugestimmt, es ihn glauben lassen. Vielleicht glaubte er, sein Papa würde kommen und ihn vor der Krankheit retten. Morgen würde sein Vater vielleicht Feuerwehrmann sein, oder Cowboy.
Manchmal wusste sie besser als die jungen Leute, wie wichtig der menschliche Aspekt für die Kranken war. Nicht selten entschied der Lebenswille über Leben und Tod, war ausschlaggebender als die Krankheit selbst.
Ásta hatte ihre Arbeit in diesen zwanzig Jahren gut gemacht. Hatte sich immer bemüht, anderen Gutes zu tun, und das würde sie auch weiterhin machen, bis es an der Zeit war, dass die nächste Generation übernahm.
2012
Helgi
Bergþóra war schon zur Arbeit gegangen, als Helgi aufwachte. Es war nach neun. Er hatte gut geschlafen und sich nicht herumgewälzt. Das Sofa war unter den gegebenen Umständen wirklich ein angenehmer Schlafplatz. Sie hatte ihn nicht geweckt und sich auch nicht verabschiedet. Aber damit hatte er schon gerechnet.
Am liebsten hätte er sofort ein bisschen im Peter-Duluth-Buch geschmökert, doch stattdessen stand er auf. Es lockten so viele Versuchungen, seit er nach Island zurückgekehrt war und noch keinen Job hatte, da vergingen die Stunden leicht mit Müßiggang. Aber das kam nicht in Frage. Er war immer gut organisiert und gewissenhaft gewesen, und jetzt musste er schnellstmöglich und diszipliniert seine Abschlussarbeit zu Ende bringen.
Und er musste eine Entscheidung treffen, was seine Zukunft anging. Eigentlich musste er froh sein, dass ihm mehrere Möglichkeiten offenstanden, dass er jung war und die Zukunft vor sich hatte, aber die Ungewissheit belastete ihn, ja sie machte ihm sogar ein wenig Angst.
Sein Professor in Großbritannien hatte den Kontakt zu einem Unternehmen hergestellt, das Interesse an Helgi zeigte und ihm sogar einen Job in England in Aussicht gestellt hatte. Helgi fand das spannend, hatte schon immer im Ausland arbeiten wollen, und jetzt standen ihm alle Türen offen. Nur Bergþóra war von diesem Gedanken alles andere als begeistert; bis heute war dieser Konflikt ungeklärt. Sie hatte vor allem gesagt, dass sie wenigstens an einen etwas wärmeren Ort ziehen sollten, wenn sie schon weiterhin im Ausland bleiben müssten. Einen konkreten Vorschlag hatte sie nicht gemacht. Mal abgesehen davon, dass es gar kein Jobangebot aus dem Süden gab. Außerdem wollte sie ihren Job in Island nicht aufgeben. Sie hatte sich für die Zeit seines Studiums beurlauben lassen, damit sie zusammen sein konnten, aber das war immer nur als befristete Lösung geplant gewesen. Jetzt war sie zurück auf ihrem Teamleiterposten. Sie war Sozialarbeiterin und stand unter enormem Druck, das empfand zumindest Helgi so, trotz seiner Erfahrungen aus dem Polizeidienst. Manchmal wünschte er sich, sie würde sich eine andere Arbeit suchen.
Und dann war da noch das andere Jobangebot. Helgi hatte einen Anruf von der Kriminalpolizei Reykjavík erhalten, vom Leiter der Abteilung für schwere Verbrechen, Mord und Körperverletzung. Dieses Team kannte Helgi noch nicht, denn während seines Sommerjobs bei der Polizei hatte er deutlich alltäglichere Aufgaben übernommen, von allem ein bisschen. Der Anruf kam völlig überraschend, der Mann musste über drei Ecken von Helgi erfahren haben. Andererseits war Helgi sehr erfolgreich im Studium und hatte einige gute Bekannte bei der isländischen Polizei. Wenn der Traum von einem Job im Ausland nicht wahr werden konnte, war die Reykjavíker Kriminalpolizei zugegebenermaßen die bestmögliche Alternative. Nach dem Anruf hatte es ein weiteres Gespräch gegeben, und jetzt lag die Entscheidung bei Helgi. Er konnte im Prinzip jederzeit einsteigen, er musste nur aktiv werden.
Mit Bergþóra hatte es natürlich schon ausführliche Diskussionen darüber gegeben, und sie hatte ihre Meinung ziemlich deutlich gemacht. Sie verstand nicht, warum er das Jobangebot aus Reykjavík nicht schon längst angenommen hatte. »Die warten nicht ewig, Helgi«, hatte sie immer wieder gesagt. Dabei drängte die Entscheidung nicht besonders. Offensichtlich war er derjenige, den der Abteilungsleiter in seinem Team haben wollte, und er hatte keinerlei Druck gemacht. Helgi wollte noch ein bisschen die Freiheit genießen, den Traum vom Job im Ausland noch nicht endgültig zerplatzen lassen, sondern sich langsam und behutsam davon verabschieden; wollte erst einmal richtig in Reykjavík ankommen, wo seine Karriere beginnen und mit Sicherheit auch enden würde. Das war schon in Ordnung so. Er würde sich bestimmt nicht langweilen, und er wusste, dass er ein guter Kriminalkommissar sein würde. Außerdem hatte er ja immer noch die alten Krimis, in die er flüchten konnte, wenn ihm der Alltag zu belastend wurde.