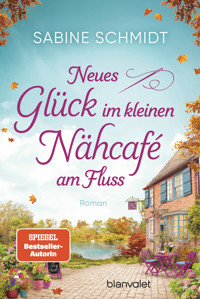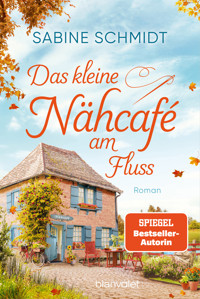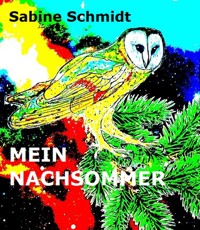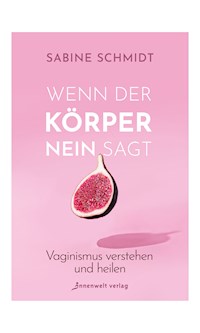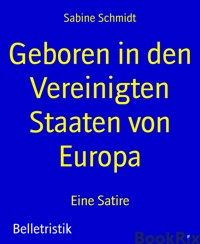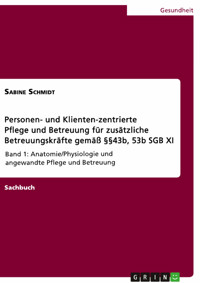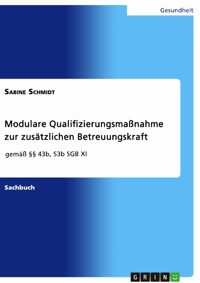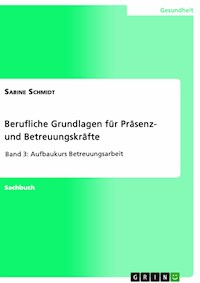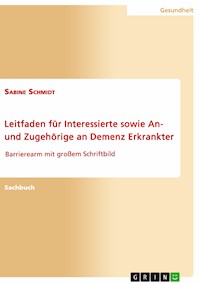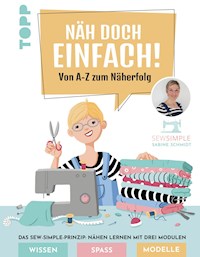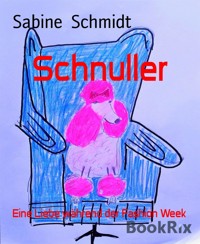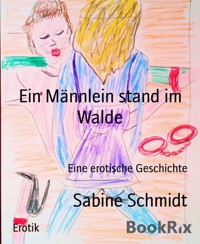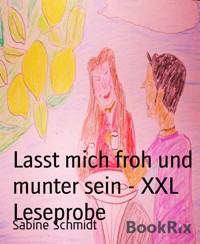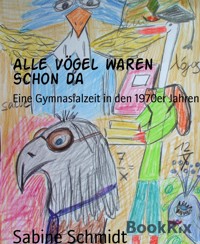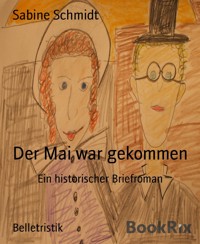13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Fachbuch aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Psychologie - Persönlichkeitspsychologie, Note: 1,7, Universität zu Köln (Humanwissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Erziehung und Anerkennung, Sprache: Deutsch, Abstract: Für ein Seminar zur Erziehung und Anerkennung habe ich die Dissertation von Christiane Deibl ,,Herausforderung und Responsivität. Reflexionen zum prekären Charakter pädagogischer Interaktionen" mit einer aktuellen Online-Studie von dem Autor Michael Nast ,,Generation Beziehungsunfähig" unter der Fragestellung „Führt das Begehren nach Anerkennung zu Beziehungs- und Bindungsunfähigkeit?“ verglichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Im Folgenden möchte ich meine vorherige Ausarbeitung zu dem Text: „Christiane Deibl - Das Begehren nach Anerkennung im Spiegel unterschiedlicher Formen des Neides“ mit einer aktuellen Online-Kolumne von dem Autor Michael Nast:„ Generation Beziehungsunfähig“ unter der Fragestellung: „ Führt das Begehren nach Anerkennung zu Beziehungs- und Bindungsunfähigkeit?“ vergleichen.
Schlagwort Selbstverwirklichung:„Entfaltung der eigenen Persönlichkeit durch das Realisieren von Möglichkeiten, die in jemandem selbst angelegt sind[1]“, oder wie auch Michael Nast sagt: „Das eigene „Ich“ ist unser großes Projekt[2]“.Ein großes Projekt da „[…] keine Generation so zwanghaft in dem Bewusstsein aufgezogen wurde, etwas Besonderes zu sein wie die heutige[3]“. „Seine Schlussfolgerung ist, dass gerade dieses Streben nach universeller Selbstverwirklichung, nach vermeintlicher Perfektion, die Beziehungs- und Bindungsunfähigkeit, von der heutzutage so viel geredet wird, ausmachen soll[4]“.
Doch was ist eine Generation?
Während Michael Nast ein Publikum im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30 ansprechen wollte, kam er zur folgenden Feststellung: „Nach den ersten Reaktionen habe ich bemerkt, es sind wohl Menschen bis Mitte 40, die das betrifft. Und dann gab es vor wenigen Wochen noch mal eine Welle, mit der die Teenager das für sich entdeckt haben. Von 16 bis 45 Jahren kann man nicht mehr von einer Generation sprechen. Das scheint wirklich eine allgemeine Befindlichkeit zu sein[5]“.
Betrachtet man jedoch den Begriff der Generation nach Mannheim:
„Generation als Einheit meint keine konkrete Gruppe, sondern in Analogie zur sozialen Struktur der Klassenlage eine „schicksalsmäßig-verwandte Lagerung bestimmter Individuen im ökonomisch-machtmäßigen Gefüge der jeweiligen Gesellschaft [6]“
kann man sowie als auch von einer Generation oder einer allgemeinen Befindlichkeit sprechen, welche unter anderem aus dem Wandel der Familienentwicklung resultiert
„So wird heutzutage der Übergang zum Erwachsenendasein in einer Altersphase zwischen dem 18. Und 35. Lebensjahr angelegt[7]“, welche die, „der Leser seiner Kolumne, sehr nahe kommt“[8]. Denn „es wird immer schwieriger- auch im Selbstverständnis der Menschen- genau zu sagen, ab wann man sich als Erwachsener versteht[9]“. So hat „das traditionelle Ereignis „Heirat und die Geburt eines Kindes“, welches den Übergang zu einem erwachsenen Menschen, neben dem eines Abschlusses einer Ausbildung und dem Beginn eines Berufslebens kennzeichnete, an Bedeutung verloren[10]“. „Im Unterschied zu den 1950er und 1960 er Jahren gibt es häufiger längere Phasen des Alleinlebens, man lebt zeitweilig in einer Paarbeziehung mit getrennten Haushalten, wohnt unverheiratet in einer Paargemeinschaft zusammen oder lebt in Wohngemeinschaften[11]“. Daher lässt sich auch zeitlich gesehen erklären, warum diese Befindlichkeit auch die Leser seiner Kolumne mit dem Höchstalter von 45 Jahren anspricht.
Michael Nast beschreibt den obigen Wandel sehr anschaulich in seiner Online Kolumne, indem er sein Leben, mit dem seiner Eltern vergleicht.
„[…]begann ich mein Leben mit dem Leben meiner Eltern zu vergleichen, an welcher Stelle sie standen, als sie in meinem Alter waren. Sie waren verheiratet, hatten ein Haus, Kinder und zwei Autos, alles war geordnet. Sie waren weiter als ich. So gesehen bin ich verglichen mit ihrem Leben gnadenlos gescheitert. Und damit bin ich nicht allein[12]“.
Darüber hinaus führt er auch die verlängerten Bildungswege an, welche die Gesellschaft auch als Begründung für eine spätere Familiengründung nehmen,
„man sagt ja, dass vierzig das neue dreißig ist; so gesehen wäre dreißig das neue zwanzig. Da passt es schon ganz gut, noch in WGs zu leben, und sich für Kinder noch zu früh zu fühlen[13]“.
Darüber hinaus ist im Hinblick auf dem Wandel der Familie „das Verhältnis zwischen dem Privatleben und dem beruflichen Bereich komplizierter geworden[…][14]“. „Im Vergleich zu früher sind heutzutage mehr Frauen als damals darum bestrebt erwerbstätig zu sein. Eine Familiengründung, welche zumindest eine zeitweilige Erwerbslosigkeit einer der beiden Partner bedingen würde, ist somit unattraktiv geworden[15]“.
„Man unterscheidet also nicht mehr zwischen Arbeit und Privatleben, sie sind heutzutage miteinander verwoben[16]“, denn „Arbeit gilt als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Wünsche und Träume und wenn man seine Träume verwirklicht, empfindet man seine Arbeit nicht als Arbeit, sondern als Leidenschaft[17]“. „Der Mittelpunkt des Lebens hat sich von dem der Familie, im Vergleich zu früher[18], auf den beruflichen Erfolg verlagert[19]“. Dieses wird mitunter durch unser heutiges Zeitalter der Technik ermöglicht[20]“. „Da wir ständig über kommunikative Medien erreichbar sind, wird die strikte Trennung von Beruf und Privatleben erschwert[21]“.
Michael Nast führt jedoch in seiner Kolumne an, dass die Arbeit nur ein Teil unserer Selbstverwirklichung ist:
„Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Wir werden zu unserer eigenen Marke. Die Frage, was unsere Individualität am treffendsten versinnbildlicht, beschäftigt uns wie keine Generation zuvor. Wir modellieren unser Leben. Wir arbeiten an unserer Karriere, an unserer Figur, und daran, unseren Traumpartner zu finden, als wäre unser Leben ein Katalogentwurf, dem wir gerecht werden wollen. Man entscheidet sich bewusst für Dinge, mit denen man sich einen angemessenen Rahmen für sein Leben zusammenstellt, die richtige Fassung gewissermaßen. Jedes Detail wird zum Statement, das unser Ich unterstreichen soll: Mode, Musikrichtungen oder Städte, in die man zieht, Magazine, wie man sich ernährt – und in letzter Konsequenz auch die Menschen, mit denen man sich umgibt. Im Spiegel habe ich schon vor einigen Jahren gelesen: „Früher ging das Leben so: Erwachsen werden, Beruf ergreifen, heiraten, Kinder und gut. Heute sind überall diese Stimmen, die flüstern, dass alles noch viel besser sein könnte: der Job, der Partner, das Leben und vor allem man selbst.“ Mit anderen Worten: Wir befinden uns in einem anhaltenden Zustand der Selbstoptimierung. Wir wissen, dass alles noch viel besser werden kann. Bis es perfekt ist. Das Problem mit dem Perfekten ist allerdings, das man diesen Zustand nie erreicht[22]“.
Doch warum ist uns, unsere Selbstverwirklichung so wichtig?
Betrachtet man die Aussage von Michael Nast:
„Das keine Generation so zwanghaft in dem Bewusstsein aufgezogen wurde, etwas Besonderes zu sein wie die heutige[23]“, wird „der Aspekt unserer heutigen Leistungsgesellschaft, welche ihren Höhepunkt ab den neunziger Jahren erreichte[24]“, deutlich.
Denn in dieser, „sind die Leistungen des Einzelnen verantwortlich dafür, welche soziale Stellung, welches Ansehen, welchen Erfolg usw. er oder sie innerhalb einer Gesellschaft einnehmen kann[25]“. „Leistungsgesellschaft“ wird also in der Regel als ein Begriff verstanden, welcher die Hierarchisierungsprozesse einer Gesellschaft beschreibt und welcher einen kontinuierlichen Vergleich zwischen den Einzelnen Individuen der Gesellschaft impliziert.
Darauf bezogen hatte auch schon Rousseau eine Definierung getroffen. In seinen Augen, „reizt und fordert die bürgerliche Gesellschaft durch die ungleich verteilten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen zum Vergleich heraus[26][…]“.
„Der Vergleich ist für die bürgerliche Existenz, in der man in seinem sozialen Sein wesentlich von derAnerkennung anderer abhängig ist, konstitutiv, kann doch die eigene Stellung, die eigene Leistung nur in Relation mit anderen ermittelt werden. Dies ruft permanent denNeid auf andere hervor, die besitzen oder können, was man selbst begehrt[27]“.
Dieser Vergleich, welcher der Nährboden für Neid ist, mag zwar „als gesellschaftlicher Motor förderlich sein, da die Individuen ihre persönliche Entwicklung bestmöglich optimieren und somit in der Lage wären die Wirtschaft anzukurbeln[28]“, für das „Privatleben ist dies bezüglich zwischenmenschlicher Beziehungen jedoch eher hinderlich[29]“.
Unsere heutige Leistungsgesellschaft und dessen Erwartungshorizont sind also mit unter Gründe dafür, warum „die Individuen den anhaltenden Wunsch verspüren ihr Selbst zu optimieren[30]“. Schwierig wird es dann, „wenn jene von ihren wichtigsten Bezugspersonen nur Wertschätzung und Anerkennung bei Erfüllung der Erwartungen bezüglich der geforderten Leistungen erhalten.
Denn dies hat zur Folge, dass die Betroffenen in ihren weiteren Lebensverläufen dazu neigen werden, sich Anerkennung durch Leistung zu erarbeiten“, welches unteranderem auch zu Burnout führen kann[31]“.
„Dass Kinder allein durch die Straßen ziehen, unbeaufsichtigt von Erwachsenen und ohne professionelle Animation, war in früheren Generationen normal- […] Heute sieht der Alltag der Kleinen ganz anders aus. Der Terminkalender der wohlbehütetenden Sprösslinge ist voll. Zwischen Musikunterricht, Sportverein, Frühenglisch und Nachhilfestunden bleibt wenig Zeit für Spontanität[32]“.
Dieses bedeutet, dass der Leistungsdruck heutzutage schon im Gegensatz zu früher seine Anfänge in der Kindheit besitzt.