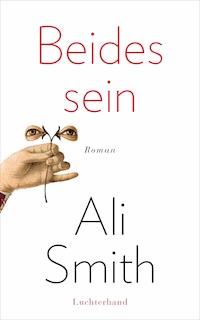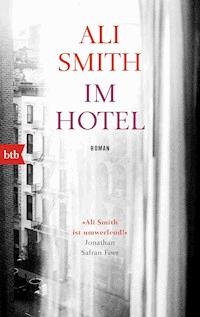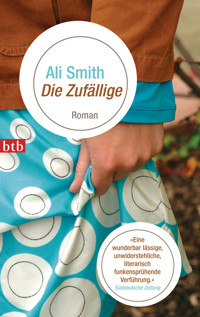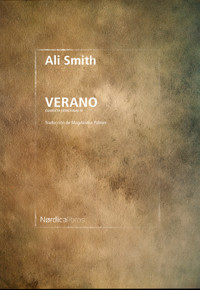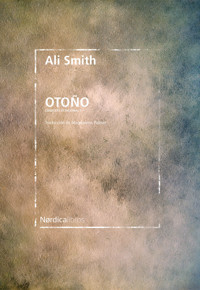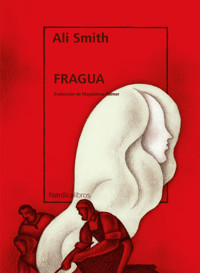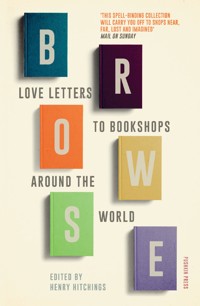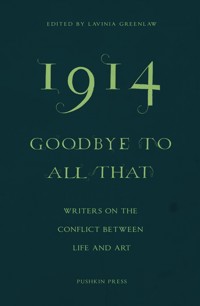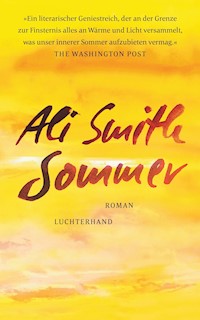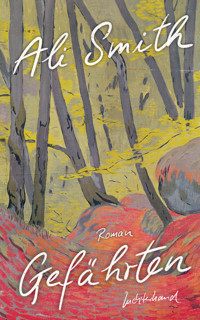
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»›Gefährten‹ ist, wie das Leben selbst, chaotisch, lustig, traurig, wunderschön und geheimnisvoll.« The Guardian
Wie keine andere fängt Ali Smith den Geist der Zeit ein und macht Hoffnung auf die Zukunft. Ihr neuer Roman ist eine überbordende Feier der Gemeinschaft in all ihren Facetten, zeitlos und gegenwärtig, legendär und rätselhaft, fordernd und tröstlich.
Sandy, eine Künstlerin, hütet Haus und Hund ihres Vaters, der während des Lockdowns im Krankenhaus liegt. Völlig unerwartet erhält sie den Anruf einer ehemaligen Studienkollegin, die sie ewig nicht gesehen hat und die ihr von einem merkwürdigen Traum erzählt. Nicht nur das, sie dringt samt ihrer Familie ungebeten in Sandys Leben ein. Und es entspinnt sich eine Geschichte über Freiheit und Unterdrückung, in der sich ein kunstvolles eisernes Schloss aus dem sechzehnten Jahrhundert und seine Schmiedin in die zunehmend chaotische Gegenwart drängen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Zwei Frauen, zwei Künstlerinnen – aus zwei Jahrhunderten.
»Ali Smith ist eine der größten lebenden Schriftstellerinnen,
die Virginia Woolf unserer Zeit.« The Observer
Sandy, eine Malerin, hütet Haus und Hund ihres Vaters, der während des Lockdowns im Krankenhaus liegt. Fünfhundert Jahre früher, im England der Pest, schmiedet eine junge furchtlose Frau ein kunstvolles eisernes Schloss: das berühmte Boothby-Schloss. Es entspinnt sich eine faszinierende Geschichte über Freiheit und Unterdrückung, in der die Gestalt der jungen Schmiedin aus der Vergangenheit zunehmend in Sandys chaotische Gegenwart drängt.
»Wunderschön und geheimnisvoll.« The Guardian
»Ein Roman für unsere Zeit.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Zur Autorin
Ali Smith, 1962 in Inverness geboren, hat mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten. Smith ist Mitglied der Royal Society of Literature und wurde 2015 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. »Gefährten« ist der Schlusspunkt ihres hochgelobten Jahreszeitenquartetts. 2022 wurde Ali Smith mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet. Sie lebt in Cambridge.
Silvia Morawetz übersetzt Literatur aus dem Englischen, u. a. von Janice Galloway, James Kelman, Hilary Mantel, Joyce Carol Oates und Anne Sexton.
Ali Smith
Gefährten
Roman
Aus dem Englischenvon Silvia Morawetz
Luchterhand
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Companion piece« bei Hamish Hamilton, einem Imprint von Penguin Random House Ltd., London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 Ali Smith
Copyright © der deutschen Ausgabe 2023
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung buxdesign / München
unter Verwendung eines Motivs von
© Undergrowth (oil on canvas) / Serusier,
Paul (1864–1927) / Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-30018-0V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
für Nicola Barkerund für Sarah Woodin Liebe
Das warme Tal der Ewiglebenden.Sie promenieren an grünen Wassern.Mit roter Tusche malen sie mir auf die BrustEin Herz und Zeichen eines gnädigen Empfangs.Czesław Miłosz
Nun Brache, ruf mich her, daß ich küsse den Mund ihres Staubes.Dylan Thomas
Passiv, wie ein Vogel, der alles sieht, allesüberfliegt, und der in seinem Herzenin die Lüfte das Bewusstsein entführt,das nicht verzeiht.Pier Paolo Pasolini
Es erzürnt mich bis ins Innerste, dass die Erde so verwundet worden ist, während wir uns alle haben blenden lassen von angeblich wertvollen geistigen Großtaten, von Schatzkammern pseudokulturellen Reichtums. Mein eigenes Leben hat an Wert verloren durch die öden Jahre, in denen ich mir Kenntnisse über die Arkana mediokrer Erfindungen angeeignet habe, wie eine von denen, die alles wissen, was es zu wissen gibt über den Helden irgendwelcher Comics oder Fernsehserien, die längst nicht mehr existieren. Das Leid, das anderen zugefügt wurde, während ich und meinesgleichen sich mit so etwas abgaben, beschwert mein Gewissen wie ein Verbrechen.Marilynne Robinson
Hammer und Hand, zum Besten angewandt.Motto der Zunft der Londoner Schmiede
Du entscheidest
’Allo ’allo ’allo. Wo soll’s denn hingehen?
Das ist die Stimme von Zerberus, dem Höllenhund mit den drei Köpfen (ein ’allo pro Kopf). Im antiken Mythos bewacht er das Tor zur Unterwelt und passt auf, dass kein Toter herauskommen kann. Seine Zähne sind messerscharf, seine Köpfe gleichen denen von Schlangen und erheben sich über seinem Rücken wie Federbüsche, er spricht aufgesetzt freundlich mit einem, scheint’s, guten alten britischen Bobby, was ein altmodisches Wort für einen Polizisten ist.
Dieser britische Polizist ist allerdings von heute, die neueste käufliche Version, und er hat den Styx überquert, steht am Eingang zur Unterwelt und zeigt den Zerberus-Köpfen Fun-Fotos von sich und anderen Uniformierten, auf denen sie herumalbern, das V-Zeichen über Bildern von Leichen echter Ermordeter machen und scherzhafte rassistische / sexistische Kommentare hinzufügen, Fotos, die er auf der lustigen Polizei-App herumgeschickt hat, die er und seine Kumpels zurzeit verwenden hier im Land der Union-Jack-Jüngelchen im Jahr des Herrn zweitausendeinundzwanzig, in dem diese Geschichte spielt, in der ich zu Beginn eines Abends in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa ins Nichts starre, und Fantasie und Wirklichkeit sich auf beklemmende Weise miteinander vermischen.
Zerberus hebt nicht einmal eine Braue (dabei könnte er, wenn er wollte, sechs heben). Ist doch nichts Neues. Sollen sich die Leichen halt stapeln, je mehr, desto besser in einem Land in Trauer, das, permanent dazu angehalten, so tut, als wäre es kein Land in Trauer.
Tragödie versus Farce.
Hatten Hunde überhaupt Augenbrauen?
Ja, Sand. Plausibilität ist wichtig im Mythos.
Ich hätte, wenn ich es genau hätte wissen wollen, vom Sofa aufstehen, den Raum durchqueren und am Kopf des Hunds meines Vaters nachsehen können.
Aber mich kümmerte nicht mehr, ob Hunde Augenbrauen hatten.
Mich kümmerte nicht, welche Jahreszeit es war.
Oder welcher Wochentag.
Zu der Zeit war für mich alles Mist einer einzigen Mistigkeit. Ich verachtete mich sogar für dieses kleine Wortspiel, auch wenn das nicht meine Art war, denn ich liebte Sprache schon mein Leben lang, sie war bei mir die Hauptperson und ich ihre ewig treue Gefährtin. Doch zu der Zeit konnten sogar Wörter und alles, was sie konnten und nicht konnten, mich mal kreuzweise, und damit hatte es sich.
Dann leuchtete mein Handy auf dem Tisch auf. Das Licht leuchtete in dem dunklen Zimmer.
Ich hob das Handy hoch und starrte darauf.
Nicht das Krankenhaus.
Okay.
Eine mir unbekannte Nummer.
Jetzt überrascht es mich, dass ich überhaupt ranging. Ich werd wohl gedacht haben, vielleicht jemand, für den mein Vater gearbeitet hatte oder ein ehemaliger Kollege, und der hatte erfahren, was passiert war, und rief an und wollte wissen, wie es ihm ging usw. Eine Spur verantwortlich fühlte ich mich schon noch bei so was. Die Auskunft hatte ich ja parat. Noch nicht über den Berg. Unter Beobachtung.
Hallo?, sagte ich.
Sandy?
Ja.
Ich bin’s, sagte eine Frau.
Aha, sagte ich, nicht klüger als zuvor.
Sie nannte mir ihren Namen.
Heute heiße ich Pelf, mein Mädchenname ist Martina Inglis.
Es dauerte einen Moment. Dann erinnerte ich mich.
Martina Inglis.
Sie war zur selben Zeit am College wie ich, im selben Jahr, im selben Kurs. Freundinnen waren wir nicht gewesen, eher Bekannte. Nein, nicht einmal Bekannte. Weniger als das. Ich dachte, vielleicht hat sie das von meinem Vater gehört (obwohl Gott weiß wie das hätte sein sollen) und rief, auch wenn wir uns kaum kannten, jetzt bei mir an (obwohl Gott weiß woher sie meine Nummer haben sollte), um mir, keine Ahnung, beizustehen.
Doch sie erwähnte meinen Vater gar nicht.
Sie fragte nicht, wie es mir ging oder was ich machte oder das Zeug, das Leute meistens sagen oder fragen.
Ich glaube, deshalb legte ich nicht auf. Sie spielte mir nichts vor.
Sie sagte, sie hätte schon eine ganze Weile mit mir sprechen wollen. Sie sei jetzt, erzählte sie, Assistentin des Kurators an einem Nationalmuseum (hättest du dir jemals vorstellen können, dass ich mal so etwas mache?) und gerade von einer Tagesreise aus dem Ausland zurückgekommen, wo das Museum sie zwischen zwei Lockdowns hingeschickt hatte, um ein aus England stammendes Truhenschloss aus einer Wanderausstellung von Objekten des Spätmittelalters und der Frührenaissance persönlich nach Hause zu begleiten, eine Schließvorrichtung, erklärte sie, ihrer Zeit weit voraus, noch dazu eine ganz ungewöhnlich gute und schöne Ausführung, historisch nicht ganz unbedeutend.
Abends also wieder hier eingetroffen, habe sie lange anstehen müssen, bis sie das vordere Ende der Schlange vor der Grenzkontrolle erreicht habe, wo die Pässe per Hand kontrolliert wurden (die meisten digitalen Lesegeräte seien außer Betrieb gewesen). Als sie schließlich ganz vorn stand, habe der Mann hinter der Scheibe gesagt, sie habe ihm den falschen Pass gegeben.
Sie konnte sich nicht denken, was er meinte. Ein falscher Pass, was sollte das sein?
Ah, Augenblick, habe sie gesagt. Verstehe. Entschuldigung, ich habe Ihnen bestimmt den gegeben, mit dem ich nicht ausgereist bin, einen Augenblick bitte.
Ein Pass, mit dem Sie nicht ausgereist sind, sagte der Mann hinter der Scheibe.
Ich habe zwei, sagte sie.
Sie holte ihren anderen Pass aus der Innentasche ihrer Jacke.
Doppelte Staatsbürgerschaft, sagte sie.
Genügt ein Land Ihnen nicht?, sagte der Mann hinter der Scheibe.
Bitte?
Ich sagte, genügt ein Land Ihnen nicht?, sagte der Mann noch einmal.
Sie sah zu seinen Augen über der Maske. Die lächelten nicht.
Das ist doch wohl meine Sache, nicht Ihre, sagte sie.
Er nahm ihr den zweiten Pass ab, klappte ihn auf, sah ihn sich an, schaute sich die beiden Pässe zusammen an, schaute auf seinen Bildschirm, tippte etwas, und nun spürte sie, dass zwei maskierte Beamte in Uniform dicht neben ihr standen, direkt hinter ihr, einer auf jeder Seite.
Wenn ich mal kurz das Ticket sehen könnte, mit dem Sie heute hier eingereist sind, sagte der Mann hinter der Scheibe.
Sie zog ihr Handy hervor, scrollte, bis sie das Ticket fand, drehte das Handy um und hielt es zu ihm hoch. Einer der Beamten nahm ihr das Handy aus der Hand und schob es dem Mann hinter der Scheibe durch. Der legte es auf ihre Pässe. Dann desinfizierte er sich die Hände aus einer Flasche auf seinem Tisch.
Wenn Sie bitte hier entlangkommen würden, sagte der zweite Beamte.
Warum?, sagte sie.
Routinekontrolle, sagte der zweite Beamte.
Sie begannen sie wegzuführen.
Ihr Kollege hat noch mein Handy. Er hat noch meine beiden Reisepässe, sagte sie.
Erhalten Sie zu gegebener Zeit zurück, sagte der hinter ihr.
Sie führten sie durch eine Tür und durch eine zweite Tür in einen nichtssagenden Gang, in dem außer einem Scanner nichts war. Sie ließen die Tasche, in der die kleine Packkiste mit dem alten Schloss darin war, ihr einziges Handgepäck, durch den Scanner laufen.
Fragten, was für eine Waffe sich in der Kiste befinde.
Seien Sie nicht albern. Das ist selbstverständlich keine Waffe, sagte sie. Der breitere Gegenstand ist ein Schloss, es war im sechzehnten Jahrhundert einmal das Schloss an der Geldtruhe eines Barons. Der längliche Gegenstand daneben ist kein Messer, sondern der Originalschlüssel zu diesem Schloss. Es ist das Boothby-Schloss. Wenn Sie etwas über englische Metallverarbeitung im Spätmittelalter und in der Frührenaissance wüssten, wüssten Sie, dass es sich hier um ein bedeutendes historisches Artefakt und ein fantastisches Beispiel für die Güte des Schmiedehandwerks handelt.
Der Beamte brach die Packkiste grob mit einem Messer auf.
Sie dürfen das nicht rausnehmen!, sagte sie.
Er hob das eingewickelte Schloss heraus und wiegte es in den Händen.
Legen Sie das zurück!, sagte sie. Legen Sie das sofort zurück!
Sie sagte es mit solcher Schärfe, dass der Uniformierte aufhörte, das Schloss von einer Hand in die andere gleiten zu lassen, und es fast linkisch in die Packkiste zurücklegte.
Dann verlangte der andere, dass sie bewies, die zu sein, für die sie sich ausgab.
Wie denn?, sagte sie. Sie haben meine beiden Reisepässe doch schon. Und mein Handy.
Sie haben also keinen schriftlichen Nachweis für einen behördlichen Auftrag zum Transport eines nationalen Kulturguts?, sagte der Beamte, der die Packkiste in den Händen hielt.
Sie wollten sie in das Zimmer bringen, das sie Befragungsraum nannten. Sie klammerte sich mit beiden Händen an die Seite des Scannerbands, machte sich so schwer sie konnte, wie die Demonstranten in den Nachrichten, und weigerte sich, freiwillig irgendwohin zu gehen, ehe sie ihr nicht die aufgebrochene Packkiste zurückgaben und sie nachprüfen ließen, dass beides, Boothby-Schloss und zugehöriger Schlüssel, noch darin waren.
Sie sperrten sie und die Tasche mit der Kiste in einen kleinen Raum ein, in dem sich nichts befand außer einem Tisch und zwei Stühlen. Der Tisch war aus grauem Plastik und Aluminium, genau wie die Stühle. Es stand kein Telefon auf dem Tisch, gab keine Fenster. Es gab auch keine sichtbare Kamera an einer der Wände, in die sie hätte winken können, auch wenn da sehr wohl Kameras sein mochten, die sie nicht sah, aber Gott weiß wo, Sand, mit einer sehr kleinen Linse kann man heute alles Mögliche machen. Linsen sind heute kleiner als Fruchtfliegen. Nicht dass es in dem Raum etwas Lebendiges gegeben hätte, abgesehen von mir. Außerdem hatte die Tür innen keine Klinke und ließ sich auch nicht zum Aufgehen bewegen, indem man an den Seiten herumtastete; sie hatte unten und an den Kanten Kratzspuren und kleine Furchen von den früheren Versuchen anderer. Es gab auch keinen Papierkorb, wie sie merkte, als nach ihrem Hämmern niemand kam, der ihr gesagt hätte, wo sich eine Toilette befand, oder der sie dort hingebracht hätte; danach ließen sie sie sehr lange, wie sich herausstellte, da drin hocken.
Später durfte sie ohne weitere Befragung und Erklärung gehen, sie gaben ihr zwar ihr Handy zurück, behielten aber ihre Pässe; die bekommen Sie, erklärte ihr eine Frau an einem Schalter, zu gegebener Zeit zurück.
Bis heute habe ich keinen von beiden wieder, erzählte sie mir. Und ich grüble immer noch. Entweder die haben mich da reingesteckt und ehrlich vergessen, oder sie haben mich mit Absicht vergessen.
So oder so, sagte ich. Ganz schönes Ding. Sieben Stunden.
Siebeneinhalb, sagte sie. Ein ganzer Arbeitstag, der auch noch um halb vier in der Früh anfing und größtenteils für Schlangestehen an Grenzkontrollen draufging. Aber siebeneinhalb Stunden. In einem komplett leeren Raum.
Das ist lange, sagte ich.
Sehr lange, sagte sie.
Ich wusste, was ich nun tun sollte – fragen, was sie siebeneinhalb Stunden lang gemacht hatte in dem komplett leeren Raum. Doch ich steckte in einer Phase meines Lebens, in der ich über Anteilnahme hinaus war, weit hinaus war über Höflichkeit und aufgenötigtes geselliges Gerede.
Ich zögerte.
Ich schwieg, gut zehn Sekunden lang.
Äh, hallo?, sagte sie.
Ich weiß nicht, wie sie das machte, aber irgendetwas in ihrer Stimme erzeugte bei mir ein schlechtes Gewissen wegen meines Zögerns.
Na gut. Was hast du die ganze Zeit da drin gemacht?, sagte ich.
Ah, daran hängt ein Märlein, sagte sie (und ich hörte ihrer Stimme an, dass sie erleichtert war, weil ich gesagt hatte, was von mir erwartet worden war). Eigentlich habe ist dich deswegen angerufen. Hör zu. Es ist etwas Seltsames passiert. Ich hab es noch niemandem erzählt. Teils, weil ich nicht weiß, wem ich es sonst erzählen könnte. Ich meine, darüber nachgedacht hab ich schon, es kam aber nichts dabei raus. Und vorige Woche dachte ich, Sandy Gray. Die Sand von früher. Als wir an der Universität waren. Die wüsste, was man davon halten soll.
Wovon?, sagte ich
und wurde innerlich langsam unruhig, weil ich, seit sich alles verändert hatte, rein äußerlich ja weitermachte wie vorher und wie wir alle so tat, als wäre alles bestens, obwohl es entsetzlich war, dabei war ich eigentlich nicht mehr im Lot und mit Sicherheit nicht mehr dieselbe wie früher.
Zuerst, sagte sie, saß ich nur reglos da, die Hände im Schoß. Ich war wütend, redete mir meine Wut aber aus. Bereitete mich auf das vor, worum auch immer es bei der Befragung gehen würde.
Dann wurde es ziemlich kalt da drin, und ich stand auf und lief ein bisschen herum, besonders groß war der Raum ja nicht, ich fing an, im Kreis zu joggen, und weil er so klein war, wurde mir von dem Im-Kreis-Herumrennen schwindlig, zum Glück kriege ich nicht so schnell Platzangst.
Dann versuchte ich noch einmal, die Tür zu öffnen. Aber ich hatte nichts, womit ich sie aufkriegen konnte. Ich erwog sogar schon, den Boothby-Schlüssel auszuwickeln und es mit dem Bart zu versuchen, der endet in einen Dorn mit einem kleinen Häkchen dran, ich dachte, damit kriege ich die Tür an der Unterseite zu fassen und schau, ob ich sie bewegen kann. Aber daran schuld sein, wenn der Schlüssel Schaden nahm, das kam nicht infrage, ausgeschlossen.
Dann fiel mir ein, ich war eigentlich noch nie längere Zeit allein mit dem Boothby gewesen oder hatte auch nur Gelegenheit, es mir richtig anzusehen.
Ich holte also die kleine Kiste aus der Tasche, sie war jetzt eh aufgebrochen, der Beamte hatte sie mit seinem Messer kaputt gemacht. Hob die beiden in Tuch eingeschlagenen Teile heraus und legte sie auf den Tisch, wickelte das Schloss aus und legte es, mit dem Tuchstoff darunter, vor mich hin. Ah, Sand, das Boothby-Schloss, wer immer das gemacht hatte, hatte Gott weiß wie wundertätige Hände. Hast du es mal gesehen?
Nein, sagte ich.
Schon mal davon gehört?
Nein, sagte ich.
Google mal danach. Du wirst begeistert sein. Wenn jemand es wirklich kapiert, dann du.
Eine Person, an die ich mich kaum erinnerte und auch nicht erinnert hätte, hätte sie sich mit dem Anruf nicht bei mir in Erinnerung gebracht, hatte all die Jahre ein Bild von mir im Kopf behalten, das sie glauben ließ, ich würde etwas »kapieren«?
Google, sagte sie, ist natürlich kein Vergleich damit, es in natura zu sehen, das echte Metall. Es ist wirklich wunderschön. Und wirklich raffiniert. Man käme beim Anschauen nicht drauf, dass es überhaupt ein Schloss ist oder dass ein besonderer Mechanismus darin steckt, ganz zu schweigen davon, dass man nicht erkennt, wie oder wo der Schlüssel eingeführt wird, mit dem man es öffnet. Man erkennt es nicht mal gleich, wenn man weiß, wo man hinsehen muss. Es ist so gemacht, dass es aussieht wie ein von Efeublättern überwuchertes Schloss, doch schon dieses Wort wird ihm nicht gerecht, so sehr ähnelt jedes Blatt aus Metall echtem Efeu, ist aber keiner, und trotzdem meint man, man würde, nähme man es in die Hand, spüren, wie es nachgibt, genauso wie man es bei einem echten Blatt spürt. Man sieht es sich an und begreift wieder, wie erstaunlich ein echtes Efeublatt ist. Und die Ranken, als würden sie buchstäblich vor deinen Augen länger, sie sind so zart, haben so einen, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, Rhythmus, es ist, als seien sie biegsam, beweglich. Wenn man versucht, alles zusammen im Blick zu behalten, schieben sich die Ranken und die Blätter förmlich innen aus dem, was der Baron oder wer immer damit absperrte, heraus und darüber hinweg. Das eigentliche Schloss, sagen Historiker der Schließtechnik, ist äußerst robust, sieht aber, wenn man es öffnet und genauer betrachtet, trotzdem ganz filigran aus, ich würde mir nicht anmaßen zu erklären, wie der Mechanismus funktioniert, aber Leute von weiter oben auf der Museumsleiter meinen, es sei für die damalige Zeit eins der am schwersten zu knackenden Schlösser, eigentlich für jede Zeit, mit der ausgeklügelten neuartigen Zuhaltung, die man noch Jahrhunderte später sonst nirgendwo fand, ich meine, eine für die Zeit verblüffend kunstfertige Arbeit, zumal die Metalle damals generell grober waren oder jedenfalls in dem Teil des Landes, in dem das Schloss gefertigt wurde, und das handwerkliche Geschick, das man brauchte, um etwas auf diesem Niveau herzustellen, ich meine, kaum vorstellbar mit den einfachen Werkzeugen, die man fürs Schneiden oder Formen ja nur hatte. Ich hab mich jedenfalls nicht getraut, es in die Hand zu nehmen, es lag da in seinem Tuch auf dem Tisch unter dem Neonlicht in diesem Nichts von einem Raum, das Metall in allen Farben vergangener Jahrhunderte schimmernd, und es war so schön, dass ich, für eine Weile zumindest, vergaß, wie dringend ich eigentlich auf die Toilette musste.
Dann meldete sich mein körperliches Bedürfnis zum zweiten Mal, viel drängender als beim ersten, und da bei meinem ersten Türhämmern nichts passiert war, geriet ich in Panik bei dem Gedanken, was ich da drin tun würde oder lieber würde lassen wollen, haha, wenn beim zweiten Hämmern wieder nichts passierte. Da hörte ich es.
Sie hielt inne.
Sie holten dich schließlich raus, sagte ich.
Nein, sagte sie. Es war nicht irgendjemand. Na ja, doch, schon. Bloß nicht physisch anwesend. Bloß – ich meine, ich hörte jemanden sprechen, als wäre er mit mir in dem Raum. Aber da drin war nur ich. Es war seltsam. Und was es sagte, war auch seltsam.
Da wird jemand nebenan sein, dachte ich mir, und das hörst du durch die Wand, die Wand weiter hinten, aber verblüffend deutlich, so deutlich, wie ich dich jetzt höre. Jedenfalls, langer Rede kurzer Sinn: Deswegen habe ich dich angerufen.
Um mir zu sagen, dass du eine seltsame Stimme durch eine Wand gehört hast, sagte ich.
Nein, sagte sie, die Stimme war nicht seltsam. Beschreiben war nie meine Stärke, wie du noch wissen wirst. Nein, was sie sagte, das war seltsam. Oder, genau genommen nicht seltsam, ich weiß bloß nicht, wie ich es sonst nennen oder was ich davon halten soll.
Was sagte sie denn?, sagte ich.
Curlew oder curfew.
Sie sagte – was?
Das, weiter nichts. Nur diese Wörter.
Curlew oder curfew?, sagte ich.
Es klang wie eine Frage, sagte Martina. Ich glaube, es war eine Frauenstimme, aber eine sehr tiefe. Für einen Mann war sie wiederum zu hoch, es sei denn, es war ein Mann mit einer Fistelstimme.
Was hast du geantwortet?, sagte ich.
Ich hin zu der Wand und gesagt, wie bitte, könnten Sie das bitte wiederholen? Und die Stimme tat es. Curlew oder curfew. Und dann noch: Du entscheidest.
Wie ging es weiter?, sagte ich.
Na, ich hab denjenigen, wer immer es war, gefragt, ob er mir helfen oder jemandem Bescheid sagen kann, dass ich auf die Toilette muss, sagte sie.
Und weiter?
Das war alles, sagte sie. Nichts weiter. Es kam niemand, gefühlt noch mindestens eine Stunde lange nicht, zum Glück habe ich noch die Blasenkontrolle eines viel jüngeren Menschen.
Klingt wie Veralbern, sagte ich.
Ich veralbere dich nicht, sagte sie. Warum sollte ich? Es war so. Ist passiert. Genau so, wie ich es dir erzählt habe. Ich veralbere dich nicht.
Nein, ich meine, als wollte jemand dich veralbern. Versteckte Lautsprecher?
Wenn es die gab, waren sie sehr gut versteckt, sagte sie. Aufnahmegeräte hab ich keine gesehen.
Ein Psychotest bei der Grenzkontrolle?
Keine Ahnung, sagte sie. Es ist mir schleierhaft. Wie auch immer. Ich rufe an, weil ich eins nicht aus dem Kopf kriege.
Na ja, so lange in dem Raum eingeschlossen, sagte ich. Schikaniert, eingeschlossen und nichts anderes dabei als ein echt altes, äh – Schloss. Das ist kein Klacks.
Nein, nicht das, sagte sie. Ich krieg das mit dem curlew nicht aus dem Kopf. Und mit dem curfew. Ich meine, was zum Teufel. Als hätte mir jemand eine Botschaft überbracht, mir etwas anvertraut. Aber was ist die Botschaft? Sand, ich kann nachts nicht schlafen, weil ich nicht draufkomme, was das bedeuten soll. Mir Sorgen mache, dass ich dem nicht gewachsen bin. Ich geh ins Bett, bin müde, richtig erschöpft. Und liege dann im Dunkeln wach und mache mir Sorgen, dass ich etwas Wichtiges übersehe, etwas, worauf ich viel mehr achten sollte.
Du kannst von Glück sagen, dass dich nur das jetzt nachts wach hält, sagte ich.
Ich meine, ich weiß, dass curlew der Brachvogel ist und curfew die Sperrstunde. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll. Wo ist hier der Witz? Ich liege da, und Edward ist lieb und alles, aber ich kann es ihm nicht sagen.
Wieso nicht?
Er ist mein Ehemann, sagte sie.
Ah.
Ich hielt das Handy von mir weg. Jemand, den ich kaum kannte, wollte mich in einen Streit über Defizite in seiner Ehe hineinziehen. Ich ließ den Zeigefinger über der Auflegen-Taste schweben.
Meinen Kindern kann ich es auch nicht sagen. Die eine würde lachen. Die andere würde mich als Cis Terf bezeichnen, was ich ja wohl bin. Neulich haben die beiden mich angeschrien, ich ließe sie nicht ausreden. Ich kapiere nicht mehr, was meine eigenen Kinder mir sagen wollen. Und im Museum kann ich es auch niemandem erzählen. Die würden mir nie wieder ein Objekt anvertrauen und mich für verrückt halten. Für eine Fantastin.
Ich sah auf das Handy in meiner Hand, aus dem heraus ihre Stimme das Wort Fantastin sprach. Legte aber noch nicht auf, sondern dachte, wie ich merkte, überraschend intensiv an das Schloss, das sie beschrieben hatte, bei dem der Weg ins Innere unter Efeu versteckt ist, ich dachte an das weiche Einschlagtuch, ausgebreitet auf einem schäbigen Plastiktisch im fensterlosen Raum auf dem Flughafen. So ein Gegenstand kann das, wohin er gerät, verwandeln, er kann zeigen, dass sogar ein nichtssagender Raum wie der, in dem sie siebeneinhalb Stunden lang eingesperrt worden war, ein Museum völlig neuer Art sein kann.
Und da bist du mir eingefallen, sagte sie mir nun wieder ins Ohr. Weil du in unserer Collegezeit auf Partys immer die Kunststücke vorgeführt hast, Träume gedeutet, anderen aus der Hand gelesen –
Äh, sagte ich (weil ich nicht die leiseste Erinnerung daran hatte, mal jemandem aus der Hand gelesen oder einen Traum gedeutet zu haben).
– und du warst immer überzeugend, wenn du erklärt hast, was eine Gedichtzeile bedeutet und so weiter. Du hast einfach durchgeblickt. Generell. Mehr als wir alle. Ganz die Kunststudentin eben. Du hattest eine Art, über Dinge nachzudenken, die jeder, der etwas normaler war, als abseitig abgetan hätte.
Normal.
Danke, sagte ich. Ich überlege.
Ich meine, klar, ich hab damals auch Kunst studiert. Oder so. Aber nie so wie du. Ich hab es wegen der Jobs getan, die man da ergattern konnte, wegen der HiWi-Stellen. Nicht dass mir Kunst nicht gefallen hätte oder nicht gefällt. Aber wie du war ich nie. So war da sonst niemand. Du warst, na ja, anders.
Ach ja?, sagte ich.
Jedenfalls, ich lag da, mitten in der Nacht, hab die Vorhänge angestarrt, da bist du mir eingefallen, und ich dachte: Sand. Ich besorg mir eine Telefonnummer oder eine Mailadresse und frage sie. Jemand wie Sand wird wissen, was das zu bedeuten hat.
Und hier ist jemand wie ich, sagte ich.
Also. Was hältst du davon?, sagte sie. Was hat das zu bedeuten?
Welcher Teil deines Erlebnisses speziell?, sagte ich.
Bloß die Wörter, sagte sie. Mich interessieren bloß die Wörter, weiter nichts.
Curfew oder curlew, sagte ich.
Andersrum, sagte sie.
Curlew oder curfew.
Curlew oder curfew. Du entscheidest, sagte sie.
Na ja, sagte ich. Das ist es doch. Man hat die Wahl. Und es hat etwas mit Zeit versus Vogel zu tun. Ich meine die Wahl zwischen Vorstellung oder Wirklichkeit, in beiden Fällen, bei der Zeit und bei dem Vogel. Die Brache ist ein Vogel, und die Sperrstunde ist eine Zeit, in der Menschen gemäß behördlicher Anweisung nicht mehr im Freien unterwegs sein dürfen. Sie müssen von Gesetzes wegen zu Hause sein.
Ja, aber das versteht sich von selbst, das weiß ich alles, sagte sie.
Deshalb die Wahlmöglichkeit, sagte ich. Fragt sich, ob es überhaupt eine echte Wahl zwischen den Vorstellungen gibt, die zwei willkürliche Wörter hervorrufen, aus deren Schreibung man schließen kann, dass ihre Paarung ein Witz ist – und die vielleicht sogar nur zu diesem Zweck erfolgte, vielleicht auch bloß, weil es fast die gleichen Wörter sind, bis auf einen einzigen Konsonanten, dessen Wechsel die Bedeutung von allem ändert, nur minimal, aber spielend.
Konsonantenwechsel, sagte sie. Oh. Oh ja. Siehst du, daran hatte ich nicht mal gedacht.
Bei der Entscheidung für eins der beiden, sagte ich, geht es um Unterschied und Gleichheit. Und um Abweichungen bei den Bedeutungen der Wörter –
(Ich hörte, wie sie am anderen Ende der Leitung mitschrieb.)
– und um alle Gemeinsamkeiten, die man bei dem feststellt, wofür die Wörter stehen. Zum Beispiel: Vögel haben Flügel, und von der Zeit heißt es, sie fliege dahin –
Ja!, sagte sie. Das ist genial. Du bist eine richtige Intelligenzbestie.
– und wenn wir nur mal für einen Augenblick, sagte ich, an die kurze Spanne denken, die das Leben eines Vogels währt, das er offensichtlich ja in Freiheit verbringt, lässt sich das dem gegenüberstellen, dass das, was wir mit der uns zugemessenen Zeit anfangen, auf die eine oder andere Art nicht bloß von der Natur bestimmt oder beherrscht werden kann oder wohl auch immer bestimmt wird, sondern auch durch äußerliche Faktoren wie Ökonomie, Geschichte, soziale Zwänge, gesellschaftliche Konventionen, die persönliche Psyche und den politischen und kulturellen Zeitgeist. Und wenn wir jetzt curlew und curfew