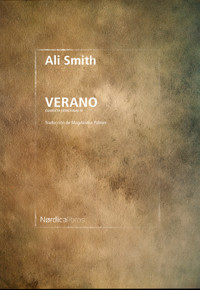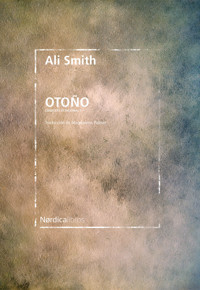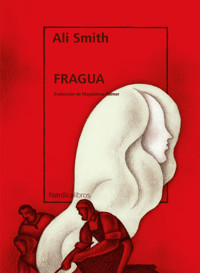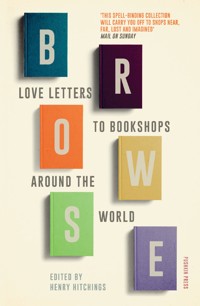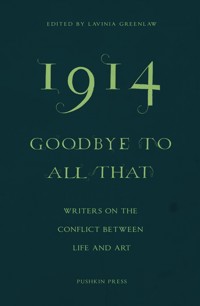15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Ali Smith die Regeln des Erzählens erklärt, entfalten sich Geschichten. Ihre Vorlesungen über Literatur sind eine Liebesgeschichte, wie sie noch keiner je gehört hat – eine Geschichte zweier Liebender ebenso wie die Geschichte der Liebe des Menschen zur Kunst und was sie für unser aller Leben bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Die Ich-Erzählerin von Ali Smiths neuem Buch ist eine Frau, die um ihre verstorbene Geliebte, eine begnadete Kunst- und Literaturwissenschaftlerin, trauert. Ein Jahr und ein Tag sind seit ihrem Tod vergangen, und immer noch kann sie nicht loslassen. In der Wohnung erinnert alles an die verstorbene Geliebte, deren Vorlesungen sind überall verstreut, und dann glaubt sie auch noch, die Erscheinung der Geliebten leibhaftig vor sich zu sehen, und beginnt mit ihr zu sprechen. Ein Dialog entspinnt sich ‒ über Kunst und was sie alles bewirken kann und wie untrennbar sie mit dem Leben verbunden ist. Sie sprechen über Michelangelo und Dickens, Ovid und Colette, Sappho, Shakespeare und Saramago, steinzeitliche Höhlenmalereien und Filmmusicals, Alfred Hitchcock oder Salvador Dalí. Und über diesem Kommentieren und Erzählen, über diesem Erinnern und Trauern gewinnt die Ich-Erzählerin ihren Lebensmut, die Lust am Schauen und Denken und Sein zurück.
Ali Smiths neues Buch ist eine spielerische und geistreiche Mischung aus Essay und Erzählung und Roman ‒ ein Fest des Entdeckens und Forschens, eine Hymne auf die Kraft der Kreativität, die uns Menschen über Zeit und Raum und bis über den Tod hinaus verbindet.
Zur Autorin
Ali Smith wurde 1962 in Inverness geboren und lebt heute in Cambridge. Sie hat mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten. Sie ist Mitglied der Royal Society of Literature und wurde 2015 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. Ihr letzter Roman »Beides sein« wurde 2014 ausgezeichnet mit dem Costa Novel Award, dem Saltire Society Literary Book of the Year Award, dem Goldsmiths Prize und gewann 2015 den Baileys Women’s Prize for Fiction.
Zu der Übersetzerin
Silvia Morawetz, geb. 1954 in Gera, ist die mit mehreren Stipendien ausgezeichnete Übersetzerin von u. a. Janice Galloway, Paul Harding, James Kelman, Hilary Mantel, Joyce Carol Oates und Anne Sexton.
Ali Smith
Wem erzähle ich das?
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz
Luchterhand
für Xandra BingleyEmma Wilson und Sarah Wood
Das Leben dieses Buches begann mit vier Vorlesungen für die Weidenfeld Visiting Professorship in Komparatistik am St. Anne’s College, Oxford, im Januar und Februar 2012. Die Vorlesungen sind hier im Wesentlichen so abgedruckt, wie sie gehalten wurden.Mein Dank gebührt allen am St. Anne’s College, weil sie dieses Buch erst möglich gemacht haben und weil sie sich so gut, klug und aufmerksam um mich gekümmert haben, vor allem Tim Gardam, Sally Shuttleworth, Matthew Reynolds und Lord Weidenfeld.
Beharre nicht auf der WelleDie sich an deinem Fuß bricht, solange erIm Wasser steht, werden sichNeue Wellen an ihm brechen.
Bertolt Brecht
Inhalt
Zeit
Form
Ränder
Angebot und Widerspiegelung
Einige bei der Niederschrift dieser Vorlesungen benutzte Quellen
Bildteil
Bildnachweise
Anhang zur deutschen Ausgabe
Abdruckgenehmigungen
Zeit
So kalt weht heut der Wind, mein Lieb,
und regnet an manchen Tagen;
ich hatte nur ein Herzallerlieb,
heut wurd es zu Grabe getragen.
Ich tu für mein einzig Herzallerlieb,
was ein junger Mann nur vermag;
und weine still an ihrem Grab
ein volles Jahr und einen Tag.
Das volle Jahr und der Tag waren verstrichen, und ich wusste mir noch immer keinen Rat. Wenn überhaupt, wusste ich mir noch weniger Rat.
Ich ging rüber in dein Arbeitszimmer und sah mir deinen Schreibtisch an, auf dem die unfertigen Sachen, das, woran du zuletzt gearbeitet hattest, noch ordentlich gestapelt lagen. Ich sah mir deine Bücher an, zog aufs Geratewohl eins deiner Bücher aus dem Regal − Arbeitszimmer, Schreibtisch, Bücher, sie waren jetzt mein.
Wie es der Zufall wollte, hatte das Buch, das ich heute aus dem Regal zog, ursprünglich sogar mal mir gehört. Es war ein Roman von Dickens, Oliver Twist, die alte Penguin-Ausgabe aus meiner Zeit an der Universität mit einem Buchrücken, dessen Orange fast völlig verblasst war, und mit einem Buchdeckel, dessen Illustration, ein Stahlstich, eine fidele Runde von Trinkern und Kindern in einem Pub zeigte und sich vom Rücken zu lösen begann. Eine Lektüre hielt das Exemplar bestimmt noch durch. Ich hatte Oliver Twist nicht mehr gelesen, seit, o Gott, wann?, er Teil des Lehrplans an der Uni war, lange vor unserem Kennenlernen, seit über dreißig Jahren also.
Das versetzte mir schon einen leichten Schock. Ein volles Jahr und ein Tag mögen als kurze Zeit durchgehen, aber dreißig Jahre? Wie konnte es sein, dass mir dreißig Jahre vorkamen wie ein bloßer Wimpernschlag? Es war die Zeitspanne zwischen ausschließlich in Schwarzweiß gezeigten Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg und David Bowie, der Life on Mars in den Top of the Pops sang, eine Zeitspanne, in der eine Frau erwachsen geworden sein und vier eigene Kinder bekommen haben konnte, von denen das erste, wenn sie zeitig angefangen hatte, inzwischen fast alt genug war für seinen Schulabschluss. Der auch längst nicht mehr A-Levels hieß.
Vielleicht probiere ich ja, Oliver Twist zu lesen, das ganze Ding, von Anfang bis Ende. Ich hatte über ein Jahr und einen Tag nichts gelesen, hatte es nicht gekonnt. Ich schlug das Buch auf. Das erste Kapitel – Handelt von dem Ort, wo Oliver Twist geboren wurde, und von den Umständen, die seine Geburt begleiteten – begann auf Seite 45 (das sind ganz schön viele Seiten, bevor er überhaupt auf die Welt kommt, vierundvierzig, ich wollte aber kein von wer weiß wem verfasstes Vorwort lesen, die Zeit der Einführungen hatte ich Gott sei Dank hinter mir; zu irgendetwas musste es schließlich gut sein, dass man älter wird), und ich ließ mich in dem Sessel am Fenster nieder.
Am Fenster zog es. An dem Fenster hatte es schon immer gezogen, weil wir es in dem Jahr, in dem wir es frisch gestrichen und zum Trocknen einen Spaltbreit offen gelassen hatten, anschließend nicht mehr ganz zubekamen, ohne die Farbe zu beschädigen, und das wolltest du auf keinen Fall, denn du hattest es ja sehr sorgfältig gestrichen. Also beließen wir es dabei. Wenn ich längere Zeit hier saß, das war mir klar, würde ich schlimme Hals- und Schulterschmerzen bekommen, Sommer hin oder her. Apropos Sommer: während dieses einen Jahrs und einen Tags hatte ich mich öfter gefragt, ob mir die Jahreszeiten je wieder vorkommen würden wie etwas ganz Neues, das ich nun zum ersten Mal erlebe, statt dass sie bloß eine hinter der anderen hergetrottet kamen wie Holzpferde auf einem alten Karussell.
Ich schaute durch den Raum zu dem anderen Fenster, vor dem der Sessel, wenn es nach mir gegangen wäre, von Anfang an hätte stehen sollen. Das Licht war dort besser, außerdem war es näher zum Schreibtisch, und das hieß, ich konnte die Schreibtischlampe verstellen und weiterlesen, wenn es dunkel wurde.
Aber es war dein Sessel, dieser hier, auch wenn wir ihn mit meiner Kreditkarte gekauft hatten (und er noch nicht abbezahlt war; wie unfair, dass ein Sessel, den wir im Internet gesehen und mit Kreditkarte gekauft hatten und der mit einem Lieferwagen gebracht worden war, ein längeres Leben besitzen sollte, konnte, ja besaß als wir). Ob wir ihn an den anderen Platz rücken sollen, darüber hatten wir uns oft gestritten, und du hattest dich jedes Mal durchgesetzt.
Ich glaube, es lag an dem Tag nach dem vollen Jahr, dem einen zusätzlichen Tag, der auf den Haufen der verstrichenen Tage und Monate noch obendrauf kam, dass ich das Buch auf den Sessel fallen ließ und ihn durch den Raum zu zerren begann.
Er war schwer, viel schwerer, als er aussah, so dass ich auf halbem Weg stehen blieb, mich dahinterstellte und schob. Das Schieben war streckenweise aber auch mühsam, denn ein Läufer verfing sich unter dem Sessel und wurde durch den Raum mitgeschleift, außerdem befürchtete ich, mit einem Sesselbein schlimme Kratzer am Boden zu machen, ja, so war es, schau, unter mir entstand eine tiefe Schramme beim Schieben. Aber es war mein Boden, ich konnte damit machen, was ich wollte, und schob also den Sessel weiter, obwohl sich der Teppich darunter aufwölbte und die anderen Läufer im Raum ebenfalls verrutscht waren.
Als ich wieder Luft bekam, griff ich nach dem Buch, meinem, nicht deinem, und setzte mich an dem neuen Platz in den Sessel. Das Bild, bei dem das Buch aufklappte, zeigte einen auf dem Boden liegenden Jungen, über dem ein anderer so stand, als habe der ihn gerade geschlagen, daneben eine entsetzt blickende Frau an der offenen Tür und noch eine zweite Frau, die den kleinen Jungen davon abhielt, noch einmal zuzuschlagen. Die Bildunterschrift lautete Oliver plucks up a spirit. Oliver erwacht zur Tat. Ja, hier war das Licht viel besser. Die Teppiche, nun Berg und Tal, hatten Ähnlichkeit mit Tieren, mit einer kreuz und quer auf dem Boden lagernden schlafenden Hundemeute. Das gefiel mir sehr. Das Zimmer auf einmal voller neuer und unerwartet schlafender Hunde, das war eine schöne Idee.
Unter den öffentlichen Gebäuden einer Stadt, die ich aus mancherlei Gründen lieber nicht nennen und noch weniger mit einem erfundenen Namen bezeichnen will, ist auch eins, wie es ehedem die meisten Städte, große und kleine, besaßen: ein Armen- und Waisenhaus. In diesem Haus wurde an einem Tag und Datum, die ich nicht zu erwähnen brauche, da sie für den Leser keinesfalls Bedeutung erlangen können, jener Sterbliche (theitem of mortality) geboren, dessen Name diesem Kapitel voransteht. Noch lange, nachdem er durch den Wundarzt des Kirchspiels in diese Welt der Sorgen und Mühen eingeführt war, blieb es recht zweifelhaft, ob das Kind lange genug leben würde, um überhaupt einen Namen zu erhalten. In diesem Fall wäre höchstwahrscheinlich die vorliegende Lebensbeschreibung gar nicht erschienen, oder sie hätte, auf wenige Seiten zusammengedrängt, das unschätzbare Vergnügen gehabt, die knappste und getreueste Biographie in der Literatur aller Zeiten und Länder zu sein.
Erstens: warum gab Dickens der Stadt, in der sich das zutrug, keinen Namen? Dann: bei dem Wort Armenhaus fiel mir ein, dass mein Vater mir mal erzählte, seine Mutter (meine Großmutter) habe auch in der Wäscherei eines Armenhauses gearbeitet. So kurz war der Abstand zwischen dem Armenhaus, das in den meisten Städten existierte, und mir, die ich so viele Jahre entfernt in der damaligen Zukunft lebte. Dann: wieso soll ein Geburtstag keine Bedeutung haben? Dann die Mahnung: die Zeit wird es weisen. Dann der Ausdruck, den Dickens für den neuen Erdenbürger verwendet, ein »Sterblicher«, ein item of mortality – eine Wendung, die auch auf sein Buch gemünzt sein könnte, so als hielte ich einen vergänglichen Gegenstand in der Hand. Dann: »diese Welt der Sorgen«. Beim Lesen dieser Worte spürte ich zwar gleich wieder das Gewicht meiner eigenen Sorgen, das Gewicht der Welt, die auf meinen Schultern lastete, aber es wurde mir doch auch etwas leichter dadurch, dass irgendwer irgendwo irgendwann die Welt ebenfalls als eine Welt der Sorgen aufgefasst hatte.
Hatte es eben geklopft? War jemand an der Tür? Nein, was immer es war, es hörte auf. Das kam bestimmt von nebenan; die hatten wohl gehört, dass ich den Sessel an eine andere Stelle gerückt hatte, und wollten mir den Rang im Möbelrücken streitig machen.
Ich kehrte zu meinem Buch zurück. »… blieb es recht zweifelhaft, ob das Kind lange genug leben würde, um überhaupt einen Namen zu erhalten«. Das war interessant. Bewies der Erhalt eines Namens, dass man am Leben geblieben war? Lebte namenlos Gebliebenes weniger lange? War es damit nach ein paar Seiten zum Beispiel schon wieder aus und vorbei? Und bestand ein Zusammenhang zwischen Namensgebung und Weiterleben und noch einer zwischen beidem, der Namensgebung und dem Weiterleben, und der Zeit?
Na also, dachte ich. Ich bin okay. Ich habe einen echt schweren Sessel von A nach B gehievt. Ich habe etwas verändert. Und ich habe neunzehn Zeilen in einem Roman gelesen und mir einen Haufen Gedanken darum gemacht − und nichts davon mit dir zusammen oder auf dein Geheiß; ich habe sogar die Worte item of mortality gelesen und dabei nicht an dich gedacht, sondern an was anderes. Die Zeit heilt alle Wunden. Oder, wie du immer sagtest, macht aus Wunden Achillesfersen. Worauf du jedes Mal mit der Geschichte von Achilles ankamst, den seine Mutter zum Schutz in einen Fluss tauchte, aber mit Zeigefinger und Daumen an der Ferse festhielt, so dass sie nicht mit dem Wasser in Berührung kam und er an dieser Stelle eben doch verwundbar blieb. Besser, sagtest du immer, kann man nicht zeigen, was Spannung beim Erzählen von Geschichten ist. Von dem Moment an wiesen alle Zeitpfeile auf seine verwundbare Ferse.
Allerdings muss ich gar nicht dauernd an das denken, was du immer sagtest. Ich hab eben geschlagene zehn Minuten kein einziges Mal an dich gedacht, dachte ich gerade, bevor ich wieder ins Buch sah. Dann blickte ich auf und über den Rand des aufgeschlagenen Buchs, weil es sich anhörte, als käme jemand die Treppe hoch.
Es kam wirklich jemand. Du.
Du standst in der Tür. Hustetest. Das Husten war so typisch, das konntest nur du sein.
Du warst mit Staub und etwas bedeckt, was wie feine Steinchen aussah. Deine Kleider waren schmutzig, verklebt, zerrissen. Du trugst die schwarze Weste mit der weißen Stickerei, die 1995 schon nicht mehr modern war und die wir zu Oxfam gegeben hatten. Deine Haut war schmutzig, dein Haar voller Staub und Sand. Du sahst zerschunden aus. Als du dich ein bisschen an der Tür schütteltest, rieselten Steinchen von dir herab und kullerten zum Teil hinter dir die Stufen hinunter.
Ich bin spät dran, sagtest du.
Du bist …, sagte ich.
Spät dran, sagtest du noch einmal und klopftest dir Arme und Schultern ab. Ich komme später als … Später als … Als …
Später als das Kaninchen bei Alice, sagte ich, weil das deine ständige Rede war, wenn du dich verspätet hattest.
Als ein was bei was?, sagtest du.
Das Kaninchen. Bei Alice.
Was ist das gleich?, sagtest du.
Du hobst die Hand, als suchtest du die Brille auf deiner Nase, aber du hattest keine auf.
Bei Alice im Wunderland, sagte ich. Das weiße Kaninchen. Es hat eine Taschenuhr einstecken. Weißt du noch? Es kontrolliert ständig die Zeit.
Welche Zeit ist es gleich?, sagtest du.
Ich zog das Handy aus der Tasche.
Viertel vor acht.
Dann merkte ich, dass ich mich verhört hatte und dass du in Wirklichkeit Zeit, was ist das gleich? gesagt hattest.
Du warst es, ausgenommen die Augenpartie. Wo deine Augen gewesen waren, ein Blau wie kein zweites, hattest du jetzt schwarze Löcher. Es sah aus, als wären deine Augen vollständig zu Pupillen geworden. Du tratst in das Zimmer, als wärst du blind, hinter dir eine Spur aus grobkörnigem Zeug, sehr ähnlich dem, was ich in der Hand hatte, als wir alle dabeistanden und ich die Urnevoll du auf der alten Römerstraße im Wald bei dem Weg mit den Buchen verstreute, kamst noch weiter herein und bliebst vor deinem alten Schreibtisch stehen, auf dem die Papierstapel im Großen und Ganzen noch so lagen, wie du sie zurückgelassen hattest.
Dann gähntest du, tratst ein paar Schritte zurück und gingst rüber ins vordere Zimmer, ließest die Türen hinter dir offen. Setztest dich vor den ausgeschalteten Fernseher.
Du bist von den Toten zurückgekehrt und willst fernsehen?, sagte ich.
Du sagtest nichts. Ich schaltete ein. Du hocktest zusammengesunken vor dem Filmchen auf BBC 24, das in Dauerschleife ein paar Jugendliche in Hoodies zeigte, die mit hochgezogenen Schultern vor einem Debenhams herumlungerten. Die Ansager sprachen von Ausschreitungen, und Zuschauer riefen im Studio an, die sich anhörten, als wären sie empört darüber, dass ein und dasselbe Filmaterial ständig wiederholt wurde. Dann merkte ich, dass die eingespielten Zuschauerstimmen ebenfalls vom Band kamen.
Ich setzte mich zu dir und sah dir eine halbe Stunde beim Fernsehen zu. Dann fiel mir ein, ich sollte dir vielleicht einen Tee anbieten. Aber hieß es nicht laut einem alten Brauch, dass man Toten nichts zu essen gab und auch nichts zu essen von ihnen annahm? Schön und gut, aber das warst schließlich du. Und warst es, offensichtlich, auch nicht, weil es sich um meine Einbildung handelte. Und dem Produkt meiner Einbildung konnte ich sehr wohl einen Tee anbieten, wenn ich wollte.
Ich ging in die Küche und brühte ihn – Milch, ein Stück Zucker – in deiner früheren Lieblingstasse. Kam damit wieder rüber und reichte ihn dir. Ging zum Fernseher, weil ich die Fernbedienung suchen wollte, und als ich wieder zu dir sah, hattest du die Tasse umgedreht und kipptest den heißen Tee auf den Fußboden. Dann stecktest du dir die leere Tasse in die Tasche.
Es lief ein Bericht über den Golfkrieg von 1991, über die seitdem bei Kindern im gesamten Irak stark erhöhte Rate der Krebserkrankungen, eine Entwicklung, die bis heute, zwanzig Jahre später, unvermindert anhielt, weil das US-Militär Raketen und Geschosse verwendet hatte, die abgereichertes Uran enthielten und Stäube im Land verteilten, die noch viertausendfünfhundert Millionen Jahre weiterstrahlen, wie der Kommentator im Hintergrund sagte. Bei so einer Meldung wärst du fuchsteufelswild geworden vor Zorn, und es hätte dich nicht mehr im Sessel gehalten.
Jetzt weiß ich genau, dass du nicht real bist, sagte ich.
Du sahst mich aus deinen schwarzen Augen an.
Real, was ist das gleich?, sagtest du.
Ich schaltete den Fernseher aus.
Okay, sagte ich. Wenn ich dich schon mal dahabe, können wir das auch ausnutzen und den Augenblick genießen. Denn ich wollte, wir hätten uns schon früher darauf besonnen, dass wir in der Gegenwart leben und sie genießen. Das hab ich schon tausendmal gedacht, seit du nicht mehr da bist.
Du griffst nach dem Bleistiftspitzer, der auf dem Beistelltisch neben dem Sofa lag.
Also, zwei Dinge, die ich dir gern sagen würde, sagte ich.
Du drehtest den Bleistiftspitzer in deiner Hand und ließest ihn in die Tasche deiner Weste fallen. Er landete mit dumpfem Ton auf dem Becher.
Na ja, viel mehr als zwei, aber die zwei wollte ich dir unbedingt sagen, sagte ich. Das erste wollte ich dir genau genommen zeigen.
Ich ging nach nebenan ins Arbeitszimmer und zum Bücherregal, zu den Js, griff nach oben und zog den ersten Band deiner alten Ausgabe der Goldenen Schale von Henry James heraus. Im Frühjahr, als ich dachte, ich könnte doch mal wieder probieren, etwas zu lesen, hatte ich mir das Buch ausgesucht, teils deshalb, weil du es so sehr mochtest. Und besonders mochtest du diese Ausgabe, die du in einem Secondhandladen gefunden und gekauft hattest: 4 Pfund für beide Bände. Ich hatte mich in meinem ersten Frühling ohne dich seit einem Vierteljahrhundert mit dem Buch in den Garten gesetzt und es lesen wollen. Aber lesen war eins der Dinge, die ich nicht konnte. An dem Tag, an dem ich dachte, ein allerletztes Mal probiere ich es noch, hatte ich aufs Geratewohl eine Seite aufgeschlagen und mich prompt daran erinnert, wie du, das war ein paar Jahre her, im Sommer mal aus dem Garten in die Küche gerannt kamst, das offene Buch in der Hand, schau! Sieh dir das an! Die ist bestimmt schon hundert Jahre alt, eine hundert Jahre alte Florfliege, es könnte gut und gern hundert Jahre her sein, dass jemand dieses Buch zum letzten Mal aufgeschlagen hat, sieh dir die Flügel an! Man sieht sogar die einzelnen Adern, das Grün, stell dir das mal vor, vor hundert Jahren hat genau diese Florfliege vielleicht Rosen einen Besuch abgestattet, was sagt man dazu, ist die nicht wunderschön?
Seite 338, sagte ich jetzt.
Ich schlug das Buch auf, ging durchs Zimmer und legte es dir auf die Knie. Zeigte auf das Wort von, ziemlich weit oben auf der Seite, auf dem die Florfliege, nach all diesen Jahren immer noch ein wenig grün, ihre Flügel ausgebreitet hatte.
Siehst du?
Du hieltest das Buch, sahst darauf, sahst verwirrt mich an.
Jedenfalls, sagte ich, nahm das Buch wieder an mich, klappte es zu und legte es auf die Armlehne des Sessels, das zweite, was ich dir unbedingt sagen wollte.
Zwei, was ist das gleich?, sagtest du.
Ich zog meinen Pullover hoch und zeigte es dir, das Tattoo oberhalb meiner linken Hüfte.
Das ist die Geschichte meines Tattoos. Wir sind erst seit kurzem ein Paar, da sage ich dir, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen will. Du kannst Tattoos nicht ausstehen, sagst du, die findest du billig, und du möchtest nicht, dass ich mir eins machen lasse. Denk doch mal an ihren historischen Vorgänger, nach einem Jahrhundert wie dem zwanzigsten, sagst du, sind Tattoos nun ein auf ewig unauslöschliches Symbol einer bestimmten Art von Brutalität, und fragst, ob ich weiß, was du damit sagen willst und wie schwer die wieder zu entfernen sind. Ich sage, ich will mir trotzdem eins stechen lassen, ob es dir gefällt oder nicht, ich will William Blakes Tiger als Tattoo auf der Schulter haben, und du, was, das ganze Gedicht? Dann erkundige dich aber vorher, ob der Tätowierer weiß, dass Blake seinen mit y schreibt. Nein, sage ich, nicht das ganze Gedicht, ich möchte die Zeichnung, die er von dem Tiger gemacht hat, über den er das Gedicht schrieb. Du lachst laut auf und erzählst mir, was Angela Carter darüber gesagt hat, sie fand, das fubsy beast bei Blake, das mollerte Tier, sehe aus wie eine Schlafanzughülle. Ich gehe weg und schlage das Wort fubsy nach. Das hab ich noch nie gehört.
Am nächsten Abend sage ich zu dir, ich hätte beschlossen, dass ich mir ein Tattoo nur machen lasse, wenn du bestimmst, was es sein soll.
Gut, sagst du, ich weiß auch schon, was.
Du gehst zu deinen Bücherregalen (wir sind da noch nicht zusammengezogen, haben noch nicht getan, was das größte Versprechen überhaupt ist: unsere jeweiligen Bücher in eine gemeinsame Bibliothek zu überführen), ziehst ein schmales Bändchen von Jane Austen heraus, schlägst es auf und blätterst, bis du das Gesuchte findest.
Von hier, sagst du, bis dahin.
Ich wusste nicht, dass es eine Jane Austen auch schon vor Stolz und Vorurteil und Verstand und Gefühl gab. Das hier ist aus Jack & Alice, einem Buch, von dem ich noch nie gehört hatte. Ich lese:
The perfect form, the beautifull face, & elegant manners of Lucy so won on the affections of Alice that when they parted, which was not till after Supper, she assured her that except her Father, Brother, Uncles, Aunts, Cousins & other relations, Lady Williams, Charles Adams & a few dozen more particular freinds, she loved her better than almost any other person in the world.
Okay, welches Stück soll ich?
Das Ganze, sagst du, von The bis world, und ich erwarte, dass dein Tätowierer alles auch genau so sticht, wie Austen es schreibt, beautifull mit zwei l und freind auch wie die junge Austen, mit vertauschtem e und i. Sonst wirst du dir eine neue Haut besorgen müssen, denn mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden, wenn du schon ein Tattoo haben musst. In Ordnung?
Das alles?, sage ich.
Du kannst von Glück sagen, dass die unds alle Et-Zeichen sind, sagst du.
Klar, du stellst mich auf die Probe. Ich dich umgekehrt aber auch. Ich gehe mit dem Buch in das Tattoo-Studio in der Mill Road und komme nach mehreren Sitzungen mit exakt dem Tattoo nach Hause. Ich lasse es mir in Dunkelblau stechen, deiner Augenfarbe. Es kostet mich ein Vermögen. Es schmerzt wie Ironie.
Als es fertig ist und meine Haut sich wieder beruhigt hat, sehe ich dich wieder.
Du bist nicht von dieser Welt, sagst du, als du es siehst. Du bist echt nicht von dieser Welt.
Keinen Monat später ziehen wir zusammen und fusionieren unsere Bibliotheken.
Jetzt stand ich vor dem Phantom-Du und hatte mein Hemd so weit hochgezogen, dass sich deine tiefschwarzen Augen auf einer Höhe mit meinem Hüftknochen befanden.
Nachdem du nicht mehr da warst, sagte ich, hätte ich einmal fast mit jemandem geschlafen. Keine Ahnung, warum ich das getan hab, ich war wohl einsam und drehte langsam ein bisschen durch. Jedenfalls, die Frau, sie hat mir das Hemd aufgeknöpft, weißt du, wir waren kurz davor, hat sich mein Tattoo angesehen und gesagt: Wusstest du, dass das Wort beautiful in deinem Tattoo falsch geschrieben ist? Sie hat sich nicht mal die Mühe gemacht, bis zu dem Wort freind weiterzulesen und etwas dazu zu sagen. Da hab ich mir das Hemd wieder zugeknöpft und mich mit einer Ausrede aus dem Staub gemacht.
Du sahst auf meinen Hüftknochen und dann zu mir herauf, und ich glaubte zum ersten Mal seit deiner Rückkehr so etwas wie ein Wiedererkennen über dein Gesicht huschen zu sehen.
Das war’s, zwei, jetzt hab ich’s wieder, sagtest du.
*
Nach dem vollen Jahr und einem Tag
hob die Tote zu sprechen an:
»Wer sitzt da weinend an meinem Grab,
der mich nicht schlafen lassen kann?«
»Ich bin’s, Geliebte, an deinem Grab,
der dich nicht schlafen lassen kann;
von deinen kalten Lippen ein letzter Kuss,
es liegt mir gar viel daran.«
1. You Must Remember This: Warum wir Zeit haben und warum die Zeit uns hat
Die kürzeste Kurzgeschichte der Welt, wie lautet die? Es war einmal, meine Herren, bitte. Ein zeitloser Ort, wie könnte der aussehen? Vielleicht ungefähr so, wie George Mackay Brown das Tir-Nan-Og beschreibt, ein Land ewiger Jugend »weit im Westen«, in dem es
weder Krankheit noch Welken gab, weder Leiden noch Tod. Auf den Feldern wogte stets üppig-golden das Korn, die Obstgärten waren schwer beladen mit Äpfeln; ein jeder Stein war kostbar. Kein Sturm fegte um die Schiffe und die Türen der Menschen. Die Menschen von Tir-Nan-Og besaßen ewige Jugend und Schönheit, kannten weder Asche im Bart noch im langen, golden wallenden Haar eines Mädchens.
Das würde niemals klappen. Es wäre, als sei man tot und wisse es nur nicht. Wir würden einen Stein nach dem anderen aufheben, und sie wären alle gleich öde und kostbar. Wir müssten kahle Bäume erfinden, uns Missernten vorstellen. Dann würden wir die Zeit erfinden. Und sobald wir das getan hatten, bekäme alles einen Sinn, und die ersten grauen Haare würden sichtbar, und bis dahin würden wir den Tod wohl simulieren, damit wir Geschichten darüber erzählen konnten.
Walter Benjamin sagt, der Erzähler habe seine Autorität dem Tod entliehen. Von der Zeit nichts zu wissen, in Augenblicken der Zeitlosigkeit, so Joseph Conrad in seinem 1917 geschriebenen Roman Die Schattenlinie, ist ein Zeichen der Kindlichkeit. Nur »die ganz Jungen haben, streng genommen, keine Augenblicke«. Die Zeit aber hat Bedeutung. Die Zeit wird es weisen. Die Zeit ist Wirkung, sie ist Ungewissheit, Sittlichkeit, Sterblichkeit. Boxer kämpfen in Runden, zwischen denen Glockenschläge die Zeit anzeigen. Häftlinge sitzen ihre Zeit ab. Zeit ist bloß one damn thing after the other