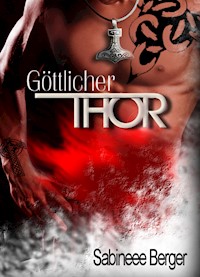4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was für ein Albtraum! Ein gewöhnlicher Arbeitstag endet für die junge Versicherungskauffrau in einem brutalen Geiseldrama. Der Anführer der Bande hat dabei keine Skrupel, der verheirateten Frau eine ganz besondere Rolle aufzudrücken. Eiskalt und mit professionellem Killerinstinkt versucht er sie zu manipulieren, ihr Gewalt anzutun und seinem Plan zu unterwerfen. Doch zur Überraschung aller entpuppt sich die sonst so sanftmütige Sandra als spontane Kämpfernatur und mutige Kontrahentin. Wie sehr sie jedoch mit ihrem Vorgehen und ihrem Mut den Killer reizt, erfährt sie erst, als es schon zu spät ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sabineee Berger
Geiselnahme?
Dieses eBook wurde erstellt bei
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch interessieren! Noch mehr Infos zum Autor und seinem Buch finden Sie auf tolino-media.de - oder werden Sie selbst eBook-Autor bei tolino media.
- gekürzte Vorschau -
Inhaltsverzeichnis
Titel
01.Kapitel
02.Kapitel
03.Kapitel
04.Kapitel
05.Kapitel
06.Kapitel
07.Kapitel
08.Kapitel
09.Kapitel
10.Kapitel
11.Kapitel
E-Books
Impressum tolino
01.Kapitel
Wien am Morgen! Herrlich! Die Sonne stand schon verhältnismäßig hoch, die Vögel zwitscherten und die Menschen bewegten sich in morgendlicher Langsamkeit durch die Gassen. Hin und wieder versperrte ein dreister Lieferwagen den Weg, doch das störte nicht, brachte mich lediglich zum Schmunzeln.
Die meisten Menschen waren nicht schlecht gelaunt, aber auch nicht fröhlich. Als langjährige Städterin war ich an die verhaltene Lebendigkeit der arbeitenden Schicht gewöhnt oder womöglich auch nur an die Eigenheit der Wiener. Wenige zeigten ein Lächeln oder waren gar überschwänglich (Gott behüte!). Zu früher Stunde mochte das verständlich sein, aber mir selbst konnte nichts so schnell die Freude trüben.
Gut, ein wenig privilegiert war ich schon, weil mein Büro die Möglichkeit zur Gleitzeit bot und ich daher oft erst um 9.00 Uhr zu arbeiten anfing. Gerade heute war es besonders ideal, weil ich doch etwas spät dran war. Dazu hatte ich eine wunderbare Nacht mit meinem Mann verbracht und grinste offenbar permanent durch die Gegend. Hermann und ich waren zwar schon über drei Jahre zusammen, fühlten uns aber so frisch verliebt wie am ersten Tag. Selbst die überstürzte Hochzeit vor zweieinhalb Jahren hatte daran nichts geändert. Wir waren glücklich, wohnten im zweiten Bezirk und hatten beide gut bezahlte Jobs. Mittlerweile planten wir sogar, unsere Familie um Kinder zu bereichern, aber ganz ohne Hast und Druck. Wir waren noch jung und hatten Zeit. Zumindest waren wir uns für die nächsten drei bis vier Jahre darüber einig.
Ja, es lief gut zwischen uns. Sehr gut sogar. Dazu waren der frühsommerliche Morgen und die heutige Stimmung in Wien besonders erfrischend. An Tagen wie diesen ließ ich es mir einfach nicht nehmen zu Fuß ins Büro zu gehen. Egal, ob das 15 Minuten länger dauerte oder nicht.
Zügig schritt ich voran, um den zweiten Bezirk hinter mir zu lassen, bog auf die Taborstraße ein und ging ein kleines Stück weiter zur Schwedenbrücke. Dort warf ich einen verträumten Blick auf den Donaukanal und die bunten Graffitis, die seinen Weg zierten und legte einen Zahn zu, weil ich noch ein ordentliches Stück vor mir hatte. Vom Schwedenplatz aus bog ich auf die Rotenturmstraße und befand mich augenblicklich im Paradies. Altes Flair kombiniert mit dem Luxus des Neuen und einer Lebendigkeit, die ich mochte. Spätestens bei den Fiakern an der Nordseite des Stephansdoms fühlte ich mich tatsächlich wie eine Urlauberin, die den Tag genießen konnte. Meine Absätze klapperten laut auf dem steinernen Boden, die Sonne kitzelte meine Nase und mein bunter Frühlingsrock umschmeichelte meine Beine. Das Wunderbare daran war, dass ich genau diese Kleinigkeiten genießen konnte. Und auch das Lächeln konnte ich nicht lassen und das provozierte ständig Blicke anderer. Blicke, die Verwunderung zeigten oder auch Empörung, vielleicht das eine oder andere Staunen und, die sehr oft ein Schmunzeln zur Folge hatten. Doch ich ging nicht darauf ein, schenkte keinem der Gaffer einen Blick.
Ah! Die Kärntner Straße! Das letzte Stückchen bis zu meiner Arbeitsstätte legte ich in nullkommanichts zurück, ohne dabei den Blick fürs Schöne zu verlieren. Seit über acht Jahren arbeitet ich schon im Rossmann-Konzern, gleich hinter der Oper, aber zum Glück war ich selbst nach etlichen Jahren noch nicht so abgestumpft, um blind durch die Straßen zu rennen und lediglich an die Arbeit zu denken oder das Multikulturelle zu verfluchen. Nein, genau das war ja Ursache meiner Faszination. Und wer bitte konnte schon die Pracht übersehen? Ausschließlich Menschen mit Sorgen, Ängsten oder Frust. Und dazu gehörte ich nicht! Ja, ich gehörte eindeutig zu den Privilegierten und zu den wenigen Menschen, die noch genießen konnten wer sie waren und wo sie waren. Selbst wenn sie dadurch auf andere oberflächlich oder verträumt wirkten.
Apropos verträumt ... wie so oft stand ich bereits vor der riesigen Glastür des Konzerns, ohne wissentlich von der Kärntner Straße in die Führichgasse abgebogen zu sein. Ajejeje! Mit einem milden Lächeln über genießerische Schwäche öffnete ich die Türe und betrat die Eingangshalle des alten Rossmann-Konzerns. Die betretene Stimmung des Portiers konnte meiner guten Laune nichts anhaben, denn Morgenmuffel konnte ich schon immer gut ignorieren. Zwar rief ich ein automatisiertes „Guten Morgen“, scherte mich aber kein bisschen um seinen gehetzten Blick. Was wusste ich, was den schon wieder plagte! Der Fröhlichste war er schließlich noch nie gewesen. Schwungvoll drehte ich mich um die eigene Achse und stieß mit einem lauten „Klack“ meine Personalkarte ins Zeiterfassungsgerät – was alleine schon verdeutlichte, wie mittelalterlich die Leitung des guten Rossmann-Konzerns mit Technik und Neuerungen umzugehen wusste. Danach machte ich mich schnurstracks auf den Weg zu meinem Büro in den ersten Stock.
Nach meinem Schulabschluss hatte ich als absolutes Greenhorn hier begonnen und gleich Gefallen gefunden an der trockenen Büroluft. Mit meiner Tätigkeit und dem Arbeitsklima war ich durchaus zufrieden, und auch wenn ich keine großartige Karriere eingeschlagen hatte, so war ich doch mit Fleiß und Ausdauer zumindest ein paar Gehaltsstufen nach oben gewandert. Aber ich war bei weitem nicht mehr so engagiert wie zu Beginn meiner Berufslaufbahn und das lag an meinem privaten Glück. Seit ich Hermann kennen und lieben gelernt hatte, war die Wichtigkeit in meinem Leben automatisch zu ihm und seinem Leben gewandert. Uns hatte es aber auch so derart stark erwischt, dass wir in jeder freien Sekunde eine stürmische und intensive Zeit miteinander verlebten. Für Karriere, lernen oder Neuorientierung blieb da einfach keine Zeit. Hermann war und blieb mein absoluter Traummann und aus unserer Beziehung konnte ich so viel Freude schöpfen, dass ich in der Arbeit generell als sehr fröhlicher Mensch galt und sogar als „Sonnenschein“ bezeichnet wurde. Selbst wenn die Arbeit einmal erdrückende Ausmaße annahm, blieb ich meist freundlich und cool. Und das war doch recht häufig. Zu bestimmten Zeiten konnten sich die Akten nämlich durchaus in beachtlicher Höhe stapeln und (samt Abteilungsleiter) nach Erledigung brüllen. Wegen meiner Coolness war ich aber noch lange kein Übermensch und spürte die Belastungen so wie alle anderen. In meiner Hirnchemie schien nur ständig etwas dafür zu sorgen, freundlich zu bleiben und möglichst Ruhe zu bewahren. Gut, vielleicht konnte man mir einen leicht übertriebenen Hang zur Heiterkeit nachsagen, aber meinen Verstand hatte ich deswegen noch lange nicht eingebüßt. Menschen, denen ein Zuviel an Peace and Happiness ins Gesicht geschrieben stand, obwohl eine fette Psychose dahinter lauerte, waren eindeutig zu meiden. Diese „Es-ist-ja-alles-so-heil-Menschen“ konnten selbst bei mir Aggressionen wecken und das hieß dann, dass es nichts mehr zu Lachen gab. Vor allem nicht für die anderen.
Wenn meine Kollegen also wüssten, dass hinter dem harmoniebedürftigen, fröhlichen Wesen durchaus auch eine übertriebene Portion Aggressionlauerte, hätten sie vielleicht einen anderen Namen als Sonnenschein für mich gefunden. Was soll’s ... dachte ich und lenkte meine Gedanken wieder auf die stürmische Nacht mit Hermann und dem wohligen Gefühl in meinem Bauch. Die Stufen in den obersten Stock nahm ich beschwingt und schaute nicht rechts, nicht links. Dadurch bemerkte ich die veränderte Atmosphäre im Gebäude kaum oder nur unbewusst. Klar, mein Verstand hätte sich einschalten können, weil die alltägliche Betriebsamkeit fehlte, aber dem war leider nicht so. Glücklich stolperte ich weiter die Stufen hinauf und vermisste keinen meiner Kollegen, die eigentlich bereits bei ihrem zweiten oder dritten Automatenkaffee hätten stehen sollten, oder geschäftig von einem Stockwerk ins andere flitzen mussten. Nicht einmal den fehlenden Duft von Kaffee bemerkte ich und das war schon eigentümlich, denn ich war eine wahre Genuss-Schnüfflerin.
Natürlich stellte sich ein Teil von mir schon auf den bevorstehenden Arbeitstag oder meine Bürokollegen ein, doch wirklich da war ich deswegen noch lange nicht. Gerade einmal die grau vergilbte Wand des Ganges sowie meine alte Bürotür stachen mir erneut ins Auge. Der übertriebene Geiz unserer Firmenleitung war legendär und blockierte schon viel zu lange entsprechende Sanierungsmaßnahmen. Aber so waren die Geschäftsführer des Mutterkonzerns in der Schweiz nun einmal: Sie legten keinerlei Wert auf Komfort, Stil oder neuzeitliche Technik ... zumindest was ihre Wiener Niederlassung betraf.
Mit einem leisen Seufzen auf den Lippen, öffnete ich die Tür zu meinem Büro und wollte gerade ein fröhliches „Hallo!“ oder „Guten Morgen!“ trällern, als ich so dermaßen erschrak, dass mir jeder Buchstabe einzeln im Hals stecken blieb.
Nach außen hin blieb ich wie erstarrt, doch innerlich durchzuckte mich ein lautloses „Huh-ha-jesses!“, als hätte ich meinen Finger geradewegs in eine der vielen Steckdosen bei der Tür gebohrt und einen dezenten Stromschlag erhalten. Durch das Unterdrücken des Schreis gestaltete sich das wie eine innerliche Explosion und mein Kreislauf sackte schlagartig ins Bodenlose. Ich spürte förmlich, wie ich kreidebleich wurde.
Überfall, dröhnte es in meinem Kopf, während ich noch an der Bestürzung arbeitete, obwohl hier niemand laut war oder sich schnell bewegte. Es war vielmehr ein Schreck wie im Zoo, wenn man plötzlich einem echten Raubtier gegenüberstand und seine mörderischen Augen und seine riesigen Reißzähne aus nächster Nähe sehen konnte, weil man nur durch eine lächerlich dünne Glasplatte getrennt war. Man spürte es schlicht, wenn etwas wirklich Gefährliches vor einem stand. Nein, hier gab es keinen entlaufenen Tiger, aber dafür eine Menge Stillstand und Schwärze.
Abgrundtiefe Schwärze.
Die zwei Augen, die mich fixierten waren finster und böse und hielten mich wie unter einem Bann fest. Schwarz wie die Nacht waren sie und schwarz war auch die Maske, die der Mann trug. In stummer Aggressivität stierte er mich an und attackierte mich, ohne mich zu berühren. Harte, unbeschreibliche Dinge konnte ich in diesen Augen sehen, als hätte der Jäger Beute entdeckt und würde sein Opfer jeden Moment töten und ausweiden.
Skurril und unwirklich war diese Situation und einen kurzen Moment hoffte ich sogar auf einen dummen Scherz meiner Kollegen, doch in Wahrheit war völlig klar was hier los war: Jemand überfiel gerade unser Büro und niemand, also wahrlich niemand scherzte hier oder lachte gar. Das „Wie? Was? Warum?“ stand wohl mit allen Fragezeichen der Welt längst in meinen Augen, während ich blasser und immer blasser wurde. Der maskierte Mann stand indessen vor mir, war breit wie ein Schrank und eindeutig ein Verbrecher. Alleine mit seinem Blick hielt er mich so derart in Schach, dass ich gar nicht auf die Idee kam, umzudrehen und fortzulaufen. Einen kurzen Moment überlegte ich das zwar sehr wohl, aber genau in diesem Moment schaltete der Mann einen Gang höher und packte mich. Brutal wurde ich ins Innere des Büros gezerrt und keine Sekunde dabei aus den Augen gelassen. Jede Überlegung in Richtung Scherz wurde dadurch noch lächerlicher, denn der Mistkerl packte extra hart zu, quetschte meine Haut und zerknautschte meine Bluse.
Verflucht, meine Bluse! ... ging es mir konfus durch den Kopf, obwohl Knitterfalten ja wohl nicht gerade der Knackpunkt an der ganzen Sache waren. Dennoch drängte sich dieses Detail übertrieben stark in mein Bewusstsein, weil es mich als „unordentlich“ markierte und schwarzes Leder gerade blütenreines Weiß beschmutzte. Lächerlich, dachte ich noch, weil meine Aufmerksamkeit sich gerade völlig aufs Falsche konzentrierte und konfus verglich, dass meine glatt gebügelte Kleidung nicht mehr in Ordnung war, weil NICHTS hier mehr in Ordnung war!
Dann wurde ich auch schon heftig weitergezerrt und war nur mehr damit beschäftigt, nicht zu stolpern oder gar zu fallen. Als auch noch die Türe mit einem lauten Krachen ins Schloss fiel, kippte endlich der Schalter in meinem Kopf, der mich in einer seltsamen Starre und Lautlosigkeit festgehalten hatte. Ein Kloß löste sich aus meinem Hals und ich schrie laut und schrill auf. Unnatürlich irgendwie und viel zu spät. Dem Kerl selbst war das jedoch recht egal. Er schubste mich daraufhin nur etwas brutaler und ich musste aufpassen, nicht auf der Nase zu landen.
Alles an meinem Gefühlsleben wirkte verdreht und wie außer Kontrolle. Mein Herz pochte, mein Blick hetzte herum. Auch meine Reaktionen schienen völlig frei von Zeit zu sein oder einfach nur viel zu spät einzusetzen.
„He, was soll das?“, empörte ich mich zwar, aber die Frage war lächerlich und ich wurde dafür auch nur noch fester gepackt und weitergezerrt. Mühsam kam ich wieder auf die Beine und taumelte verzweifelt hinter dem Mann her. Mein Blick wanderte Hilfe suchend durchs Büro, doch was ich sehen konnte, war schlicht eine Katastrophe! Weitere vermummte Gestalten dominierten den Raum, bohrten sich mit schwarzer Präsenz ins alltägliche Geschehen, wirkten unwirklich und doch so bedrohlich, dass kein Zweifel bestand, in welcher Gefahr wir uns alle befanden. Meine Kollegen hockten gefesselt und geknebelt auf ihren Drehsesseln, waren starr vor Schreck und zu keiner Gegenwehr in der Lage. Zusätzlich wurden sie mit Gewehren bedroht.
Ein schwarzer Mann kniete hinten am Boden und war gerade dabei zwei meiner Mitarbeiter zu verzurren. Was vollkommen ruhig und gelassen über die Bühne ging. Die ganze Situation wirkte so irrational und fremd, dass ich vollkommen verblüfft stehen blieb und dafür prompt einen weiteren, kräftigen Stoß in die Rippen kassierte. Ein stechender Schmerz, dann ein Keuchen ... mein Keuchen ... und ich stolperte weiter.
Bewaffneter Raubüberfall! ging es mir durch den Kopf, hektisch und konfus, denn genau das war ja das Verrückte an der Sache! Hier war schlicht und ergreifend nichts zu holen. Wir waren schließlich keine Bank und hatten auch keinen Tresor. Nirgendwo. Und warum auch? Es war ein gewöhnliches Büro und alles andere als König Salomons Schatzkammer. Büro!!! Herrgott es ist doch nur ein Büro! brüllte es in meinem Kopf, weil ich nicht verstehen konnte, wie etwas so Abgefahrenes am helllichten Tag in Wien und noch dazu in unserem Versicherungskonzern geschehen konnte. Und dann noch mit dem Aufgebot! Der Auftritt der schwarzen Männer wirkte einfach total übertrieben. Dabei gab es hier weder Geld noch irgendeine Person mit großzügigen Verwandten im Multimillionärsbereich. Verständlich war das alles nicht. Beängstigend sowieso. Das ganze Ausmaß des Desasters war hier nur schwer zu begreifen, aber es war klar, dass meine Kollegen und ich uns in höchster Gefahr befanden.
Und immer noch wurde ich in eine Richtung geschoben und jeden Moment vermutlich gefesselt und geknebelt. Was für ein Albtraum! Mein Puls raste schon die längste Zeit und irgendwann versuchte ich mich sogar gegen den harten Griff des Mannes zu wehren. Doch der hielt mich wie in einem Schraubstock gefangen und wirkte dabei hart und kein bisschen mehr menschlich. Er reagierte – für seine Verhältnisse – wahrscheinlich sogar recht sanft, als er mich nur leicht schüttelte und nicht auch noch schlug. Dafür zerrte er mich umso schneller weiter.
Am liebsten hätte ich laut geschrien und getobt, doch meine Angst ließ das nicht zu. Außerdem war hier niemand laut, schon gar nicht die Geiseln. Es war sogar ausgesprochen still, unheimlich und erdrückend. Selbst die kackschwarzen Verbrecher sprachen kein Wort, wechselten nur Blicke untereinander und deuteten oft in ruppigen Gesten mit ihren Gewehren herum. Als verschreckter Neuankömmling spürte ich ihre Blicke doppelt und dreifach. Außerdem war es ein seltsames Gefühl, keine Gesichtszüge und kaum menschliche Regungen wahrnehmen zu können. Auch ich wurde nicht als Mensch gesehen, sondern nur als Störfaktor oder Mittel zum Zweck. Und meine persönliche Leibwache wirkte sowieso wie ein ferngesteuerter Roboter, der nur darauf fixiert war, mich zu meinem Platz zu bringen.
„Setz dich hin und mach keine Mucken ... sonst bist du schneller tot, als du ‚Bitte nicht‘ sagen kannst.“, zischte er gefährlich nah an meinem Ohr und stieß mich unsanft in den Sessel. Hart landete ich auf meinem Allerwertesten und brachte mit meinem Gewicht den Drehsessel gefährlich ins Schwanken. Weil meine Hände aber so stark zitterten, versuchte ich mich erst gar nicht festzuhalten, sondern versteckte sie eher in meinem Schoß und hielt sie krampfhaft fest. Niemand sollte sehen, wie sehr ich bereits um Fassung rang oder wie panisch ich war. Dabei war genau dieser Zustand längst offensichtlich. Die Blicke meiner Kollegen streiften mich nur zeitweise, waren voller Angst, wirkten beschämt und verhalten. Sie hatten resigniert, sich untergeordnet und wussten nur zu gut, wie es mir ging.
Den Anführer der Bande erkannte ich instinktiv an seiner arroganten Haltung und seinem Umgang mit den anderen maskierten Männern. Er war mit Sicherheit ihr Kommandeur, Hauptmann oder wie auch immer man jemanden in solchen Kreisen nannte. Seine Augen waren von außergewöhnlich hellem Blau, durchdringend und streng, aber auch auf subtile Art freundlich. Er war zweifelsfrei der Gefährlichste von allen und ganz Herr der Lage. Selbstgefällig stellte er sich mit der Waffe vor mich hin, um eine kurze Ansprache zu halten. Meine Nackenhaare standen bereits in Reih und Glied, als er mit durchdringender Stimme und spürbarer Autorität, zu sprechen begann.
„Wenn ihr genau tut, was wir verlangen, wird keinem ein Haar gekrümmt!“, rief er und blickte kurz in die Runde, ob er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Anwesenden hatte. Was alleine schon der reinste Hohn war, weil wir ängstlich und unterwürfig wie die Hasen waren. Seine ganze Haltung verdeutlichte wie bereit er war, seine Waffe zu gebrauchen. Diese unterdrückte, aber spürbare Brutalität und die Härte seiner Stimme verfehlten ihre Wirkung nicht. Unter seiner schwarzen Tarnung war der Mann vermutlich ein einziger Eisblock, hart und kalt wie der Tod, denn etwas an ihm verängstigte mich mehr als die Waffe direkt vor meiner Nase.
Von einem kleinen Büroscherz war die Situation mittlerweile so weit entfernt wie ich von einer riesigen Flasche Baldrian. Dabei hätte ich wohl alles dafür gegeben, mich mit einem starken Beruhigungsmittel oder etwas Hochprozentigem zu beruhigen! Der Stress für meinen Körper war deutlich, aber das wirklich Beängstigende spielte sich in meinem Kopf ab. Ständig rasselten die Gedanken durcheinander, kreisten um den eiskalten Anführer und vor allem um das WARUM. Eine derartige Aktion in einem stinknormalen Versicherungsbüro war einfach unlogisch und gab keinen Sinn. Geld konnte kaum das Motiv sein, aber vielleicht handelte es sich ja um einen schnöden Racheakt. Manchmal konnten den besten Angestellten Fehler passieren, ungerechtfertigte Ablehnungen ausgesprochen und Auszahlung übersehen werden. Oder es passierte wirklich Schlimmes, die Prüfung versagte und ermöglichte irgendjemandem Geldwäsche. Was – ihres Wissens nach – zwar noch nicht vorgekommen war, aber theoretisch möglich war. Und gab es nicht immer jemanden, der dann der Geschädigte war? Im Grunde kam ihr das trotzdem alles sinnlos vor und sie kam immer wieder zu dem Gedanken zurück, dass sich hier nur unzählige Versicherungsakte, Ordner und der übliche Bürokram befand. Das Großaufgebot von maskierten Verbrechern war mehr als ungewöhnlich, sicher extrem kostspielig und einfach nur idiotisch. Zurzeit hielt sich noch nicht einmal jemand von der Geschäftsleitung im Gebäude auf. Außer den paar Gruppenleitern gab es hier also nur noch ‚normale‘ Angestellte wie mich.
Etwas weiter hinten hantierte einer der schwarzen Kerle mit seiner Waffe demonstrativ vor meinen männlichen Kollegen und lenkte alle Blicke auf sich. Der bullige Kerl zog eine gezielte Machtdemonstration ab, weil er diese Geiseln vermutlich als größeres Risiko einstuft als uns Frauen. Oder aber der Typ hatte einfach nur eine Macke, denn eine Machtdemonstration wie diese war gar nicht notwendig. Meine Kollegen waren auch so schon eingeschüchtert genug. Als einfache Büroangestellte waren sie nicht gerade die verborgenen Superhelden, die sich aus ihren Anzügen schälen würden, um dem Unrecht den Kampf anzusagen. Außerdem waren sie – wie wir alle – extrem eingeschüchtert. Kaum jemand getraute sich den Blick zu heben.
Der Anführer sah es offenbar ähnlich und unterbrach die kleine Demonstration, indem er den bulligen Typen mit nur einer Handbewegung zu mir dirigierte und aufforderte mich zu fesseln. Der ließ noch ein leises Knurren in Richtung der drei männlichen Geiseln vernehmen und kam dann tatsächlich. Ohne ein Wort kniete er sich neben meinen Sessel und band meine Hände auf der Rückseite der Sessellehne zusammen. Der plötzliche Schmerz in meinen Handgelenken war befremdend und an sich schon ein kleiner Schock, doch der eigentliche Schock war der lächelnde Blick des Anführers. Jede meiner Bewegungen und jede noch so kleine Gefühlsregung wurden von ihm beobachtet.
Ich senkte den Blick, denn die freundliche Härte seiner Augen (und ich wusste genau wie widersprüchlich dieser Bewertung war) konnte ich nicht ertragen. Während ich also gebunden wurde und zu Boden blickte, beruhigte sich meine Atmung allmählich, ließ auch der erste Schock nach und ordneten sich meine Gedanken. Nachträglich erkannte ich daher all die Vorzeichen, die mich hätten warnen können und die ich, in meiner verträumten Ignoranz, übersehen hatte. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit, womöglich durch einen guten Selbstverteidigungskurs, oder etwas mehr Interesse und Einfühlungsvermögen ... und ich hätte erkannt, dass der Morgenmuffel in der Portierloge in Wirklichkeit unter enormen Druck gestanden hatte und womöglich sogar ein „Vorsicht“ flüstern hätte wollen. Hätte wollen! Denn ich war einfach mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen vorbeispaziert und hatte danach noch nicht einmal die fehlenden Menschen auf den Gängen bemerkt! Herrgott, ein bisschen Gefahrenschulung und ein besserer Realitätsbezug am Morgen hätten mir nicht nur rechtzeitig die Flucht ermöglicht, sondern auch die Möglichkeit geboten, die Polizei zu verständigen! All das ... und damit warf ich erneut einen vorsichtigen Blick auf den Anführer ... all das wäre zu vermeiden gewesen.
Die Terroristen befanden sich mit Sicherheit schon seit geraumer Zeit im Rossmann-Konzern und so wie ich die Lage nun einschätzte, waren noch viel mehr von ihnen an der Sache beteiligt. Vier von den Verbrechern befanden sich alleine in meinem Büro, doch der Rest des Gebäudes musste ebenfalls kontrolliert werden und das vergrößerte den Aufwand um einiges und zwar nicht nur um die Anzahl der Geiselnehmer. Technisches Equipment, langfristige Planung, terroristische Ausbildung ... waren nur ein paar Details, die mir so spontan einfielen und die diese Aktion in eine Größenordnung verschob, die alles nur noch verrückter machte.
Meine Gedanken drehten sich ständig im Kreis und spiegelten sich in meinem Gesicht. Das bemerkte ich zumindest, als ich aufblickte und der Anführer wieder instinktiv zu mir herübersah. So, als ob er nur auf eine Begegnung mit mir gewartet hätte und sich nun köstlich über mein Mienenspiel amüsierte. Dabei konnte ich nur seine Augen sehen, also wirklich gar nichts von seinem Gesicht. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass er nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken konnte. Es war wohl diese Kombination aus Schalk und Härte, die mich so seltsam erwischte und noch viel ängstlicher machte. Vielleicht war es auch sein aufdringlicher Fokus, die schwarze, massive Wucht seines Körpers oder eben dieser bohrende Blick. Lange hielt ich das jedenfalls nicht aus und wusste gar nicht mehr, wo ich hinsehen sollte, fühlte mich wie unter einem menschlichen Röntgenschirm und getraute mich nicht einmal mehr zu denken. Den anderen Geiseln ging es wohl ähnlich, denn sie hatten alle ihre Köpfe gesenkt, waren im Großen und Ganzen still und ließen nur gelegentlich ein paar unterdrückte Seufzer hören. Die wenigen, verloren wirkenden Blicke brannten sich dennoch in mein Bewusstsein, obwohl es auch guttat, hin und wieder einen davon zu erhaschen. Meine KollegInnen waren in dieser Situation wie Verbündete, selbst wenn sie panisch und ängstlich waren. Alleine der kurze Blickkontakt und das Gefühl der Vertrautheit stärkten unbewusst unser Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir waren Leidensgenossen, saßen im selben Boot, ob es nun sinkend war oder nicht. Sehr stabil ist es jedenfalls nicht, dachte ich. Dazu verhielt sich der Chef der Truppe seltsam. Stierte immer wieder her, schien sich über uns zu amüsieren und zugleich in Gedanken die Messer zu wetzen. Die Macht, die von ihm ausging, war fast körperlich zu spüren und schon wieder machte er sich auf diese harte Weise über mich lustig.
„Die Beine nicht!“, zischte er dem bulligen Kerl nämlich zu, weil der gerade meine Hände fertig verschnürt hatte und sich weiter ans Werk machen wollte. Dabei fixierte er nur mich und dieses Mal getraute ich mich nicht mehr wegzusehen, war wie gefangen von dem eigentümlichen Blau seiner Augen und konnte nicht einmal mehr zwinkern. Der Knebel blieb allerdings auch mir nicht erspart. Ein Tuch wurde zwischen meine Zähne geschoben und auf meinem Hinterkopf fest verzurrt. Es folgten ein kurzer Ruck an meinen Haaren und dann ein schmerzhaftes Einschneiden an meinen Mundwinkeln. Unbequem und mit ungewohnten Schmerzen saß ich auf meinem Sessel und blickte weiterhin in diese stechenden Augen, die schon wieder so unpassend schalkhaft blinzelten.
„Also!“, brüllte der Anführer dann plötzlich von einer Sekunde auf die andere laut und ich zuckte wie unter einem Hieb zusammen. Sein intensiver Blick wanderte von mir zu den anderen Geiseln, befreite mich von seiner Aufdringlichkeit und ließ mich dennoch nicht los.
„Meine Damen ... meine Herren! Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Sie befinden sich in unserer Gewalt!“ Ihm war offenbar zum Scherzen zumute, während wir hier Todesängste auszustehen hatten. Das Grinsen hinter der Maske konnte zwar keiner sehen, doch hören konnten wir es alle. Mit dem Gewehr im Anschlag machte er dann noch eine kurze Rundumdrehung, um zu zeigen, wie sehr er alles und jeden hier unter Kontrolle und im Visier hatte. Es war eine lässige Zurschaustellung seiner Macht und zugleich eine primitive Phalluspräsentation von seinem stahlarten Ding.
„… und mit Ihnen, werte Damen und Herren, natürlich das gesamte Gebäude!“, ergänzte er dann so arrogant und selbstgefällig, dass mir schlecht wurde und ich am liebsten den Kopf geschüttelt hätte. Dabei bestand für mich kein Zweifel, dass dieser Mann genau wusste was er tat.
Das Gebäude des Rossmann-Konzerns war zwar recht einfach strukturiert, aber für solch eine Aktion dennoch eine organisatorische Herausforderung. So ging ich schnell im Kopf durch, wie viele Menschen überhaupt im Gebäude sein konnten und vermutlich zu Geiseln geworden waren. Üblicherweise gab es so an die dreißig bis fünfzig Mitarbeiter, die sich, unter normalen Umständen, auf zwei Stockwerke des Gebäudes verteilten. Zurzeit hatten wir jedoch gerade Urlaubssaison und so rechnete ich insgesamt mit maximal dreißig Personen. Einen Stock tiefer befand sich eine kleine Anwaltskanzlei mit weiteren fünf Personen. Machte insgesamt 35 Leute, die sich in der Gewalt der Geiselnehmer befinden mussten.
„Wie Sie sich denken können, werden wir für Ihre Freilassung Lösegeld fordern! Ich bitte Sie daher, sich auf einen längeren Aufenthalt einzustellen und weiterhin Ruhe zu bewahren!“
Lösegeld? Ja, war die Welt denn verrückt geworden? Von einer derartigen Verbrecheraktion hatte ich ja noch nie gehört, zumindest nicht in einem Büro. Flugzeuge, Banken, Züge ... da konnte es schon einmal eine Geiselnahme wegen Lösegeld oder irgendeiner politischen Forderung geben. Doch hier war das irgendwie grotesk. Außerdem stellte sich die prinzipielle Frage, wer denn eigentlich erpresst werden sollte. Etwa der Mutterkonzern in der Schweiz oder gar die Regierung? Und … egal wie abwegig die Situation auch war, jeder von uns wusste, dass dieser Mann es ernst meinte. Seine Entschlossenheit war spürbar, seine Überlegenheit klar. Jeder hier hatte einen Heidenrespekt vor ihm, selbst seine Männer – und die waren immerhin auf seiner Seite und nicht wie wir … gefesselt und geknebelt.
Schon wieder drehten sich meine Gedanken um diesen kaltblütigen Mann und nun auch noch um die mögliche Höhe des Lösegeldes. Geiselnahmen waren bei uns nicht ganz so üblich wie in anderen Ländern und mein Vertrauen in diverse Behörden oder Sonderkommandos daher eher gering. Wenn ich dann auch noch dummerweise an diese verfluchte Geiselnahme in Deutschland dachte, die völlig ausgeufert war, wurde mir gleich noch einmal so schlecht.
Die Ansprache des Anführers war mittlerweile vorüber und weitere Erklärungen von ihm nicht beabsichtigt. Selbstsicher schritt er durch den Raum, beobachtete alles und jeden und versprühte dabei so viel Testosteron, dass ich ihn nicht einmal mehr heimlich beobachten wollte. Seine Männer standen ihm um nichts nach, hielten uns die ganze Zeit mit ihren Gewehren in Schach und wirkten wie verhaltene Bestien, die auf Beute lauerten und allzeit bereit waren vorzustoßen, zuzupacken und zu vernichten. Diese Vorgehensweise war mit nichts zu begründen, außer mit gezielter Einschüchterungstaktik. Verängstige Zivilisten, die gefesselt und geknebelt waren, stellten in der Regel einfach weniger Bedrohung dar.
Nach ein paar Minuten der Stille machte sich Karin, meine Bürokollegin, mit einem dumpfen „Mmmpf“ bemerkbar. Ihr Gesichtsausdruck zeigte, dass sie sich dringend verständlich machen wollte. Zuerst reagierte niemand, doch dann wurde ihr auf ein Zeichen des Blauäugigen, der Knebel entfernt. Sie atmete tief durch, keuchte leicht und begann nervös und leicht stotternd zu reden.
„Bitte ...“, meinte sie und leckte sie hastig über ihre trockenen Lippen. „… ich muss unbedingt auf die Toilette ... dringend.“, ergänzte sie und ihr Blick war schlichtweg herzzerreißend. Die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben und jeder konnte nachvollziehen, wie lange sie sich schon mit ihrer Blase oder ihrem Darm herumgeplagt haben musste. Eine Wortmeldung, wie diese, hatte sicher all ihren Mut verlangt. Die vier Männer wirkten jedoch gelangweilt und absichtlich unbeteiligt, ließen sich Zeit und reagierten kaum auf ihre so dringend vorgebrachte Bitte.
Klar, nur ja keine Menschlichkeit aufkommen lassen, ätzte ich in Gedanken.Was für Schweine! Wahrscheinlich grinsten sie sogar hässlich hinter ihren bescheuerten Masken und was sie sich dachten, wollte ich erst gar nicht überlegen. So oder so demonstrierten sie mit ihrem Verhalten neuerlich Macht – auf einer Ebene, die das Körperliche überschritt, obwohl es doch etwas sehr Körperliches betraf. Doch Karin gab nicht auf, ließ ein paar Mal ihr flehentliches „Bitte ...“ hören und brachte die Männer schließlich dazu, sich in einer fremden Sprache zu unterhalten. Hart und eckig polterten die Vokale aus ihren vermummten Mündern und erinnerten an eine Sprache aus dem Osten. Selbst verbal passten sie sich also an die brutale Situation an.
Die Männer lachten derb über Karin, ihre Bitte oder über uns Geiseln im Allgemeinen. Sie machten so lange Späße, bis sie alle wie auf ein Zeichen zu mir herübersahen und verstummten. Und das war – bei Gott – ein schlimmer Moment, den ich wohl nie vergessen würde. Sie hatten alle irgendwann über mich gesprochen und ich hatte keine Ahnung warum. Nichts war aber so unheimlich und beängstigend wie dieses kollektive Anstieren. Im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, so unvorbereitet und ohne Zusammenhang brachte mich ziemlich durcheinander. Und zum Nachdenken, denn ich hatte nichts getan, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken.
Keiner der Geiseln hatte die Worte der Männer verstanden, aber mit ihrem Spott hatten sie automatisch eine noch viel unangenehmere Atmosphäre geschaffen. Ich hatte jedenfalls richtig Angst und das unbekümmerte Gefühl von heute Morgen war mittlerweile so weit entfernt von mir, wie der Jupiter von der Erde. Dafür krampfte ständig mein Magen und meine inneren Alarmglocken schrillten viel zu spät Vorsicht! Vorsicht! Dabei hatte das nun wirklich keinen Sinn mehr: Ich war Geisel, gefesselt und geknebelt, mir wurde eine riesige Waffe vors Gesicht gehalten und ich hatte zusätzlich das Gefühl irgendwie das makabre Interesse des Anführers und das seiner Leute provoziert zu haben. Womit auch immer!
Der Kragen meiner Bluse wurde mit jeder Minute enger und das Gefühl der Beklemmung allmählich unerträglich. Vielleicht würde ich Hermann ja nie wiedersehen! Bis zu diesem blöden Gequatsche der Männer hatte ich das eigentlich nicht geglaubt, aber jetzt konnte ich mir auch vorstellen wirklich hier zu sterben. Und diese Erkenntnis war niederschmetternd, trieb mir die Schweißperlen auf die Stirn. Einen Moment hatte ich sogar das Gefühl keine Luft mehr zu bekommen und keuchte übertrieben auf, dann musste ich kurz die Augen schließen, um die leichte Panikattacke nur ja schnell wieder loszuwerden.
Wie aus weiter Ferne hörte ich dann die Männer, die sich endlich entschlossen hatten, Karin loszubinden. Meine Kollegin seufzte erleichtert und ich öffnete schließlich wieder meine Augen, versuchte gleichmäßig zu atmen und mich zu beruhigen. Doch der aufdringliche Blick von zwei stahlharten Augen ließ das nicht zu. Offensichtlich hatte er mich wieder die ganze Zeit beobachtet und ich fragte mich allmählich, warum dieser Mann ausgerechnet mich hier so fertigmachen wollte. Aus irgendeinem Grund hatte er sich wohl vorgenommen mich anzustarren und total zu verunsichern. Und … das gelang ihm ganz hervorragend!
Verstört wich ich seiner Härte aus und blickte ängstlich zur Seite. Der Kerl war mir einfach unheimlich, die ganze Situation eine Katastrophe. In meiner defensiven Haltung erhaschte ich einen kurzen Blick auf Karins panische Augen und wurde gleich noch ängstlicher. Das Bedürfnis laut zu schreien, zu schlagen und zu kratzen wurde unerträglich. Dabei hätte die Enge meiner Kehle wahrscheinlich keinen einzigen Ton hervorgebracht. Karin ging es nicht gut, aber es sollte ihr ja eigentlich gar nichts Schlimmes passieren! Im Gegenteil: Sie durfte endlich ihre Not lindern und zur Toilette. Nichtsdestotrotz war ihre Panik übermächtig und auch für mich spürbar. Mehr noch! Sie war ansteckend. Als würden sich ihre Emotionen mit diesem kurzen Blickkontakt wie ein giftiger Stachel in mich hineinbohren und infizieren. Angst war ansteckend, das konnte ich in dem Moment nur bestätigen. Und während Karin in demütiger Haltung mit einem der Männer zur Tür ging, zitterte ich mir bereits die Seele aus dem Leib.
Alle Blicke waren auf Karin und ihren maskierten Begleiter gerichtet. Alle, bis auf diesen einen, der immer noch ausschließlich an mir haftete und sich aufdringlich intensiv in meine Seele bohrte. Ich wollte gar nicht mehr schlau werden aus diesem Psychospielchen des Anführers und versuchte nur tunlichst seinem Blick nicht mehr zu begegnen. Natürlich hätte ich den Blick wieder senken können, doch ich fixierte lieber Karin so lange, bis sie schließlich aus dem Büro verschwunden war. Danach verlor ich für einen Moment jeden Bezugspunkt, bekam kaum noch Luft, bemerkte ‚ihn‘ immer noch im Augenwinkel und starrte schließlich schwer atmend auf meine Schuhe.
Atmen. Ein, aus.
Es war eine schlichte Anleitung, die mich beruhigen sollte, die den schneidenden Blick des seltsamen Mannes ausblenden sollte. Doch es wurde im Raum so drückend still, dass mir das nur schwer gelang. Als würden die verbliebenen Terroristen sich nun noch mehr in stiller Konfrontation auf ihre Geiseln stürzen, … weil sie alle irgendeinen Psychoscheiß hier abzogen. Mein starrer Blick zu Boden verursachte derweil erste Verspannungen und als ich den Kopf ein wenig zur Seite drehen wollte, bemerkte ich, dass bereits mein gesamter Rücken schmerzte. Durch die unnatürliche Haltung und meine gebundenen Hände war das natürlich kein Wunder, aber es war einfach noch so ein Zusatz mehr, der mich verrückt machte. Alles war hier verkehrt und nicht in Ordnung und der Druck der Situation lastete so schwer auf mir, dass ich meinte jeden Moment einem einzigen Krampf erliegen zu müssen.
Nur nicht hineinsteigern! war die Devise, denn das hätte alles nur schlimmer gemacht. Dabei hatte ich ja sogar noch den Vorteil, meine Beine bewegen zu können, weil sie nicht gebunden waren. Den anderen Geiseln musste es also schon die längste Zeit bedeutend schlimmer ergehen. Aber unsere Befindlichkeiten waren den Geiselnehmern natürlich egal. Die scherten sich kein bisschen um unseren Zustand oder um diverse unangenehme Sitzhaltungen. In meinen Augen waren sie auch kaum mehr Menschen, sondern nur noch ausführende Organe, die stumm und starr im Raum standen und in ihrer Größe und Macht wie Statuen aus schwarzem Obsidian aussahen. Glattgeschliffen, kraftvoll, kalt und leblos. Wie der Tod selbst. Lediglich die Augen glitzerten ab und an und auch das war für mich kein Zeichen für Lebendigkeit.
Arschlöcher.
Es war die einzige Gegenwehr, die ich in meinem Kopf finden konnte: Dummes Bewerten und Beschimpfen. Und womöglich konnte man mir die Verachtung im Gesicht ablesen, aber das war mir gerade egal. Mir stand der Schweiß auf der Stirn, die Handfesseln waren viel zu fest und der Knebel im Mund inzwischen die reinste Qual. Wenn sie hier einfach so stumm verharrten und uns bedrohten, durfte man ja wohl schon auch mal unschön denken.
Mit der Zeit fragte ich mich dann, wo Karin so lange blieb. Inzwischen mussten schon mindestens zehn Minuten verstrichen sein und da die Klos nun wirklich nicht weit weg waren, hoffte ich, dass es keinen Zwischenfall gegeben hatte. Einen mit Gewalt, viel Blut und einer toten Karin.
Ein rhythmisches Klopfen an der Tür riss mich aus meinen destruktiven Gedanken. Gott sei Dank, dachte ich automatisch, weil ich mit der Rückkehr meiner Kollegin rechnete. Doch als sich die Tür öffnete, konnte ich nur einen weiteren, maskierten Mann erkennen. Noch einer, huschte es durch meinen Kopf, weil der Mann viel größer war als jener, der Karin zur Toilette geführt hatte. Wer weiß wie viele noch hier sind, überlegte ich und bemerkte, dass der Neue einen sehr unruhigen Eindruck machte. Das Wenige, das er dann in dieser eigentümlichen Sprache von sich gab, wirkte viel zu schnell gesprochen und verärgert. Angepisst, dachte ich nur und kombinierte, dass irgendetwas nicht ganz so lief wie geplant. Was zwar irgendwo eine kleine Genugtuung war, aber dennoch vor allem ein mulmiges Gefühl bereitete.
Dann begannen die anderen Geiselnehmer hitzig zu diskutieren und so, wie sie es taten klang ihre Sprache nicht nur noch härter, sondern auch derber. Selbst die coole Haltung des Anführers veränderte sich, weil ihm ganz deutlich etwas gegen den Strich ging und er sich nicht scheute, das zum Ausdruck zu bringen. Natürlich wurde seine Einschüchterungskraft dadurch noch viel stärker! Sein Zorn gab mir das Gefühl, als könnte er alleine damit schon den ganzen Raum in Asche legen. Wir Geiseln wurden dadurch automatisch wieder ängstlicher und drückten uns mehr und mehr in die Sessel, um möglichst unsichtbar zu werden. Doch natürlich hatten wie keine Zauberumhänge und konnten uns auch nicht Kraft unserer Gedanken dematerialisieren. Wir saßen fest – in einer Realität, die kein bisschen Raum ließ für Idiotie oder Zaubersprüche. Das hier war echt und es war grausam, aber unsere Ängste waren schlicht und ergreifend nicht relevant, denn die Terroristen schmiedeten neue Pläne, diskutierten und gaben herrische Befehle. Erklärungen für uns Geiseln gab es selbstverständlich nicht.
Mit bellender Stimme wies der Anführer seine Männer dann an, zeigte mit der Waffe kurz auf uns Geiseln und verursachte alleine durch den kleinen Schwenk eine kleine Massenhysterie unter uns. Meine Atmung verdoppelte sich und mein Herz produzierte seltsame Zwischenschläge. Von meinen Kollegen waren dumpfe Geräusche der Verzweiflung zu hören und jeder von uns dachte sich wohl, dass wir jetzt irgendeinen Missstand auszubaden hätten. Von einer Sekunde auf die andere war die zuvor so erdrückende Stille verschwunden und das lähmende Abwarten zu einem bösartigen Kollaps geworden. Und wie bösartig! Denn alles was in dem Raum schwarz und bisher statisch gewesen war, begann sich nun plötzlich zu bewegen. Schnell, kontrolliert, wie ein Dauerfeuer. Die plötzliche Dynamik war unfassbar. Zwei der maskierten Männer liefen auf meinen Kollegen zu, bedrohten sie alleine mit der Wucht ihrer Körper und hantierten dann an ihren Fußfesseln herum. Meine Kollegen wurden also nicht geschlagen oder wirklich bedroht, aber das kapierte ich erst nach einiger Zeit. Sie wurden losgebunden und vielleicht hätte ich erleichtert sein sollen, aber dafür war die Aktion einfach zu ‚massiv‘! Gesprochen wurde kein Wort, aber alleine die Geräusche der Aktion waren so nervenaufreibend, dass mir der kalte Schweiß ausbrach. Bei meinen Kollegen wurden die Fuß- und Armfessel entfernt, die Knebel aber nicht. Der Anführer gab noch ein paar gezielte Anweisungen, bellte nicht mehr so laut wie zuvor, wirkte aber dennoch wie unter Hochspannung. Unter kontrollierter Hochspannung, denn auch jetzt war er ganz Herr der neuen Situation, dirigierte und überwachte. Mit seinem massiven Fokus hielt er sowohl uns, als auch seine eigenen Männer in Schach.
Nach dem Lösen der Fußfessel hatten wir aufzustehen und wurden so lange geschoben und geschubst, bis wir in einer ordentlichen Reihe aufgestellt waren. Das stumm aggressive Vorgehen der Maskierten, sowie die Ungewissheit, was nun auf uns zukommen würde, verursachte bei mir und meinen Kollegen eine neue Welle des Entsetzens. Wirr flogen unsere Blicke durch den Raum, suchten hektisch nach Halt, womöglich auch nach einem Ausweg. Doch beides war natürlich illusorisch. Der Geruch von Angst stieg uns penetrant in die Nase und stachelte die kollektive Hysterie weiter an. Bilder von Gefangenen drängten sich in unsere Köpfe, aufgestellt in Reih und Glied, fertig gemacht für die eigene Hinrichtung. Diese Vorstellung hatten offenbar alle und war so krass, dass die Ersten bereits zu wimmern begannen und bedenklich hin und her schwankten. Auch ich spürte die neue Panik so stark, dass ich ebenfalls taumelte. Was heißt taumelte! Mir zog es den Boden regelrecht unter den Füßen weg, weil ich ein paar der furchtbaren Fantasiebilder gar nicht mehr aus dem Kopf vertreiben konnte. Den anderen ging es offenbar keinen Deut besser, denn jeder wusste instinktiv, dass die Pläne der Geiselnehmer geändert worden waren, dass etwas Neues bevorstand und, dass wir es auszubaden hatten. Keiner von uns war auf die Wucht dieser Angst vorbereitet oder konnte damit umgehen. Die einen heulten, andere zitterten und der eine oder andere pinkelte sich vermutlich in die Hose, denn es stank längst nicht mehr nur nach abgestandener Luft.
Mir war inzwischen kotzübel geworden.
Sechs Menschen hatten schon ein riesengroßes Potential Angst zu erzeugen und von einem zum anderen schwappen zu lassen. Kollektive Hysterie war nicht länger ein fiktives Wort für mich, sie war spürbar und hatte bereits befremdende, unmenschliche Züge angenommen. Keiner von uns wusste, was jetzt wirklich kommen würde, interpretierte wüst in schwarzes Verhalten, erwartete das Schlimmste und fühlte sich einfach nur mehr klein, unbedeutend und verschwindend.
Der Geruch veränderte sich, wurde schärfer. Jemand hatte nicht nur uriniert, sondern bei weitem mehr von seinem Innenleben verloren. Natürlich war es extrem unangenehm und selbst in solch einer Situation peinlich und entwürdigend. Es verschärfte aber vor allem die Atembedingungen und machte es beinahe unmöglich, nicht ebenfalls einen unappetitlichen Beitrag zum „Wahnsinn Terror“ abzugeben. Noch aber hatte ich mich halbwegs unter Kontrolle ... bis auf das ständige Zittern.
Die Terroristen fluchten zuerst in ihrer Sprache über die plötzliche Geruchsbelästigung, rissen dann aber ihre Witze, schnüffelten blöd herum und zeigten mit ihren Gewehren auf einen meiner Kollegen. Eh klar! Auch noch verspottet zu werden, war die absolute Spitze der Entwürdigung. Erste Tränen der Wut stahlen sich in meine Augen, denn auch wenn ich ausschließlich Angst empfinden sollte, so ging mit einem Mal doch ein kleiner Keim von Hass in mir auf. Die Kerle waren gemein, brutal und womöglich auch irgendwann unsere Mörder. Also warum sollte ich sie mir nicht tot vorstellen und in die Hölle wünschen?
Das hier war eine Extremsituation, komplett anders als alles, was ich bisher erlebt hatte. Es war der blanke Horror und daher nicht wirklich zu erklären, warum ein Teil von mir nicht in Angst versank, sondern die Situation mit Wut betrachtete oder gar spannend fand. Aber was wusste ich schon über Ausnahmesituationen, außer dass sie nicht vorhersehbar waren und an die Grenzen jedes normalen Menschen gingen. So etwas wie das hier brachte mit Sicherheit Charakterzüge zum Vorschein, die man sich nicht einmal im Traum vorstellen konnte. Die Überlegung war verrückt, doch ein kleiner, beschränkter Teil meines Wesens freute sich tatsächlich über dieses Desaster, schien mit einem Mal irgendwie pervers mutiert zu sein und beinahe schon ... Interesse zu zeigen. Nämlich an dem, was noch so alles passieren konnte, weil ich meine Kollegen so ja wirklich noch nie erlebt hatte. Und genau solche Situationen waren es doch, die einem – unter anderem – auch das wahre Ich zeigten.
Irrsinn ... schoss es mir durch den Kopf, weil ich mich dabei ertappte selbst aus dieser Situation einen Nutzen ziehen zu wollen. Hermann war derjenige der oft nicht verstehen konnte, warum ich immer wieder das Bedürfnis hatte, aus jeder Angelegenheit etwas Positives herauszuholen. Für ihn gab es nur schwarz oder weiß, toll oder uninteressant. Die Grauzonen dazwischen waren etwas für Schwächlinge, nicht relevant oder lächerlich. Bei mir jedoch gab es viel von diesem Grau und das nicht gerade im farblosen Sinn.
Ja, es war verrückt und obwohl mein Puls raste und mein Adrenalinschub einem Drogenkonsum glich, war ich gespannt auf die nächsten Schritte. Gespannt! Ich! Es war echt krass und ich offenbar gleich einmal die Erste, die bereits extreme Charakterzüge in einer außergewöhnlichen Situation erkennen ließ. Trotzdem war diese Vorstellung gerade die einzig willkommene Ablenkung, um nicht vollkommen hysterisch zu werden.
Die schnelle Verschiebeaktion war mittlerweile beendet und die Geiselnehmer inzwischen nur mehr darauf aus, ihre Gewaltbereitschaft und Macht zu demonstrieren. Ständig brüllten sie uns an oder drohten mit ihren Waffen. Dazwischen berieten sie sich mit ihrem Anführer oder blieben einfach wieder wie schwarze Statuen stehen. Der Umstand, dass etwas nicht so lief, wie sie es sich vorgestellt hatten, war allgegenwärtig, denn unsere Situation hatte sich kein bisschen entschärft, sondern nur verändert. Es gab zwar noch keine konkrete Gewalt, aber sie war doch deutlich näher gerückt.
Die schwarzen Männer waren aufgebracht, stapften ständig im Zimmer umher, überlegten und berieten sich, ohne uns wirklich aus den Augen zu lassen. Wir blieben im Unklaren, während die Bösen eine neue Strategie entwarfen. Doch aus irgendeinem Grund kamen sie da offenbar nicht weiter. Bis der Blauäugige einem Wutausbruch näher war denn je. Er sagte nichts mehr, aber seine Haltung sprach Bände und sein muskulöser Körper wirkte so angespannt, als wäre er kurz vorm Bersten. Noch während ich diesen Gedanken mit blutigen Bildern ausschmückte, fegte der Mann bereits den nächstbesten Computerschirm samt Station vom Tisch. Wie Pappe flogen die Teile durch die Luft und schlugen krachend am Boden auf. Es war nur ein Computerschirm, aber wir wussten alle, dass es genauso gut ein Mensch hätte sein können. Dazu kam plötzlich ein dunkles Grollen aus seiner Kehle, als würde er sich jeden Moment in die Bestie verwandeln, die er zweifelsfrei auch war. Unser Schluchzen und Seufzen lieferte dann nur weiteren Zündstoff für ein ganzes Pulverfass voller Angst. Wir zitterten uns die Seele aus dem Leib, während die Luft geladen war von bitterer Wut und Gewaltbereitschaft. Momentan war es nur ein Computer, der zu Bruch gegangen war, aber alleine diese unbeherrschte Aktion machte klar, welche Wut in diesem Mann steckte.
Die ersten Tränen kamen von Birgit, einer Kollegin um die Vierzig. Wir alle waren knapp vorm Heulen, aber sie verlor halt als Erste die Nerven und schluchzte so laut, dass ich sofort mit einer Gegenmaßnahme des Anführers rechnete. Schließlich waren die Terroristen in Aufruhr und am Überlegen. Es konnte also niemand laute Heulerei brauchen. Niemand.
Seine Augen wurden auch prompt schmal und zeigten die pure Mordlust. Jeden Moment rechnete ich damit, dass er Birgit den Gewehrkolben über den verheulten Kopf ziehen oder auch gleich ihr Leben beenden würde. Doch genau in dem Moment, wo ich das dachte, klopfte es erneut an der Tür und zwar im gleichen Rhythmus wie schon zuvor.
Dieses Mal war es Karin, die unsanft, aber immerhin lebendig, von ihrem maskierten Begleiter ins Zimmer gestoßen wurde. Ihr hochroter Kopf ließ erahnen, dass sie nicht gerade Schönes erlebt hatte und peinlich berührt war, aber sie wirkte auch erleichtert. Ihr rechtzeitiges Eintreffen hatte jedenfalls einen Übergriff auf Birgit verhindert, dessen war ich mir sicher. Der Anführer stand immer noch unter Strom, aber das Eintreffen der beiden schien auch seinen Zustand ein wenig zu verbessern und so wie bei ihm die Anspannung sank, sank sie auch automatisch bei uns. Zorn, Panik und Selbstmitleid wurde mit einem Mal weniger und selbst Birgit hatte sich wieder so weit im Griff, dass sie nur noch leise schniefte. Zu ihrem Glück, dachte ich, denn der Anführer hätte sicher kurzen Prozess mit ihr gemacht, wenn sie weiter so laut genervt hätte.
Jetzt aber nickte er dem Mann zu und ließ Karin zu uns in die Reihe führen. Seit ihrer Wortmeldung und ihrer Rückkehr schienen jedenfalls Stunden vergangen zu sein, obwohl das kaum möglich war. Es zeigte nur, dass Zeit keine Rolle mehr spielte oder ich zumindest jedes Zeitgefühl verloren hatte.
Dann erschütterte ein neuerlicher Schwall eckiger und derb klingender Worte den Raum und erfasste uns wie eine Druckwelle. Wir konnte das noch nicht einmal begreifen oder verarbeiten, als sich die schwarze Brigade auch schon in Bewegung setzte. Wie die Kampfhunde kamen sie auf uns zu und glichen einer schwarzen Lawine, die vorhatte alles mit sich zu reißen.
Hinrichtung, ging mir panisch durch den Kopf. Zuerst wurden die Kollegen zu meiner Rechten gepackt und in eine Richtung gestoßen, dann der Rest um mich herum. Es war wie das Fortklauben einer schützenden Mauer aus lebenden Körpern. Mich rührte zwar vorerst keiner an, aber das änderte nichts an dem Gefühl, plötzlich nackt und vollkommen alleine dazustehen. Die Knie wurden mir weich und all meine Ängste von vorhin, selbst die grässlichen Bilder einer Hinrichtung, waren wie auf Knopfdruck wieder da. Auch meine Kollegen rechneten in dem Moment mit den ersten, tödlichen Konsequenzen. Alle gingen wir vom Schlimmsten aus, fürchteten die Endgültigkeit nach der endlos erscheinenden Diskussion und einer letztendlich hart getroffenen, polternden Entscheidung.
Alles ohne Verhandlungen oder Polizei ... jammerte ich im Stillen, weil ich instinktiv begriffen hatte, dass es für ein erstes Opfer noch viel zu früh war. Aber auch wenn diese Überlegung durchaus logisch war, konnte sie gegen meine Angst nichts ausrichten. Lediglich die Fakten konnten es und die sickerten allmählich in mein Bewusstsein, denn … es war noch nicht so weit. Die zwei Kollegen, die gepackt worden waren, mussten sich nicht etwa hinknien oder wurden mit der Waffe am Kopf bedroht. Nein, es stand noch keine Hinrichtung auf dem Programm, sondern allem Anschein nach lediglich ein Ortswechsel. Zuerst wurden die Kollegen vorwärts geschoben und dann mit schnellen, ruppigen Bewegungen aus dem Zimmer gestoßen. Die Worte der Geiselnehmer klangen dabei gewohnt hart, aber auch nicht so, als würde gleich ein Mord passieren. Sie gaben zwar keine Erklärungen ab, doch alleine durch ihre Handlungen wurde uns Geiseln klar, dass wir vorerst noch nichts zu befürchten hatten. Vielleicht war es auch einfach nur Instinkt. Aber genau dieser Instinkt befreite uns von einem enormen Druck – zumindest für den Moment. Das kollektive, stille Aufatmen war jedenfalls nicht zu überhören und wie das begierige Luftholen nach einem viel zu langen Ausflug unter Wasser. Meine Knie waren dennoch butterweich und auch das Zittern konnte ich nicht so schnell abstellen, aber wir hatten immerhin noch Zeit gewonnen.
So wurden beinahe alle meine Kollegen im Gänsemarsch aus dem Büro geführt. Nur ich und Thomas blieben zurück, weil wir beide mit dem Anführer selbst das Büro verlassen würden. Und der war nun mal der letzte Terrorist, der geblieben war.
Während Thomas mit dem Lauf der Waffe in Schach gehalten wurde, packte mich der Anführer grob um die Taille und zog mich fest an seine Seite. Mein Puls begann gleich noch mehr zu rasen, weil die Härte seines Körpers zeigte, wie viel Kraft in diesem Mann steckte. Wäre nicht wenigstens Wärme von dem Muskelmonster ausgegangen, hätte ich ihn für eine Maschine gehalten.
Ein harter Ruck verdeutlichte mir, dass ich zu langsam war und mich etwas mehr bemühen musste, um an seiner Seite zu bleiben und Schritt zu halten. Und ja … natürlich versuchte ich gleich alles, um nur ja keine besondere Aufmerksamkeit zu erregen oder einen noch festeren Griff zu riskieren.
Wir wurden im Eiltempo vorangetrieben, mit der Waffe zurechtgewiesen, geschubst oder gestoßen. Auf diese erniedrigende Weise gelangten wir also in den Speisesaal im zweiten Stock, wo auch endlich das ganze Ausmaß dieser verrückten Aktion ersichtlich wurde.
Zehn (!) bewaffnete Männer hatten die Angestellten des Gebäudes zusammengetrieben und im Speisesaal platziert, um sie gesammelt unter Kontrolle zu halten. Zusammen mit den Angestellten aus der Anwaltskanzlei, dem Portier und den Putzfrauen waren es wohl tatsächlich an die vierzig Geiseln. Mein schneller Rundumblick ermöglichte keine genaue Zahl, aber ich wollte meinen Blick auch nicht unnötig lange heben. Mut war eben so eine Sache und ich offenbar nicht wirklich damit gesegnet. Das Motto lautete einfach so unauffällig wie möglich zu bleiben, um nur ja keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Völlig unverständlich ... dachte ich mir dennoch die ganze Zeit, weil ich diesen Massenauflauf so gar nicht begreifen konnte. Ganze zehn Männer machten sich hier die Mühe, vierzig unbedeutende Menschen gefangen zu nehmen! Nicht, dass sie wirklich unbedeutend gewesen wären, aber viel Geld konnte man für uns wohl kaum erwarten. Schon gar nicht von einem erzkonservativen Unternehmen, das schon als legendär geizig galt. Aber wer wusste schon etwas über Firmenpolitik, Rache oder Mafiamethoden? Vielleicht hatten sich die Firmenbosse mit den falschen Leuten angelegt und wurden nun mit Rufschädigung und einem entsprechend raschen Börsenniedergang konfrontiert. Die wahren Hintergründe kannten nur die Geiselnehmer und womöglich nicht einmal die. Ausführende Organe hatten oft nur einen Teil der Information zur Verfügung, wenn überhaupt. Zumindest reimte ich mir das so zusammen.
Während ich so in Gedanken versunken dastand und auf meine Zuordnung zu den anderen Geiseln wartete, legte sich plötzlicher eine warme Hand in meinen Nacken und das nicht mit der üblichen Brutalität, sondern fast schon sanft und spielerisch. Ich erschrak dennoch so dermaßen, dass ich wie unter einem Stromschlag zusammenfuhr. Ja, spinnt der?
Schon wieder war es der Anführer der Bande, der mich anders behandelte, hinter mir stand und mich nun beinahe zärtlich massierte. Mein erster Impuls war natürlich mich seiner Hand zu entziehen, doch meine Angst war zu groß, meine Nervosität unbeschreiblich. Ich wagte keinerlei Eigenhandlung, stand nur stumm da und wünschte mich auf einen anderen Planeten. Dass ich dabei viel zu schnell atmete, nur um möglichst unauffällig zu bleiben, fiel sowohl mir, als auch dem Geiselnehmer auf. Doch er spielte weiter mit mir, strich über meine Haut und massierte mein verspanntes Genick. Irgendwie hatte er wohl mitbekommen, dass ich mich zuvor völlig verspannt hatte. Trotzdem war seine Zuwendung natürlich völlig daneben und ich wusste kaum, wie ich aufrecht stehen sollte. Schweiß perlte auf meiner Stirn, während meine angespannte Haltung eigentlich auch für andere hätte Bände sprechen müssen. Jeder hätte sehen müssen, dass hier etwas passierte, was noch weniger in Ordnung war, als alles was bisher schon passiert war. Aber die Geiseln waren in einem Ausnahmezustand und die Geiselnehmer nur damit beschäftigt sie zusammenzupferchen. Niemand hatte ein Auge auf mich oder Interesse an meiner unangenehmen Situation. Niemand … außer der Kerl hinter mir, denn er wusste mit Sicherheit, was er mir antat und wie sehr er mich verunsicherte. Seine Schadenfreude kroch wie ätzender Ballast unter meine Haut, verbrannte mich und juckte einfach nur höllisch. Dabei wollte ich endlich zu den anderen Geiseln und vor allem ganz weit fort von diesem aufdringlichen Mann.
Seine tiefe Stimme war dann erschreckend nahe, flüsterte mir etwas Unverständliches zu und trieb mir die Gänsehaut auf die Unterarme. Eben noch mit ätzender Schadenfreude verbrannt, verursachte die Schwingung seiner Stimme nun eine Kälte auf meiner Haut, die mich erzittern ließ.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by Sabine Berger Autorenname Sabineee Berger www.bumaku.at
Bildmaterialien © Copyright by Sabine Berger Autorenname Sabineee Berger www.bumaku.at
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7394-4132-0