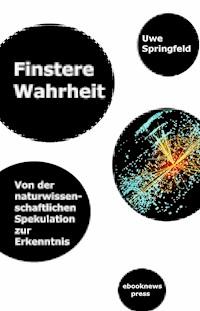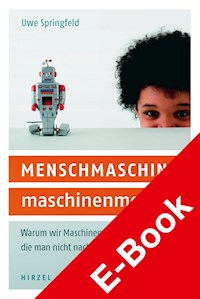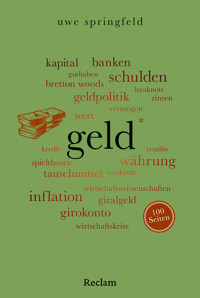
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
Was ist Geld? Und wie funktioniert es? »Geld kann Momente des perfekten Glücks schaffen. Woher hat es solche Macht über die Menschen?« Geld strukturiert moderne Gesellschaften. Es ist Wertmaßstab sowie universelles Tauschmittel und bewahrt Werte auf. Doch woher bekommt Geld seinen Wert? Wie funktionieren die zugrundeliegenden Mechanismen und wie sieht die Infrastruktur hinter dem Geld aus? Alltagsnah und kompetent klärt Uwe Springfeld die zentralen Fragen rund ums Geld – von der Entstehung über die Inflation bis zur Geldpolitik. Er präsentiert hilfreiche Definitionen, korrigiert populäre Irrtümer und blickt in die Zukunft der Bankensysteme. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Uwe Springfeld
Geld. 100 Seiten
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962375
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net, München
Infografik: © Andreas Sträußl | Guter Punkt, München
Bildnachweis siehe Anhang
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962375-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020781-9
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Weingummi
Geld
Geldhäuser
Geldarten
Wirtschaftskreislauf
Menschen
Marseille
Lektüretipps
Bildnachweis
Leseprobe aus Bitcoin. 100 Seitenn
Weingummi
Ich war müde, kaputt und satt vor Glück. Den ganzen Nachmittag hatte ich mit dem achtjährigen ukrainischen Mädchen Silwa auf dem Spielplatz im Park getobt. Ich hatte sie auf der Schaukel angeschubst, ihr auf der Seilbahn (»eins, zwei, drei«) ordentlich Schwung gegeben, sie auf dem Klettergerüst abgesichert und beim Balancieren die Hand gehalten. Zwischendurch hatte ich mit ihrer Mutter Hanna (Mitte 40, klein, drahtig, schwarzer Gürtel in Aikido) ein paar Erwachsenensätze gesprochen.
»Genau genommen ist Geld nichts als Schulden«, meinte sie. Ich nickte. Tatsächlich »schöpfen« (erzeugen) Banken Geld, indem sie vorhandene Werte mit Darlehn beleihen. Diese Schuldnerperspektive legt nahe, dass ein Leben ohne Geld möglich ist. Nämlich dann, wenn man die aus der Lutherbibel (Matthäus 6,12) bekannten Zeilen eines gebeteten Vaterunsers für alle Menschen und Institutionen wahr werden lässt: »Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.« Hat Geld mehr mit Glauben als mit rationalen Entscheidungen eines Homo oeconomicus zu tun?
Irgendwann hatte ich im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens geblättert. Es widmet dem Thema Geld drei Kapitel. Dort liest man zum Beispiel von dessen Heilkraft, als kannten die Autoren vor knapp hundert Jahren schon die heutigen IGeL-(individuelle Gesundheitsleistungs-)Arztgespräche: »Wir können zur Sicherheit noch einen Ultraschall oder einen Bluttest machen, den müssen sie aber selbst bezahlen.« Der Abschnitt erinnert auch an eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, nach der man mit weniger Geld auf dem Konto in Deutschland früher stirbt als mit mehr Geld.
Im selben Handbuch findet sich auch die Überzeugung, Geld sei ein Erzeugnis übernatürlicher Mächte. Eine Verschwörungstheorie der frühen Neuzeit? Tatsächlich steht hinter dem modernen Geld eine Autorität, die für Verschwörungstheoretiker geheimgesellschaftlich organisiert ist und sich nach Ansicht anderer Querdenker aus Reptilien-Aliens zusammensetzt. Allerdings muss man auch zugeben, dass man sich quergedacht auf dem Weg von der Tapete bis zur Wand mental verläuft.
Die Autorität hinter dem Geld ist heute ein Staat oder Staatenbund wie die Euroländer. Deren Rechtsprechung braucht einen Maßstab, bei Vertragsstreitigkeiten den Wert des entstandenen Schadens zu bemessen. Den bietet Geld, das so betrachtet historisch auf einem Rechtsprinzip des ausgehenden Mittelalters ruht: »Pacta sunt servanda«, Verträge müssen eingehalten werden.
Deshalb antwortete ich auf Hannas Gedanken vom Geld als Schulden: »Geld ist auch ein Wertmaßstab.« Und ergänzte: Wenn Geld ein universeller Wertmaßstab sei, sollte es diese Werte auch aufbewahren. Anderenfalls taugt es kaum, nach lang andauernden Schadensersatzklagen Werte zu fixieren. Trotz Inflation hat das Geld heute noch ungefähr den Wert von gestern. Sollte die Inflation steigen oder die Institution hinter dem Geld ihre Autorität verlieren, entwickeln sich Ersatzwährungen. »Zigaretten beispielsweise«, erinnerte ich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und schob mit der Schuhspitze eine Kippe Richtung Papierkorb.
Ich wollte gerade fortfahren, dass auf diesen beiden Eigenschaften die bekannteste des Geldes fußt, ein universelles Tauschmittel zu sein. Da hatte sich etwas hinter uns verändert. Wir drehten uns um und sahen, dass Silwa stehen geblieben war. Sie schaute auf ihre Hand, dann zu uns, dann wieder auf ihre Hand und schließlich rannte sie auf uns zu: »Guckt, was ich gefunden habe!«, rief sie. Eine silbern glänzende Ein-Euro-Münze.
Ganz ehrlich, wer redet in solchen Momenten über Essays, selbst wenn sie von Geld handeln? Wen interessieren irgendwelche Projekte? »Kann ich mir dafür eine Schokolade kaufen?«, fragte Silwa. »Reicht das? Oder Kekse? Oder –« Es war so schwierig, sich am nächsten Tag vor den grellbunten Süßigkeiten im Supermarkt zu entscheiden. Dann nahm Silwa das Allerbunteste aus dem Regal, eine Tüte saure Weingummis, und bezahlte stolz an der Kasse, ganz wie eine Erwachsene. Die Kassiererin (um die 40, Zopf, Drachentattoo auf dem Oberarm) lächelte. Ich lächelte, und das Glück wäre perfekt gewesen, wenn in diesem Augenblick meine Assoziationen nicht mit mir gedanklich spazieren gegangen wären.
Geld – alles klar?
Geld
Ich weiß nicht, was der Auslöser war. Vielleicht war es die Art, wie Silwa den Euro der Kassiererin rüberreichte. Jedenfalls staunte ich, dass Geld solche Momente des perfekten Glücks schaffen konnte. Woher hatte es diese Macht über Menschen? Es gibt verschiedene Theorien. Die Bekannteste ist die Tauschtheorie. Sie kommt mit dem Habitus des Praktischen daher. Ein kleinerer Discounter verkauft zwischen 1000 und 2000 verschiedene Produkte. Wollte man ihn von Geld auf Tauschhandel umstellen, würde es einerseits endlos viele Preise und noch längere Verhandlungen an der Kasse geben. »Wie viel Liter Milch bekomme ich für eine handgetischlerte Tür? Und was kriege ich für ein Paar Schuhe?« Andererseits: Braucht der Discounter aktuell Türen oder Schuhe? In einer solchen Welt verkompliziert sich auch die Verwaltung des Supermarkts. Ich wollte dort nicht die Buchhaltung machen. Ich wollte auch kein Finanzbeamter sein, der aufgrund des Tauschhandels die fälligen Steuern ermittelt. Wie sollte sie der Supermarkt bezahlen? Mit Hüttenkäse?
Die Tauschtheorie hat einen Nachteil. Um zu zeigen, wie praktisch Geld ist, setzt sie es in ähnlicher Art voraus, wie der fünfte Gottesbeweis des Scholastikers Thomas von Aquin Gott selbst voraussetzt. »Gott und Geld existieren, weil Geld und Gott existieren.« In solcher Art logischen Kurzschlusses werden alle Alternativen (wie in der Geldfrage beispielsweise ein Tauschhandel) prinzipiell ad absurdum geführt. Von diesem Ansatz aus wird nicht argumentiert, sondern (wie man heute sagt »populistisch«) behauptet.
Eine andere Theorie kommt historisch daher. Geld bestand früher einmal aus Münzen mit Metallwert, oft Gold und Silber. Der spiegelt exakt den Wert des Geldes wider. Daraus haben sich (man muss ja sparen) das Papier- und schließlich (heute) das Geld in den Computern der Banken entwickelt. Eine dritte Theorie sagt, Geld sei nichts als Ausdruck von Schulden. Banken gäben quasi Schuldscheine als Kredit aus, wenn sich jemand beispielsweise eine kleine Wohnung kauft, vielleicht wie ich in Marseille. Hinzu kommen ungezählte Theorien aus der Soziologie, die argumentieren, dass Geld seine Bedeutung und seinen Wert aus den sozialen Normen, Konventionen und Interaktionen innerhalb einer Gesellschaft erhalte. Geld wird als ein Symbol für soziale Macht, Status und Anerkennung betrachtet.
Meine Assoziationen führten mich zu einer Geldtheorie, die die Rolle des Staates betont. Diese Theorie geht von der Autorität des Staates aus, der den Wert des Geldes garantiert und der das Geld als gesetzliches Zahlungsmittel unterstützt. Dieser Gedankengang fängt mit der Frage eines notorischen Querulanten an, ob die kleine Silwa (rein rechtlich betrachtet) selbstständig Weingummi für ihren Euro kaufen darf. Was wäre, wenn ich mich auf Eskalationsstufe eins (Silwa hatte inzwischen die Tüte aufgerissen, war aber im letzten Moment von ihrer Mutter daran gehindert worden, sich eine Handvoll von dem Zeug in den Mund zu stopfen) vor der Kassiererin aufgebaut und verlangt hätte, die Weingummis sofort zurückzunehmen? Weil Silwa als Schulkind noch nicht geschäftsfähig war und wenn ein Kaufvertrag zwischen ihr und dem Supermarkt überhaupt bestanden hätte, er hiermit sofort (Eskalationsstufe zwei: »Sofort!«) zu widerrufen sei. Oder hätte sich die Kassiererin auf eine Verabredung zwischen uns berufen können (»auf Ehrenwort aus dem Regal genommen und bezahlt«)?
Der Unterschied zwischen einem Vertrag und einer Verabredung liegt auf der Hand. Bei einer Verabredung verlassen sich die Parteien darauf, dass ein einmal gegebenes Wort eingehalten wird. Dass also weder ein überängstlicher Erwachsener (Eskalationsstufe drei: »Sie nehmen sofort ihr überzuckertes Giftzeug mit den Zusatzstoffen aus der Massentierhaltung zurück, sonst gibt’s solchen Ärger, den werden Sie nie vergessen!«) plötzlich den Kauf rückgängig machen will, noch dass eine übereifrige Kassiererin einem allein einkaufenden Kind (»Das kostet das Doppelte …«, Ohrfeige links, Ohrfeige rechts, »… und du zahlst jetzt!«) genauso plötzlich alles Geld aus der Tasche zieht.
Bei einer Verabredung gilt das Faustrecht, das Recht des Stärkeren. Bei einem Vertrag greift das Zivilrecht. Das bedeutet, dass bei einem Vertrag nicht nur die Vertragspartner beteiligt sind, sondern immer auch eine außenstehende Garantiemacht, die quasi als Schiedsrichter die Einhaltung des Vertrags gewährleistet. Konkret: Silwa als Kundin, der Supermarkt als Lieferant und der Staat mit den Gesetzen des Zivilrechts nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Sollte ich – sofern tatsächlich ein formloser Vertrag zwischen Silwa und dem Supermarkt bestand – mich tatsächlich vor der Kassiererin aufbauen, würde nicht das Faustrecht, sondern letztlich der Staat mit seiner Institution des Zivilgerichts entscheiden. War der formlose Kaufvertrag zwischen einem Mädchen und einer international agierenden Discounterkette gültig?
Sollte tatsächlich ein gültiger Vertrag bestehen, hätten es Reklamationen der beschriebenen Art schwer. Grundlage des Urteils ist der bereits erwähnte Rechtsgrundsatz »Pacta sunt servanda«. Wie viele der heutigen Rechtsgrundsätze geht auch dieser auf das römische Recht zurück. Konkret auf einen Beschluss des karthagischen Konzils 345–348. Inhaltlich belegen lässt sich die Formel erstmals im Liber Extra, einer Sammlung von Dekreten, die Raimund von Peñafort 1234 für Papst Gregor IX. anlegte und den Universitäten von Bologna und Paris – also den Geburtsorten der Rechtswissenschaft und der Scholastik – zusandte. Zuerst sollte diese Regel Taufpaten davon abhalten, ihren Patenkindern gegenüber wortbrüchig zu werden. Später zog sie ins Geschäftsleben ein, unter anderem um zu verhindern, dass ein übereifriger Geschäftspartner im Supermarkt mit den Worten »Willst du das Mädchen vergiften?« vom Kaufvertrag zurücktreten kann.
Im Verlauf des Verfahrens kämen auch die entstandenen Schäden zur Sprache. Anwaltskosten hier und dort, Arbeitsstunden der Kassiererin, Schmerzensgeld wegen verdorbenem Magen und so weiter. Deren Werte müssen nachvollziehbar gemessen werden. Die Institution, die die Einhaltung von Verträgen garantiert (der Staat), muss gleichzeitig einen Maßstab anbieten. Dieser Maßstab muss den Schaden bemessen, der durch den Vertragsbruch entstanden ist. Dafür schaut man, man ahnt es schon, auf das Geld wie zum Beispiel Silwas Euro. Erst dadurch, dass eine Garantiemacht für die Einhaltung von Verträgen einen Wertmaßstab kreiert und verbindlich einführt, kann man Werte wie »Arbeitsstunde einer Kassiererin« mit dem einer aufgerissenen Tüte Weingummis vergleichen. Ohne Geld lassen sich solche Schäden kaum beziffern. Deshalb kann man die Rechtsauffassung »Pacta sunt servanda« als Grundlage des Geldes betrachten. Ohne die Verpflichtung, Verträge einzuhalten, und ohne eine dahinterstehende Garantiemacht, die für ihre Institutionen Werte bemessen muss und deshalb einen Wertmaßstab zur Verfügung stellt, ist Geld in der heutigen Form undenkbar.
Werte unabhängig von konkreten Gütern und Dienstleistungen messbar zu machen, ist die erste Funktion des Geldes. Der Rest folgt aus der täglichen Praxis im Umgang mit diesem Wertmaßstab. Wenn das Messen von Werten irgendeinen Sinn haben soll, darf sich der Maßstab nur minimal verändern. Mit anderen Worten: Geld muss die Werte aufbewahren, gewissermaßen über die Zeit einfrieren. Das ist die zweite Funktion des Geldes. Silwa muss ihr Geld nicht sofort in Weingummis umwandeln, sondern erst, wenn sie es will. Das setzt allerdings eine dritte Funktion des Geldes voraus. Geld muss transportabel sein. Eine Münze, wie die 2017 aus dem Berliner Bode-Museum gestohlene Goldmünze »Big Maple Leaf« (deutsch: Großes Ahornblatt) im Wert von umgerechnet etwa vier Millionen Euro bei einem Gewicht von 100 Kilogramm (3215 Feinunzen) bleibt eine Ausnahme. Als Viertes muss ein Gegenüber das Geld auch annehmen. Silwa wird an der Supermarktkasse nicht plötzlich mit der Forderung konfrontiert, ihre Schulden für die Tüte saurer Weingummis mit anderen Tauschgütern als Geld zu begleichen. Geld, so die fünfte Eigenschaft, ist ein universelles Tauschmittel, das Silwa, nebenbei gesagt, auch bis zu einem kleinen Betrag eigenverantwortlich ausgeben darf. Dafür sorgt das Bürgerliche Gesetzbuch mit dem Taschengeldparagraphen (§ 110). Die Idee, an der Kasse zu protestieren, war blöd. Außerdem: Wer will es sich durch unnötigen Krawall mit einem Mädchen wie Silwa verderben?
Welchen Schatz Silwa für ihren Euro erworben hatte, zeigte sich, als wir mit der Tüte Weingummis zu Hannas Familie nach Hause kamen. Silwas Bruder Tima schaute sogar vom Computerspiel hoch, als sie ihm die Süßigkeiten vor die Nase hielt: »Guck mal. Willste welche?« Tima nickte, aber Silwa lachte ihn aus: »Nee, sind alle meine.« Tima ließ nicht locker: »Eines.« – »Nee. Meins«, sagte Silwa, holte einen der Weingummis aus der Tüte und hielt ihn mit spitzen Fingern in die Luft. Ausgerechnet einen Schnuller. »Mhmmm!« Tima versuchte sich das Stück zu schnappen. Silwa war schneller: »Meins!«, rief sie und steckte sich das Stück in den Mund.
Für nichts in der Welt hätte Silwa die Kontrolle über ihre Weingummis abgegeben, obwohl ihre Macht, nüchtern durch die Augen eines Ökonomen betrachtet, nur das wert war, was sie dafür bezahlt hatte. Einen Euro. Ohne das gefundene Geld hätte sich Silwa die Weingummis nie kaufen und ohne die Weingummis hätte sie nicht diese Aufmerksamkeit und Anerkennung der Familie erlangt. Weil der Euro ganz am Anfang der Ereigniskette stand, so die Logik der Wirtschaftswissenschaften (die mich selbst aber zweifeln ließ), war Silwas Ein-Euro-Münze die ökonomische Grundlage aller Aufmerksamkeit.
Geld entstand aus dem Tauschhandel? Menschen haben Waren von Wert wie Muscheln, Salz oder Metalle verwendet. Solche Waren erfüllten bestimmte Anforderungen wie z. B. Haltbarkeit, Teilbarkeit und die Fähigkeit, sie zu transportieren.
Schuf eine Autorität wie (heute) der Staat das Geld? Sie gibt es aus und akzeptiert ausschließlich Geld, beispielsweise als Steuerzahlung. Darüber erhält Geld seinen Wert.
Entstand Geld durch Kredit- und Schuldbeziehungen, die vor der Einführung beispielsweise von Münzen bestanden? Schuldscheine, die die Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld repräsentieren, sollen als erste Version des Geldes verwendet worden sein.
Entstand Geld durch soziale Übereinkünfte und kollektives Vertrauen? Weder Materialwert noch staatliche Macht machen Geld wertvoll, sondern die Akzeptanz von Geld in der Gesellschaft.
Auch mit einer daraus resultierenden Eigenschaft des Geldes hatte ich meine Probleme. Über die von Anbietern und Kunden ausgehandelten Preise, Ökonomen sprechen vom Warenwert, kann man die Werte ganz verschiedener Dinge vergleichen. Drei Tüten Weingummi aus dem Discounter waren 2025 weniger wert als ein Nahverkehrsticket in Berlin, 58 von ihnen entsprechen im selben Jahr dem monatlichen Preis für ein Deutschlandticket. Für 60 bis 120 Tüten bezahlt man so viel wie für eine Hose, vielleicht im Sonderangebot. Das Geld für 15 000 Tüten reicht für ein gebrauchtes Auto. Das Kapital, für das man einen 20-Fuß-Standardcontainer mit Weingummi füllen könnte, würde gegen Ende der Billigzinsphase (geschätzt) auch für eine Zwei-, vielleicht sogar eine Dreizimmerwohnung in Marseille reichen.