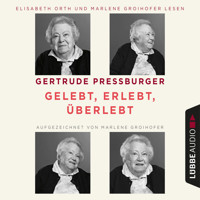Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gertrude Pressburger war zehn, als Hitler in Österreich einmarschierte. Obwohl die jüdische Familie katholisch getauft worden war, musste sie fliehen. Fast sechs Jahre dauerte die Flucht, die 1944 in Auschwitz endete. Gertrude überlebte den Holocaust – ihre Eltern und die zwei jüngeren Brüder wurden von den Nationalsozialisten umgebracht. Jahrzehntelang hat Gertrude Pressburger geschwiegen. Dass ein maßgeblicher Politiker in Österreich 2016 von einem drohenden Bürgerkrieg spricht, hat sie bestürzt. Per Videobotschaft warnte sie vor einer Rhetorik der Extreme. Dass ihre wahrhaftigen Worte Gehör finden, hat sie bestärkt, mit einer jungen Journalistin ihre Autobiographie zu schreiben: „Ich bin nicht zurückgekommen, um dasselbe noch einmal zu erleben.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gertrude Pressburger war zehn, als Hitler in Österreich einmarschierte. Obwohl die jüdische Familie Jahre zuvor auf Wunsch des Vaters katholisch getauft worden war, musste sie fliehen. Fast sechs Jahre dauerte die Flucht quer durch Jugoslawien und Italien, die 1944 in Auschwitz endete. Gertrude überlebte – ihre Eltern und die zwei jüngeren Brüder wurden von den Nationalsozialisten umgebracht.
Jahrzehntelang hat Gertrude Pressburger geschwiegen. »Wie einen Stein in der Brust« hat sie ihre Vergangenheit in sich getragen: »Ich konnte und wollte nicht erzählen.« Dass ein maßgeblicher Politiker in Österreich 2016 von einem drohenden Bürgerkrieg spricht, hat sie bestürzt. Dass ihre wahrhaftigen Worte Gehör finden, hat sie bestärkt, mit einer jungen Journalistin ihre Geschichte aufzuschreiben. »Ich bin nicht zurückgekommen, um dasselbe noch einmal zu erleben.«
Zsolnay E-Book
GERTRUDE PRESSBURGER
GELEBT, ERLEBT, ÜBERLEBT
AUFGEZEICHNET VON MARLENE GROIHOFER
Mit einem Nachwort von Oliver Rathkolb
Paul Zsolnay Verlag
MEINER FAMILIE
In Liebe unvergessen
INHALT
1. Kapitel: Die Erste, die im Baumwipfel sitzt
2. Kapitel: Weg aus Wien
3. Kapitel: Mit drei Kindern und fünf Koffern
4. Kapitel: Auschwitz
5. Kapitel: Hinter der gläsernen Wand
6. Kapitel: Wo ist mein Vater?
7. Kapitel: Wien, das Feindesland
8. Kapitel: Ich lasse mich nicht unterkriegen
Epilog
Danksagung
Oliver Rathkolb: Nachwort
Es gibt Nächte, in denen fällt es mir schwer, einzuschlafen. Ich glaube, das passiert, weil ich tagsüber nicht ausgelastet bin, denn früher habe ich das nicht gehabt. Dann lege ich mich um elf Uhr abends ins Bett und schlafe um eins immer noch nicht, werde um drei Uhr wieder munter und liege bis vier wach. Meiner Cousine geht es ähnlich, sie steht dann auf und fängt an, die Fenster zu putzen. Mich macht es nicht nervös, wenn ich nicht schlafen kann. Ich bleibe liegen und döse, gebe meinem Körper die Möglichkeit, sich auch ohne Schlaf zu erholen, und das Liegen beruhigt meine Kreuzschmerzen.
Manchmal, wenn ich so daliege, teste ich mich selbst. Belanglose Worte fallen mir ein, und ich versuche, sie in andere Sprachen zu übersetzen. Wie heißt »Kind« auf Kroatisch? Wie weit kann ich auf Schwedisch noch zählen? Wie weit auf Italienisch? In wie vielen Sprachen kann ich »Ich liebe dich« sagen? Das probiere ich aus, mit geschlossenen Augen, während ich in die Finsternis hineinhorche und darauf warte, dass der Schlaf zurückkommt. Früher hat uns mein Vater auf die Idee zu solchen Spielereien gebracht. Heute haben die Kinder Spielsachen – wir hatten Wörterketten und »Stadt, Land, Fluss«.
Und dann, plötzlich, taucht in der Nacht noch anderes auf: Szenen von früher zögern den Schlaf hinaus. Szenen, von denen ich oft gar nicht weiß, dass ich sie noch weiß. Auf einmal sind sie da, glasklar.
»Gerti, du wäschst das Geschirr ab, Heinzi, du übernimmst das Abtrocknen«, sagt meine Mama. Wir stehen mit ihr in der Küche, ich und mein um drei Jahre jüngerer Bruder. Dann gehen die Eltern, und wir bleiben allein daheim. Mein Bruder will die Aufgaben tauschen, es passt ihm nicht, dass er abtrocknen soll: »Ich will abwaschen.« »Nein«, sage ich, »du planscht da nicht im Wasser herum.« Ich kremple meine Ärmel hoch, hebe den Kessel mit dem heißen Wasser vom Haken über dem offenen Kamin und stelle ihn in die Abwasch aus grauem Beton. Einen Teller nach dem anderen tauche ich ins warme Wasser und schrubbe ihn mit einem Fetzen ab. Sorgfältig staple ich die Teller anschließend neben dem Becken übereinander. »Beeil dich ein bisschen«, sage ich zu meinem Bruder, der immer noch neben mir steht und schaut. »Nur wenn ich mit dem Teller anfangen kann, den du als Erstes abgewaschen hast«, sagt Heinzi. Ich erkläre ihm, dass das nicht geht, weil der erste jetzt ganz unten liegt und er den obersten zuerst abwischen muss, da zieht er zornig den untersten hervor, worauf die Teller umkippen, hinunterfallen und alle auf einmal am Küchenboden zerbrechen. Schimpf kriege natürlich ich, als die Eltern später heimkommen, schließlich bin ich die Ältere, die vernünftig sein hätte müssen.
Da sehe ich meinen Bruder vor mir, wie er auf einmal ganz entsetzt ist über sich selbst und wie leid ihm die Sache tut. Dass ihm das passieren hat können. »Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht.« Er weint sowieso sehr schnell, und jetzt rinnen dicke Tränen seine Wangen herunter, als er kommt, um sich bei mir zu entschuldigen: »Sei mir nicht bös, bitte. Ich wollte dir nicht schaden.«
So liege ich in meinem Bett und denke an meine Familie, ganz für mich allein, wie ich es immer mache, seit über siebzig Jahren. Meist fallen mir lustige Situationen ein oder Momente inniger Gefühle. Oft überlege ich, wie meine Brüder heute aussehen könnten. Ich kann sie mir einfach nicht als alte Männer vorstellen.
Es knackst, irgendwo in der Dunkelheit meines Schlafzimmers, vielleicht sind es die in die Jahre gekommenen Hausmauern oder die Bretter im Kleiderkasten. Nichts, was mich stören würde.
Da ist meine Mutter, mit Migräne in einem Hotel in Genua, und ein zaubernder Immigrant, der sie vom Kopfweh befreit. Mein mittlerer Bruder mit einem riesigen Sonnenbrand beim Fischen am Gardasee. Mein Vater, der Obstknödel kocht, die hart sind wie Stein. Der Kleine bei mir unter der Tuchent, obwohl ich Scharlach habe.
Nicht mehr lang, dann fängt es draußen an zu dämmern. Gerade will ich den Schlaf gar nicht zurück. Gerade lasse ich meine Gedanken zu und genieße, dass ich noch so tief dabei empfinden kann.
Wenn ich mich umdrehe, kann ich von meinem Sessel aus durchs Fenster in den Innenhof sehen. Ein paar junge Bäume stehen auf einer Rasenfläche, die zu dieser Jahreszeit graubraun statt grün ist, daneben verläuft ein schmaler gepflasterter Weg. »Letztens hat dort ein kleines Kind mit seiner Mutter die ersten Schritte geübt«, sagt Frau Pressburger, »ich bin am Fenster gestanden, und wir haben einander zugewinkt.« Sie lacht. Von ihrem Platz aus hat sie den Gartenbereich direkt im Blick. Wir sitzen uns gegenüber, an einem Tisch in ihrer Wiener Wohnung. Es ist ein Wintertag zu Jahresbeginn, und das digitale schwarze Kästchen neben mir im Regal zeigt kurz nach elf Uhr. »Früher geht es bei mir nicht«, hat mir Frau Pressburger am Telefon gesagt, »ich brauche ein bisschen, bis ich in der Früh in die Gänge komme.«
»Wissen Sie schon, was Sie zu Mittag vom Chinesen bestellen wollen?«, fragt sie mich und nimmt ein Stück Papier zur Hand. Ich nicke. »Mango-Ente« notiert sie sich mit blauem Kugelschreiber, während ich meine Kopfhörer und das Mikrofon aus dem Rucksack hole. Dann schiebt sie den kleinen Zettel zur Seite und legt ihre Hände startbereit auf die dunkle Tischplatte. »Bitte stoppen Sie mich, wenn ich etwas erzähle, das Sie nicht brauchen können«, sagt sie, »damit wir nicht ins Wischiwaschi kommen.« Von ihrer Teetasse schaut mir ein rosa Elefant entgegen. »Keine Sorge, Sie sind niemand, den man unterbrechen muss«, sage ich. Und dass ich ja gekommen sei, um zuzuhören. Ich ziehe mein Handy aus der Hülle, bringe das Flugzeugsymbol zum Leuchten und lasse meinen Blick kurz durchs Wohnzimmer wandern. Ein dunkelbrauner Einbauschrank steht hier, ein Sofa und der Tisch, an dem wir sitzen. Gleich nebenan liegt die Küche, durch die man ins Bad gelangt, und zwei Türen weiter muss das Schlafzimmer sein. Seit bald sechzig Jahren wohne sie schon in diesem Gemeindebau, sagt Frau Pressburger. Seitdem ihr Mann gestorben ist, lebt sie hier allein. »Einfache Speisen kann ich mir nach wie vor selbst zubereiten«, erzählt sie, »aber das Einkaufen nimmt mir jede Woche mein Schwiegersohn ab.« Nun klappe ich mein Notizbuch auf und schalte das Aufnahmegerät ein. »Sie unterbrechen aber bitte das Interview, wenn es Ihnen zu viel wird«, sage ich. Frau Pressburger nickt, ihr Blick ist wach: »Natürlich. Da brauchen Sie keine Angst zu haben, ich bin ganz eine Direkte.«
1. KAPITEL
DIE ERSTE, DIE IM BAUMWIPFEL SITZT
Es gibt Straßen in Wien, die betrete ich nicht. Nie würde ich hinter dem Schloss Schönbrunn von der Altmannsdorfer Straße in die Belghofergasse abbiegen. Nie würde ich durch die Wehlistraße zur Donau spazieren. Ich schaffe es nicht. Heute bin ich sowieso zu schlecht zu Fuß dafür. Mein Rückgrat ist verschoben, die Nerven machen im Kreuz einen Bogen, und der Knochen drückt schmerzhaft darauf. Um ein Stück zu gehen, brauche ich meinen Rollator oder den Arm meiner Tochter, und bald muss ich mich wieder setzen. Aber auch früher war ich ganz bewusst nie dort. Seit siebzig Jahren meide ich die Orte meiner Kindheit in Wien. Von meinem Mann weiß ich, dass es die Absperrung nicht mehr gibt, durch die wir Kinder in der Wehlistraße immer zum Donauufer hinuntergeschlüpft sind. Ich weiß auch, dass am Khleslplatz vor meiner Volksschule schon lange kein Zirkus mehr gastiert, weil die Wiese weg ist und dort jetzt ein Haus steht. Aber ich kann unmöglich bis in unsere Straßen gehen, vor unseren Wohnhäusern stehen und mir denken, ja, da haben wir gelebt, mit Mama und Papa. Ein einziges Mal bin ich mit dem Auto durch die Belghofergasse gefahren. Durch die Scheiben habe ich die Fenster unserer Wohnung gesehen, jener Wohnung, in der wir gelebt haben, bis ich zehn Jahre alt war. Ausgestiegen bin ich nicht. Ich will nicht, dass Erinnerungen auftauchen. Und ich will niemandem begegnen. Unser Familienleben, das war einmal. Schneewittchen geht man nicht suchen.
Heute müssen unsere Nachbarn von damals längst gestorben sein. Auch die, die meine Mutter fast umgebracht hätten.
Ich kann mich noch genau erinnern: Meine Mama steht im Innenhof unseres Wohnhauses in der Belghofergasse und hängt die Wäsche auf. Die Hemden vom Papa, die kleinen Söckchen meines Bruders, meine Kleider. Da schleudert aus einem oberen Stockwerk plötzlich jemand eine gusseiserne Pfanne in ihre Richtung. Zufällig löst sich in diesem Moment ein Wäschestück von der Leine. Meine Mutter bewegt sich ein Stück zur Seite, fängt es auf, damit es nicht zu Boden fällt, und befestigt es mit einer Wäscheklammer. Ganz knapp verfehlt die Pfanne ihren Kopf und landet im Gras, nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. Schneeweiß ist sie im Gesicht, als sie zurück in die Wohnung kommt und erzählt, was passiert ist. Ein antisemitischer Anschlag im Jahr 1937. Ich weiß nicht, wer von unseren Nachbarn es war und ob meine Eltern es gewusst haben. Ich weiß nur, dass sie beschließen, dass wir umziehen: »Denn jetzt wird es lebensgefährlich.«
In diesem Gebäude in Wien-Meidling, in dessen Hof der Pfannen-Angriff stattfindet, wohnen wir, seit mein um drei Jahre jüngerer Bruder Heinzi auf der Welt ist. Vor unserem Wohnhaus hier im Südwesten der Stadt liegt ein schmaler Vorgarten, rundherum gibt es eine Grünanlage, und drei Häuser weiter ist alles noch unverbaut. Die Einzigen, die vorbeikommen, sind die »Pracker«, Obstverkäufer mit ihren Holzkarren. Und Lavendelfrauen sind unterwegs, singend ziehen sie die Straße entlang: »An Lavendel homma do, wer kauft an o.« Man kauft ihn und hängt ihn sich in den Kleiderkasten. Unsere Wohnung liegt im Souterrain, und um zur Eingangstür zu kommen, muss man durch den Vorgarten, dann ums Haus herum und ein paar Stufen hinunter. Wir haben eine große Wohnküche mit einem gemauerten Herd, den wir mit Holz heizen, und einem Ecktisch samt Bank, um den wir bei den Mahlzeiten schweigend sitzen, denn »beim Essen spricht man nicht«, sagt der Papa. Durch unsere Küchenfenster schaut man auf die Straße, ich jedoch nicht einmal auf Zehenspitzen, denn sie liegen hoch, und wir Kinder sind klein. Im Zimmer nebenan schlafen wir alle zusammen: Heinzi und ich in einem Einzelbett, der Kleine bei den Eltern.
Bei meiner Geburt am 11. Juli 1927 lebten meine Eltern noch in einem Kabinett. Nicht einmal einen Herd gab es dort im zwanzigsten Bezirk, meine Mutter kochte auf einem Spirituskocher. Erst als das zweite Kind da war, konnten sie in Meidling unsere Zimmer-Küche-Wohnung bekommen. Dass antisemitische Anfeindungen unsere Familie wenige Jahre später zum Umziehen zwingen werden, ahnen sie Anfang der 1930er Jahre noch nicht.
Gertrude und ihre Mutter, 1927
Der Heinzi heißt eigentlich Heinrich Peter, ist drei Jahre jünger als ich und ein bisschen eine »Zezn«: Das schmeckt mir nicht, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Meine Eltern wollten ihn ursprünglich Heinz nennen, aber das gilt im Österreich meiner Kindheit nicht als vollständiger Vorname. Wir witzeln oft, dass er ein verpatztes Mädchen ist. Er ist eher wehleidig, sehr introvertiert und sehr gescheit. Ein ausgesprochenes Talent fürs Zeichnen hat er, malt wirklich wunderschön, ist eine richtige Naturbegabung. Mit Bleistift und Papier kann er sich stundenlang beschäftigen. Einmal zeichnet er eine Kirche, so fein und exakt, dass man glauben könnte, man habe ein Foto vor sich. Der Pfarrer ist begeistert und hängt das Bild in die Sakristei. Heinzi ist sehr fleißig und lernt mit Begeisterung. Das Spielen mit anderen Buben liegt ihm weniger. Wir sind schon etwas älter, da wartet er nach der Schule manchmal auf mich. Ich drücke ihm meine Schultasche in die Hand, er läuft damit heim, und ich gehe für ihn mit den Buben raufen.
Gertrude und Heinzi mit der Mama, Schönbrunn 1932
Als ich sieben bin und Heinzi vier, kommt der Kleine auf die Welt: »unser« Kind. Denn Heinzi und ich haben ihn uns selber ausgesucht. Bis zuletzt noch erledigt die Mama im Jahr 1934 hochschwanger den Haushalt. Mit der Straßenbahn fährt sie ins Spital, als die Wehen einsetzen, und entbindet fast schon auf den Stiegen, so schnell geht es. »Kommt mit, ihr dürft euch ein Kind aussuchen«, sagt der Arzt, als wir unsere Mutter im Krankenhaus in der Klosterneuburger Straße besuchen. Sie liegt allein in ihrem Bett, und wir haben den Neuankömmling noch nicht gesehen. Der Arzt führt Heinzi und mich über den Gang und öffnet leise die Tür zu einem schmalen länglichen Zimmer. Mehrere Säuglinge sind hier in kleinen Bettchen nebeneinander untergebracht. Der erste streckt die Ärmchen in die Höhe. Er ist sehr dünn. Heinzi und ich schauen uns an und schütteln den Kopf. Nein, den wollen wir nicht. Das zweite Kind weint. Nein, das gefällt uns auch nicht. Überhaupt gefällt uns keines, bis wir zum letzten kommen. Fünf Kilo wiegt es und hat darum ein vollkommen glattes Gesicht, nichts ist verdrückt. »Den wollen wir«, sagen wir, und der Arzt hebt den Kleinen behutsam aus dem Bettchen. Er sieht tatsächlich so aus, als würde er lachen, obwohl er das ja noch gar nicht kann. »Schauts, das ist ein richtiger Lump, der lacht, wenn man ihn rausnimmt«, freut sich der Arzt. »Herr Doktor, der ist höchstens ein Lumpi, aber kein Lump«, korrigiert ihn die Krankenschwester. Und damit hat der Kleine seinen Namen. Josef Ernst taufen ihn meine Eltern, doch alle nennen ihn Lumpi. »Waren wir blöd, dass wir dich im Krankenhaus ausgesucht haben«, schimpfen Heinzi und ich den Kleinen, wenn er wieder einmal schlimm ist.
Als er schon älter ist, besuchen wir in Mödling eine Ausstellung. Kaum angekommen, versteckt der Kleine sich hinter der nächsten Ecke. »Lumpi, Lumpi«, rufen wir. Da kommt eine Frau auf uns zu, sehr verärgert: »Sie wissen aber, dass Hunde hier verboten sind!« Mein Bruder saust aus seinem Versteck hervor und stellt sich kerzengerade vor sie hin: »Der Lumpi, das bin ich. Und ich bin sicher kein Hund.« Noch heute sehe ich ihn vor mir, den blonden, robusten, kernigen Buben. »So einen Sohn habe ich mir immer gewünscht«, sagt der Papa. Und: »Eigentlich schaut er aus wie der typische Hitlerjunge.« Unsere Mutter hat nach dem Lumpi auf jeden Fall genug vom Kinderkriegen: 1,90 Kilogramm habe ich bei der Geburt gewogen, Heinzi dann schon über zwei und der Kleine stolze fünf. »Noch ein schwereres kann ich nicht mehr auf die Welt bringen«, sagt sie. Dafür, dass sie so zart ist, hat sie ohnehin ein sehr gebärfreudiges Becken.
Beim dritten Kind hat sich auch mein Vater an den Anblick eines Neugeborenen gewöhnt. Meine Geburt hat ihn noch recht entsetzt: »Dass ein Baby so ausschaut!« Ich war das erste, das er je gesehen hat. »Am Anfang warst du nicht so schön, aber du bist immer hübscher geworden«, sagt er. »Und heute bin ich eine Schönheit«, scherze ich.
Der Kleine ist erst ein paar Wochen alt, als unser Vater das Baby einpackt und mit ihm spazieren geht. Er stellt den Kinderwagen am Gehsteig ab und will das Tor zum Vorgarten zusperren, da gerät der Wagen plötzlich ins Rollen, fährt über den Randstein und kippt um. Zum Glück landet erst die Decke auf dem Boden, darauf der Kleine selbst und wie eine Käseglocke darüber der Wagen. Alles gutgegangen. Trotzdem ist es eine Sensation, als unser Vater später schildert, was sich zugetragen hat. Dass dem Papa so etwas passiert! Ihm, unserem großen Vorbild. Heinzi und ich können es gar nicht fassen.
Heinzi ist unser Gelehrter, Lumpi ist der Robuste, und ich stehe in der Mitte. Mit dem einen lerne ich, mit dem anderen raufe ich. Als sich meine Eltern in der Schule nach mir erkundigen, sagt die Lehrerin: »Während der Stunde ist sie die Bravste, die ich in der Klasse habe, aber sobald die Glocke läutet, ist sie die Erste, die auf einem Baum sitzt.« Ich bin keine sehr Ruhige. Was Eltern und Lehrer von mir verlangen, befolge ich, sonst lasse ich mir nicht gern etwas sagen. Ich habe meinen eigenen Kopf. Mein Selbstbewusstsein hat mir der Papa beigebracht. »Lasst euch nicht unterkriegen«, ist einer seiner wichtigsten Sätze, das lebt er selbst und fordert er auch von uns Kindern. »Halt hoch den Kopf, was dir auch droht, und werde nie zum Knechte«, schreibt er Anfang 1938 mit schwarzer Tinte in mein Stammbuch.
Gertrude heiße ich, weil niemand sonst in der Verwandtschaft so heißt. Meine Mutter wollte nicht, dass es Aufregung unter den Damen gibt, dass gefragt wird, warum ich nach der benannt wurde und nicht nach jener. »Nur Trude darf niemand zu ihr sagen«, hat die Mama festgelegt, das war ihre Bedingung. Trude hat ihr nicht gefallen. Die dunkle Augenfarbe habe ich von ihr geerbt, die klaren Gesichtszüge vom Vater, und vom Charakter her bin ich dem Kleinen am ähnlichsten. »Gerti«, schreit der Lumpi, wenn ihm etwas wehtut, nicht »Mama«. Wir zwei hängen besonders aneinander. Neid kennen wir keinen unter den Geschwistern, auch gestritten wird nicht oft, aber die Rolle der Ältesten ist nicht immer einfach für mich. Stellen die Brüder etwas an, muss ich dafür geradestehen, denn ich »hätte ja aufpassen müssen«. Ich traue mich nicht, meinem Vater zu widersprechen, und so ist es gut, dass die Mama mir viel erklärt: warum es wichtig ist, dass ich vernünftig bin, oder dass der Papa viel Verantwortung hat und darum nervös ist.
Wenn uns die Mama zum Frühstück ein Schmalzbrot schmiert, ist der Papa schon weg, er muss zu Fuß zur Arbeit oder zumindest ein ordentliches Stück bis zur Straßenbahn gehen. Wo genau er arbeitet, weiß ich nicht. Daheim spricht er nicht darüber, da ist er nur Familienvater. Er ist Tischler, spezialisiert auf Kunsttischlerei, und wäre gerne Innenarchitekt geworden, aber das Studium habe er sich nicht leisten können, erzählt er uns. Für mich ist mein Vater ein sehr eleganter Mann. Er ist groß, fast einen Meter achtzig, blond und hat blaue Augen. Als ich schon älter bin, gehe ich einmal allein mit dem Vater Arm in Arm durch die Straßen. Später stichelt eine Bekannte bei meiner Mutter: »Sie, jetzt hab ich Ihren Mann gesehen mit einer Jungen, nicht, dass der fremdgeht.« Meine Mama lacht. Und ich bin stolz. Die Frau denkt, ich könnte seine Freundin sein! Wir Kinder verehren unseren Vater. Aber wir fürchten ihn auch. Er ist die absolute Respektsperson.
Ich glaube, unser Vater zieht sich erst in der Tischlerei für die Arbeit um, denn er geht immer im Anzug aus dem Haus. Nie trägt er eine Krawatte, immer hat er ein Mascherl um. Auch wir Kinder sind stets adrett gekleidet. »Man kann noch so arm sein, dreckig und zerrissen muss man nicht daherkommen«, sagt meine Mama und wäscht, stopft, näht und bügelt. Ausbildung hat meine Mutter keine machen können, aber nähen und kochen hat sie im Waisenhaus gelernt. Sie kann aus dem kleinsten Stoffrest ein Röckchen für mich schneidern. Wunderschön singen. Den ungemütlichsten Raum heimelig machen. Und aus fast nichts eine Mahlzeit zubereiten.
Wäre es nach der Großmutter gegangen, dann hätte der Papa die Mama nicht heiraten dürfen. Jahrelang hat sie nach dem Tod ihres Mannes darauf gewartet, dass der jüngste Sohn endlich seine Lehre abschließen und für sie und zwei ihrer älteren Töchter sorgen würde. Dass er kein Geld nach Hause bringen, sondern eine eigene Familie gründen will, macht die drei Damen nicht sehr glücklich. Denn bevor der Großvater an einer Lungenentzündung stirbt, ist die Familie meines Vaters in Wien gutsituiert, mein Großvater hat als Schneidermeister seine eigene Werkstatt mit Angestellten und meine Großmutter eine Haushaltshilfe. Nach seinem Tod im Jahr 1908 ist alles weg, und die Großmutter steht allein da: mit fünf kleinen und sieben großen Kindern. So etwas wie Witwenrente gibt es noch nicht. Mein Vater ist das jüngste der zwölf Geschwister und erst vier Jahre alt, als er seinen Vater verliert. Die sieben älteren Kinder hat der Großvater aus erster Ehe mitgebracht. Die Großmutter sagt also nein zur Hochzeit, und mein Vater muss warten, denn noch ist er nicht volljährig, ohne die Unterschrift der Mutter darf er nicht heiraten.
Er lernt meine Mama auf einem Tanzabend bei Verwandten kennen. Sie heißt Gisela, hat schwarzes naturgewelltes Haar und ist mit ihren 1,49 Metern wahrscheinlich eine der Kleinsten auf der Tanzfläche. »Sie ist so klein, dass sie mir aus dem Hosensack hängt«, sagt der Papa gern. Angeblich ist ihr Vater im Ersten Weltkrieg gefallen, aber mir ist von den Eltern meiner Mutter fast nichts bekannt, nur, dass beide aus Wien stammen. Ich vermute, dass meine Mama ein uneheliches Kind war, denn vor ihrer Hochzeit trägt sie den Nachnamen ihrer Mutter. Sie hat drei jüngere Schwestern, und meine Großmutter stirbt, als meine Mama zwölf Jahre alt ist. Eine der Schwestern, meine Tante Resi, kommt mit meiner Mutter ins Waisenhaus. Die zwei anderen habe ich nie getroffen: Beide wachsen bei Pflegefamilien auf, die Drittgeborene erst nach dem Tod der Großmutter, die Jüngste schon ab ihrer Geburt. Als meine Mutter im Jugendalter ist, nimmt ein älteres kinderloses Ehepaar sie als Haustochter bei sich auf, Dienstmädchen mit Familienanschluss bedeutet das. Sie hilft nicht nur im Haushalt, sondern ist auch ein bisschen Familienmitglied, darf dabei sein, wenn das Ehepaar Jugendliche aus der Verwandtschaft zum Diskutieren und Tanzen zu sich in die große Wohnung einlädt. An einem dieser Abende verliebt sie sich in meinen Vater. Sobald er 21 und volljährig ist, heiraten meine Eltern, gegen den Willen meiner Großmutter. Das ältere Ehepaar bezahlt meiner Mutter die Hochzeit.
Meine Mutter ist äußerst gutmütig. Mein Vater ist sehr dominant. Aber es funktioniert. Sie lieben sich wirklich und sind immer füreinander da. Ab und zu gehen die Eltern aus, nur zu zweit. »Gerti, pass gut auf. Seid schön brav und macht niemandem auf«, sagen sie dann. An einem dieser Tage kauft meine Mutter bei den »Prackern« eine Tasche voller Äpfel und Birnen. »Falls ihr was wollt, die Tasche steht unter dem Tisch«, sagt sie, bevor sie die Wohnungstür hinter sich schließt. Als es finster wird, fangen wir an, uns zu fürchten, so ganz allein ohne Eltern. Da kriechen wir alle drei unter den Tisch, ziehen das Tischtuch wie einen Vorhang bis zum Boden herunter und essen die halbe Obsttasche leer. Auf diese Art versteckt fühlen wir uns wohl. Noch wohler fühlen wir uns, als die Eltern wieder heimkommen. Am liebsten ist uns, wir sind alle zusammen.
Außer, wenn einer von uns etwas angestellt hat. Dann fürchten wir uns vor dem Papa. Denn immer wenn die Wut in ihm aufsteigt, kriegen wir Kinder Hiebe. Er zieht den Riemen aus der Hose, und zack, schlägt damit zu. Wir merken, er versucht sich zu beherrschen und schafft es doch nicht, angeblich hat er das von seinem Vater geerbt, der noch jähzorniger gewesen sein soll. Im nächsten Moment tut es ihm leid. Einmal lernen wir im Französischunterricht die Worte »Bonjour mon petit Ernest«. Die fremde Sprache macht mir Spaß, und ich freue mich: Mein Vater heißt Ernst, und nun kann ich ihn auf Französisch begrüßen. »Bonjour mon petit Ernest«, sage ich stolz, als ich durch die Haustür komme, und kriege als Antwort prompt eine Ohrfeige. Weil es respektlos sei, so mit dem Vater zu sprechen: »Ich bin kein ›kleiner‹ Ernst«, empört er sich. Als er einmal den Kleinen haut, verzieht dieser keine Miene. »Warum hast du nicht geheult oder geschrien?«, fragt ihn die Mama, »das hätte vielleicht geholfen.« »Die Freude, dass ich weine, die mach ich ihm nicht«, sagt der Lumpi.
Ein einziges Mal will unser Vater auch auf die Mama losgehen. Da stellt sie sich, ohne ein Wort zu sagen, an die Wand, schaut ihn nur an, und er beruhigt sich. Die Mama ist klein und zart, widerspricht selten, aber ist innerlich immer die Starke.
Eines Tages passt meinem Vater das Mittagessen nicht, denn die Mama hat Fisolen angekündigt und stattdessen doch Kohlgemüse gekocht. Er wird zornig, nimmt den vollen Teller und schmeißt ihn auf den Küchenboden. Scherben überall. Unsere Mutter schaut den Vater an und sagt kein Wort. Sie schimpft nicht, sie keppelt nicht, sie isst ruhig weiter. Wir Kinder machen es genauso. Nach dem Essen kehrt der Papa wütend zurück zur Arbeit. Als er am Abend nach Hause kommt, liegen Teller und Essensreste immer noch am Boden. »Wieso ist das noch da?«, fragt er meine Mutter verärgert. Keine Antwort. Stumm deckt sie wieder den Tisch und stellt den Suppentopf in die Mitte, denn abends gibt es meistens Suppe. Der Vater setzt sich auf seinen Platz und schlägt demonstrativ die Zeitung auf. Unsere Mutter sagt nicht, bitte iss doch etwas. Wir löffeln still in uns hinein, danach räumt sie den Tisch wieder ab, stellt seinen vollen Teller wieder weg und schweigt. Fast drei Tage lang geht das so. Vielleicht jausnet der Vater in der Werkstatt, zu Hause rührt er keine Mahlzeit an. Und immer noch liegt der Teller, den er auf den Boden geschleudert hat, zu unseren Füßen – wir machen alle einen Bogen darum. Bis er am dritten Tag die Putzfrau aus der Tischlerei zu uns nach Hause schickt, damit sie den Küchenboden reinigt. Alles räumt sie weg und wischt sie auf. Ruhig setzt er sich danach zu Tisch, die Mama schöpft ihm wie immer seine Portion auf den Teller – und er beginnt zu essen. Streit hören wir keinen. Er sagt auch nicht, sei wieder gut, zumindest nicht vor uns Kindern. Er isst, und dann ist alles wieder in Ordnung.
Ein einziges Mal bekomme ich eine Ohrfeige von meiner Mutter. Es passiert, als ich schon um die fünfzehn bin und irgendetwas sage, das sich nicht gehört. Danach kann ich tagelang nicht aufhören zu weinen. »Ich bitt dich, das war doch nur eine Ohrfeige«, versucht meine Mama mich zu beruhigen. Aber ich kann es gar nicht glauben. Vom Papa bin ich es gewohnt, aber dass die Mama mich schlägt! Bei ihr gibt es keine Strafen oder Hiebe. Sie erklärt uns die Dinge.
Trotz seiner Wutausbrüche haben wir Kinder unseren Vater aufrichtig gern. Er ist streng, aber wenn wir nichts anstellen, ist er sehr liebevoll. Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Als ich am Blinddarm operiert werde, hält er im Spital ununterbrochen meine Hand. An Sonntagen rauft und spielt er mit den Brüdern im Bett, veranstaltet Polsterschlachten, und meine Mama lacht: »Da liegen drei Buben beisammen.« Zum Nikolaus geht er mit uns spazieren, und wenn wir heimkommen, wartet die Mama schon: »Jetzt habt ihr den Nikolo gerade verpasst. Schaut, was er euch mitgebracht hat.« Die Winter meiner Kindheit sind kalt, und wenn das Wasser friert, gehen wir Eisrutschen. Mit großen Schritten befreit der Vater das vereiste Bächlein in der Nachbarschaft für uns vom Schnee und rutscht uns voran.
Für Weihnachtsgeschenke ist fast kein Geld da, meistens reicht es nicht für mehr als ein Paar Strümpfe oder einen neuen Pullover. Als ich die einzige Puppe meines Lebens bekomme, sogar mit Puppenwagerl, ist das etwas sehr Besonderes. Der Kopf meines kostbaren Besitzes ist aus Porzellan und der Körper aus Stoff. Natürlich meint der dreijährige Heinzi es nicht böse, als er die Puppe nimmt und wäscht. Doch dann hat sie kein Gesicht mehr, und ich weine bitterlich. Statt auf ein hübsch aufgemaltes Puppengesicht blicke ich jetzt auf nacktes Porzellan. Auch hier ist mein Vater zur Stelle, holt Pinsel und Farbe und zeichnet alles wieder nach: die schön geschwungenen Lippen, die großen Augen und die feine Nase.
Wenig später nimmt das Dasein meiner Puppe trotzdem kein gutes Ende: Wir sind mit den Eltern auf einer Wiese in der Nachbarschaft, und ich bin kurz abgelenkt, als Heinzi mein Puppenwagerl schnappt und damit losrennt. Er stolpert, die Puppe fällt zu Boden, ihr Kopf zerbricht, und ich fange an zu heulen. Jetzt habe ich keine Puppe mehr! Heinzi sucht sich ein anderes Spielzeug, will jetzt irgendetwas aus Steinen bauen, die auf der Wiese herumliegen. Da hebt er einen zu schweren in die Höhe und muss mit einem Leistenbruch ins Spital gefahren werden. Das ist an diesem Tag dann doch das einschneidendere Erlebnis. Dass der kleine Bruder sich verletzt hat, übertönt natürlich meinen Puppenschmerz.