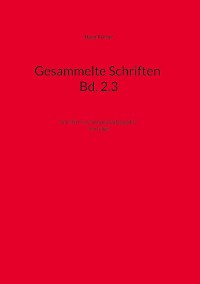19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gesammelten Schriften enthalten alle zwischen 1969 und 2021 erschienen Schriften des Autors und umfassen alle seine Bücher, Essays, Artikel und Vorträge aus seinen verschiedenen Fachgebieten. Zum Teil sind auch bisher unveröffentlichte Werke und Manuskripte enthalten. Im Bd. 1 sind Beiträge zur Lehrer- und Berufsbildung, Erwachsenenbildung, Didaktik, Kompetenz- und Performanzorientierung gesammelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt Band 1.1
I Erwachsenen- und Berufsbildung
Artikel, Vorträge, Essays, Lexikoneinträge
Vorrede zu Band 1
Spiel als Torheit (1991)
Das Humankapital (1994)
Die Risikogesellschaft und ihre Bildungsbedürfnisse (1994)
Bildungsmanagement oder Bildungspolitik (1994)
Freizeit in unserer Gesellschaft (1996)
O Freunde, nicht diese Töne (1996)
Der Mythos der Stunde Null (1997)
Bildung und Kultur – Begriffe und Begrifflichkeit
Nägel einschlagen (2001)
Erwachsenenbildung zwischen Anpassungsqualifizierung, Bildung, Ermächtigung und Kundenzufriedenheit (2003)
Generative Bilder (2009)
Editorial: Ausbildungen à jour (2010)
Qualität und Quantität – Nicht alles was zählt, zählt (2010)
Vorrede des Herausgebers
Einleitung
Die Geschichte des Zahlbegriffs
Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde gemäss Piaget
Qualität und Quantität in der Hegel’schen Logik
Qualität und Quantität als ökonomische Kriterien
Von Geld und Geist
Qualität, Quantität und Geschlecht
Fazit
Von Humboldt bis zum ›Tod der Bildung‹ (2013)
Geschichte der Berufsbildung (2014)
Grundsätzliches zur Genderfrage (Abschiedsvorlesung) (2015)
Self-reliance and vocational education (2020)
Lexikoneinträge
Bildung (1998)
Bildungsverständnis (1998)
Erwachsenenbildung (1998)
Geistige Behinbderung
Geld (1998)
Erwachsenenbildung (2005)
Volkshochschule (2013)
Vorrede zu Band 1
Der Band 1 enthält alle Schriften zur Erwachsenen- und Berufsbildung. Im Band 1.1 sind kleinere Beiträge zur Erwachsenenbildung aus den Jahren 1991-2015 aufgenommen und mein grundsätzlicher Beitrag zur Qualität in der Erwachsenenbildung aus dem Jahr 2010. Obwohl die Erwachsenenbildung und Berufsbildung seit den späten 90er-Jahren der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit waren, gibt es dazu nur wenige Schriften. Das Meiste bestand in Vorbereitungen für den Unterricht, die meist nach Gebrauch gelöscht wurden, ausser z.B. meiner Abschiedsvorlesung zur Genderfrage.
Der Essay zu self-reliance and vocational education aus dem Jahre 2021 zeigt auf, dass Bildung immer in einem gesellschaftlich-ökonomischen Kontext betrachtet werden muss.
Im Band 1.2 sind die Schriften zur Didaktik und zur Kompetenz- bzw. Performanzorientierung enthalten. Den grössten Umfang nimmt dabei das Berner Modell aus dem Jahr 2009 ein. Es wurde praktisch unverändert, mit zwei drei kleinen Änderungen und Ergänzungen übernommen. Dies ist nicht selbstverständlich, da sich in meinem didaktischen Verständnis in den letzten Jahren einiges geändert hat und ich nicht mehr hinter allen Aussagen in dieser Schrift stehe. Es ist nicht so, dass diese absolut fasch wären, doch stehen sie ›auf dem Kopf‹ und es gälte sie auf die Füsse zu stellen. Ansätze dazu sind in Bd. 1.2 ersichtlich.
Was bereits in dem französisch geschriebenen Essay zur Validierung von Kompetenzen kritisch beleuchtet wurde, hat sich im Laufe der Jahre zu einer grundsätzlichen Kritik an der Kompetenzorientierung – wie sie in der Berufsbildung gehandhabt wird – hin zu einem Paradigmenwechsel zur Performanzorientierung entwickelt.
Dabei stütze ich mich hauptsächlich auf die Tätigkeitstheorie, denn diese ist meiner Ansicht nach die ideale Basis für eine Didaktik der Berufsbildung. Teile dieses neuen Verständnisses von Didaktik haben ihren Niederschlag bereits in den englischen Texten für die Berufsschulen in Myanmar (2016) und Eritrea (2017) und dem deutschen Text über das ›performanzorientierte Prüfen‹ (2017) gefunden. Die Mitarbeit in diesen beiden Berufsschulprojekten habe sehr viel zu meiner neuen Auffassung von Didaktik beigetragen, da wir unter diesen extremen Bedingungen grosse Herausforderungen zu bewältigen hatten (und haben), was mit den vorhandenen Modellen schwierig war und zu neuen theoretischen Konzepten führte.
Dies führte zu den beiden dieses Thema bisher abschliessenden Essays zum Verständnis der Alltagstheorie bei Vygotskij, Gramsci, Lukács und Brecht aus dem Jahr 2020 und ›Warum Performanzorientierung‹ aus dem Jahr 2021.
Boll, im Januar 2022
Spiel als Torheit - ein Kontrapunkt1
Kinderspiele
Das Bild ›Kinderspiele‹, das der niederländische Maler Pieter Bruegel der Ältere 1560 gemalt hat, begeisterte die Pädagoginnen und Pädagogen allezeit. So meinte Adolf Portmann: Dieser gigantische Spielplatz
mag so manche der glücklichen Erinnerungen in uns wach zu rufen. Ist er doch erfüllt von Rausch und Tumult, die ein spielbesessenes Herz mitzureissen vermag. Glauben wir nicht, das Tosen zu hören, das Schreien und Überschreien. Sachte, zärtliche Spiele gibt es hier allerdings wenige. [...] Doch die bedingungslose Hingabe ans Spiel, wie wir sie vor Brueghels Bild erleben, müsste dennoch selbst dem gestrengsten Schulmeister ein Lächeln heimlichen Vergnügens abgewinnen.2
Eine formale Betrachtung zeigt aber, dass das Bild auch auf andere – ich möchte sagen, weniger naive und idealistische – Weise interpretiert werden kann.
Das Bild präsentiert etwa 80 Kinderspiele, die zum Teil bis heute bekannt sind. Oft wird es als enzyklopädisches Dokument angesehen, als eine reine Bestandsaufnahme. Diese Auffassung des Bildes wird durch verschiedene formale Elemente unterstützt. Das Bild hat verschiedene Mittelpunkte. Das Auge kann nicht auf einzelnen Szenen ruhen, sondern wird herumgeführt. Aber nicht nur die verschiedenen geometrischen und optischen Mittelpunkte lassen das Auge unruhig umherwandern, sondern auch der hoch angesetzte Fluchtpunkt, die flache Hintergrundlandschaft ›Taufe‹ spielenden Kinder. Gerade dieser hochangesetzte Fluchtpunkt ist einer der Schlüssel für das Verständnis des Bildes. Er bewirkt eine eigentümliche Distanziertheit von den spielenden Kindern. Die Betrachtenden sind nicht in das Geschehen auf dem Bild einbezogen, sondern beobachten das Treiben auf dem Marktplatz von einem erhöhten Standpunkt aus.
Wenn wir die Spielenden genauer betrachten, entdecken wir, dass es gar keine Kinder sind, sondern kleine Erwachsene, die nicht etwa fröhlich spielen, sondern verbissen und konzentriert ihre Beschäftigungen ausüben.
Wir schauen also nicht dem munteren Treiben einer spielenden Kinderschar zu, sondern beobachten von aussen das sinnlose Tun der Menschheit. Erasmus von Rotterdam schrieb in seinem 1515 erschienenen und damals weitverbreiteten Werk ›Das Lob der Torheit‹, das Bruegel gekannt haben muss: Denkt euch, es stehe ein Mensch auf einer hohen Warte, sehe ringsum auf die Erde [...] und überschaue nun den ganzen Jammer der Menschheit.3
Dieser Gedanke wird auch durch die Farbgebung des Bildes unterstützt Die beiden vorherrschenden Farben sind Blau und Rot. Rot galt zur Zeit Bruegels als Farbe der Unwissenheit, der Dummheit, Blau als Farbe der Torheit, wobei Torheit in Erasmus’ Sinne als Selbstsucht und Genussstreben zu verstehen ist. In seinem damaligen ›Bestseller‹ finden wir auch den Schlüssel zum Verständnis des Kindes bei Bruegel und verstehen, warum er die Verderbtheit dieser Welt in Kinderspielen dargestellt hat:
Nun, was an den Kleinen tut es uns dann so an ...? Ist es nicht der verführerische Reiz der Torheit ? [...] wieder ein Kind sein [...] etwas anderes als ein Narr, als ein Mensch ohne Verstand (sein)?4
Das Kind wurde nur als kleiner törichter Erwachsener gesehen, das Spiel als sündige Verführung auf dem Weg der Tugend. Erst Rousseau, und in seiner Nachfolge Philosophen und Pädagogen wie Kant, Schiller und Pestalozzi, begannen im Kind ein eigenständiges Wesen und im Spiel mehr als unnützen Zeitvertreib zu sehen. Doch ist hier Vorsicht am Platze, nicht Euphorie. Gerade bei den genannten Pädagogen stand das Spiel nicht im Dienste der Entfaltung von Kreativität, sondern im Dienste der Disziplinierung.
Spiel als Nötigung zum Immergleichen
Der wohl bedeutendste Denker unseres Jahrhunderts, Theodor W. Adorno, hat sich in seiner Ästhetischen Theorie5 eingehend mit dem Spiel auseinandergesetzt. Er bezeichnet es immer wieder als ›leeres Spiel‹, ›sich selbst genügendes Spiel‹, das ›auf das Läppische regrediert‹. Dabei geht er vom Gegensatz zwischen Kunst und Spiel aus. Kunst beinhaltet für ihn stets ein Moment des Widerstands, während das Spiel der Anpassung dient.
Der pure Rückgriff auf Spielformen dagegen steht regelmässig im Dienst restaurativer oder archaistischer gesellschaftlicher Tendenzen. Spielformen sind ausnahmslos solche von Wiederholung. Wo sie positiv bemüht werden, sind sie verkoppelt mit dem Wiederholungszwang, dem sie sich adaptieren und den sie als Norm sanktionieren.6
Dabei kann er sich auch auf Freud beziehen, der in Jenseits des Lustprinzips7 den Wiederholungszwang und das Spiel immer wieder in der Nähe des sado-masochistischen Lustgewinns lokalisiert. Dazu sei nur an die frustrierenden Erlebnisse erinnert, die wir alle als Kinder (und eventuell auch noch als Erwachsene) mit Spielen wie dem ›Eile mit Weile‹ gemacht haben. Dies mag auch den Erfolg der Computerspiele erklären, bei welchen die Spielenden einerseits gegen sich selbst kämpfen, andererseits in den extremsten Varianten, wie in den KZ- und anderen menschenverachtenden Spielen, mit sadistischer Lust versuchen müssen, möglichst viele Juden, Türken oder Tamilen umzubringen. Was Freud den Bemächtigungstrieb im Spiel nennt und Adorno als regredierende Komponente begreift, kulminiert dort, wo Spiel in der kollektiven Regression zum Krieg wird.
Aus diesem Grunde rückt Adorno das Spiel auch immer wieder in die Nähe des Sports, den ja bereits die Römer als Herrschaftsinstrument eingesetzt haben (panem et circenses; Brot und Spiele).
Das Spiel mit seiner »Nötigung zum Immergleichen [...] deutet den Gehorsam [...] in Glück um«8. Dass die Unterwerfung unter den Wiederholungszwang des Spiels oft aus freien Stücken erfolgt, führt Adorno zur Formulierung: »Unmündigkeit aus Mündigkeit ist der Prototyp des Spiels«9. Ich erinnere mich selbst an einige Situationen als Teilnehmer von Erwachsenenbildungskursen, in welchen ich mich beim Einsatz von Spielformen manipuliert, gegängelt und entmündigt fühlte.
Spiele in der Erwachsenenbildung
Was fangen wir nun als Leitungspersonen in der Erwachsenenbildung mit solch einer vernichtenden Kritik des Spiels an, wir, die wir uns doch den mündigen Menschen auf unsere Fahnen geschrieben haben, jedoch viele positive Erfahrungen mit Spielen anführen können? Natürlich gilt es nicht, einfach alles über Bord zu werfen. Etwas vorsichtiger und bewusster dürften wir im Einsatz von Spielen in der Erwachsenenbildung aber werden:
Werden diese Prinzipien befürwortet, gibt es nur noch wenige Spielformen, die in der Erwachsenenbildung (und nicht nur dort) bedenkenlos eingesetzt werden können.
Eine der wichtigsten Formen ist dabei bestimmt das Planspiel. Doch auch im Planspiel steckt das Risiko, ins Beliebige abzugleiten. Die Spielenden können vergessen, dass das, was sie z.B. in einem entwicklungspolitischen Planspiel spielen, für Millionen von Menschen bittere Wirklichkeit ist. Ein Planspiel muss daher Konsequenzen haben. Nur der Ernst, mit welchem es gespielt wird, verbürgt, dass es trifft, was es soll. Spiel als Vorstufe zu eigenverantwortlichem Tun. In diesem Sinne wären die Menschen nicht dann Menschen, wenn sie zusammen spielen, sondern erst dort, wo sie solidarisch handeln.
1 erschienen in ›Erwachsenenbildung‹ 2/91, S. 20-24
2 Portmann (1961), S. 7
3 Erasmus [1511], S. 67f
4 Erasmus [1511], S. 67f
5 Adorno [1969]
6 Adorno [1969], S. 470
7 Freud [1920]
8 Adorno [1969], S. 470
9 Adorno [1969], S. 71
Das Humankapital10
Vorbemerkung
Der vorliegende Versuch einer Kritik der aktuellen bildungspolitischen bzw. der bildungsökonomischen Diskussion entstand in der Absicht, auf die einseitig auf Deregulierung ausgerichtete Nummer 4/93 der ›Education permanente‹ mit einem Leserbrief zu reagieren. Im Laufe der Arbeit daran wuchs diese Antwort zu einem Artikel aus und hat nun einen Umfang angenommen, der verlangt als eigenständiger Essay veröffentlicht zu werden.
Die ursprüngliche Intention soll aber als allgemeine Stossrichtung erhalten bleiben, da ich der Ansicht bin, dass den unterschwelligen bis offensichtlichen Intentionen der SVEB – die den Bereich der Erwachsenenbildung dem entfremdeten Geist der Warengesellschaft unterwerfen wollen und letztlich zu einer Zerschlagung der heute noch möglichen Bildungsprozesse führen werden – energisch entgegengetreten werden muss. Aus dieser Zielsetzung erklärt sich auch die stellenweise polemische, angriffige oder provokative Wortwahl.
In den umfangreichen Fussnoten sind Nebenstränge der Argumentation enthalten, die dorthin verbannt wurden, um den Hauptstrang nicht zu sehr zu belasten. Sie dienen dem besseren Verständnis meiner Position, die aber auch ohne sie verstanden werden kann.
Bildung als Ware oder Bildung als Arbeit
Innerhalb der schweizerischen Erwachsenenbildungsszene wird zurzeit – von vielen direkt Betroffenen unbeachtet – die von der SVEB (Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung) entfachte Diskussion um neue Förderungsstrukturen der Erwachsenenbildung geführt. Dabei geht es vordergründig darum, die bisherige auf wackeligen Beinen stehende Unterstützung der SVEB durch das Bundesamt für Kultur auf eine rechtlich einwandfreie Grundlage zu stellen. Dagegen wird wohl kaum jemand etwas haben, da die Notwendigkeit einer starken Dachorganisation nicht angezweifelt wird. Hingegen kann der Verdacht nicht von der Hand gewiesen werden, dass es einzelnen Mitgliedern der SVEB in Wirklichkeit darum geht, durch die neue Förderungsstruktur der bisher von der öffentlichen Hand subventionierten Erwachsenenbildung die finanziellen Mittel zu entziehen. In diese Richtung ist die Bemerkung des Geschäftsführers der SVEB zu interpretieren, dass von den sieben Millionen, die der Kanton Bern über das Erwachsenenbildungsgesetz für die Erwachsenenbildung einsetzt, mindestens vier Millionen in eine zu gründende schweizerische Stiftung zu überführen seien. Damit würde dem wohl flächendeckendsten Erwachsenenbildungsangebot der Schweiz, das gemäss Gesetz vorwiegend benachteiligten Regionen und Bevölkerungsgruppen zukommt, die existentielle Grundlage entzogen. Wenn dies die geheime Absicht des SVEB-Vorstosses ist, ist es an der Zeit, dass sich die betroffenen Mitglieder der SVEB dagegen zur Wehr setzen.
In die gleiche Kerbe haut Daniel Witzig in einem Artikel in der NZZ11 den er interessanterweise doppelt gezeichnet hat, nämlich als Leiter des grössten privaten Anbieters der Schweiz und als Präsident der SVEB. Wenn er in seiner ersten Eigenschaft von »systematische(m) Preisdumping« spricht, »welches zu einem unnötigen Verdrängungsprozess führt«12 und meint
staatliche Erwachsenenbildung, sei sie nun allgemein oder beruflich, verfüg(e) über keine Legitimation. Die Subventionierung vollzieh(e) sich in einem diskutablen Graubereich13
und muss mit solchen Witzigkeiten unweigerlich in Interessenkonflikt kommen mit seiner zweiten Funktion, in welcher er doch die Mitglieder der SVEB zu vertreten hätte. Er könnte dahingehend argumentieren, dass heute – nach der Öffnung der SVEB auf die betriebliche Weiterbildung hin – diese Organisationen gegenüber den öffentlich-rechtlichen Anbietern in der SVEB in der Mehrheit seien. Somit würde sich die – an sich begrüssenswerte – Öffnung der SVEB gegenüber der betrieblichen Weiterbildung als trojanisches Pferd der Deregulierung erweisen.
Interessant ist es auch, dass in der laufenden Diskussion zwar immer von Qualität der Erwachsenenbildung gesprochen wird, diese aber nie inhaltlich differenziert wird, sondern sich die ganze Auseinandersetzung auf rechtlich-formaler Ebene abspielt. Besonders deutlich wird dies in der entsprechenden Nummer der SVEB-Zeitschrift Éducation Permanente (4/93).
In seinem ›Plädoyer für die Stiftungsform‹ versucht der Jurist Tomas Poledna zwar im ersten Teil einige erwachsenenbildnerische Pfähle einzuschlagen und hat dazu sogar ein Buch durchgeblättert, das sich mit Bildungspolitik im Weiterbildungssektor befasst, nämlich den dicken Wälzer über Bildungspolitik im Umbruch, für welchen ebenfalls ein Jurist, Prof. Hans Giger, als Herausgeber zeichnet14. Von den 49 in diesem Buch versammelten Beiträge sind 27 von Juristen oder Ökonomen geschrieben und nur 16 von Pädagogen oder Psychologen. Es lohnt aber, sich mit den Beiträgen der von Tomas Poledna zitierten Autoren zu befassen. Diese entstammen alle aus dem rechtsbürgerlichen bis rechtsextremen politischen Spektrum, zum Teil aus dem Dunstkreis des VPM.15
Hans Giger und Beatrice Rebmann bezeichnen »Bildung .... wo man sie mit kommerziellen Zielen betreibt, [...] (als) ein(...) umsatzfähige(s) Gut.«16 und »Bildung [...] ist in beinahe jeder Hinsicht zu einem eigentlichen Konsumgut geworden«17.
Somit habe auch der Bildungsmarkt zu funktionieren nach dem
Prinzip der freien, nur an ganz wenige Regeln gebundenen Marktwirtschaft, die eine optimale Wettbewerbssituation bedingt, in der das Recht des Stärkeren entscheidet18.
Demgegenüber skizzieren sie einen Staat, der sich durch seine Subventionspolitik
[...] einseitig dem Schutz des Schwachen verschrieben hat, solchermassen bestimmte Personenkategorien privilegiert und die traditionelle Wirtschaftsfreiheit einzuschränken beginnt [...] Bildung zum Nulltarif19 aber verführt zu staatlich finanziertem Müssiggang ebenso wie zu einer Verflachung und Gleichschaltung der Bildung.20
Die ganze Analyse gipfelt in der von John Stuart Mill übernommenen Feststellung »es regiert die Mittelmässigkeit«21. Sind seine Partei- und Gesinnungsgenossen im Bundesrat und in den Kantonsregierungen wohl mit dieser Aussage einverstanden?
Ohne hier bereits im Detail darauf einzugehen (das soll weiter unten geschehen), kann ich mich zwar mit der Beschreibung der Phänomene einverstanden erklären, würde sie aber darum nicht mehr als Bildung, sondern als ›Halbbildung‹22 bezeichnen. Echte Bildung zeichnet sich unter anderem gerade dadurch aus, dass sie nicht zum ›Nulltarif‹ erhältlich ist, sondern sich am Stoff abzuarbeiten hat und es dafür unabdingbar Musse braucht.
Noch extremer – und holzschnittartiger – zeichnet Gerd Habermann, von der Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer in Bonn, das Bild. Für ihn gilt – wie er andernorts formulierte – die »Gewinnmaximierung als oberste und einzige soziale Pflicht des Unternehmers«23 und damit auch der Bildungsbemühungen des Einzelnen.
Die Weiterbildungsinvestition wirft individuelle Erträge ab, die dem Investor [...] zugute kommen, so dass ihm auch eine Finanzierung seiner Investitionen ganz oder [...] zumindest teilweise zugemutet werden kann.24
Weil es sich dabei
um einen Markt wie andere auch [handelt, sei] die Ungleichheit der Bildungsbeteiligung [...] kein Argument für Regulierung – so wenig wie die ungleiche Verteilung anderer Güter [...]. Subventionierung von Bildung bezeichnet er als [...] unlautere(n) Wettbewerb der öffentlichen Hand [... und als] »umfassende Bildungspatronage, die Aufrichtung einer universellen Schulvogtei auch über erwachsene Bürger [...] mit Bildungsgütern zum Nulltarif.25
Wir sehen, die Schlagwörter wiederholen sich, doch Habermann operiert zusätzlich mit Reizwörtern wie »kollektivistisches Denken«26 und anderen Begriffen aus dem Wörterbuch des kalten Krieges, und sein Plädoyer für die Vermarktung von Bildung (oder was sich dafür hält) gipfelt in der Feststellung
Kollektivistische Massnahmen [...] können indessen nur zu Freiheitsverlusten und zu einer Einbusse an Wohlfahrt führen«27
Diese Müsterchen des ideologischen Hintergrunds der Deregulierer im Bildungswesen mögen für den Moment genügen und im Folgenden soll vertieft auf ihren eigentlichen ›Gehalt‹ eingegangen werden.
Der Bildungs›markt‹
In ihren Zielen und Inhalten sind all diese Deregulierer nicht über die Argumente ihres geistigen Vaters, Milton Friedman, des Begründers des Neoliberalismus, hinausgekommen. Dieser hat in seinem grundlegenden Aufsatz The Role of Government in Education28 vor bald vierzig Jahren alle wesentlichen Elemente der neoliberalen Kritik am staatlichen Bildungswesen formuliert. Friedman geht davon aus, dass es »durchaus wünschenswert wäre, die Kosten für die Erziehung den Eltern direkt aufzuerlegen«29. Einzig für die minimale Grundausbildung sieht er Gründe, die staatliche Eingriffe rechtfertigen, da sie den Staat stabilisieren helfen.
Sie rechtfertigen auf keinen Fall reine Berufsausbildung, die die wirtschaftliche Produktivität eines einzelnen Schülers steigert, ihn aber weder für seine Rolle als Staatsbürger noch für eine soziale Führerrolle qualifiziert.30
Ganz besonders gilt dies von der Fort- und Weiterbildung, denn sie
ist eine Form der Investition in menschliches Kapital. [...] Ihr Zweck ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Produktivität des Menschen«31.
eil nun aber der Einzelne den Gewinn aus dieser Investition zieht, hat er die Investition auch selbst zu tätigen. Alle Ansätze, die in irgendeiner Form kompensatorisch, z.B. im Sinne der Chancengleichheit, wirken, sind aus diesen Gründen zu verwerfen.
Das Ziel ist nicht die Einkommensneuverteilung (und schon gar nicht die Emanzipation der Menschen; HF), sondern die Dispositionsmöglichkeiten von Kapital zu vergleichbaren Bedingungen für Investitionen in Menschen und Sachwerte.32
In diesem Zusammenhang gibt Friedman auch eine – aus neoliberaler Sicht – einleuchtende Begründung für den Ausbau der Erwachsenenbildung: Da die Individuen eher bereit sind zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens in kurze Weiterbildungsmodule zu investieren als einmal in eine lange Ausbildung, muss die Grundausbildung verkürzt und die rekurrente Bildung lebenslang ausgebaut werden. Für längere Aus- und Weiterbildungen müssen die Individuen die Möglichkeit haben, Ausbildungskredite zu erhalten. Da für die privaten Kreditinstitute das Risiko bei Ausbildungskrediten sehr gross ist, darf sogar gemäss Friedman der Staat hier mit Stipendien einspringen.
Sonst aber hat der Staat in solch einem bildungspolitischen Ansatz nur die Aufgabe, Rahmenbedingungen, z.B. Diplome, zu gewährleisten33 oder allgemein seine ordnungspolitischen Funktionen wahrzunehmen, dh. »improving the operation of the invisible hand«34. Diese ›invisible hand‹ erinnert an ein Leitmotiv des Utilitarismus und Liberalismus. Und wirklich sind die Überlegungen der neoliberalen Bildungsökonomen nicht neu, sondern finden sich bereits beim Stammvater des Liberalismus, bei Adam Smith.
In seinem Hauptwerk the wealth of nations35 geht er im fünften Buch explizit auf die Aufgaben des Staates im Bildungswesen ein. Dabei unterscheidet er zwischen Ausgaben der Bildungseinrichtungen für die Jugend und solchen für Menschen jeden Alters.
Auch er hält die private Finanzierung von Bildung grundsätzlich für richtig, doch sieht er die Vermittlung von allgemeinen auch für den Staat interessanten Kenntnissen durch die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung gefährdet. In der modernen Gesellschaft muss daher allen eine allgemeine Grundausbildung vermittelt werden.
Mit nur geringem Aufwand kann der Staat fast der gesamten Bevölkerung diese Schulbildung erleichtern, sie dazu ermutigen, ja sogar dazu zwingen. So kann die Regierung dabei helfen, indem sie in jeder Gemeinde [...] eine bescheidene Schule einrichtet, in der Kinder gegen ein geringes Schulgeld unterrichtet werden, das auch der einfache Arbeiter aufbringen kann. Der Staat sollte für einen Teil, keineswegs aber für das volle Lehrergehalt aufkommen. Denn würde er es ganz oder hauptsächlich bestreiten, so würde das in Kürze dazu führen, dass der Lehrer seine Pflichten zu vernachlässigen trachtet.36
a) Bildung in der Marktwirtschaft
Bildung sei eine Ware, wie jede andere auch. Im Folgenden soll diese Grundannahme auf zwei Ebenen widerlegt werden:
In einem ersten Schritt soll mit einer ökonomischen Argumentation gezeigt werden, dass wirkliche Bildung keine Ware ist und sein kann.
Umgekehrt soll aufgezeigt werden, dass die Bildungsgüter, die heute tatsächlich als Waren vermarktet werden, keine Bildung erlauben, sondern zur Halbbildung verkommen sind.
Gemäss der klassischen Nationalökonomie und ihrer Vorläufer – auf welche sich die neoliberalen Bildungsökonomen berufen – besitzt jede Ware einen Gebrauchswert und einen Tauschwert37. Der Tauschwert einer Ware – auch der Ware ›Arbeitskraft‹ - bestimmt sich durch die in ihre Produktion investierte Arbeit. Da auch die neoliberalen Bildungsökonomen davon ausgehen, dass durch Bildung der Wert der Arbeitskraft erhöht wird, zeigt sich bereits in der Bestimmung dieses Werts, dass Bildung eher unter die Kategorie der Arbeit subsumiert werden müsste. Bereits aus dieser Argumentation wird deutlich, dass Bildung eben nicht einfach ein Konsumgut ist, sondern dass man sich Bildung zu erarbeiten hat. Damit wäre das Grundaxiom eigentlich bereits erledigt, doch soll es – immer noch innerhalb der ökonomischen Kategorien – auch noch durch andere Überlegungen falsifiziert werden. Wäre Bildung eine Ware, so könnte sie wirklich auf dem Bildungsmarkt ausgetauscht werden.
Der Tauschvorgang auf dem Markt muss aber gewissen Kriterien genügen, um überhaupt vollzogen werden zu können. Für einen geregelten Tauschvorgang muss erstens vorausgesetzt werden können, dass das Eigentum an einer Ware klar garantiert und feststellbar ist, damit es im Tauschakt von einer Person auf die andere übertragen werden kann. Zweitens ist der Gebrauch und damit die Wertveränderung der Ware während des Tauschvorgangs eingestellt.38
Beide Voraussetzungen gelten nun aber für Bildungsgüter nicht: Einerseits ist das Eigentum der Bildung nicht gewährleistet, denn wenn sie ausgetauscht wird, verliert sie der Bildende nicht, sondern sie wird vermehrt. Andererseits wäre es ja gerade ein Kennzeichen von Bildung, dass sie bereits während des Austauschvorgangs gebraucht, z.B. kreativ verändert wird.
Für den Erwerb von Fähigkeiten wird (z.B. in schlechten Schulen39) zumindest der zweite Aspekt oft erfüllt, werden doch dabei Fertigkeiten ohne Gebrauchswert als reine Tauschwerte in den Schülern deponiert, um sie zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder abzurufen. Freire nennt diese Art der Wissensvermittlung die ›Bankier-Methode‹:
So wird Erziehung zu einem Akt der ›Spareinlage‹, wobei die Schüler das ›Anlage-Objekt‹ sind, der Lehrer aber der ›Anleger‹. Statt zu kommunizieren, gibt der Lehrer Kommuniqués heraus, macht er Einlagen, die die Schüler geduldig entgegennehmen, auswendig lernen und wiederholen. [...] Sie haben die Möglichkeit, Sammler oder Katalogisierer der Dinge zu werden, die sie aufstapeln.40
Mit dermassen aufgestapelten Bildungsgüter und den entsprechenden Ausweisen können sie zwar ihren Tauschwert auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, gebildet sind sie deswegen aber nicht - im Gegenteil.41 Sie sind im besten Falle halbgebildet.
(1) Exkurs: Bildung in der Grenznutzentheorie
Obwohl sich die neoliberalen Bildungsökonomen auf die Arbeitswert- und nicht auf die Grenznutzentheorie berufen, soll der Begriff der Bildung kurz auf dem Hintergrund dieses Paradigmas betrachtet werden. Dies umso mehr, als in der Praxis die beiden Paradigmen von den Bildungspolitikern oft vermischt werden.
Zur Bestimmung des Grenznutzens von Bildung müsste grundsätzlich festgehalten werden, dass Bildung erstens ein Nicht-Sättigungsgut ist. Der Grenznutzen von Bildung wird anfänglich rapide steigen, dann zwar auch abnehmen, doch nie Null werden. Zweitens gibt es für echte Bildung keine Substitutionsgüter, wenn uns die Kulturindustrie auch das Gegenteil weismachen will. Aus diesem Grunde kann Bildung auch keiner Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden, denn gemäss der Grenznutzentheorie sind die Kosten einer erreichten Bedürfnisbefriedigung stets der entgangene Nutzen der unterbliebenen Verwendung der Mittel für andere Zwecke. Wessen Bildung aber unterblieben ist, kann sich den dabei entgangenen Nutzen prinzipiell nicht ausmalen.42 Dies wird auch einer der Gründe sein, warum die herrschende Politikerkaste (Herr Blocher nennt sie vornehmer die ›classe politique‹, zu welcher er aber prominent auch gehört) die scheinbar knappen Mittel lieber für Güter einsetzt, deren Nutzen in ihrem Denken evident ist, wie Militärflugzeuge, gentechnologische Forschung usw.
(2) Exkurs: Berufliche Fort- und Weiterbildung
Man mag nun einwenden, dies sei vielleicht für die Allgemeinbildung gut und recht, doch für die berufliche Bildung gälten die knallharten Gesetze der Marktwirtschaft. Es sei darum hier auch kurz auf dieses Argument eingegangen bzw. versucht, auch hier einen anderen Blickwinkel einzugeben. Dabei setze ich voraus, dass über Schul- und Berufsbildung die soziale Schichtung einer Gesellschaft reguliert bzw. stabilisiert wird43 und werde mich nur auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Fort- und Weiterbildung konzentrieren. Nehmen wir an, bei einem bestimmten technologischen Stand der Produktionsmittel sei Vollbeschäftigung gegeben. Der technologische Fortschritt führt nun dazu, dass sich die Arbeitenden in Fortbildungskursen dem neuen Stand anzupassen haben. Tun sie dies nicht, wird ihre Arbeitskraft dequalifiziert und im schlimmsten Fall werden sie arbeitslos. Es ist also nicht so, dass sie nicht mehr arbeiten wollen44, sondern ihre Arbeitskraft ist auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt. Die neoliberalen Bildungsökonomen werden nun sagen, dass die so dequalifizierte Arbeitenden die Neuinvestition in ihre Arbeitskraft selbst zu berappen haben, da sie, bei erfolgreicher Fortbildung, ja auch den Nutzen daraus zögen.
Genau an diesem Punkt kann das Ganze auch von einem anderen Standpunkt aus gesehen werden: Der technologische Fortschritt ist ja nur möglich, weil ein Teil des erarbeiteten Mehrprodukts in die Forschung, dh. in die Löhne und Materialkosten einer über längere Zeit unproduktiven Entwicklungsabteilung, gesteckt wird. Indem den Arbeitnehmern also ein Teil ihres Mehrprodukts vorenthalten wird, bezahlen sie ihre Dequalifizierung zum Teil selbst. Es wäre also nicht mehr als gerecht, wenn auch ihre Fortbildung daraus finanziert würde. Da dies aber unter den herrschenden politökonomischen Verhältnissen kaum zu realisieren ist, sollen die Unternehmen über die Steuern zumindest zum Teil an eine staatlich subventionierte berufliche Fortbildung beitragen.
Ich bin mir bewusst, dass diese knappe Argumentation noch nicht in allen Punkten überzeugend ist, doch wollte ich nur mögliche Argumentationslinien aufzeigen, mich nun aber, nach diesen ökonomischen Exkursen, wieder der allgemeinen Erwachsenenbildung zuwenden.
b) Der Mythos der knappen Mittel
In der laufenden Diskussion wird immer wieder damit argumentiert, dass in einer Situation der knappen Mittel keine solchen mehr für die Bildung zur Verfügung stünden. Auch Daniel Witzig leitet seinen Artikel mit dem Hinweis ein, dass »Bund, Kantone und Gemeinden sich einem Zustand öffentlicher Armut nähern«45. Demgegenüber möchte ich an den beiden grundsätzlichen Urteilen festhalten, wie sie von Marcuse als unabdingbar für die Sozialwissenschaften postuliert worden sind:
das Urteil, dass das menschliche Leben lebenswert ist oder vielmehr lebenswert gemacht werden kann oder sollte. Dieses Urteil liegt aller geistigen Anstrengung zu Grunde; es ist das Apriori der Gesellschaftstheorie, und seine Ablehnung (die durchaus logisch ist) lehnt die Theorie selbst ab;
das Urteil, dass in einer gegebenen Gesellschaft spezifische Möglichkeiten zur Verbesserung des menschlichen Lebens bestehen sowie spezifische Mittel und Wege, diese Möglichkeiten zu verwirklichen. [...] Der etablierten Gesellschaft steht eine nachweisbare Quantität und Qualität geistiger und materieller Ressourcen zur Verfügung.
46
Diese Urteile, d.h. die Auffassung, dass auch die heutige Finanzkrise nicht eine Frage der Ressourcen, sondern eine der Verteilung sei, soll hier nicht diskutiert werden – so wichtig dies auch wäre47 –, sondern nur mit dem Hinweis auf die noch nie so hohen Gewinne der Banken oder auf die ungeheuerliche und weltweite Verschwendung von Ressourcen für Kriegsmaterial untermauert werden.
Ich erlaube mir, an der Tatsache festzuhalten, dass auf dieser Welt genügend Ressourcen vorhanden wären, damit jeder Mensch ein menschenwürdiges Leben führen und gebildet werden könnte.
Diese Forderung wurde bereits vor bald vierhundert Jahren von Comenius erhoben, indem er Bildung für alle reklamierte. In seinem Wahlspruch ›Omnes, Omnia, Omnino‹ (Allen, Alles, Ganz)48 vertrat er klar die Vision, dass Bildung ihre Mission erst erfüllt habe, wenn die ganze Menschheit von ihrer befreienden Kraft erfasst sei und sich sowohl von der Unberechenbarkeit der Natur als auch der Unterdrückung durch einzelne Menschen oder Menschengruppen emanzipiert habe.
Stattdessen wird die Menschheit bis in die unberührtesten Gegenden und intimsten Bereiche mit seichter Massenkultur und Pseudo-Bildungsgütern überflutet. So kann kaum eine öffentliche Toilette benützt werden, ohne dass man mit Konservenmusik berieselt wird und die letzten Nomadenstämme werden mit amerikanischen Familienserien bestrahlt.
So werden riesige Ressourcen dafür eingesetzt, die Welt statt mit Bildung mit »sozialisierter Halbbildung«49 zu überziehen.
c) Triumph der Halbbildung
Die Halbbildung nahm ihren Ursprung in der Dialektik der Aufklärung, dass nämlich die Vernunft, die angetreten war, die Natur in den Dienst der Menschen zu stellen, diese selbst in den Dienst nahm und den Zielen ihrer instrumentalisierten Form unterwarf. Mit dem (inzwischen weltweiten) Sieg der Logik des Geldes wurden alle Bereiche des menschlichen Lebens – und das meint eben auch die Bildung – »der Allgegenwart des entfremdeten Geistes«50 unterworfen. Der philosophische Reduktionismus bemächtigte sich auch der Bildung und in seinem methodisch-didaktischen Rigorismus zerstückelte er auch die Bildung in Natur-, Geistes-, Sozial- und andere Wissenschaften, in Fachgebiete, in Vor- und Hauptstudien, in Stilepochen, ernste und andere Musik, kurz in Bildungsgüter, die man aneignen, anhäufen, anwenden, anerkennen lassen und mit Gewinn anlegen konnte. Das halb Verstandene und zu Renommierwissen verkommene Auswendiggelernte wurde zum modischen Kulturgut, zur Ware, die ihren Gebrauchswert für die Entwicklung der Menschen verlor und zum abstrakten Tauschwert für die Qualifizierung der Ware Arbeitskraft wurde.
Auch Personen, die sich ernsthaft um Bildung bemühten (und bemühen), fehlt in der alles beherrschenden Massenkultur die Musse, die Bildung einfordert, da auch von ihnen verlangt wird, über die müssig vergeudete Zeit Rechenschaft abzulegen. In diesem Sinne gehört es zur Forderung nach Bildung, für alle Menschen Lebensbedingungen zu erkämpfen, die Musse und damit Bildung erst ermöglichen. Es ist wohl so, dass Bildung mehr Lebensqualität verspricht, aber erst ein gewisses Minimum an Lebensqualität erlaubt, Bildung zu erwerben.
Was ist Bildung?
Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten eine radikale Kritik am gängigen Bildungsverständnis geführt worden ist, ginge es nun darum, positiv zu formulieren, was Bildung sei. Dabei finden wir uns in einem offensichtlichen Dilemma:
Wenn wir inhaltlich vorgeben wollten, was Bildung sei, so würden wir Mündigkeit und Selbstbestimmung ausser Kraft setzen, einen Kernbestandteil des Bildungsverständnisses.51
Trotzdem können einige Aspekte festgemacht werden, die Bildung ausmachen; dabei bewegt sich Bildung in der Dialektik der zwei Dimensionen ›Anpassung – Widerstand‹ und ›Eigenes – Fremdes‹:
Die philosophische Bildungsidee [...] hatte beides gemeint, Bändigung der animalischen Menschen durch ihre Anpassung aneinander und Rettung des Natürlichen im Widerstand gegen den Druck der hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung.
52
Bildung will in der Zueignung des Fremden die Entfremdung des Eigenen aufheben.
53
In der dialektischen Einheit dieser beiden Dimensionen54 kann Bildung augenblicksweise aufscheinen. Dabei soll ganz bewusst besonderes Gewicht auf die Dialektik dieser Widerspruchspaare gelegt werden. Im Sinne der Dialektik im bekannten Chanson von Mani Matter, dass nämlich ein Sandwich ohne Fleisch nichts als Brot und ein Sandwich ohne Brot nichts als Fleisch sei, gilt auch, dass Bildung ohne Widerstand nichts sei als Anpassung usw. Es ist klar, dass Bildung nicht immer die dialektische Einheit aller Widersprüche verwirklichen kann (und soll) doch ist die einseitige Ausrichtung auf ein Element (zB. die Anpassung) ein Wesenszug der Halbbildung.
Nach einem weiteren Diktum Adornos ist Bildung »nichts anderes als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung«55. Im Sinne der oben entwickelten Kategorien bestünde Bildung eben gerade nicht in der Aneignung von Bildungsgütern im Haben-Modus, sondern die Individuen sollen sich diese quasi im Seins-Modus zu eigen machen, d.h. sie in ihrem geschichtlichpolitischen Werden begreifen.56 Darum kann der Erwerb (bzw. die Aneignung) von isolierten Fähigkeiten, wie er in Weiterbildungskursen oft geschieht, nicht unter Bildung subsumiert werden.
An dieser Stelle müsste nun auch das geschichtlich-politische Werden (und Zerfallen) der humanistischen Bildungsidee entwickelt werden. Da dies im Rahmen eines kurzen bildungsökonomischen Essays zu weit führen würde, seien nur kurz die wichtigsten Elemente einer solchen Analyse erwähnt.
Im Zentrum der klassischen Bildungsidee stand (und steht) der Anspruch auf Mündigkeit aller Menschen. Dieser Anspruch war auch eine der Triebfedern der bürgerlichen Revolutionen, denn er richtete sich gegen die standesmässig ererbte und nicht erarbeitete Legitimation57. In diesem Prozess war die Verwirklichung von Bildung aber nur augenblicksweise möglich, ja sie war bereits in ihrer Entstehung von zwei Seiten her bedroht:
Einerseits war der antifeudale Reflex sehr stark und mit der Ablehnung des Scheins wurde auch das Sein entwertet. Es galt nicht mehr was eine Person an sich gearbeitet hatte, sondern was sie sich materiell erworben hatte, aus dem ›uomo universale‹ wurde der ›homo oeconomicus‹
58
.
Andererseits merkte das Bürgertum an der Macht bald, dass die Forderung nach Emanzipation für alle genau diese Macht einschränken, ja überwinden würde. Die klassische Bildungsidee transzendiert sich selbst, indem jede Institution, die die Bildung zur Mündigkeit auf ihre Fahnen schreibt, ihr Ziel dann erreicht hat, wenn sie sich selbst überholt hat. Darum hat das Bürgertum diese Fahnen bald einmal eingerollt und in die ideologische Gerümpelkammer der Geschichte verbannt, immer bereit, sie wieder zu entrollen, wenn es zur Erhaltung der Macht notwendig war. Mündigkeit wurde von der Menschengattung weg auf das Individuum projiziert und, als auch dieses, noch zu gefährlich war, ins Gebiet der Geisteswissenschaften verbannt.
Die Bildungsidee, die einmal angetreten war, die Menschen von der blinden Notwendigkeit der Naturgewalten zu befreien und sich diese dienstbar zu machen, degenerierte zur Herrschaft über die Natur und damit auch über die innere Natur der Menschen, zur Triebunterdrückung im Dienste der Ausbeutung der Menschen und der sie umgebenden Natur. Die Aufgabe der Kultur und damit auch der Bildung wäre es, das erinnernd aufzunehmen, was in diesem Prozess am Wegrand liegen blieb.
Kultur (und Bildung; HF) ist der perennierende Einspruch des Besonderen gegen die Allgemeinheit, solange diese unversöhnt ist mit dem Besonderen.59
Erwachsenenbildung, die ihren Namen verdient, hätte diesen Anspruch auf doppelte Weise einzufordern: sie müsste das verstümmelte Eigene sowohl der Gattung als auch des Individuums sichtbar machen und, indem sie trotz des offensichtlichen Zerfalls von Bildung daran festhält, die Individuen befähigen, solidarisch gegen den entfremdeten und entfremdenden Geist der Halbbildung Widerstand zu leisten.
a) Qualität in der Bildung
In diesem Sinne gälte es nun zu definieren, was Qualität in der Bildung bedeuten könnte. Es kann nicht darum gehen, das Idealbild der Bildung in allen Details auszupinseln, damit es als fertiges Leitbild vor sich her getragen werden kann, sondern nur darum, einige Leitideen einer Erwachsenenbildung zu skizzieren, die dem Anspruch auf Aufklärung als dem »Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit«60 gerecht werden könnte:
Bildung kann nur gelingen, wenn sie nicht abgehoben im Elfenbeinturm Nabelschau betreibt, sondern ausgehend von Problemen der konkreten Lebenswelt der Beteiligten, diese in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stellt, darin analysiert und darauf zurückwirkt.
So wie wir sowohl als Individuum und als Gattung nur durch handelndes Eingreifen in die Mitwelt zu Erkenntnis kommen können, ist Erkenntnis erst konstitutiv für den Menschen, wenn sie entsprechendes konsequentes und solidarisches Handeln induziert. Auf diese Weise kann es möglich werden, sich einem der Ziele von qualitativ hochstehender Erwachsenenbildung anzunähern, nämlich auf die Überwindung der historisch zwangsläufigen Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit hinzuarbeiten.